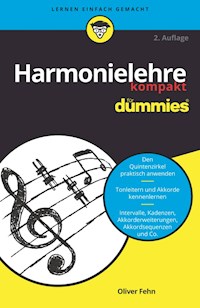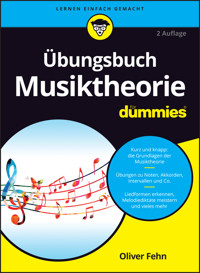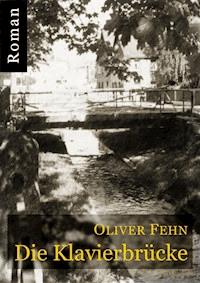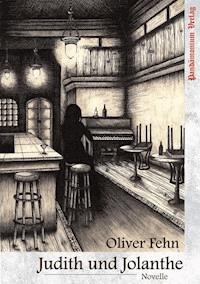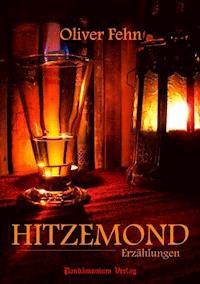
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
"Lesen Sie das Buch nicht, wenn Sie soeben ein seelisches Tief durchlaufen oder sich allgemein leicht ängstigen", warnt der Autor seine Leser in der Vorbemerkung. Doch in dem neuen Buch von Oliver Fehn geht es keineswegs um Geister, Vampire und Monster – nein, die Ängste, Abgründe und Schattenseiten des Menschen sind Thema dieser 12 Geschichten, die in trostlosen Dörfern, alten Schulhäusern, unheimlichen Dachböden, einsamen Bars, gigantischen Städten bei Nacht – und manchmal auch in ganz schlichten Kinderzimmern spielen. Der Autor, bekannt für seine bedrückenden Schilderungen des Bösen und Morbiden, führt hier seine Erzählkunst in neue Höhen, und das Risiko, bei vielen seiner Leser verschüttete Albträume zu neuem Leben zu erwecken, nimmt er dabei gern in Kauf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oliver Fehn
Hitzemond
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort: Nur ganz kurz …
Kapitel 1 – Nachtgesang
Kapitel 2 – Schmuddelbuddel
Kapitel 3 – Vergessen … wie die Rosen
Kapitel 4 – Die Herzen treffen sich am Broadway
Kapitel 5 – Wo die Engel sind
Kapitel 6 – Hitzemond
Kapitel 7 – Teen Angel
Kapitel 8 – Es brennt kein Licht auf Manderley
Kapitel 9 – Türen aus Rauch
Kapitel 10 – Doktor Trost
Kapitel 11 – Blutkonzert
Kapitel 12 – Der schwarze Vorhang
Nachwort: Nochmal ganz kurz …
Impressum neobooks
Vorwort: Nur ganz kurz …
Wir alle werfen einen Schatten, der je nach psychischer Tageszeit mal länger ist, mal kürzer. Wir sind nicht von Natur auf gut, so wie einige Spinner uns das glauben machen wollen. Doch unsere wirklichen Ängste haben nichts zu tun mit Dämonen, Phantomen, Vampiren und Geistern, sondern mit Menschen. Zu Recht. Die Abgründe unserer eigenen Seele (und die der anderen) sind es, vor denen wir wirklich auf der Hut sein müssen; denn sie sind unberechenbar. Die faszinierendsten Gestalten der Weltliteratur – Elektra, Ophelia, Phaedra – sind diejenigen, die unter den Bann ihrer eigenen Schatten gerieten, bis sie selbst Schatten wurden und in Schattenwelten lebten. Ihre armen Opfer (die sie manchmal auch selbst waren) hatten nichts zu lachen; sie bekamen es ganz aus der Nähe zu sehen, das Gesicht, das in unseren Albträumen meist nur aufschimmert.
Um das Schattenhafte, um die Dinge, die bei Nacht lebendig werden, geht es auch in den 12 Geschichten in dieser Sammlung. Sie sind über Jahre hinweg entstanden, die älteste davon („Nachtgesang“) schrieb ich, als ich noch ein Teenager war, die neueste („Der schwarze Vorhang“) kurz vor Herausgabe dieses Buchs.
Lesen Sie das Buch nicht, wenn Sie soeben ein seelisches Tief durchlaufen oder sich allgemein leicht ängstigen.
Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Spaß!
Münchberg, Ende Juli 2013
Oliver Fehn
Kapitel 1 – Nachtgesang
Die erste Kurzgeschichte, die ich schrieb; ich war noch nicht mal zwanzig. Eine jener Geschichten, von denen man Jahre später sagt: „Wenn ich sie damals nicht geschrieben hätte, wäre sie wohl nie geschrieben worden.“
Nachtgesang
„Willst du wirklich kein Taxi nehmen?“, fragte Kitty. „Um diese Uhrzeit ist die Stadt wie ausgestorben.“
Vor der Tür heulten Motoren, und Autos hupten ihr Abschiedskonzert. Sie standen am Fenster, die halbleeren Gläser in der Hand, und winkten den letzten Gästen nach.
„Keine Sorge, Dickerchen“, sagte Judy. „Seit vorhin bin ich doch vierzig. Ein richtig großes Mädchen.“
„Ein altes Mütterchen, meintest du wohl. Wie weit ist es bis zur Pension?“
„Nicht mal eine halbe Stunde.“
Als der Kellner vorbeihuschte, um die Fenster zu öffnen, schielten sie auf seinen Hintern und schubsten sich an – zum hundertsten Mal an jenem Abend. Die kühle Luft tat gut. Im Park gegenüber flackerten Laternen, und über die Straße wehten Müll und alte Zeitungsblätter. Judy zog ein Tablettenröhrchen aus ihrer Handtasche.
„Was für die Seele?“ fragte Kitty.
„Für den Magen. Vertrage nichts Kaltes mehr. Ted sagte vorhin, wir könnten eigentlich in den jungen Tag hineinfeiern. Aber glaub mir, ich wäre gestorben.“
Sie spülte zwei Tabletten mit Wein runter und rülpste lautlos. „Hörst du das?“ fragte sie, und Kitty nickte. „Der Wind flüstert. So haben wir als Kinder immer gesagt.“
„Du bringst was durcheinander.“ Kitty klappte mit den plumpen Fingern ihre Ohrmuscheln nach vorn. „Der Regen ist es, der flüstert. Der Wind geigt.“
Sie lauschten, und es war ein Flüstern und Geigen da draußen. Dann lief eine Gruppe Jugendlicher vorbei, die das Konzert mit ihrem Geplärr übertönten. Einer starrte durchs offene Fenster und rief „Oh, eine Peepshow.“ Judy grinste nervös. Kitty sah wieder auf die Uhr.
„Ich werd verrückt.“ Judy kicherte und warf den Kopf verspielt an Kittys Schulter. „Du trägst noch immer die alte Armbanduhr, die ich dir zu deinem neunten Geburtstag geschenkt habe? Die mit dem Speedy-Gonzales-Motiv?“
Kitty starrte verschämt auf ihr Handgelenk. „Sie leuchtet sogar noch, wenn man das Knöpfchen drückt. Ich hatte sie eigentlich jedes Jahr zu deinem Geburtstag am Arm, aber du hast es nie bemerkt.“
Sie ließ Speedys Gesicht auf dem Zifferblatt aufleuchten, begrüßte ihn wie damals mit Arriba, Señor! und äffte sein spitzes Grinsen nach.
Auch Judy versuchte sich an einer Speedy-Parodie. „Arriba, Señor. Mann, ist das toll, Dickerchen. Wir sind da, die Uhr ist da, unser Freund der Wind ist da ...“
„Freund? Na ja, damals war das anders.“ Kitty rieb sich die Arme, wie man es an kalten Tagen am Feuer tut. „Meist hatten wir ganz schön Respekt vor ihm. Vor allem nachts. Am Tag war er harmlos.“
„Da geigte er auch nicht.“ Judy nickte. „Am Tag war er das, was sie uns im Physikunterricht erzählt hatten: bewegte Luft. Nachts war er Musik. Ein Lied in Moll.“ Sie reckte den Hals zum Fenster. „Oh Gott, was war das denn?“
Sie sprang zum Fenster und lauschte hinaus. Regen trommelte auf ihren Nacken, und sie schüttelte sich. Dann rauschten zwei Autos vorbei. „Hat sich fast angehört, als würde ein Elefant trompeten.“
„Vielleicht ist ja ein Zirkus in der Stadt“, sagte Kitty, die inzwischen hinter ihr stand und sie mit ihrem Gewicht ans Fensterbrett presste, dann kicherten sie ihr Schulmädchengekicher.
Judy drehte sich um. „Meine Mutter sagte immer, früher hätten die Zirkusleute ihr Zelt auf dem alten Richtplatz aufgeschlagen, wo jetzt das leere Brauereigebäude steht. Oder nicht mehr steht?“
Kitty kreischte, weil der Wind ihre Frisur zerzauste, und beide retteten sich wieder an die Bar.
„Es existiert noch“, sagte Kitty. „Ist aber ziemlich verfallen. Und der Zirkus kommt nur noch selten hierher. War wohl ein Brummi.“
Judy freute sich über die natürliche Erklärung. „Stimmt. Wenn Brummis bremsen, klingt das manchmal sehr ... wie sagt man, elefantös?“
„Elefantastisch.“
„Genau, elefantastisch.“ Sie glucksten und tranken aus. Allmählich gewann die feuchte Nachtluft im Kampf gegen Tabakschwaden und schalem Biergeruch die Oberhand. Der Kellner trug die letzten Gläser in die Küche.
„Soll ich dich nach Hause begleiten?“, fragte Judy an der Garderobe, wo ihre Mäntel wie zwei Verbrecher an einer Galgenstätte baumelten. Sie prüfte, ob der Zimmerschlüssel mit dem klobigen Anhänger noch in ihrer Tasche steckte und fand ihn unter einem Wust von Taschentüchern.
„Ich schaff's allein, sind doch nur ein paar Schritte“, antwortete Kitty. „Ist mir übrigens immer noch ein Rätsel, wieso du kein Taxi nimmst.“
„Weil ich träumen will, Dickerchen“, sagte Judy. „Wann krieg ich schon mal was von meiner alten Stadt zu sehen?“
Sie sog die süße Nachtluft ein, als könne sie so die alten Zeiten zurückholen, die Tage mit Kitty, dem Wind und den Geheimnissen. Sie war längst zur Großstadtbewohnerin geworden und hätte es hier nicht mehr ertragen. Einmal im Jahr aber die große Party und alte Freunde wiedersehen, das musste sein. Es bewahrte sie davor, stumpf zu werden und zu vergessen.
Kitty umschlang sie mit ihren fleischigen Armen. „Mach's gut, großes Mädchen. Arriba, Señor.“
In dem roten Haus, nur ein paar Schritte entfernt vom Brauereigebäude, hatten sie damals gewohnt: sie, ihre Eltern und Melissa. Dann starb Judys Mutter, und die Gemeinde erwarb das Haus; seitdem stand es ungenutzt.
Sie presste die Nase gegen das Fenster, hinter dem einst ihr Zimmer gelegen hatte. Ein kahler Raum; auf dem Boden Betonsäcke und Maurerutensilien. Dann lief sie ein paar Schritte weiter und spähte in Melissas Zimmer. Dasselbe. An die Fensterscheibe hatte jemand einen selbstklebenden Schmetterling gedrückt, auf dessen Flügeln All You Need Is Love stand.
Sie ging zur Haustür und drückte die Klinke nieder. Verschlossen. In einem Horrorfilm wäre das anders gewesen: Sie wäre eingetreten und hätte Schritte im Treppenhaus gehört, und ihre tote Mutter hätte ihr Kaffee und Kuchen gebracht, als hätte sie all die Jahre über nur gewartet. Mach’s gut, liebes altes Haus, flüsterte sie, ehe sie weiterging.
Auch das Brauereigebäude, das an Sommertagen salzigen Trebergeruch verströmt hatte, barg eine wichtige Erinnerung. Über eine Treppe an der Seitenfront gelangte man über einen unterirdischen Korridor zu den Kellern. Dort hatte man sich wunderbar verstecken können: vor der Weißen Bande (ein paar Jungs, die mit Eisbärenmasken Jagd auf Nachbarmädchen machten, um ihren Puppen die Augen auszustechen), vor dem Buckligen aus dem Nachbarhaus, dem niemand begegnen wollte, weil er bucklig war, und einmal auch vor einem Pferd, das aus einem Schlachttransporter gesprungen und panisch durch die Straßen galoppiert war.
Nur Kitty, Melissa und sie hatten das Versteck gekannt. Einmal war sie einen ganzen Tag lang nicht mehr hervorgekommen, und Kitty hatte ihr am Abend Kekse und Limo gebracht, als Überlebensration. Dass die Brauerei an einem Ort stand, wo man in alten Zeiten Verbrecher hingerichtet hatte, machte das Spiel natürlich besonders gruslig. Zumindest für Judy und Kitty. Melissa nahm es eher mit Gleichmut hin.
Während Regentropfen von ihrem Kopftuch abprallten wie Gewehrkugeln, dachte sie an ihre Schwester. Ob sie unruhig wurde, wenn draußen der Wind geigte? Ob die Pfleger ihr Medikamente spritzten oder ihr ein Radio in die Zelle stellten, damit sie Ruhe gab?
Beim Überqueren der Flussbrücke sah sie hinüber zu dem großen Gebäude mit den vielen beleuchteten Fenstern. Ihre Schwester hatte im fünften Stockwerk gewohnt, hinter dem dritten Fenster von rechts, doch das war Jahre her, und vermutlich hatte man sie längst in eine andere Zelle umquartiert. Judy wusste es nicht, weil sie Melissa nie besuchte.
Ein einziges Mal war sie dort gewesen, vor mehr als zwanzig Jahren, um sie zum Geburtstag zu überraschen. Mit einem Ständchen auf der alten Stradivari, Melissas einzigem Vermächtnis. Sie hatte sich ein heiteres Stück ausgesucht, was von Mozart, und monatelang geübt, bis ihr die Fingerkuppen bluteten. Auf Melissas Ohren jedoch schien es nicht harmonischer zu wirken als das Gejaule von Hunden.
„Was ist mit Hütchen?“ fragte sie nach der ersten Strophe und starrte ihre Schwester durch stecknadelgroße Pupillen an. „Hast du Hütchen schon vergessen?“
Judy ließ sich nicht verunsichern und spielte auch die zweite Strophe. Es war Frühling; Knospen sprossen aus den Bäumen, und Kinder liefen barfuß, während sie hier spielte, mit rotem Kopf, und Melissa auf ihre Anstaltsschuhe starrte, die Lippen zusammengepresst, die Finger gekrümmt, eine Missgeburt hinter Glas.
„Ich hab geträumt, du bringst Hütchen mit, und Hütchen hat sein Totenhemd nicht mehr getragen, und alles war nur ein böser Spuk“, sagte sie.
Dann war Judy gegangen, weinend, um die verhexte Geige für immer auf den Dachboden zu verbannen. Ein Pfleger hatte sie zur Tür begleitet.
„Es steht nicht gut um sie. Sobald sie träumt, fängt sie an zu frieren. Dann läuft sie barfuß durch den Schnee, um nach Hütchen zu suchen. Seien Sie nicht traurig. Sie haben sich alle Mühe gegeben.“
Eine Hand griff nach ihrer, als sie an der Brücke stand und sich das Treiben in der Anstalt vorstellte. Seltsamerweise erschrak sie nicht. Sie spürte kurze, weiche Finger, wie die eines Kindes; die Nägel abgekaut.
„Willst du mit mir Liebe machen?“ fragte der Junge.
Als sie sich zu ihm umdrehte, starrte er zu Boden und zog die Schultern hoch. Am Kragen des roten Flanellhemdes, das er auf der nackten Haut trug, baumelte ein Preisschild, auf seiner spärlich behaarten Brust sah sie Gänsehaut. Er roch wie feuchte Lumpen.
„Mir ist kalt im Regen. Wollen wir Liebe machen?“
Sie zog eine kleine Nagelschere aus ihrer Handtasche, trennte das Preisschild ab, und der Wind nahm es mit. „Jetzt bist du viel schicker. Woher hast du denn dieses Hemd?“
Er wich einen Schritt zurück und klammerte sich an einen Laternenpfahl. „Die anderen haben es für mich ausgesucht. Mich haben sie nicht mit ins Geschäft gelassen.“
„Welche anderen?“ fragte Judy.
„Die aus dem Eispalast. Dort haben wir alle gewohnt, bis heute Morgen.“
Sie strich ihm über den Nacken. „Ich kann keine Liebe mit dir machen. Ich habe einen Mann. Einen sehr zornigen Mann. Er würde dich schlagen, wenn er es herausbekäme.“
Der Junge zog die Mundwinkel herab. „Ich will nicht, dass einer mich schlägt.“ Nach einer Weile blitzten seine Augen. „Aber wir könnten es heimlich tun.“
Sie deutete mit dem Finger auf das Anstaltsgebäude. Hinter Melissas früherem Fenster huschten Schatten auf und ab. „Dort drüben wohnt meine Schwester“, sagte sie. „Dort leben die Menschen hinter Glasscheiben.“
Er nickte lange und vergaß vielleicht, worüber. „Kaufst du mir eine warme Jacke?“
„Ja, aber erst morgen früh. Jetzt sind alle Läden geschlossen.“
Er lächelte, als hätte sie ihm ein süßes Geheimnis verraten. Während sie nebeneinander herliefen, starrte er auf ihre Beine. Es war nicht das Starren von Männern, die nur auf den richtigen Moment warten. Er schien zu wissen, was auf keinen Fall geschehen durfte.
In diesem Moment hörten sie den Gesang zum ersten Mal.
Er kam aus den Flussniederungen, wo keine Lichter brannten, kam näher und entfernte sich. Eine trällernde Opernstimme. Sie sah hinab, um die fremde Sängerin zu erspähen, sah aber nichts als Schwärze.
„Klingt wie aus einer Zauberoper“ sagte sie. „Wir sind nicht allein.“
Der Gesang rutschte in den Keller, um sofort wieder pfeilgeschwind zu einem hohen C emporzuschnellen, das ein ekstatisches Halleluja ebenso sein konnte wie ein Schmerzensschrei. Als sie nach seiner Hand griff, spürte sie, dass er zitterte.
„Sie kann mal wieder nicht schlafen“, murmelte er. „Dann steht sie auf und singt. Und sucht nach dem, den sie verloren hat. Sie hat mir nie von ihm erzählt, aber wahrscheinlich gab es eine Zeit, in der die beiden täglich Liebe machten.“
„Wer bist du eigentlich?“ fragte sie, als sie durch menschenleere Gassen liefen. Sie gingen jetzt Hand in Hand, aber sie wusste nicht, ob sie das wollte.
„Ich bin Mooney“, sagte er. „Der Mann im Mond. Aber ich war immer ein guter Mann im Mond. Ich habe mich nie mit der Eisprinzessin angelegt.“
Sie nickte, als erzähle er ihr von gemeinsamen Bekannten. Sobald sie an einer Sitzbank vorbeikamen, spürte sie ein Zucken in seiner Hand. Sie antwortete mit einem Ruck in die Gegenrichtung, wie bei Hunden, die man leinenführig macht.
„Die Eisprinzessin“, wiederholte sie. „Ist das die Frau, die wir singen hörten?“
„Nein“, antwortete er ungeduldig. „Die Eisprinzessin ist die, die uns die Zuckerperlen gibt.“
„Eine gute Prinzessin also?“
Er schüttelte energisch den Kopf. „Wenn sie gut wäre, hätten wir nicht aus ihrem Palast fliehen müssen.“
Sie ertappte sich dabei, seine Finger zu streicheln. Er streichelte zurück. Ihre Hände machten Liebe.
„Und die Frau, die gesungen hat?“
„Hat tote Augen. Starrt und starrt.“ Als seine Finger sich in vertraulichere Regionen vorwagten, riss sie sich los. Mooney nickte, als würden alle Dinge im Leben so enden.
Er deutete auf ein Bushäuschen am Ende der Straße, in dem ein schummriges Lämpchen brannte. „Verstecken wir uns dort? Bauen wir uns ein Nest?“
Sie lachte. „Lauf schon.“
Sie rannten los, und es war, als würden sie im Regen fliegen, dann stolperte sie über eins von Mooneys langen Beinen, stürzte und zog ihn mit, und sie kugelten über die Straße und lachten, und es war wie Liebe machen, nur ohne Liebe.
„Oh.“ Sie deutete auf die Straße, lachte und hielt sich an seiner Schulter fest. „Ich hab meine ganzen Papiertaschentücher ausgesät.“
Er winkte ab. „Die holt sich der Regen.“
Im Bushäuschen hoffte sie, dass Mooney ihre Kindereien nicht als Einladung verstanden hatte. Als sie sich auf die fleckenübersäte Bank setzten, vor der Eispapier und Zigarettenkippen im Schmutz klebten, presste er sie an sich. Sein Atem in ihrem Gesicht war kühl wie der Mond.
„Hörst du? Jetzt singt sie wieder. Was tun wir, wenn sie uns hier entdeckt?“
Sie spähten durch die kleine Türöffnung auf die andere Straßenseite, wo an einer Fassade rosa und grüne Lämpchen sich zu dem Schriftzug Bar Amor formten. Die Fenster waren gekippt, sie hörten Dean Martin, wie er Everybody Loves Somebody lallte, dann klirrten Gläser. Die Bar Amor hatte noch geöffnet.
Der Gesang war jetzt nur noch wenige Schritte vom Bushäuschen entfernt. Sie eilten über die Straße, steuerten die Eingangstür an, und der Mann im Mond versteckte sich hinter Judy.
„Erzähl mir deine Geschichte“, sagte er, als sie an einem der kleinen Marmortische saßen und ein wortkarger Wirt ihnen ihre Getränke servierte: Rotwein für sie, und einen Mondschein-Cocktail für Mooney. Er lachte und rührte das indigofarbene Getränk mit dem Finger um. Dann versuchte er, dasselbe mit Judys Wein zu tun, aber sie gab ihm einen Klaps auf die Hand.
Außer ihnen war niemand hier. Im fahlen Licht der Kerze auf dem Tisch betrachtete sie sein Gesicht zum ersten Mal genauer. Ein Teenager, mit Flaum auf der Oberlippe. Rosige Wangen. Und breite, durstige Lippen, die ihn ein wenig entstellten. Als er lächelte, sah sie seine Kinderzunge.
„Was für eine Geschichte?“ flüsterte sie. Hinter dem Tresen stand der wortkarge Wirt und starrte sie an.
Er zuckte die Achseln. „Jeder hat eine Geschichte. Ich könnte dir zum Beispiel erzählen, warum ich im Eispalast gelandet bin. Willst du es wissen?“
Sie trommelte im Takt zu Dean Martin, der sein Lied bereits zum dritten Mal sang. Sobald die Platte zu Ende war, warf der Wirt eine neue Münze in die Jukebox.
„Du wolltest Liebe machen“, sagte sie. „und jemand anderes wollte es nicht.“
Seine Augen verwandelten sich in kleine Schlitze. „Du bist ziemlich schlau.“ Unter dem Tisch berührten sich ihre Knie.
„Dann bist eben du dran“, sagte er.
Sie seufzte. „Es gibt viele Geschichten. Welche willst du hören?“
„Die von der Kälte. Von der Welt, die immer kälter wird. Davon handeln die meisten Geschichten.“
Sie trank von ihrem Wein, der einen Hitzestoß durch ihre Venen jagte. „Du hast Recht. Es ist kalt geworden auf diesem Planeten. Als wäre immer Winter. Ich hatte eine Schwester, die beschloss, sich für immer in ihr kleines, überheiztes Zimmer zurückzuziehen. Auch im Sommer knisterte dort immer der Ofen. Zuletzt ließ sie niemanden mehr zu sich. Seit jenem schwarzen Tag. Dem schwärzesten in meinem Leben.“
Er nickte, als wäre er dabei gewesen. „Es gibt solche Tage. Da gefriert einem das Blut in den Adern. Meine Schäferhündin ist an Darmkrebs gestorben, als ich noch klein war. Sie hat alles vollgekackt: ihre Decke, mein Bett, jeden Teppich. Dann ist sie gestorben. Ich habe nicht geweint. Aber wenn ich irgendwo am Weg Hundekacke sehe, werde ich traurig. Dann friere ich und muss über den Tod nachdenken.“
Sie wischte ihm einen hartnäckigen Regentropfen von der Nase und lächelte. Vielleicht war er ja ein Engel, der fremde Junge, der kackende Hunde liebte und keine Tränen mehr hatte.
„In meiner Geschichte spielt auch ein Hund mit“, sagte sie. „Aber nur in einer Nebenrolle. Die Hauptrolle in meiner Geschichte spielt ein Elefant.“
Mit diesem Elefanten hatte alles angefangen. Hütchen hatte Melissa ihn getauft, und sie trug das Stofftier die ganze Zeit mit sich herum, auch in die Kirche und jene rätselhafte Schule am Stadtrand, von der Judy bald glaubte, sie sei verflucht: eine Schule für Kinder wie Melissa, die mit Schneeflocken sprachen und Briefe an Engel schrieben. Die nicht blöd sein konnten, weil sie – das betonte ihre Mutter oft – wunderbar Geige spielten und sich komplizierte Notenfolgen einprägen konnten. Die aber die Zähne fletschten und ihre Finger zu Krallen bogen, wenn man sie mit rosa Fliedersträußen fotografierte, in einem weißen Kleid, das aussah wie ein Totenhemd.
Hütchen.
Judy sollte ihn in Pflege nehmen, als Melissa für ein paar Tage mit ihrer Schulklasse in die Berge fuhr. „Du musst ihn bei dir schlafen lassen“, sagte sie. „Er war noch nie allein. Und du musst die Heizung in deinem Zimmer einschalten, auf Höchststufe.“ Es war August, und auf den Straßen schmolz der Teer. Judy nickte nur.
„Vergiss es auf keinen Fall“, ermahnte Melissa sie am nächsten Tag, bevor sie in den Bus stieg und ohne Tränen Richtung Süden fuhr. „Schlimm genug, dass er an seinem vierzigsten Geburtstag allein sein muss.“
Hütchens Geburtstag wurde jedes Jahr groß gefeiert. Mit Bananen, Erdnüssen und Bonbons, die Melissa zum Schluss alle selbst verspeiste. Den Elefanten hatte ihr Cousin ihr vor fünf Jahren auf dem Volksfest geschossen. An jenem Tag war Hütchen zur Welt gekommen, und nun wurde er laut Melissa jedes Jahr zehn Jahre älter, so rechne man das bei Elefanten. Als Judy nach Hause kam, lag ein Zettel mit rosa Schmierschrift auf ihrem Bett: Deng an meinen Ellefanten.
Doch nicht eine Nacht lang war Judy gehorsam. Sie verschmachtete fast in ihrem Bett, zerwühlte die nassgeschwitzte Decke und zog sich schließlich nackt aus. Hütchen lag mit ausgestrecktem Rüssel neben ihr und grinste.
Als die Sonne aufging, hatte sie die Nase voll. Sie packte den Elefanten bei den großen Ohren und begann ihn zu schütteln: „Okay, mein Junge. Grins du ruhig. Du erträgst keine Kälte, und ich ertrage verdammt noch Mal keine Hitze. Die letzten sieben Stunden waren deine Show – jetzt zeige ich dir mal, was für ein großartiges Gefühl es ist, sich für andere zu opfern.“ Sie nahm Hütchen, trug ihn runter in den Keller und steckte ihn in die Tiefkühltruhe. Dann ging sie auf ihr Zimmer, stellte die Heizung ab, riss alle Fenster auf und schlief ein.
Als sie Hütchen am nächsten Morgen aus seinem eisigen Gefängnis befreite, lächelte er wie immer. Es klebten aber Eisperlen an seinem Rüssel, und sein Fell, vollgesogen mit Judys gefrorenem Schweiß, fühlte sich klamm und borstig an. Sie fönte ihn ab und warf ihn auf den Garderobenschrank; dort blieb er liegen, bis Melissa zwei Tage später von ihrer Fahrt zurückkam. Man sah, dass ihr die Berge keinen Spaß gemacht hatten, vermutlich vor Sorge um Hütchen. Judy brachte ihr den Elefanten, und die große Schwester presste ihn an ihre Brust. Sofort jedoch musterte sie das Stoffbündel mit irrem Entsetzen.
„Was hast du mit ihm gemacht?“ rief sie.
„Was soll ich mit ihm gemacht haben?“
Melissa ballte die Fäuste. „Er ist tot. Du hast ihn umgebracht.“
Judy zeigte ihr den Vogel. „Wie kann er tot sein, du dumme Kuh? Stofftiere sind schon tot, wenn sie geboren werden. Schlitz ihm den Bauch auf, und du findest nichts als stinkende Holzwolle. Tot, meine Güte.“
„Er ist tot“, flüsterte Melissa, und eine Träne fiel auf Hütchens Fell und blieb dort hängen wie Geifer. „Erfroren.“
„Sie rannte in mein Zimmer, nichts hätte sie aufhalten können, und ich musste hilflos zusehen, wie sie sich rächte: an Frosty, meinem kleinen Eskimohund. Sie würgte ihn, ihre knochigen Finger krallten sich um seinen Hals. Es war entsetzlich.“ Als sie sah, wie der Mann im Mond eine Braue hob, sagte sie: „Natürlich, Frosty war auch nur ein Plüschtier. Aber, zum Teufel, nicht in diesem Moment.“
Mooney trank von seinem Mondscheincocktail. Seine Augen blickten sanft und teilnahmsvoll, als erlebe er im Geiste alles mit.
„Du wirst mich für übergeschnappt halten“, sagte sie nach einer Schweigeminute. „Frosty sah aus wie zuvor, seine lange rote Zunge leuchtete noch immer wie Himbeer-Götterspeise. Aber ganz sicher war ich mir nicht, was Melissa mit ihm angestellt hatte. Du verstehst, was ich meine. Oder verstehst es auch nicht. Hütchen und Frosty waren natürlich schon immer tot gewesen, aber jetzt waren sie ... irgendwie anders tot.“
„Anders tot“, wiederholte Mooney, als sei es das Schlüsselwort. Das Schlimmste hatte sie ihm nicht erzählt: Nachdem Melissa ihrem Elefanten ein Totenkleid genäht und ihn im Garten begraben hatte, hatten sie und Kitty ihn heimlich wieder ausgebuddelt, waren damit nachts in ihr Zimmer geschlichen, hatten Hütchen mit einer Taschenlampe angestrahlt und sich dazu ein gruseliges Trompeten aus den Kehlen gequetscht. Melissa war vor Angst fast übergeschnappt. Aber solche Geschichten erzählte man nicht. Jedenfalls nicht Engeln, die immerzu froren.
„Wir schließen.“ Der Wirt stand mit einem großen Portemonnaie vor ihrem Tisch. Erschrocken hob Mooney die Hand an den Mund, doch Judy winkte ab. „Ich zahle für uns beide. Darf ich ein Taxi rufen?“
Er sah auf die Uhr, dann nickte er. Sie kramte in ihrer Börse. Kramte und kramte. Es fehlten ihr vierzig Cent.
„Das geht nicht“, sagte der Wirt. „Das haben schon andere versucht. Hat Ihr Kavalier nichts einstecken?“
Mooney fühlte sich nicht angesprochen. Nachdem Judy ihm erklärt hatte, worum es ging, schüttelte er den Kopf.
„Wir brauchten kein Geld im Eispalast“, sagte er. „Ich hab nur Kautabak in meiner Tasche. Und Murmeln.“
Der Wirt rief einen Frauennamen, und eine dicke Frau trat aus einem Verschlag.
„Zechpreller, so nennt man das doch?“ sagte sie, nachdem der Mann sie aufgeklärt hatte. „Wir werden die Polizei rufen.“
„Aber es sind nur vierzig Cent.“ Judy schüttelte verzweifelt den Kopf. „Ich kann es Ihnen morgen vorbeibringen.“
„Sparen Sie sich’s.“ Der Wirt ließ das große Portemonnaie zuschnappen. „Mir reicht’s, wenn ich euch beide nicht wiedersehe. Und jetzt aufstehen und gute Nacht. Das Telefongespräch könnt ihr vergessen.“
Der Regen versetzte ihnen wütende Ohrfeigen, als sie sich draußen in die Arme fielen. Mooney summte Everybody loves somebody, immer nur die eine Zeile, und wieder flüchteten sie in ihr Bushäuschen, und als Judy keine Stimme hörte, die da irgendwo sang, lachte sie. Der Wind war warm und der Regen süß; sie schnappte ein paar Tropfen mit den Lippen auf. Ihre Jubelstimmung verflog, als Mooney fragte:
„Darf ich bei dir schlafen?“
Sie räusperte sich. „Ich hab doch nur ein Hotelzimmer.“
Er sah sie flehend an. „Bitte. Ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll. Die anderen werden sich den Hintern abfrieren, in ihren Kellergewölben und unter den Brücken. Aber Mooney hat ein Zuhause. Weil er charmant ist und die Frauen ihn mögen.“ Er legte die Hände aufeinander, als wolle er beten. „Bitte.“
„Okay. Vielleicht darfst du bei mir schlafen. Aber nicht mit mir.“
Sein dankbares Lächeln schien ihn Mühe zu kosten. Wahrscheinlich hoffte er, es sei nicht ihr letztes Wort.
Vielleicht war es ja nicht ihr letztes Wort.
„Stimmt was nicht?“ fragte Mooney, als sie vor der Hoteltür standen. „Du guckst so seltsam.“
Ja, du Schlaumeier, dachte sie, es stimmt was nicht. Sie kramte in ihrer Manteltasche, ihre Finger bohrten und tasteten, dann spürte sie Tränen in den Augen. Der Schlüssel war weg.
Na klar, ihre Aktion mit dem Sturz. Die Taschentücher, die überall auf der Straße lagen. Der Schlüssel musste mit ihnen herausgefallen sein. Warum zum Teufel hatte Mooney die Taschentücher gesehen und nicht den Schlüssel?
„Ich glaube, aus unserer gemeinsamen Nacht kann nichts werden.“ Sie erklärte ihm alles und ließ es so klingen, als hätte sie heute Nacht wer weiß was mit ihm anstellen wollen.
„Das sagst du nur so, stimmt's?“ Mooney zog eine Schnute. „Du willst warten, bis ich weg bin, und dann allein pennen, stimmt's?“
An seiner Stelle hätte sie das auch so interpretiert. Aber sie wollte ja gar nicht, dass er ging. Wenn Mooney weg war, war sie allein. Mit dem Regen und den leeren Straßen. Im Hotel gab es keinen Nachtportier, es befand sich nicht mal eine Glocke an der Tür. Sie war obdachlos. Sie waren es beide.
„Ich werde dich nicht in Ruhe lassen“, sagte Mooney und packte ihren Arm. Würde nun dasselbe geschehen wie damals, ehe sie ihn in den Eispalast steckten?
Sie tätschelte seine Hand. „Doch, das wirst du.“
Er sah sie mit runden Augen an, dann blendete sie Scheinwerferlicht, und ein Bus hielt. Außer zwei jungen Mädchen stieg niemand aus. Der Bus war leer bis auf eine Japanerin, die ganz hinten saß und ihnen aus dem Fenster zulächelte. Judy winkte, und sie winkte zurück. Die Japanerin warf den Kopf in den Nacken und lachte. Sie wirkte beschwipst. Während der Motor im Leerlauf vor sich hingurgelte, sahen sie, wie der Busfahrer an einen Baum urinierte. Mooney klopfte an die Scheibe, und die Frau zeigte ihm die Zunge.
„Sie will Liebe machen“, sagte er zu Judy.
„Bist du dir da sicher?“
Er nickte, als sei er auf diesem Gebiet ein alter Hase. „Die anderen müssen frieren. Unter den Brücken und in den Kellern. Aber der Mann im Mond wird es warm haben. Weil keine Frau ihm widerstehen kann.“
Er streckte Judy die Hand hin und küsste sie auf die Stirn. „Nimm dich in Acht, Liebes. Sie sind unterwegs. Und wenn die Frau wieder singt, versteck dich gut. Sie sucht nach ihrem Liebsten. Und nach einem Mädchen, das ihn ihr weggenommen hat, für immer. Gott segne dich. Und grüß mir den Mond.”
Er sprang in den Bus, dann sah Judy, wie er neben der Japanerin in den Sitz sank und eine Menge erzählte. Sie hob die Schultern und gestikulierte. Dann stieg der Busfahrer zurück in sein Cockpit, der Motor knatterte, und sie fuhren weiter. Der Mann im Mond winkte, und das Mädchen winkte mit.
Judy sah ihnen nach und schwenkte ein Taschentuch. Ein kalter Windstoß entriss es ihr und ließ es in den Nachthimmel segeln wie einen verirrten Drachen.
Sie lief zurück in die Richtung, aus der sie gekommen war, und im Rauschen des Regens, der wie wütende Schnäbel auf sie einpickte, vernahm sie obszöne Worte.
Sie musste bei Kitty läuten; es war die einzige Möglichkeit, nicht irgendwo unter einer Brücke schlafen zu müssen. Immer wieder blieb sie stehen und hielt sich die Seite, weil ihre Lungen sich jedem Atemzug widersetzten. Es war wie damals, als sie vor der Weißen Bande geflohen war: Hilflose Kinderangst, die sich auch nach Jahren noch genauso anfühlte.
Als sie vor der Tür des Mietshauses stand, in dem Kitty wohnte, läutete sie Sturm. Mein Dickerchen wird nicht öffnen, dachte sie, denn in bösen Filmen öffnete nie jemand. Ihre Blicke streiften Kittys Briefkasten, aus dem ein Versandhauskatalog ragte, ein in narbige Plastikfolie eingeschweißter Wälzer. Sie hielt ihn ins Licht der Straßenlaternen. Heute Morgen mit der Post gekommen. Warum hatte Kitty ihn bei ihrer Ankunft nicht mit ins Haus genommen?
Vielleicht, weil Kitty nie zu Hause angekommen war ...?
Die Brauerei. Warum war ihr dieser Gedanke nicht gleich gekommen? Ihr Geheimversteck. Bis der Morgen kam und die Straßen sich belebten, würde sie dort geschützt sein. Am Horizont platzte schon der Himmel und schickte die ersten Streifen Licht, wie beschlagenes Silber.
Zum ersten Mal im Leben stieg sie bei völliger Dunkelheit dort hinab. Hätte wenigstens ein Stern durch die Luke geblinzelt. Lieber Mann im Mond, falls du wirklich ein Engel warst, dreh jetzt mit deiner Laterne eine Ehrenrunde für mich. Auch wenn ich nicht mit dir Liebe machen wollte, hilf mir trotzdem. Dafür werde ich lernen, den Mond zu umarmen, und wir können ein Paar sein, wenn die warmen Nächte kommen.
Der Mann im Mond reagierte nicht. Er musste weit weg sein, so weit wie das Meer, oder wie Japan vielleicht.
Dann hörte sie jene Schritte, wie sie tack-tack-tack die Treppe herunterkamen. Stöckelschuhe. Nicht flink wie am Morgen, wenn die Welt erwacht, sondern langsam und schwer.
Nachtschritte.
Wenn sie nicht schlafen kann, steht sie auf und singt. Weil sie nach dem sucht, den sie verloren hat.
Kein fröhlicher Gesang, der hüpfte und perlte.
Nachtgesang.
Wenn der Himmel sich zuzieht und Winde sich quälen,
kommt der Mitternachtsengel, hat Hunger auf Seelen.
Judy summte mit. Dann fielen ihr weitere Worte ein, eine ganze Strophe. Als Kinder hatten sie sich vor diesem Lied gegruselt. Zumindest Judy. Vor diesem irren Liedchen, das niemand erfunden hatte, das es auf keiner Platte gab, das ihre Mutter nicht kannte, ihre Großmutter nicht, und von dem ihre Lehrerin sagte, es sei scheußlich, nichts für Kinder. Der Mitternachtsengel. Judy hatte ihn sich in schneeweißem Gewand vorgestellt, mit Fingernägeln wie Eiszapfen.
Von der kleinen Kitty im Hause dort drüben
sind nichts als silberne Schuhchen geblieben.
Sie hatten verschiedene Namen eingesetzt, ein Gruselspiel für Kinder. Von der kleinen Judy, der kleinen Melissa, von ihnen allen waren nur silberne Schuhchen geblieben. Oder ein Geigenkasten. Oder Hütchen, der Elefant. Das erste Opfer einer langen bösen Eiszeit.
Kommt der Morgenwind dann und bläst auf den Wegen,
weht dir nur der Geruch von Knochen entgegen.
Wer dieses Lied noch einmal singt, schreibt eine Strafarbeit. Aber war es denn so schlimm? Schlimmer als der Bi-Ba-Butzemann, dessen Name so lustig klang und der in Wahrheit auf Dachböden lebte und junge Vögel fraß? Oder der Heidschi Bumbeidschi, der in den Weihnachtstagen Babys aus ihren Wiegen raubte? Böse Mädchen sangen mit. Sie tat es jetzt.
Der Regen, der Regen hat alles gesehen,
und er schweigt, und er schweigt, bis die Spuren verwehen.
Die Stimme war jetzt ganz nahe. „Alles Gute zum Vierzigsten.“
Dann spürte Judy eine Hand, die sich um ihren Nacken legte und ihr die Schulter drückte, so wie man kleine Schwestern tröstet. Dann die Finger an ihrem Hals. Die sich keine Zeit ließen, sondern es schlagartig taten, wie eine zuschnappende Falle. Ihre Knie gaben nach.
Das Seltsame war, dass sie weich fiel, wie auf einen Kleiderhaufen oder einen Berg von Marshmallows. Während ihr letzter Schrei von einem hohen C erstickt wurde, klammerten sich ihre Hände an das nächstbeste Etwas – einen menschlichen Arm. Ein sanftes Licht strahlte auf. Speedy Gonzales, mit seinen frechen Mäusezähnen, grinste sie an.
Kapitel 2 – Schmuddelbuddel
Meine zweite Geschichte, und etwas völlig anderes als „Nachtgesang“. Übrigens trotz der Ich-Form in keiner Weise autobiografisch. Nur eine Art Traum, a fantasy …
Schmuddelbuddel
Vom ersten Tag an, Schmuddelbuddel, haben sie dich alle verachtet.
Lange Zeit ahnten sie nicht mal, dass du hier wohntest. Wenn Mutti in mein Zimmer kam, rief ich: Schnell, Schmuddelbuddel, unters Bett! – und wie ein flinker Ball rolltest du in dein Versteck und gabst keinen Laut von dir, bis sie wieder draußen war. Manchmal blieb sie lange: straffte die Gardinen, enthaarte den Teppich und schrubbte sogar unsere Lieblingsposter, auf denen das Meer und der Himmel immer blasser wurden – alles schweigend, ohne mich anzusehen. Sobald sie wieder draußen war, explodierten wir beide förmlich vor Lachen, kugelten uns am Boden und schlugen Purzelbäume. Sie hatte ja keine Ahnung.
Schlimmer war es, wenn du erkältet warst und immerzu niesen musstest. Bis runter ins Esszimmer konnte man dich hören, und manchmal klapperte ich laut mit meinem Besteck, damit sie nichts mitbekamen. Sie sagten, wenn du nicht sofort aufhörst, nehmen wir dir den Teller weg, und du kriegst gar nichts zu essen.
Leider warst du ziemlich oft erkältet – kein Wunder. In Zuckerwatteland, wo du geboren bist, ist der Sommer länger als hier, und das Meer dort ist warm wie Badewasser. Mir war klar, dass du oft Heimweh hattest. Und wusste, dass du, wenn du unruhig schliefst und dich an mich schmiegtest, von deiner großen Kuschelhöhle träumtest. Wenn der Morgen kam und Mutti dreimal an die Tür klopfte – das Signal zum Aufstehen – schlüpftest du rasch in dein Versteck.
Oh Gott, weißt du noch, wie ich einmal von der Schule kam und nicht wie gewohnt deinen Schatten am Fenster sah? Diesmal ist es passiert, dachte ich. Diesmal haben sie ihn entdeckt. Ich wusste ja nicht, dass du mich überraschen wolltest und gerade unser Bett zur Kuschelhöhle umbautest. Ich dachte wirklich, sie hätten dich aufgespürt und in die Mülltonne gesteckt. Was ist das für ein Scheusal in Tobys Kinderzimmer? Wie schmutzig es ist. Igitt, wirf es raus.
Ich saß am Tisch und brachte keinen Bissen runter. Als ich begann, mit der Gabel herumzuspielen und dein Gesicht in die Soße zu zeichnen, warfen sie mir lange, schweigende Blicke zu und nickten. Ich hatte keine Ahnung, was dieses Nicken zu bedeuten hatte. Vielleicht hieß es ja: Ab heute, mein Junge, bist du wieder allein. Ab heute ist dein Schmuddelbuddel nicht mehr bei dir.
Irgendwann ließ ich meine Portion einfach stehen und rannte die Treppe hinauf in mein Zimmer, um nach dir zu suchen. Dein Versteck war leer, die Vorhänge zugezogen. Ich riss die Schranktüren auf, sah in meiner Aufregung sogar in den Schubladen nach – dann lugtest du auf einmal unter der Bettdecke hervor. Da fiel uns beiden nichts Besseres ein, als vor Freude zu heulen.
„Sollte doch 'ne Überraschung werden“, sagtest du. „Ich hab inzwischen die alten Träume aus deinem Bett gefegt, da verging die Zeit wie im Flug.“
Das freute mich natürlich. Deine Tage waren noch einsamer als meine. Schließlich konnte ich dich nirgendwohin mitnehmen, ob ich nun in der Stadtbücherei schmökerte, Kastanien sammelte oder am Steinbruch schwimmen ging. Dein Fell war oft nass vor Tränen, wenn ich nach Hause kam. Dann lehnte ich mich an dich und sagte: