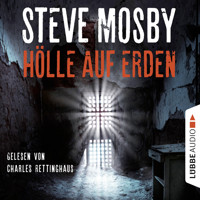9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Brillant, verstörend, hoch spannend - der neue Psycho-Thriller von Steve Mosby, Englands Meister des Genres. Charlotte Matheson ist vor zwei Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Doch plötzlich taucht eine Frau mit einem Netz von Schnittnarben im Gesicht auf, die ihr verblüffend ähnlich sieht und behauptet, sie sei Charlie, auferstanden von den Toten. Detective Mark Nelson soll den rätselhaften Fall untersuchen und erfährt von der völlig verstörten Frau schreckliche Dinge aus ihrem Leben nach dem Tod. Jedes Jahr, pünktlich zum Geburtstag seines Sohnes, bekommt Detective David Groves von einem Unbekannten eine Karte. Obwohl sein Sohn schon lange tot ist. Der Mörder wurde nie gefasst. Doch diesmal gibt es keine Glückwünschkarte, sondern eine seltsame Nachricht: Ich weiß, wer es getan hat. Ihre Nachforschungen werden für beide Ermittler zu einer Reise in die Finsternis, an einen Ort der Schrecken und skrupelloser Willkür. Wollen sie bis zur Wahrheit vordringen, müssen sie zuerst durch die Hölle gehen und sich ihren tiefsten Ängsten stellen ... Für Fans von Mark Billingham, Stuart MacBride, Michael Robotham und Val McDermid
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Ähnliche
Steve Mosby
Hölle auf Erden
Thriller
Aus dem Englischen von Ulrike Clewing
Knaur e-books
Über dieses Buch
Charlotte Matheson ist vor zwei Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Doch plötzlich taucht eine Frau mit einem Netz von Schnittnarben im Gesicht auf, die ihr verblüffend ähnlich sieht und behauptet, sie sei Charlie, auferstanden von den Toten. Detective Mark Nelson soll den rätselhaften Fall untersuchen und erfährt von der völlig verstörten Frau schreckliche Dinge aus ihrem Leben nach dem Tod.
Jedes Jahr, pünktlich zum Geburtstag seines Sohnes, bekommt Detective David Groves von einem Unbekannten eine Karte. Obwohl sein Sohn schon lange tot ist. Der Mörder wurde nie gefasst. Doch diesmal gibt es keine Glückwünschkarte, sondern eine seltsame Nachricht: Ich weiß, wer es getan hat.
Inhaltsübersicht
Für Lynn und Zack
Groves
Der Junge in der Grube
Es war fast Mitternacht, als sie schließlich mit David Groves in den Wald fuhren. Äußerlich wirkte er absolut ruhig. Daran würde er sich später deutlicher erinnern als an alles andere. Er wusste noch, dass er dachte: Es muss seltsam auf sie wirken, wie ruhig ich bin.
Sie waren auf der Umgehungsstraße Richtung Norden unterwegs. Zu dieser späten Stunde herrschte nur wenig Verkehr, und auch der flaute stetig ab, je weiter sie kamen. In entgegengesetzter Richtung führte dieselbe Straße zu den Abzweigungen in die Wohngebiete und Einkaufszentren der Stadt; auf der Strecke war immer viel los. Der Norden hingegen war dem Verfall preisgegeben, es gab kaum etwas, das die Fahrt hierher lohnte. Das Gewerbegebiet, das zur Linken an ihnen vorbeisauste, lag größtenteils verlassen und tot da. Fabrikdächer waren in sich zusammengesunken, ohne dass es jemanden zu stören schien.
Auch an Wäldern fuhren sie vorbei, die sich düster und undurchdringlich zur Rechten erstreckten. An manchen Stellen führten Fußwege hinein, die jedoch spätestens nach einer halben Meile eine Kehre beschrieben, um ein Stück die Straße hinauf wieder aus dem Dickicht herauszukommen. Nicht ein Jahr verging, ohne dass sich Menschen darin verirrten, weil sie bar jeglicher Ortskenntnis die Wege verließen. Es gab unzählige stillgelegte Schächte und Gruben, die alle zugewuchert und auf offiziellen Karten nicht einmal markiert waren. Es war erstaunlich, wie leicht man da draußen die Orientierung verlor – als regierte ein eigenes Magnetfeld in dem Gebiet, das den inneren Kompass außer Kraft setzte. Der weitläufige Wald barg viele Gefahren.
Groves sah durchs Autofenster die Bäume vorbeihuschen. Pechschwarz hoben sich die Berge in der Ferne vom Nachthimmel ab. Darüber stachen die Sterne hervor: ein interstellares, leuchtendes Meer aus Staubteilchen und Diamanten. Ein Schauspiel, das einem in der Stadt verborgen blieb. Hier draußen aber, so weit im Norden, gab es kaum künstliches Licht, so dass das Leuchten bis auf die Erde gelangte. Es ist immer seltsam mit dem Himmel, sinnierte Groves; richten wir unser Licht auf ihn, verschwindet er. Diese Haltung auch gegenüber seinem eigenen Glauben einzunehmen, dazu war er in letzter Zeit gezwungen gewesen.
Er wandte den Blick wieder ab.
Sie saßen zu dritt im Wagen. Groves hinten auf der Rückbank, allein. Mit dem ganzen Körper stimmte er in das Schaukeln des fahrenden Wagens ein. Die wenigen Straßenlaternen, unter denen sie herfuhren, tauchten den Innenraum flüchtig in orangefarbenes Licht, bevor es um sie herum wieder dunkel wurde. Es regnete leicht, die Scheibenwischer sprangen in regelmäßigen Intervallen quietschend an. Sonst war es absolut still. Niemand machte Anstalten, ein Gespräch anzufangen. Darüber, wohin sie fuhren und warum, konnten sie nicht reden, und jedes andere Thema wäre zu banal, wenn nicht sogar ein Affront gewesen. Sie zogen es deshalb vor, gar nichts zu sagen und so zu tun, als wäre das Schweigen würdevoll und nicht Ausdruck ihrer Verlegenheit. Je länger die Fahrt dauerte, umso mehr schien sich die Atmosphäre im Wageninneren zu verdichten, einen Druck aufzubauen, der die Fenster fast zum Bersten brachte.
Er fragte sich, was die Polizisten, die vorn saßen, dachten.
Unvorstellbar, was der durchmacht, vielleicht. Oder: Ich könnte das nicht.
Dabei war er sich nicht einmal sicher, ob er selber dazu imstande wäre. Er wusste nur, dass einer es schließlich tun musste und dass Caroline es in diesem Fall bestimmt nicht war. Zwar bestand kein Grund zur Eile, aber er hatte es für seine Pflicht gehalten, es so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Groves hatte mit den Ermittlungen nichts zu tun, doch diese Fahrt war eine dienstliche Gefälligkeit, um die er nicht einmal hatte bitten müssen. DCI Reeves hatte Bedenken geäußert und ihn zweimal gefragt, ob er sich seiner Sache wirklich sicher war, aber der Ausdruck in Groves’ Gesicht hatte gereicht. Wie schwer es auch werden würde, es war richtig, und Groves galt gemeinhin als einer, der immer das Richtige tat. Alle wussten, dass er ein guter Mann war. Und damit war die Diskussion beendet.
Der Fahrer bremste und setzte den Blinker. Sie fuhren in eine Parkbucht, in der sich die düsteren, massigen Schatten von zwei Mannschaftswagen der Polizei bereits unter das dichte Blattwerk geschoben hatten. Der Zugang zu dem Fußweg wurde von einem einzigen Beamten bewacht; seine Weste erstrahlte zitronengelb im Licht der Scheinwerfer, bevor sie ausgeschaltet wurden.
»Wir sind da«, sagte der Fahrer.
»Danke.«
Die Kraft seiner Stimme ließ ihn zusammenzucken. Fast war es, als gehörte sie jemand anderem. Und er fragte sich erneut, was die anderen Beamten denken mochten.
Es muss seltsam auf sie wirken, dachte Groves, wie ruhig ich bin.
Vielleicht hielten sie ihn für unerschrocken und unter den gegebenen Umständen sogar für besonders abgeklärt. Vielleicht dachten sie aber auch, dass er all seine Kräfte zusammennahm und sich entschlossen auf die Abscheulichkeit einstellte, die ihn erwartete. Dabei fühlte er sich weder stark noch mutig, und wenn die letzten zwei Jahre ihn eines gelehrt hatten, dann, dass der Anschein von Ruhe nichts zu bedeuten hat. Äußerliche Ruhe sagt nichts darüber aus, was als Nächstes passieren könnte. Auch eine Bombe verhält sich ruhig, bevor sie detoniert.
Wegen des Regens war im Wald ein Zelt errichtet worden. Strahlend weiß angeleuchtet von den Scheinwerfern, die notdürftig zwischen den Bäumen aufgestellt waren, schien es wie ein Geist über der Lichtung zu schweben. Dass das Zelt eher zum Schutz des Tatortes da war und weniger aus Respekt vor dem, was sich darunter befand, war Groves klar. Trotzdem war er froh.
Und man begegnete ihm achtungsvoll. Als er die kleine, hell ausgeleuchtete Lichtung betrat, verstummten die Beamten und Ermittler vor Ort, aber alle sahen sie ihn an, und wer ihn kannte, nickte ihm voller Mitgefühl zu. Die Botschaft war klar. Wir sind deine Brüder und Schwestern, sagten sie ihm. Auch wenn wir uns nicht vorstellen können, wie groß der Verlust für dich ist – wir tun, was wir können, und wenn möglich noch mehr.
In der Mitte, unter dem Zelt, war der Boden aufgewühlt. Blätter hatte man sorgfältig an den Rand geschoben, Erde war abgekratzt und für spätere Untersuchungen in Beutel gepackt worden. Das Resultat war eine kleine Grube mitten unter dem Zeltdach, nicht mehr als ein paar Zentimeter tief.
Fast eine Meile hatte Groves sich durch stockdunklen Wald schlagen müssen, um hierher zu gelangen. Zunächst auf markierten Wegen, dann über kaum passierbare Trampelpfade. Die Polizisten, die ihn begleiteten, ließen den Schein ihrer Taschenlampen vor sich über den Boden tanzen. Er hatte nicht weiter auf seine Schritte geachtet. Jetzt aber, wo er hier war, zögerte er plötzlich. Nichts stellte sich ihm in den Weg, trotzdem vermochte er kaum weiterzugehen.
Gott, steh mir bei.
Er nahm all seinen Mut zusammen, als die anderen Beamten zurücktraten, um ihm Platz zu machen. Zweige knackten leise unter seinen Füßen. Stück für Stück trat zutage, was sich in der Grube befand. Aber auch nachdem er es vollständig vor Augen hatte, brauchte es noch eine Weile, um sich zu etwas zusammenzufügen, das sein Gehirn verarbeiten konnte.
Die Erinnerung überfiel ihn. Caroline und ihm war es nie gelungen, Jamie eine bestimmte Bettzeit anzugewöhnen, und so hatte der Kleine sich sogar noch mit fast drei Jahren seinen eigenen Rhythmus erhalten. Sie konnten es nicht ertragen, ihn weinend in seinem Bettchen zurückzulassen. Keiner von ihnen konnte das unterdrückte Weinen aushalten, besonders weil sie, jeder für sich, so viel gemeinsame Zeit darauf verwendeten, ihre eigenen Tränen zu unterdrücken. Also hatten sie es aufgegeben. Nacht für Nacht legte Jamie sich aufs Sofa, sagte Gute Nacht, Mami und Daddy, und eine halbe Stunde später trug einer von ihnen das friedlich schnaufende, schlafende Bündel ins Schlafzimmer hinauf. Der Kleine schlief immer auf derselben Seite ein, die Hände vor dem leicht geöffneten Mund zusammengelegt, die Füße an den Knöcheln überkreuzt, das weiche, blonde Haar hinters Ohr geschoben.
So oft war Groves ergriffen gewesen von diesem vollkommenen Frieden in seinem Gesicht. Ein Kind, das in den Schlaf gesunken war. Das entschädigte für alles; ein gelungener Tag.
Genauso lag der Junge in der Grube, und dieser Anblick versetzte ihm einen schmerzlichen Stich – und dann natürlich die Kleider. Die ausgebeulten Jeans. Das, was von dem orangefarbenen T-Shirt mit dem lilafarbenen Hai übriggeblieben war. Er dachte an Caroline, daran, wie sie es zusammen mit einem anderen an dem Morgen hochgehalten hatte, als Jamie verschwunden war. Hai? Oder Affe? Immer wieder hatte sie ihn das gefragt, immer schneller und die T-Shirts dabei hin und her bewegt, bis Jamie sich vor Lachen kaum noch halten konnte. Hai, Mami! Hai.
Ein paar Haarsträhnen waren auf schmerzhaft vertraute Weise noch zurückgekämmt, jetzt aber schmutzig und spröde wie die Wurzeln im Erdreich drum herum. Der kleine Kopf war gräulich und gesprungen wie eine rußgeschwärzte alte Glühbirne. Eine Art Ruhe lag über allem, gewiss, aber eigentlich war es Leere.
Der Regen trommelte auf das Zeltdach.
Groves starrte auf die sterblichen Überreste hinab.
Er war gar nicht ruhig, bemerkte er. In Wahrheit war er fassungslos, den ganzen Nachmittag kaum bei Sinnen gewesen. Als hätte er neben sich gestanden, seit der Anruf gekommen war, und den eigenen Gedanken und Bewegungen zugesehen, ohne etwas zu spüren. Jetzt kam er wieder zu sich – in diesem Augenblick hier im Wald – mit einem festen, dumpfen Schlag, wie der des Herzens, den es macht, nachdem es einmal ausgesetzt hat.
Er ließ den Blick über die anderen Dinge schweifen, die neben dem toten Körper des kleinen Jungen in der Grube lagen. Ein Spielzeug an seiner Seite. Mehr noch als die Kleider, das Haar und die Lage war es der Anblick des Spielzeugs, der alles besiegelte.
Pu der Bär. Die Erde hatte das Orange stumpf werden lassen, und trotzdem hatte er den Plüschbär sofort erkannt. Er war Jamies Liebstes auf der Welt gewesen. Immer, wenn er morgens aufwachte, kuschelte er mit ihm und gab ihn auch im Laufe des Tages nur selten aus der Hand, bis er, das Stofftier eng an die Brust gedrückt, abends auf dem Sofa wieder einschlief.
»Ja.«
Niemand in der Lichtung antwortete. Seine Stimme klang nicht mehr so fest wie auf der Rückbank im Auto. In der Stille, die sich ausbreitete, hörte er den Regen über sich auf die Plane tropfen, langsam und regelmäßig wie ein Fingertrommeln. Detective David Groves setzte noch einmal an.
»Ja«, sagte er. »Das ist mein Sohn.«
Erster Teil
Und als es hieß, ihre MUTTER sei entschlafen, wurden SIE zu IHR in den Himmel gebracht. Und SIE bat SIE, sich zu IHR zu setzen, und voller Staunen lauschten SIE IHR, wie SIE IHNEN von den Geheimnissen des Lebens und des Todes berichtete, von der wahren Natur des Guten und des Bösen, davon, dass die Toten niemals wirklich von uns gehen und wie sie trotz allem bei uns bleiben können.
Auszug aus der Cane-Hill-Bibel
Mark
Eine schreckliche Wahrheit
Ich bin jetzt glücklich. Ich führe ein schönes Leben. Würde man jedoch tiefer bohren, stieße man auf etwas Schreckliches im Fundament.
Aus heutiger Sicht mutet es seltsam an, auf das zurückzublicken, was passiert ist. So eindringlich, wie das alles damals war – Bilder und Geräusche, leuchtend und unauslöschlich; jede einzelne Empfindung so klar und einprägsam –, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich es eines Tages vergessen könnte. Dass ich an einem anderen Ort ein neues Leben führen und in einem hochangesehenen Team bei der Polizei meiner Arbeit nachgehen würde. Mit einer Frau zusammen sein würde, die ich über alles liebe. Unvorstellbar damals, dass es sich jemals so weit weg von mir anfühlen könnte wie jetzt.
Ich war mit dem Rucksack unterwegs, als es passierte. Mit einer anderen Frau. Meiner damaligen Freundin. Lise und ich schlugen unser Zelt eines Abends auf einem kleinen Campingplatz an der Küste auf. Danach gingen wir zum Strand hinunter, um im Meer zu baden. Die Sonne bot einen traumhaften Anblick, als sie sich zum Wasser hin senkte und den Horizont vor unseren Augen in ein flammendes Orange tauchte. Ich sehe noch unsere Schatten, die uns folgten, als wir zum Meeressaum liefen, und spüre den weichen Sand an unseren Füßen.
Außer uns war niemand da; wir hatten den ganzen Strand für uns. Es war so wunderbar. Wir waren jung und verliebt und konnten nicht voneinander lassen. Wir liefen ins Wasser und ließen uns auf den seichten Wellen treiben. Wenn wir von der Strömung aufeinander zugetrieben wurden, umarmten und küssten wir uns. Drifteten wir wieder auseinander, fassten wir uns an den Händen, ließen den Körper an die Oberfläche steigen und lagen ruhig auf dem Wasser. Die Zehen lugten hervor, und wir sahen zu, wie das Licht der Sonne alles um uns herum wie mit einem Tuch aus glitzernden Perlen überzog. Es war einfach nur traumhaft.
Ich war kein guter Schwimmer und wollte nur so weit hinaus, dass ich noch stehen konnte. Deshalb probierte ich immer wieder, ob ich noch Grund unter den Füßen hatte und Sand zwischen den Zehen spürte. Das verschaffte mir ein Gefühl von Sicherheit. Plötzlich aber trat ich ins Leere, geriet mit der Nase unter Wasser und tauchte keuchend wieder auf. Ich reckte den Hals, um zum Strand zu sehen, der auf einmal viel weiter entfernt zu sein schien, als er sein sollte.
Bleib ruhig, rief Lise mir zu. Genau weiß ich es nicht mehr, aber so etwas in der Richtung. Sie sah, dass ich panisch wurde. Sie selbst war zu diesem Zeitpunkt noch ganz gelassen. Wir schwimmen wieder zurück.
Ich nickte, und wir schwammen zum Strand zurück. Dabei wandte ich vermutlich mehr Kraft auf als nötig. Obwohl ich mich nicht unmittelbar in Gefahr befand, wurde ich nervös und sehnte mich nach dem beruhigenden Gefühl, Grund unter den Füßen zu haben. Ich war fast am Ende meiner Kräfte, als ich kurze Zeit später wieder zum Strand sah, der jetzt noch weiter entfernt lag als zuvor.
Während ich einen Moment, ohne zu schwimmen, im Wasser trat, spürte ich, wie das Meer an mir zog. Lise hatte sich inzwischen schon ein Stück entfernt, und ich erkannte, dass sie jetzt gar nicht mehr gelassen war. Und das versetzte mich erst richtig in Panik, denn sie konnte viel besser schwimmen als ich. Sie ließ sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen.
Schrei um Hilfe, rief sie mir zu.
Das tat ich – wir schrien beide, so laut wir konnten –, aber nicht laut genug und scheinbar ins Nichts. Niemand war in der Nähe, der uns hätte hören können. Ich schwamm jetzt wieder, so als würde ich mich ans Wasser klammern. In null Komma nichts schien sich das Meer von einem ruhigen Gewässer in ein rauhes, aufbrausendes Monster verwandelt zu haben. Wie die Sonne, wenn sie sich manchmal blitzschnell hinter einer Wolke versteckt. Aus der Ferne hörte ich Lise schreien, dann drückte mich eine Welle hinab. Keuchend und würgend kam ich wieder hoch. Das Wasser in den Augen ließ den Strand nur verschwommen aufscheinen und seltsamerweise wie ein unbezwingbares Kliff hoch über mir. Dann wurde ich wieder hinuntergedrückt.
Wie ich es gemacht habe, weiß ich nicht, aber ich schwamm weiter. Ich war fest davon überzeugt, dass ich sterben würde, und es fühlte sich lächerlich und auch ungerecht an. Ein guter Schwimmer war ich nie gewesen, aber mich ergriff etwas Triebhaftes und Elementares, so dass ich immer wieder neue Kraft fand, wenn mein Körper schlappzumachen drohte. Ich hörte nicht auf zu schwimmen. Mehr nicht. Irgendwann – vielleicht nicht mehr als eine Minute später – spürte ich wieder Grund unter den Füßen und schleppte mich triefnass und vollkommen erschöpft aus dem Wasser. Erst begriff ich nicht, dass ich am Leben war. Aber es war so. An dem Abend schaffte ich es aus dem Meer heraus. Lise nicht.
Das letzte Bild, das ich von ihr habe, ist das vom Strand aus, wo ich am Wasser stehe und ihr zurufe: Schwimm! Atme! Du schaffst das! Ich konnte an ihrem Gesicht ablesen, dass sie mich um Hilfe anflehte, kurz bevor sie in den dunklen Wellen verschwand und ich sie nie wiedersah.
Danach hatte ich lange das Gefühl, ebenfalls gestorben zu sein. Ich erinnere mich, dass die Tage genauso dunkel waren wie die Nächte und dass mir die Trauer um Lise körperliche Schmerzen bereitete – der Kummer saß mitten in meiner Brust, wie eine muskuläre Verspannung, die sich durch Dehnen oder eine andere Körperhaltung nicht beseitigen ließ. Ihr Verlust tat mir unerträglich weh. Mein Leben hatte eine Verletzung erfahren, die ich nicht glaubte aushalten zu können. Und trotzdem lebte ich weiter. So ist das eben.
Mit der Zeit wurde es leichter. Ich wusste, was Lise sich für mich gewünscht hätte. So nahm ich mein Leben wieder in die Hand, bewarb mich um einen anderen Job und versuchte einen Neuanfang – auf der anderen Seite des Landes. Ich trauerte, brachte mein Leben aber in Ordnung. Schließlich lernte ich auch eine andere Frau kennen und verliebte mich in sie. Der Abstand zwischen heute und damals wurde immer größer, bis das, was mich damals so sehr verletzt hatte, verarbeitet war und nicht mehr so weh tat, wenn ich daran dachte. Ich habe mir ein neues Leben aufgebaut, und ich bin glücklich. Ich habe es geschafft, mich über Wasser zu halten.
All dem liegt eine schreckliche Wahrheit zugrunde und eine Frage, die zu stellen ich vermeide. Die Wahrheit ist, dass Lise ihr Leben verloren und meines sich unwiderruflich und auf entscheidende Weise verändert hat. Aber nicht nur zum Schlechten. Das glückliche Leben, das ich jetzt führe, baut auf dieser Tragödie auf. Ohne sie gäbe es auch mich nicht. Sosehr ich sie damals geliebt habe: Gäbe man mir eine Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen, dafür zu sorgen, dass Lise jenen Abend überlebt hätte und mein Leben jetzt ganz anders wäre – würde ich sie tatsächlich nutzen?
Die Frage zu stellen ist müßig, denn natürlich ist das nicht möglich. Ganz gleich, welche Abzweigung das Leben einen nehmen lässt, es kann immer nur in einer Richtung weitergehen. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen, und Menschen, die einem genommen werden, sind für immer fort.
Das jedenfalls habe ich gedacht. Aber das war, bevor eine Frau namens Charlie Matheson von den Toten zurückgekehrt ist.
Charlie
Was war mit ihrem Gesicht passiert?
Constable Tom Wilson war im Kriechtempo auf der Town Street unterwegs, als er sie entdeckte.
Er befand sich nach einem Einsatz auf dem Rückweg zum Revier: Ein Fall von häuslicher Gewalt zwischen einem Ehepaar hatte die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Tage zuvor war es auch heute viel zu heiß gewesen, und er hatte den Eindruck, dass die Hitze die Leute immer zum Äußersten trieb. Sie glühten förmlich, liefen heiß, ärgerten sich über irgendetwas und rasteten aus. Männer standen in Trauben vor den Pubs, die meisten waren angetrunken. Ihre Frauen beneidete er nicht. Genauso wenig wie die Leute von der Spätschicht.
Wilson sah auf die Uhr. Eine Stunde noch bis Dienstschluss, wenn nicht etwas dazwischenkam. Alles Mögliche konnte noch passieren, aber trotzdem zählte er in Gedanken schon die Minuten. Ein kühles Bier im Garten wäre fein, dachte er – ein klein wenig Entspannung nach einem langen, harten Tag. Er fuhr langsam weiter. Den Arm ins offene Seitenfenster gelegt, spürte er die Verheißung des Bieres schon auf der Zunge.
Dann sah er die Menschen dort stehen.
Fast wirkte es schon wie eine Versammlung, die sich vor einem Lebensmittelgeschäft zusammengefunden hatte und ihm rein körpersprachlich und unübersehbar signalisierte, dass etwas nicht stimmte. Alle starrten auf einen einzigen Punkt. Einige beugten sich vor, und einer saß in der Hocke, als würde er mit jemandem reden, der am Boden lag.
Wilson dachte an eine alte Dame, die gestürzt sein könnte. Dann hatte man vermutlich schon einen Krankenwagen gerufen. Aber trotzdem. Er setzte den Blinker, fuhr auf den Seitenstreifen und stellte den Wagen auf der gegenüberliegenden Seite ab.
Während er auf eine Lücke im Verkehr wartete, um die Fahrbahn überqueren zu können, drehten sich einige nach ihm um und schienen geradezu dankbar zu sein, als er schließlich über die Straße kam. Eine Uniform suggeriert Sicherheit. Allen Ereignissen an diesem heißen Nachmittag zum Trotz hatte Wilson die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen anständig waren und jemandem zu Hilfe eilten, wenn er sich in Not befand. Allerdings waren sie dabei immer ein wenig unschlüssig, nach dem Motto Ich weiß nicht genau, was ich tun soll, als läge ein aus dem Nest gefallener Vogel vor ihnen und sie überlegten, ob sie ihn anfassen durften oder nicht.
»Also«, sagte er. »Was ist passiert?«
Eine ältere Dame neben ihm antwortete. »Ich weiß es nicht. Sie kam einfach her und hat sich da hingesetzt. An ihrem Gang habe ich bereits gesehen, dass etwas nicht stimmte.«
Ein Mann hinter ihnen sagte: »Ich habe gerade schon einen Krankenwagen gerufen.«
»Gut. Würden Sie bitte alle etwas zurücktreten? Danke.«
Sie gehorchten und gaben den Blick auf eine Frau frei, die vor dem Laden auf dem Boden saß. Sie lehnte an einem Obstregal und hielt den Kopf gesenkt, so dass das lockige Haar ihr Gesicht verbarg. Sie hatte die Knie angezogen und die Arme wie zur Umarmung um die Schienbeine geschlungen, als klammerte sie sich an ihnen fest. Auch ohne dass er ihr Gesicht sehen konnte, hielt er sie für viel jünger, als er erwartet hatte.
Wilson beugte sich zu ihr hinab.
»Miss?«
Die Frau reagierte nicht. Sie war seltsam gekleidet, fiel ihm jetzt auf: Die Hose und die kurzärmlige Bluse leuchteten in einem strahlenden Weiß. Der Teint ihrer unbedeckten, dürren Unterarme unterschied sich in der Farbe kaum von der Kleidung. Er betrachtete die Narben, die sich kreuz und quer über die Haut zogen. Es waren viele. Einige schienen älter zu sein, während andere vermutlich erst neueren Datums waren. Die Verletzungen, die Kluft … Ihm kam der Gedanke, dass sie vielleicht irgendwo Patientin war, auch wenn ihm nicht einfiel, wo in der Nähe eine Klinik sein könnte.
»Miss?«, versuchte er es noch einmal. »Alles in Ordnung?«
Wieder keine Antwort. Sie umklammerte ihre Beine so fest, dass die Knöchel ihrer Hand die Haut zu durchstoßen schienen. Er bemerkte ihr hastiges Atmen, als versuchte sie, eine Panikattacke niederzukämpfen.
Gib ihr Zeit.
Wilson richtete sich wieder auf und wandte sich an die Frau, die ihm zuerst geantwortet hatte.
»Woher ist sie gekommen?«
»Von dort.« Sie deutete die Town Street entlang zu dem Feld, das sich dahinter erstreckte. »Ich wusste gleich, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Ich habe es sofort gesehen. Irgendetwas an ihr war seltsam. Vielleicht ist sie ja betrunken.«
»Und was ist passiert? Ist sie zusammengebrochen?«
»Sie kam her, blieb stehen, und dann hat sie … sich einfach hier hingesetzt.«
»Gut.«
Dass die Frau, die dort am Boden saß, betrunken war, glaubte Wilson nicht. Bei jemandem in einem solchen Zustand roch man es immer sofort. Egal, was sie getrunken hatten, der Alkohol drang durch alle Poren. Und diese Frau roch zweifelsfrei nicht nach Schnaps. Ihm wehte nur eine Mischung aus dem Duft der Früchte von dem Obststand neben ihm und einem Hauch Desinfektionsmittel in die Nase, das war alles.
»Kennt jemand sie?«, fragte er in die Menge. »Hat jemand sie hier in der Gegend schon einmal gesehen?«
Er blickte in leere Gesichter, einige schüttelten den Kopf.
»Alles klar.« Er ging in die Hocke. »Miss? Können Sie mich verstehen? Ich heiße Tom. Ich bin Polizist. Alles wird gut, das verspreche ich Ihnen. Können Sie mir sagen, wie Sie heißen?«
Die Antwort konnte er kaum verstehen.
»Entschuldigung, könnten Sie das bitte wiederholen?«
»Charlie.«
»Gut. Hallo, Charlie.«
»Matheson. Das ist mein Nachname. Charlie Matheson.«
»Sehr gut«, sagte er. »Und jetzt …«
»Ich hatte einen Unfall«, fuhr sie plötzlich fort. »Einen furchtbaren Unfall. Und ich weiß nicht, wo ich bin! Ich verstehe das nicht. Wo bin ich?«
Gerade wollte er antworten, als die Frau den Kopf hob und ihn ansah. Die Herumstehenden wichen zurück, und der Lärm von der Straße schien hinter einer Wand aus Wasser zu verschwinden.
Wilson wusste nicht, was er sagen sollte. Er konnte nicht anders, als die Frau anzustarren, vor ihr zu hocken und voller Entsetzen das zu betrachten, was ihrem Gesicht zugefügt worden war.
Mark
Von den Toten auferstanden
Von alldem wusste ich natürlich nichts, als ich am nächsten Morgen aufwachte. Ich wusste eigentlich überhaupt nicht viel.
In dem diffusen Zustand zwischen Schlafen und Wachen lag ich im Bett, sorgsam darauf bedacht, die Augen geschlossen zu halten, und hing meinen grauen, schweren und äußerst seltsamen Gedanken nach. Alles unzusammenhängende Puzzleteilchen, die, davon war ich überzeugt, kein schönes Bild ergeben würden, wenn man sie zusammensetzte. Mir schwante, dass es keine gute Idee wäre, mich zu bewegen, auch wenn ich nicht genau wusste, warum.
Du hast einen gewaltigen Kater, Mark.
Ach ja, genau. Das war es.
»Möchtest du einen Kaffee?«
Ich spürte einen Druck gegen mein Bein, als Sasha sich zu mir aufs Bett setzte. Sie schnippte mit den Fingern vor meinem Gesicht.
»Na los, Mark. Wach schon auf.«
Ich ächzte.
»Zu mehr bist du nicht in der Lage?«
»Sieht so aus.«
Ich hörte, wie sie den Becher auf dem Nachttisch abstellte. Dann riskierte ich einen Blick. Der Raum schien eine ungewöhnliche Schräglage eingenommen zu haben. Der Lampenschirm, den ich einen Moment lang versuchte zu fixieren, neigte sich ganz langsam zur Seite. Mein Kater schien das ganze Schlafzimmer umzurühren.
»Irgendetwas stimmt mit meinem Kopf nicht.«
»Kann ich mir vorstellen.« Mit überzogenem Mitgefühl tätschelte Sasha mein Bein. Dann stand sie auf. »Und sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.«
»Aber nicht genug.«
»Ich habe dich sogar sehr eindringlich gewarnt. Aber du bist ja erwachsen.«
Ich drehte mich ganz vorsichtig zu ihr. Sie stand neben dem Bett, den Kopf zur Seite geneigt, und sah leise lächelnd zu mir hinab. Der hellblonde Pferdeschwanz fiel ihr über die Schulter und bildete einen starken Kontrast zum Schwarz ihrer Uniform.
Wir arbeiteten beide bei der Polizei. Ich war Detective, brachte die meiste Zeit im Büro am Schreibtisch oder an einem Tisch im Vernehmungszimmer zu und kam nur gelegentlich heraus, um Vor-Ort-Befragungen zu organisieren. Ich ging im Anzug ins Büro. Meine Verlobte war Sergeant und Mitglied der Spezialtruppe zum Erstürmen von Gebäuden. Sasha gehörte zu den Leuten, die gerufen wurden, wenn eine Tür zu öffnen war, ohne dass wir anklopfen wollten. Ein harter Job, was sie stets herunterspielte, wenn ich eine Bemerkung in diese Richtung machte, und sie war entsprechend ausstaffiert. Ihre kugelsichere Weste bewahrte sie im Kofferraum ihres Autos auf, aber die restliche Uniform hatte sie an diesem Morgen schon an. Mein Blick fiel auf das Arsenal von Waffen und Gerätschaften in ihrem, wie ich ihn immer nannte, Arbeitsgürtel.
»Du siehst aus wie eine Superheldin«, bemerkte ich.
»Bin ich auch.«
»Bist du auch. Ist klar.« Ich richtete mich auf, und alles fing an, vor meinen Augen zu verschwimmen. »O Mann, danke für den Kaffee.«
»Schon gut. Es ist erst kurz nach acht. Du hast noch Zeit, um ein paar Tassen davon zu trinken.«
»Kurz nach acht? Ich habe doch heute Vormittag frei.«
»Weiß ich. Trotzdem dachte ich, dass Kaffee jetzt besser für dich ist als Schlaf.« Sie streckte die Hand aus und wühlte mir liebevoll durchs Haar. »Außerdem dachte ich, dass du dich vielleicht noch von mir verabschieden möchtest, bevor ich gehe. Zumal es für einen Gutenachtkuss gestern Abend nicht mehr gereicht hat.«
Vergeblich versuchte ich mich zu erinnern, wie ich überhaupt ins Bett gekommen war.
»Ach ja. Bitte entschuldige.«
»Hab’s überlebt.« Sie strubbelte mir erneut durchs Haar und ging. »Ich muss jetzt jedenfalls los. Haben gleich heute früh einen Einsatz. Wünsche dir einen schönen Tag, Detective Nelson, bis heute Abend.«
Ich nippte an meinem Kaffee. »Sei vorsichtig.«
Sie warf mir einen spöttischen Blick zu. »Ich glaube, das gilt eher für dich.« Sie tippte an ihren Arbeitsgürtel. »Und übrigens, Superheld, vergiss nicht, ich liebe dich.«
»Ich dich auch. Noch mal, entschuldige bitte. Ich meine es ehrlich.«
»Ja, ja, trink nur deinen Kaffee.«
Ich gehorchte. Für meinen Kopf war er nicht schlecht, an dem Schuldgefühl, das mich quälte, änderte er aber nichts. Kaum war die Haustür ins Schloss gefallen, kehrte ich in Gedanken zum gestrigen Abend zurück und erschrak angesichts dessen, was sich schemenhaft vor mir auftat.
Im Hinterzimmer einer Bar unweit der Dienststelle hatten wir gefeiert. Wir waren unter uns gewesen, nur Polizisten. Sashas und meine Kollegen stießen miteinander an, einige allerdings nur widerstrebend. Überall hingen Girlanden, und eine Menge launiger Reden wurden geschwungen, eine davon von Sasha selbst. Nur gut, dass ich mich darin nicht auch noch versucht hatte; ich glaube, ich hatte es tatsächlich in Erwägung gezogen. Darüber hinaus aber konnte ich mich kaum erinnern, was ich gesagt hatte, vor allem aber, wem. Mir schwante, dass das vielleicht nicht das Schlechteste war.
Tolle Leistung, Mark, dachte ich.
Sternhagelvoll, und Sasha viel netter zu mir, als ich es verdient hatte. Ich trank den Kaffee aus, ließ mich aufs Bett zurückfallen und legte die Unterarme über die Augen.
Tolle Leistung, dachte ich erneut. Was für eine Verlobungsfeier.
Gegen zehn war ich hinreichend gefüttert und getränkt, um einen Gang unter die Dusche zu riskieren. Dabei versuchte ich nachzudenken.
Im Dienst bin ich für Vernehmungen zuständig, was ich eigentlich einem Zufall zu verdanken habe. Bevor ich zur Polizei ging, hatte ich Psychologie studiert und im Anschluss daran in Verhaltenspsychologie promoviert. Ich wollte Profiler bei der Kripo werden. Tatorte analysieren, um die gewonnenen Erkenntnisse über den Täter dann nach Magierart herunterzuspulen.
Die Praxis setzte diesem Streben allerdings ziemlich rasch ein Ende, so einfach funktioniert es im realen Leben eben nicht. Natürlich hinterlässt jemand, der eine Straftat begeht, Spuren, die Rückschlüsse auf seine Vergangenheit zulassen. Trotzdem musste ich schnell einsehen, dass die meisten Täterprofile nicht zuverlässiger und hilfreicher sind als ein Horoskop.
Dennoch hatte ich mir im Laufe der Zeit eine gute Menschenkenntnis angeeignet und erkannt, dass ich ein Händchen dafür hatte, mit Menschen zu reden. Es machte mir Spaß herauszufinden, warum sie so waren, wie sie waren, und ihnen auf irgendeine Weise zu entlocken, was ich wissen wollte. Nach meinem ersten Studienabschluss trat ich den Dienst bei der Polizei an, wo ich mich zunächst auf Tür-zu-Tür-Befragungen spezialisierte. Nach Lises Tod habe ich mich in eine andere Gegend versetzen lassen, dorthin, wo ich jetzt bin. Und ich machte meine Arbeit gut. Mir gefiel es, Menschen zu analysieren.
Sich selbst zu analysieren ist um einiges schwieriger.
Was zum Beispiel hatte ich mir dabei gedacht, mich so zu betrinken? Soweit ich mich erinnerte, war es nicht einmal ein glückliches Besäufnis gewesen. Verdammt, wir hatten unsere Verlobung gefeiert, und für alle, die da waren, musste es ausgesehen haben, als wollte ich meinen Kummer ertränken.
Wie musste Sasha sich fühlen?
Das heiße Wasser platschte mir auf die Brust, während ich mir das Gesicht einseifte.
Natürlich wusste Sasha, was Lise zugestoßen war. Das heißt, sie wusste auch, dass wir wahrscheinlich geheiratet hätten, wenn Lise nicht ertrunken wäre. Dass ich nie in diese Stadt gezogen wäre. Sasha und ich hätten uns nie kennengelernt, geschweige denn ineinander verliebt. Gut möglich, dass sie damit ein Problem hatte, aber das ließ sie sich zumindest nie anmerken. Sie hatte mein Vorleben akzeptiert und vertraute mir. Zum Dank dafür fiel mir auf unserer Verlobungsfeier nichts Besseres ein, als mich zu besaufen, als wäre es kein Anlass zum Feiern gewesen, sondern ein Totentanz.
Aber warum? Natürlich dachte ich hin und wieder über das nach, was passiert war, auch wenn die Erinnerungen verblasst waren. Eine Zeitlang wurde ich wiederholt von einem Alptraum heimgesucht – der weiche Sand eines Strandes, das glatte Meer, das sich endlos vor mir erstreckt –, aber das war schon Monate her. Wenn ich mich recht erinnerte, hatte ich an Lise letzte Nacht nicht einmal gedacht. Dachte ich jetzt an sie, spürte ich einen Knoten, der sich in meiner Brust zusammenzog.
Albern.
Ich wusch mir die Haare und prustete das Wasser weg, das mir über das Gesicht rann. Dann stellte ich die Dusche ab. Ich liebte Sasha über alles und wollte sie heiraten. Es war also wirklich albern. Aber das Gefühl war trotzdem da. Ich sah Sashas Gesicht vor mir an diesem Morgen – lächelnd, lieb, aber auch forschend und unsicher – und stellte fest, dass auch ich selbst mich aus irgendeinem Grund nicht verstand, es einfach vermasselt hatte. Es war vielleicht nicht so schlimm, aber trotzdem. Keine Glanzleistung.
Wütend über mich selbst trocknete ich mich flüchtig ab.
Du musst es wiedergutmachen.
Das musste ich, und ich würde es auch tun. Gegen elf und nach einem weiteren schnellen Kaffee fühlte ich mich fast wieder wie ein Mensch. Innerlich aber beunruhigte mich, dass ich das anklagende Rauschen des fernen Meeres hören konnte. Der Knoten in meiner Brust löste sich nicht.
Mittags kam ich bei der Arbeit an.
Auch nach anderthalb Jahren in der Stadt war mir das neue Polizeigebäude immer noch fremd. Einerseits seltsam, da ich in dem alten Gebäude nur ein paar Wochen gearbeitet hatte, bevor die Abteilung umzog. Andererseits hatten wir in der kurzen Zeit in einem sehr schwierigen Fall ermittelt, so dass es vielleicht auch wieder verständlich war, dass sich die Ereignisse an dem alten Arbeitsplatz so eindrücklich in mein Gedächtnis einprägen konnten.
Es war ein heruntergekommener Altbau gewesen, in dem unsere Gruppe in einem einzigen Büro zusammengepfercht war, wo der Platz kaum für alle reichte. Das neue Domizil war in jeder Hinsicht anders: von strahlender Eleganz, nichts als Glas und Stahl, innen nahezu verschwenderisch geräumig. Alles war hypermodern und perfekt: frisch gestrichene weiße Wände und Decken, weicher Teppichboden, sogar an Kunstpflanzen neben den Aufzügen und abstrakte Kunst an den Wänden hatte man gedacht. In den Fluren hing der Duft von Raumlufterfrischern, die in Höhe der Fußleisten überall angebracht waren. Pinie vielleicht.
»Guten Tag.«
Um das mir mögliche Maß an Lockerheit bemüht, entbot ich der Kamera im Eingangsbereich meinen Gruß. Die automatische Gesichtserkennung reagierte nicht sofort, so dass ich mich schon fragte, ob es wirklich noch so schlecht um mein Äußeres bestellt war. Ich fühlte mich einen Moment unangenehm gemustert, bis das rote Licht am Türgriff mit einem Klicken schließlich doch auf Grün wechselte.
Ganz anders als im alten Gebäude war meinem Team und mir ein kleiner Trakt mit Büros für uns allein zugebilligt worden. Ich ging in den dritten Stock hinauf und durch die Tür, die in unseren Gang führte.
Mein Büro lag gleich vorn, aber ich schlenderte daran vorbei, um zu sehen, wer noch da war. Greg Martin, unser IT-Spezialist, war eindeutig außer Haus, denn die Tür war zu und abgeschlossen. Damit, dass jemand hineinging, um herumzuschnüffeln, war kaum zu rechnen. Und wenn, dann gab es sowieso nicht viel zu sehen. Trotzdem vermittelte Greg immer gern den Eindruck, dass Sicherheit das Nonplusultra seiner Arbeit war und der Zugriff durch einen potenziellen Hacker das komplette System zum Absturz bringen könnte.
Simon Duncan mit seiner unbekümmerten Politik der offenen Tür war genau das Gegenteil. Er war unsere Verbindungsstelle zur Forensik, war zwar häufig nicht da, machte aber die Tür trotzdem selten zu, geschweige denn, dass er sie abschloss. Auch sein Büro war verwaist. Der Computer summte einsam auf dem Schreibtisch vor sich hin. Abgesehen von einem Kalender, dessen Blätter er seit Februar nicht mehr abgerissen hatte, waren die Wände kahl. Simon war Kletterer und hatte sich für ein Foto mit Bergpanorama entschieden. Vor einer Weile hatte er mir auf seine ihm eigene schalkhaft herablassende Weise erzählt, er habe ein Bild gefunden, das ihm gefiel, und dabei wolle er es belassen. Er brauche kein Papier, das ihm zeige, welchen Tag wir gerade hatten.
Hinter dem Einsatzraum sah ich die Tür von Pete Dwyers Büro einen Spaltbreit offen stehen und vernahm auf dem Weg dorthin schon das leise Klacken seiner Tastatur. Ruhig und regelmäßig. Ein Zwei-Finger-Tipper. Pete. Ein freundlicher Bär von einem Mann, den technische Neuerungen immer wieder in Staunen versetzten. Er stand da und sah sich verwundert um, ohne eigentlich zu begreifen, was um ihn herum geschah. Mein Chef.
Ich klopfte an und stieß die Tür ein Stück weiter auf.
»Hallo, Pete.«
»Mark.« Er blickte vom Bildschirm auf und seine Miene verzog sich zu einem Grinsen, das sich um die Augen in Falten legte und sein Gesicht scheinbar schrumpfen ließ. »Sie sehen aus wie der Tod.«
»Ich dachte schon, der Computer unten würde mich nicht reinlassen.«
»Er wird Sie für einen Landstreicher gehalten haben. Kommen Sie rein. Wie geht’s Ihrem Kopf, junger Mann?«
»War schon schlimmer.« Ich schloss die Tür hinter mir. »Wenn auch nicht oft, wenn ich das hinzufügen darf.«
»Sie haben gestern Abend ganz schön gebechert. Wie eine Maschine. Können Sie sich überhaupt noch an unser Gespräch erinnern?«
Ich zuckte zusammen. Nein, konnte ich nicht. In unserer Abteilung herrschte zwar ein relativ lockerer Umgangston, aber Pete war immerhin mein Chef.
»Nicht so richtig.«
»Nicht so richtig. Eigentlich ging es nur darum, wie Sie das alles runterkippen können und was Ihr Kopf am nächsten Morgen wohl dazu sagt. Und ich sage Ihnen eins, Sie wollten davon nichts wissen. Kann es sein, dass Sie außerhalb der Arbeit ein bisschen streitlustiger sind?«
Langsam setzte meine Erinnerung ein: dass Pete mich gefragt hatte, ähnlich amüsiert wie jetzt, ob ich mir meiner Sache wirklich sicher wäre – und versucht hatte, einen Witz daraus zu machen, auch wenn es eigentlich nicht witzig gewesen war. Er hatte zwei Töchter im Teenageralter und gab sich immer gern väterlich. Vermutlich war er es deshalb gewohnt, dass man seine Bedenken beiseiteschob. Ich meinte mich dunkel zu erinnern, genau Letzteres getan zu haben, bevor ich ihn umarmte und ihm mit alkoholseligem Freundschaftsgehabe auf den Rücken klopfte.
»Und um einiges anhänglicher«, sagte ich.
Er lachte.
»Sind Sie und Sasha gut nach Hause gekommen?«
»Hab nichts anderes gehört.«
»Sonst auch alles in Ordnung?«
»Immerhin spricht sie noch mit mir. Sie hat mir sogar einen Kaffee gemacht, bevor sie ging.«
»Ihnen ist klar, dass Sie sie nicht verdient haben.« Pete machte es sich auf seinem Stuhl bequem. »Sie ist viel zu nachsichtig.«
»Das stimmt.«
»Deshalb fällt es mir zu, Ihnen für Ihre Sauferei einen Denkzettel zu verpassen. Aber das hätte ich sowieso getan. Was liegt im Augenblick bei Ihnen an?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich muss noch ein paar Dinge fürs Gericht vorbereiten. Aber ohne Termin. Also nichts, was nicht warten könnte.«
»Das trifft sich gut.« Er reichte mir über den Schreibtisch hinweg eine Akte. »Würden Sie sich das bitte einmal ansehen?«
Ich nahm den dünnen, braunen Ordner mit ein paar ausgedruckten Seiten entgegen. Alle aktuellen Fälle waren über das Intranet der Dienststelle zugänglich. Statt mir aber einfach die Fallnummer zu nennen, hatte Pete sich in altbewährter Manier eine Kopie ausgedruckt. Ich blätterte sie kurz durch und runzelte die Stirn.
»Unfallbericht«, stellte ich fest. »Charlotte Matheson.«
»Genau, mit Todesfolge.«
»Das ist zwei Jahre her. Autounfall. Auf der Umgehungsstraße von der Straße abgekommen. Nichts Außergewöhnliches. Fall abgeschlossen.« Ich sah auf. »Tragisch, aber was soll ich damit?«
»Keine Ahnung.« Pete klang jetzt noch liebenswürdiger. »Aber nehmen Sie die Akte bitte trotzdem mit und lesen Sie sie. Und dann fahren Sie ins Krankenhaus.«
»Na, so schlimm ist mein Kater auch wieder nicht.«
Pete lachte wieder.
»In der Town Street wurde eine junge Frau aufgefunden. Gestern, am späten Nachmittag. Sie war hilflos und hatte Verletzungen im Gesicht. Genaueres weiß ich nicht. Im Krankenhaus gab sie sich als Charlotte Matheson aus.«
»Als diese Charlotte Matheson hier?«
»Genau die. Anschrift, Personendaten, alles stimmt überein. Sie besteht darauf, Charlotte Matheson zu sein.«
Ich blickte auf den Ordner hinab, dann wieder zu Pete.
»Und Sie wollen, dass ich … ?«
»Dass Sie mit ihr reden, natürlich.«
»Warum?«
»Um zu überprüfen, ob an ihrer Geschichte etwas dran ist.«
»Dass sie von den Toten auferstanden ist?«
Wir wussten beide nur zu gut, was an ihrer Geschichte dran sein konnte. Dann fällt also mir die Aufgabe zu, Ihnen für Ihre Sauferei einen Denkzettel zu verpassen, wie wahr. Ich schüttelte vorsichtig den Kopf, und Pete lachte erneut.
»Alles Gute zur Verlobung, Mark.«
Mark
Sie weiß über alles Bescheid
Im Krankenhaus erwartete mich eine endlose, fast aussichtslose Tour durch das Gebäude auf der Suche nach dem Baines-Flügel, in dem die Frau, die sich als Charlotte Matheson ausgab, behandelt wurde.
Auf dem Weg durch die fast identisch aussehenden Flure behielt ich die Schilder im Blick, die von der Decke hingen. Trotzdem beschlich mich langsam das Gefühl, das Ziel könnte frei erfunden sein. Als ich eine Abzweigung erreichte, von der ich glaubte, sie soeben schon passiert zu haben, spielte ich mit dem Gedanken, mit Kreide Pfeile auf den Boden zu malen. Auch dieses kränkliche Einheitsgrün, in dem die Wände gestrichen waren, trug wenig zur Orientierung bei. Zu allem Überfluss hatte der grelle Sonnenschein auf der Fahrt hierher auch noch meinen Kater wieder aufleben lassen.
Der Mann, an den ich mich wenden sollte, war ein gewisser Dr. Fredericks, und schließlich fand ich den Baines-Flügel doch. Ich meldete mich an, woraufhin man mich in einen Warteraum schickte, der so beängstigend klein war, dass ich von Glück sagen konnte, der einzige Besucher zu sein. Schlichte schwarze Stühle reihten sich die Wände entlang um einen niedrigen Tisch, auf dem ein paar zerlesene Zeitschriften und Bücher ausgelegt waren. Ich setzte mich und atmete ruhig und gleichmäßig durch. Die Luft war warm und abgestanden. Ich spürte meinen Herzschlag im Hinterkopf, als würde ein aufgebrachter Nachbar wütend gegen die Wand hämmern.
Auf der Fahrt hierher war ich zu dem Schluss gekommen, dass ich stocksauer auf Pete war, weil er mich auf diese Mission geschickt hatte. Nach dem, was ich in der Akte gelesen hatte, stand für mich außer Zweifel, dass Charlotte Matheson tot war. Wer immer die Frau im Krankenhaus war, Matheson war es jedenfalls nicht. Herauszufinden, wer sie war, hielt ich nicht für eine angemessene Nutzung weder meiner Zeit noch meiner Erfahrung, und Pete wusste das. Dass hier ein Verbrechen vorlag, war höchst unwahrscheinlich. Und sollte die Frau sich tatsächlich als ernsthaft gestört erweisen, dann war die Sache moralisch äußerst fragwürdig. Auf die Gefahr hin, dass man mich für einen verträumten Idealisten hält, sind die, die ich vernehme, für mich immer noch Menschen und nicht Objekte plumper Büroscherze.
»Detective Nelson?«
Ich sah auf und erblickte einen Mann, der Dr. Fredericks sein musste. Er war alt und groß und trug einen brauen Anzug. Mit besorgtem Blick sah er auf mich herab.
»Geht es Ihnen gut?«
»Nein«, sagte ich. »Eigentlich nicht.«
»Dort um die Ecke steht ein Wasserspender.«
»Vielen Dank.«
Ich nahm einen Becher, ließ eiskaltes Wasser hineinlaufen und trank ihn in einem Zug leer. Ich nahm noch einen zweiten, bevor ich wieder zurückging. Fredericks hatte inzwischen in der Ecke des Wartezimmers Platz genommen, vor sich ein Klemmbrett, das er auf den Knien balancierte. Seine Beine waren so lang, dass die Enge des Raums ihm ein noch größeres Problem bereitete als mir.
»Kommen Sie«, forderte er mich auf. »Sie möchten sich bestimmt setzen.«
»Danke, ja.« Ich setzte mich ihm gegenüber und wünschte mir nichts sehnlicher, als die Sache möglichst schnell zum Abschluss zu bringen. »Ich bin hergekommen, um etwas zu überprüfen. Wenn ich richtig informiert bin, wurde gestern eine Frau aufgefunden, die sich als Charlotte Matheson ausgab. Ist das richtig?«
»Ja. Das hier ist ihre Krankenakte.« Fredericks deutete auf den Papierstoß auf dem Klemmbrett, der mit Büroklammern unterteilt war. »Es sind ältere Unterlagen. Sie war nämlich schon häufiger hier.«
Ich zeigte ihm den Ordner, den ich mitgebracht hatte. »Nach unseren Unterlagen ist Charlotte Matheson vor zwei Jahren gestorben.«
Fredericks nickte. »Entspricht dem, was wir über sie haben.«
»Dann stimmen Sie mir also zu, dass es sich um eine andere Charlotte Matheson handelt?«
»Genau das ist das Problem. Auf den ersten Blick scheint es so zu sein – oder vielleicht hat sie auch einen ganz anderen Namen. Aber sie ist fest davon überzeugt, diese Charlotte Matheson zu sein. Geburtsdatum, Anschrift, alles stimmt.«
»Ist sie verwirrt?«
»Das ist sie ganz sicher. Und sie war seltsam gekleidet, als sie hergebracht wurde: Sie trug Hose und Kittel ganz in Weiß. Zuerst sah es so aus, als wäre sie Patientin irgendeiner Einrichtung.«
»Das würde einleuchten.«
»Nur wüsste ich in dem Fall nicht, welche. Die Kleidung weist keine Markierungen auf, und es handelt sich auch nicht um die Einheitskluft eines der Krankenhäuser, die ich kenne. Außerdem habe ich mich ein wenig umgehört. Es gibt in der Umgebung keine Klinik, der eine Patientin verlorengegangen ist.«
Ich nippte immer wieder an meinem Wasser, während ich mir alles anhörte.
»Sie haben ihr doch sicher gesagt, dass sie nicht die sein kann, für die sie sich ausgibt? Weil Charlotte Matheson tot ist?«
Fredericks schüttelte den Kopf.
»Mir ist klar, dass Sie sie mit Samthandschuhen anfassen müssen. Trotzdem, ich möchte wissen, ob Sie ihr erklärt haben, dass sie diese Person nicht sein kann, weil sie tot ist.«
»Nein, haben wir nicht. Aber das müssen wir auch nicht; es ist ja unstrittig.«
Ich leerte den Becher ganz.
»Entschuldigen Sie, jetzt kann ich Ihnen nicht ganz folgen.«
»Tut mir leid. Vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt. Die Frau, die wir behandeln, weiß, dass Charlotte Matheson bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Dennoch behauptet sie, diese Person zu sein. Einen Moment bitte.«
Fredericks zog ein paar Seiten aus dem Stapel hervor und überflog sie. »Ich habe ihr gesagt, dass die Charlotte Matheson, die zu sein sie vorgibt, seit zwei Jahren tot ist. Sie hat geantwortet: ›Ja, ich weiß, dass ich das bin.‹ Sie war verwirrt, als sie zu uns kam, aber wir haben sie das immer wieder gefragt.«
»Sie glaubt also, dass sie tot ist?«
»Das sieht ganz so aus. Sie ist ein wenig durcheinander und weiß auch nicht so genau, was passiert ist. Sie scheint zum Teil auch ihr Gedächtnis verloren zu haben, ist aber fest davon überzeugt, bei einem Autounfall gestorben zu sein. Auch dem Polizisten, der sie gefunden hat, sagte sie, dass sie einen Unfall hatte, bei dem sie gestorben ist. Und sie kennt alle Einzelheiten.«
Ich hätte gern noch einen Becher Wasser gehabt.
»Was ist mit den Verletzungen?«, fragte ich. »Mein Vorgesetzter sagte mir, sie hätte Verletzungen im Gesicht davongetragen.«
Fredericks wirkte betreten. Er schob das Papier wieder zu seinen Aufzeichnungen, stand auf und bedeutete mir, ihm zu folgen.
»Ja«, sagte er. »Das ist der Grund, weshalb ich mich an die Polizei gewandt habe. Aber ich glaube, Sie sollten sich selbst ein Bild machen.«
Groves
Ein Mann wie aus schwarzem Holz geschnitzt
Ich weiß, wer es war.
David Groves legte die Karte auf die Küchentheke. Die Post kam immer sehr früh. An dem Tag, der Jamies sechster Geburtstag gewesen wäre, war das nicht anders.
Es war erst kurz vor acht, aber die Morgensonne stand schon am Himmel und schickte ihr Licht in die Küche, in der es durch die Lamellen der halb heruntergelassenen Jalousie in schemenhafte Streifen geschnitten auf den Boden fiel. Wie heimelig, dachte er immer; wie geschaffen für einen Werbespot für Brot oder Butter. Das Erdgeschoss bestand aus einem einzigen großen Raum, und die alten Holzmöbel verbreiteten eine rustikale Landhausstimmung.
Nach Jamies Verschwinden und der Scheidung von Caroline hatte Groves sich mehrere Häuser angesehen, sich in dieses aber in dem Moment verliebt, als er es betreten hatte. Es erinnerte ihn an eine Katze, die zusammengerollt in der Sonne döste. Morgen für Morgen erwachte das Cottage nur langsam aus dem Schlaf. Die Rohre in den Wänden brummten träge vor sich hin; winzige Staubpartikel trudelten schläfrig durch die Luft.
Er goss sich noch eine Tasse Kaffee – stark und schwarz – aus der Glaskanne ein und wandte sich wieder der Geburtstagskarte und dem zu, was darauf geschrieben stand.
Ich weiß, wer es war.
Das war alles. Darüber und darunter stand nichts. Die Zeile war von Hand geschrieben, wie auch die Adresse auf dem Umschlag, in dem sie verschickt worden war: die Buchstaben mit schwarzem Kugelschreiber fein säuberlich zu Papier gebracht, als gälte es, die Identität des Absenders zu verbergen.
Adressiert war die Karte nicht an David Groves, sondern an Jamie selbst.
Wenigstens war es dieses Jahr nur eine.
Das war doch schon mal was. Immer an Jamies Geburtstag tauchten die Verrückten auf. Er hatte sich eine Zeitlang gefragt, warum. Niemand wusste genau, wann Jamie gestorben war, so dass sie ihn an dem Tag auch nicht behelligen konnten. Aber warum wählten sie nicht den Tag seiner Entführung? Bis es ihm schließlich eingefallen war. Weil es am Geburtstag seines Sohnes quälender war. Der Tag, an dem Jamie zur Welt gekommen war und seine ersten beiden Geburtstage schon gefeiert hatte, bevor er entführt wurde. Es erinnerte Groves daran, dass es so viele mehr hätte geben sollen, was aber nie geschehen würde.
An diesem Tag hättest du feiern sollen, sagten die Irren. Aber stattdessen tun wir das.
In den Jahren davor hatte er Anrufe bekommen. Dabei war es zunächst still in der Leitung geblieben, bis der Anrufer schließlich den Mut aufbrachte, schnell etwas Gemeines in den Hörer zu sagen, und dann hastig auflegte. Meistens aber waren es Briefe gewesen. Voller Hohn. Briefe mit einem Geständnis, in dem Groves ausführlich und bis ins Detail beschrieben wurde, was man seinem Sohn angetan hatte, bevor er starb.
Groves glaubte nicht, dass irgendetwas davon stimmte. Es waren Leichenfledderer und Feiglinge – Typen, die sie nicht alle beisammen hatten. Trotzdem ging es ihm unter die Haut. In einem Jahr hatte jemand den Brief mit den Worten beendet: Ich komme heute Abend zu Ihnen. Machen Sie sich bereit. An dem Abend hatte Groves alle Lampen ausgemacht, die Haustür offen gelassen und im Wohnzimmer gewartet. Die ganze Nacht war er aufgeblieben, darauf gefasst, dass etwas passierte. Natürlich geschah nichts – was ihm eigentlich auch klar gewesen war. Trotzdem hatte er gewartet. Bekäme er heute dieselbe Nachricht, würde er sicher wieder wachbleiben.
Er las die Karte, die er in der Hand hielt, noch einmal.
Ich weiß, wer es war.
Der Kaffee war bitter und stark. Er steckte die Karte in den Umschlag zurück und ließ sie in einer Küchenschublade verschwinden. Später würde er sie oben zu all den anderen legen. Im Augenblick aber reichte es, wenn sie einfach nur weg war, damit Caroline sie nicht sah, wenn sie später vorbeikam. Sie waren geschieden, verbrachten Jamies Geburtstag aber immer gemeinsam.
Er stellte die Tasse ab und begann, seine Sachen zusammenzusuchen und sich für die Arbeit fertigzumachen.
Dennoch ging ihm die Nachricht nicht aus dem Kopf. Auch wenn es dieses Jahr nur eine war, sie hatte eine alte Wunde aufgerissen. Dass sie an Jamie gerichtet war, war neu. Statt ihm den Mord an seinem Sohn unter die Nase zu reiben, ohne dass er etwas unternehmen konnte, wurde ihm mit dieser Nachricht ein Hinweis auf die Mörder geliefert. Ich weiß, wer es war, hatte der Absender geschrieben. Aber ich sage es nicht. Als wüssten sie, dass es Tage gab, an denen der Gedanke daran, die Täter zu fassen, das Einzige war, was ihn dazu brachte, morgens aufzustehen und sich den Herausforderungen des Tages zu stellen. Auch so konnte man jemanden treffen, der schon am Boden lag. Und Groves spürte, dass der Schlag gesessen hatte.
Volltreffer.
Er zog sich die Trainingsjacke an und malte sich nicht zum ersten Mal aus, was er tun würde, wenn er den Mördern seines Sohnes gegenüberstand. Ungezählte Male hatte er das Szenario schon durchgespielt. Jedes Atom seines Körpers gierte danach, ihnen mindestens so schwer zuzusetzen, wie sie es mit Jamie gemacht haben mussten, und ihnen dann eine Kugel in den Kopf zu jagen.
Dabei wusste er, was wirklich geschehen würde. Statt auch nur einen Bruchteil seiner Phantasien in die Tat umzusetzen, würde er sie einfach nur verhaften.
Im Gegensatz zu seiner Ex-Frau hatte Groves sich den Glauben an Gott bewahrt, nachdem Jamie entführt und umgebracht worden war.
Er hatte sich sogar noch tiefer in seinen Glauben gestürzt, auch wenn es jetzt anders war, ungefähr wie in einer Ehe nach einer überstandenen Affäre. Daran hielt er sich fest. Er musste glauben, dass Gott einen Plan hatte und der Tod seines Sohnes, so grausam er war, ein Teil dessen war. Es stand ihm nicht zu, die Strafe zu verhängen, die Jamies Mörder in ihrem nächsten Leben erwartete.
Er konnte schlicht und einfach nur das Recht anwenden, das in diesem Leben galt. Anders zu handeln wäre ihm vorgekommen wie ein Verrat an Jamie – an der Unschuld und Güte seines kleinen Jungen. Als würde er dadurch nicht nur die Erinnerung an seinen Sohn, sondern auch seine eigene Seele beschmutzen. Nach all dem, was diese Menschen schon getan hatten, war Groves fest entschlossen, das nicht auch noch zuzulassen.
Das war auch der Grund, weshalb er heute, an diesem besonderen Datum, zur Arbeit ging. Früher war er Ehemann gewesen, Vater, ein Mann des Glaubens und Polizist; geblieben waren ihm nur noch sein Glaube und sein Beruf. Aber diese waren tief in ihm verwurzelt. Er war ein guter Mensch. Er handelte richtig. Das und nur das machte ihn jetzt noch aus.
Alles Gute zum Geburtstag, Jamie, dachte Groves, als er aus dem Haus ging, die Tür hinter sich abschloss und einen Moment nicht an die Karte dachte.
Ich würde dich so gern umarmen.
Ich vermisse dich so sehr.
Der erste Einsatz des Tages.
Die Carnegie Avenue führte am Rand der Larkton-Siedlung vorbei. Die meisten Gebäude präsentierten sich als kaum unterscheidbare, graue Betonblöcke, zwischen denen das abgebrannte Haus wie ein abgebrochener Zahn hervorstach. Das Feuer hatte ihm so heftig zugesetzt, dass es zur Hälfte in sich zusammengesunken war. Von den Flammen verkohlt und vom Löschwasser durchweicht, lagen die Überreste schwelend in der Morgensonne.
Zwei Löschwagen der Feuerwehr standen mit ausgeschalteten Lichtern davor, und auf der Straße drängten sich die Anwohner, die am Morgen gleich herbeigeeilt waren, um alles aus der Nähe zu begaffen. Sie standen in Grüppchen zusammen, um zu tratschen und Verschwörungstheorien auszutauschen, oder starrten einfach nur kopfschüttelnd und fassungslos auf die Ruine des Nachbarhauses.
»Macht doch Platz, verdammtes Pack!«
Sean Robertson, Groves’ Partner, steuerte den Wagen langsam hinter den ersten Löschwagen und drängte eine Gruppe Halbwüchsiger auf den Bürgersteig zurück, die mit einem überheblichen Grinsen im Gesicht bedächtig Platz machten. Groves saß auf dem Beifahrersitz und erwartete, dass sein Partner hupen würde. Stattdessen grinste Sean die Typen durch die Windschutzscheibe nur höhnisch nickend an.
»Diese Bengel«, sagte Groves. »So sind sie eben.«
»Nicht ein Funken Respekt.« Sean zog die Handbremse an. »Wie heißt es doch gleich? Nicht der Hund ist schlecht, sondern sein Besitzer. Man sollte sich die Eltern kaufen. Nicht mal die Hälfte dieser Rabauken kennt den Vater.«
Groves lächelte. Eine halbe Ewigkeit arbeiteten sie schon zusammen und hatten sich über die Jahre bestimmte Rollen und Verhaltensmuster zugelegt. Seans Part bestand darin, lauthals seiner Verärgerung über den Verfall der Sitten Luft zu machen. Es war nur eine Pose. Tatsächlich hätte er diesen jungen Leuten zu gern nicht nur sein Ohr geliehen, sondern ihnen auch noch seine Zeit geschenkt, wenn sie das gebraucht oder gewollt hätten. Jedenfalls solange niemand es mitbekam. Sean erinnerte Groves immer an das Gedicht von Charles Bukowski über den knallharten Schriftsteller mit dem zarten kleinen blauen Vogel, den er immer erst dann hervorholte, wenn niemand in der Nähe war.
Sie stiegen aus und gingen zum Tatort. Je näher sie kamen, umso stärker stieg Groves der Gestank der verkohlten und durchnässten Überreste in die Nase. Die Fensterscheiben waren von der Hitze zerborsten, und die Steinwände hatten die Farbe einer halbverbrannten Zeitung angenommen. An einer Ecke war das Dach eingebrochen. Das Haus musste lichterloh in Flammen gestanden haben, bevor die Feuerwehr kam. Noch immer flimmerte von der Resthitze die Luft über dem Haus.
»Robertson und Groves.« Sean hielt einem Feuerwehrmann seinen Ausweis hin. Sie waren Partner – beide hatten denselben Dienstgrad –, aber heute hatte Sean die Führung übernommen. Mit keinem Wort hatte er Jamie erwähnt und würde es auch nicht tun, obwohl er das Datum kannte. Es war seine Art, Groves beizustehen. »Wo ist der Einsatzleiter?«
»Da hinten.«
Der Einsatzleiter war ein älterer Typ mit kleinen wässrigen Augen und einem riesigen, ergrauten Schnauzbart, der unter dem Visier des Helms vorlugte und, während der Mann sie ins Bild setzte, sich hin und her bewegte, als würde jedes Wort sorgfältig durchgekaut. Als Polizist zu einem Brandort zu kommen, fand Groves immer seltsam. Normalerweise hatte er die Fäden in der Hand. Hier aber spielten sie nur die zweite Geige und durften das Anwesen erst betreten, wenn der Kommandant seine Zustimmung gab. Ihre Anwesenheit war reine Formsache – für den Fall, dass sich zu einem späteren Zeitpunkt noch etwas Verdächtiges ergeben sollte. Das kam bei Hausbränden selten vor. Aber wegen der Leiche, die drinnen gefunden worden war, mussten sie sich blicken lassen, falls sich im Zuge der Ermittlungen ausnahmsweise herausstellen sollte, dass mehr dahintersteckte.
»Rauf können Sie nicht«, sagte der Einsatzleiter. »Ich will kein Spielverderber sein, doch es geht einfach nicht. Es gibt keine Treppe mehr. Aber durch die Reste der Haustür da drüben kommen Sie ins Wohnzimmer.«
»Und der Bewohner ist da drin?«, fragte Sean.
»Wenn er zwischendurch nicht umgezogen ist, ja. Aber das wage ich zu bezweifeln. Der Gerichtsmediziner ist schon unterwegs.«
Groves’ Blick wanderte wieder zu dem Haus.
»Was für ein Inferno«, sagte er. »Was halten Sie von der Sache?«
Der Einsatzleiter zuckte nur mit den Schultern. »Wird noch untersucht. Danach seid ihr dran. Abgesehen von all den Flaschen wurden keine verdächtigen Behälter gefunden. Wenn Sie wissen wollen, was ich glaube, dann werfen Sie mal einen Blick auf den verkohlten Aschenbecher neben dem Sofa.«
»Zigarette?«
»Davon gehe ich aus. Der Kerl ist betrunken, wird müde und schläft mit der Zigarette zwischen den Lippen ein. Kennt man doch.«
Groves nickte. Die meisten Häuser in der Siedlung waren alte Sozialwohnungen, billig an Leute verscherbelt, die sie dann weitervermieteten. Die Einrichtung war alt und marode, die Elektroinstallation von zweifelhafter Qualität. Der Himmel wusste, welche Überraschungen sich in den Hohlräumen der Wände verbargen. Die meisten wären schon vor zwanzig Jahren durch die Sicherheitsprüfung gefallen. Wenn die Zigarette die Brandursache war, dann wäre auf jeden Fall eine kriminaltechnische Untersuchung fällig, mit der sie allerdings nichts zu tun hätten. Sie waren nur wegen des Mannes hergekommen, der hier gewohnt hatte.
»Können wir?«, fragte er, an Sean gewandt.
»Okay.«