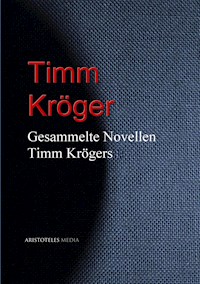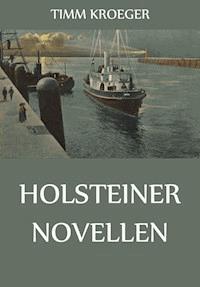
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Timm Kröger war ein deutscher Rechtsanwalt und Schriftsteller. Er verfasste zahlreiche Novellen und Geschichten, die das Bauern- und Landleben schildern. In diesem umfangreichen Band finden sich die Geschichten: Klaus Groth Dreschermelodien Auf der Heide Im Moor Die Roßtrappe von Neudorf Die Justiz auf Irrwegen Er soll dein Herr sein! Ein Butenmensch Mit dem Hammer Im Knickweg Anna und Elsa und deren Kinder Kaspar Wie Jörn Hölk den Teufel zitierte Eine Geschichte, die man nicht zu glauben braucht Wenn einer abstehende Ohren hat An der Pforte des Glücks Ein Wanderlied Hein Wieck, eine Stall- und Scheunengeschichte Die alte Truhe Ein geistlich Armer Hans Nottelbohm, seines Hasses Anfang und Ende Wieb Muthen Woher? Das Gartenmesser Sokrates Tod Warum noch? Ein Prophet im Vaterlande Napoleon Sturm und Stille Und erlöse uns... Ein Abschied Erhaltung der Kraft Daniel Dark, aus einem Jugendland Wohin? Dem unbekannten Gott! Wie mein Ohm Minister wurde Der Pfahl - Des Ohms letzte Geschichte Gräff (Trauermahlzeit) Im Nebel Ein schlechter Mensch Das vornehmere Gebot Hans Stäwelmann, ein Geheimer Ein Unbedingter Um den Wegzoll Der Einzige und seine Liebe Der Schulmeister von Handewitt Des Reiches Kommen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1997
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Holsteiner Novellen
Timm Kröger
Inhalt:
Timm Kröger – Biografie und Bibliografie
Persönliches
Zur Gesamtausgabe
Plattdeutsch oder Hochdeutsch, wie lasse ich meine Bauern reden?
Klaus Groth
Dreschermelodien
Auf der Heide
Im Moor
Die Roßtrappe von Neudorf
Die Justiz auf Irrwegen
Er soll dein Herr sein!
Ein Butenmensch
Mit dem Hammer
Im Knickweg
Anna und Elsa und deren Kinder
Kaspar
Wie Jörn Hölk den Teufel zitierte
Eine Geschichte, die man nicht zu glauben braucht
Wenn einer abstehende Ohren hat
An der Pforte des Glücks
Ein Wanderlied
Hein Wieck, eine Stall- und Scheunengeschichte
Die alte Truhe
Ein geistlich Armer
Hans Nottelbohm, seines Hasses Anfang und Ende
Wieb Muthen
Woher?
Das Gartenmesser
Sokrates Tod
Warum noch?
Ein Prophet im Vaterlande
Napoleon
Sturm und Stille
Und erlöse uns...
Ein Abschied
Erhaltung der Kraft
Daniel Dark, aus einem Jugendland
Wohin?
Dem unbekannten Gott!
Wie mein Ohm Minister wurde
Der Pfahl - Des Ohms letzte Geschichte
Gräff (Trauermahlzeit)
Im Nebel
Ein schlechter Mensch
Das vornehmere Gebot
Hans Stäwelmann, ein Geheimer
Ein Unbedingter
Um den Wegzoll
Der Einzige und seine Liebe
Der Schulmeister von Handewitt
Des Reiches Kommen
Holsteiner Novellen, T. Kroeger
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849629953
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Timm Kröger – Biografie und Bibliografie
Deutscher Schriftsteller und Rechtsanwalt, geboren am 29. Nov. 1844 in Haale (Holstein), verstorben am 29. März 1918 in Kiel. Sohn eines Landwirts. Begann mit 21 Jahren ohne Abitur in Leipzig, Zürich und Berlin Jura zu studieren. Nach Tätigkeiten als Assessor und Kreisrichter begann er als Rechtsanwalt und Notar in Flensburg zu arbeiten. Ab 1888 begann K. zu schreiben, ab 1891 erschienen seine ersten Werke. 1892 zieht er nach Kiel um, wo es bis 1903 dauerte ehe er seinen Beruf zugunsten der Schriftstellerei aufgab.
Wichtige Werke:
Eine stille Welt, 1899Hein Wieck und andere Geschichten,1899Schuld?, 1898Der Einzige und seine Liebe, 1905Hein Wieck, 1906Um den Wegzoll, 1906Mit dem Hammer, 1906Der Schulmeister von Handewitt, 1906Das Buch der Guten Leute, 1908Wohnung des Glücks, 1908Aus alter Truhe, 1908Des Reiches Kommen, 1909Heimkehr, 1910Holsteiner Novellen
Persönliches
Zur Gesamtausgabe
Sparrenwerk alter Bauernhäuser ... Wenn ein Winddruck auf dem Rethdach liegt, beginnt ein Wiegen und Rauschen, man kann, vorausgesetzt, daß einem die alten Kasten lieb sind, ihre Sprache deuten. »Ein Jahrhundert«, so raunt es, »dauert unser Leben, wenn es hoch kommt, etwas mehr. Und dann ist das Ende da, aber davon ist nicht zu reden ... der Welt Lauf. – Nur ein paar eichene Balken, doppelt zäh und stark vor Alter, Ruß und Rauch, wird man, so hoffen wir, für gut genug gehalten, dem einzufügen, was über unserer Herdstätte neu entsteht.«
Ich stehe vor einem Lebensabschnitt, worin die uns zugemessenen Jahre beschlossen zu sein pflegen. Wind und Wetter liegen zuweilen schwer auf dem Dach, ich philosophiere daher wie ein altes Bauernhaus, hoffe auf ein paar Bretter und Balken und – sammle. Ich schrieb keine Dramen, keine großen, ein Weltbild vorstellen sollenden Romane, und veröffentlichte kaum Gedichte. Indem ich mich von nichts anderem als von dem leiten ließ, was mich seelisch trieb, wurde ich das, was man vielleicht einen Spezialisten der Heimatnovelle nennen darf.
Ich heiße, was ich geschaffen habe, › Novelle‹, wohl wissend, daß der Name anfechtbar ist. Wäre es mir an erster Stelle um Genauigkeit zu tun, so müßte ich vielleicht sagen: ›Novellen, Skizzen und Erzählungen‹ – oder, da die Begriffe ›Novelle‹ und ›Skizze‹ verwaschene Formen angenommen haben, schlichtweg ›Erzählungen‹ oder › Geschichten‹. Ich habe aber davon abgesehen, weil ich nun mal mit der aufgeklebten Marke › Novellist‹ bekannt geworden bin. Auch würde es doch wohl nicht so recht stimmen, denn das, was ich bringe, will ebensosehr wegen seiner Form und in dem Wie der lyrischen Verzierungen gewürdigt sein, wie in dem Was des Geschehens.
Aber ich gebe zu, daß der Name anfechtbar erscheinen kann, möchte diesem Zugeständnis jedoch ein Fragezeichen, eine Einschränkung, hinzufügen. Denn das, was man früher etwa nach den Erklärungen von Goethe und Paul Heyse unter ›Novelle‹ verstand, versteht die moderne Dichtung doch wohl nicht mehr darunter. Früher war bei epischen Dichtungen die Darstellung der Erscheinungen außerhalb der Helden (äußerer Raum) die Hauptsache, neuerdings ist die Wiedergabe des Innenlebens (innerer Raum), sind die psychologischen Vorgänge ebenso wichtig geworden, wenn nicht noch wichtiger, und möglicherweise entsprechen meine ›Novellen‹ einigermaßen dieser modernen Anforderung. Daher bleibe ich, den Kometenschweif ›Novellen, Skizzen und Erzählungen‹ vorweg ablehnend, bei der Bezeichnung ›Novellen.‹
Der Versuchung, die bessernde Hand anzulegen, habe ich im allgemeinen widerstanden, in der Regel beschränkte ich mich darauf, gewisse Zwischenzeichen zu entfernen, womit ich früher dem Vortrag und dem Verständnis meiner Leser goldene Brücken habe bauen wollen. Denn nun ist das Vertrauen zu meiner Gemeinde in ebendemselben Maße gewachsen, wie meine Vorliebe für Gedankenstriche und Punkte gemindert.
Ganz habe ich aber meiner Absicht nicht treu bleiben können. »Sturm und Stille« (in Band 2) mußte durch eine räumlich unerhebliche Einschaltung eine bessere Motivierung der Handlung erhalten, »Der Einzige und seine Liebe« (in Band 5) bedurfte der bessernden oder vielmehr der umarbeitenden Hand, ein Teil des Schlußkapitels in »Um den Wegzoll« (im selben Band) konnte in der alten Form nicht weiter passieren, und endlich war im »Schulmeister von Handewitt« (ebenfalls in Band 5) zu versuchen, die Darstellung einer Szene flüssiger zu gestalten.
Ohne Absicht und Vorsatz mich treiben lassend, wohin der Strom meiner Sehnsucht wollte, bin ich Heimatdichter geworden. Den zumal früher über die Heimatdichtung ausgegossenen Spott habe ich leicht ertragen. Ich konnte es, ich befand mich in guter Gesellschaft: Klaus Groth, Theodor Storm, Johann Hinrich Fehrs, Fritz Reuter, Jeremias Gotthelf, Gottfried Keller und Wilhelm Raabe können als Heimatdichter angesprochen werden; Peter Rosegger rechne ich auch dazu, von vielen anderen zu geschweigen. Heimatkunst ist überhaupt eine alte Kunst, nichts Neues. Sie kann auch nicht aussterben, es müßte denn zuvor jede Sehnsucht nach, es müßten alle Erinnerungen an Heimat und Jugend und Kindheit in uns ausgetilgt worden sein.
Früher lehrte man, daß echte Kunst keinen außerhalb ihrer selbst liegenden Zweck zu tragen vermöge, und ich denke, daß der Satz noch immer Gültigkeit hat. Der Künstler will Genuß bereiten, das heißt edlen künstlerischen Genuß, und nichts als das. Dieser Genuß kann und wird freilich in dem Kreis der Empfangenden eine Veredelung der Gesinnung und möglicherweise in weiterer Folge auch ihrer Taten zur Folge haben; von der Zweckbestimmung des Künstlers wird das aber nicht mehr umschlossen. Alles das gilt zumal für den Dichter. Er schreitet wie ein Gott durch die Lande. Öfters verwandelt sich ein Wort seines Mundes in Gold, die reich zu machen, welche zu suchen und zu finden wissen; er selbst aber weiß nichts davon, will nichts davon wissen. Unbekümmert zieht er seine Straßen den tönenden Wettgesängen seiner Sonnen entgegen.
Die Poesie verträgt keinen außerhalb ihrer selbst liegenden Zweck. Hiergegen verstoßen die Heimatdichter, die ihre Schöpfungen wie Traktätchen behandeln, als Prediger der Heimatliebe auftreten, um ausgesprochenerweise Andere zu derselben Gesinnung zu bekehren. Insofern dieser Fehler von Einzelnen nicht vermieden sein sollte und der Tadel unserer Gegner sich hiergegen richtet, halte ich ihn für berechtigt.
Als wesentliches Merkmal der Heimatdichtung oder Heimatkunst erkenne ich ihre Gebundenheit an einen Ort oder an eine bestimmte Landschaft mit Unterstreichung der in dieser Umwelt hervortretenden Eigenart bei Menschen sowohl wie bei der Natur. Im übrigen wird das ganze Gebiet dichterischer Darstellung von ihr so gut wie von anderer Dichtkunst ausgenutzt. Ein echter Heimatdichter wird seine Gestalten mit klarer Hervorhebung scharfer Charakterköpfe nicht weniger ins Typische und Allgemeinmenschliche hinaufheben wie ein Romanschreiber, der sich vorgesetzt hat, eine Welt an uns vorüberrollen zu lassen; und mit demselben Recht wie jeder andere Dichter klopft auch der Heimatdichter mit allen unlösbaren Fragen der Warum und Wie und Wohin an die Tore des Ewigen. Nur in einem Punkte legen die meisten sich Beschränkung auf: sie lehnen es ab, in den Stürmen der Zeit die Rolle von Kämpfern zu übernehmen.
Und hier läuft, wie mir scheint, der Strich, der uns von den Ganzmodernen scheidet, die just hierin, im Fanfarenton neuer Bestrebungen, die Aufgabe der Dichtkunst erblicken. Die Heimatkunst verächtlich über die Achsel ansehend, geben sie ihr das Merkmal der Philisterenge und spotten über die Poesie des Glücks im Winkel. Nach unserm Dafürhalten durchaus mit Unrecht. Sie nehmen an, die Ideen ihrer Zeitdichtungen seien für uns zu groß, und ahnen nicht, daß sie uns zu klein erscheinen.
Ich möchte nicht mißverstanden werden und füge deshalb hinzu, daß selbstverständlich auch ein noch unausgegorenes Parteiverlangen Gegenstand künstlerischer Darstellung sein kann, wenn es dem Dichter gelingt, die Unruhe der Zeit in einer darüber schwebenden künstlerischen Ruhe aufzulösen; freilich ein absolut ewig Gültiges wird sich in solcher Dichtung auch im günstigsten Fall kaum ausdrücken lassen. Alles, was Altmeister Goethe derzeit über das politische Gedicht gesagt hat, gilt auch hier, wir dürfen in dem nachfolgenden Zitat dreist für ›politisches Gedicht‹ ›Zeitdichtung‹ setzen und es für unsere Ansicht in Anspruch nehmen. »Ein politisches Gedicht«, sagt er, »ist überhaupt im glücklichsten Fall immer nur als Organ einer einzelnen Nation und in den meisten Fällen als Organ einer gewissen Partei zu betrachten.« Und weiter: »Auch ein politisches Gedicht ist immer nur als Produkt eines gewissen Zeitzustandes anzusehen, der aber vorübergeht und dem Gedicht für die Folge denjenigen Wert nimmt, den es vom Gegenstand hat.«
Wir lehnen also ab, Partei zu nehmen, dabei wohl wissend, daß alle Bestrebungen in letztem Grunde einen berechtigten Kern haben, sowohl die auf Neuerung bedachten wie die auf tunlichste Erhaltung des Bestehenden gerichteten. Und wenn es gelänge – jedem Versuch in diesem Sinne bezeugen wir unsere aufrichtige Hochachtung – wenn es gelänge, die Einheit aller zur Darstellung zu bringen, wir würden darin den Gipfel der Gegenwartskunst erblicken. Leider zeigt sich jetzt noch kein befriedigendes Bild. Wir möchten es ungeheuren Bruchstellen vergleichen, die einem Schüler auf die Tafel geschrieben sind, damit er den Generalnenner finde. Er kann ihn nicht finden, die Berechnung wächst in ein Unermeßliches von Ziffern und Zahlen. Da erscheinen Rechenmeister eben so viele wie Bruchstellen, und jeder erklärt eine Grundzahl der aufgegebenen Brüche für den Generalnenner, in dem jede Größe aufgehe, jeder Rechenmeister aber einen anderen. Bei diesem Kriege aller gegen alle tun wir nicht mit, da steigen wir lieber mit Faust hinab zu den Müttern, als den Hütern der ewigen unvergänglichen Ideen, oder fliegen hinauf zu Ihm, der am großen Webstuhl des Alls sitzt und seine Weberschiffchen schießen läßt.
Noch eine Frage möchten wir streifen: Wer verbirgt sich in dem Ich einer Icherzählung, insbesondere meiner in erster Person gegebenen Novellen?
Wer aus einem Leid ein Lied, will sagen eine Dichtung, macht, kann das in erster Person tun, kann seine Bekenntnisse aber auch einer dritten Person beilegen, denn an sich ist es gleichgültig, ob man sich in erster oder in dritter Person einführt, wie denn auch umgekehrt eine Icherzählung mit einem Bekenntnis oder auch nur mit einem Erleben des Verfassers gar nichts zu tun zu haben braucht. Zuzugeben aber ist, daß für sogenannte Konfessionen die Ichform die frischeste und natürlichste, weil ungebrochene, und für alle Erzählungen, worin seelische Vorgänge einen breiten Raum einnehmen, am besten geeignet ist. Sie hat zugleich den Vorzug, daß sie die Wissensquelle des Dichters beständig vorzeigt, was nach den geheimnisvollen Gesetzen des künstlerischen Genießens hier und da notwendig ist. Sie gibt für den Verlauf der Handlung einen festen Leiter, da der Verfasser nichts erzählen kann, was er nicht angeblich selbst erlebt hat oder ihm sonst zur Kunde gekommen ist.
Das sind Binsenwahrheiten, ich werfe sie leicht hin, um hinsichtlich meiner eigenen Geschichten zu der Bitte zu gelangen, nicht zu vergessen, daß ich dichte und keine Denkwürdigkeiten schreibe, daß der Rückschluß auf das zugrunde liegende Tatsächliche mit Vorsicht zu machen ist, zu welcher Bitte ich nach gelegentlichen Bemerkungen meiner verehrten Rezensenten Veranlassung zu haben glaube. In erster Linie berichte ich jedenfalls rein künstlerisches Erleben.
Das gilt auch von dem, was ich von Fritz Twisselmann erzähle, den man gewöhnlich für mein pures Alter Ego hält. Ich sage freilich in »Heimkehr«: »Der Fritz Twisselmann bin ich selbst«, habe aber dadurch keine vollständige Personeneinheit mit mir selbst herstellen wollen. An sich sollte er nur als das »Ich« in den Erzählungen des Bandes vorgestellt sein, das nach obigen Bemerkungen nicht der Verfasser zu sein braucht, wenn auch die Annahme einer seelischen Zwillingsbruderschaft mit ihm berechtigt und begründet ist.
In meiner Sammlung beschränke ich mich auf Novellen, kaum noch im Zweifel darüber, daß darin alles beschlossen ist, was bislang von mir aufbewahrungswert erscheint. In den ersten fünf Bänden wird man in neuer Anordnung und in neuer Aufmachung das finden, was die bisher erschienenen zwölf Bändchen umfaßten, dazu neun neue, bisher nicht in Buchform veröffentlichte Stücke. Nachfolgen werden im sechsten Band zwei umfangreichere neue Novellen: »Daniel Dark« und »Dem unbekannten Gott«.
Ich hätte meine Dichtungen gern in chronologischer Folge ihres Entstehens gebracht, es ist das auch nicht ganz außer acht gelassen worden. Es durchzuführen war bei meiner Arbeitsweise, wo die Nach- und Umarbeitungen sich öfters durch Jahre erstrecken, nicht möglich. Ich will aber versuchen, in Vorbemerkungen zu den einzelnen Bänden die Zeit anzudeuten, wohin ich die Entstehung verlegen zu müssen glaube. Das soll freilich nur einen ganz allgemeinen Erinnerungswert bedeuten, da ich, wenigstens jetzt, verhindert bin, mir die zur Ermittelung der richtigen Zeit erforderliche Mühe aufzulegen.
Leichter als nach der Zeit schien mir eine Ordnung nach dem Ideeninhalt, und ich glaube gerade dadurch das beste Hilfsmittel demjenigen an die Hand zu geben, der sich etwa für meine Entwicklung interessiert. Die den einzelnen Bänden gegebenen, beziehentlich ihnen belassenen Titel mögen dabei ein Hilfsmittel sein.
Wie soll ich meine Bauern reden lassen, plattdeutsch oder hochdeutsch?
Hierüber schickte ich derzeit meiner Novelle »Des Reiches Kommen« einige Bemerkungen voran. Ich lasse sie auch jetzt wegen ihrer grundlegenden Bedeutung folgen.
Folgen lasse ich auch meinen Aufsatz »Klaus Groth, ein Gedenkblatt«. Er mag als eine Art Widmung an die Manen des großen plattdeutschen Lyrikers hingenommen werden.
Endlich – Abtragung einer alten Schuld. Mein Freund, der Schriftsteller Jacob Bödewadt, hat bei dem Werk alle Mühen der Herausgeberschaft übernommen. Das sei ihm an dieser Stelle von Herzen gedankt.
Kiel, im Oktober 1913
Timm Kröger
Plattdeutsch oder Hochdeutsch, wie lasse ich meine Bauern reden?
Wie lasse ich meine Helden reden, wenn ich, hochdeutsch schreibend, aus einer Welt erzähle, in der man plattdeutsch spricht, zumal die eingeführten Personen plattdeutsch sprechen?
Der Wunsch und die Aufgabe treuer Wirklichkeitswiedergabe drängt darauf hin, die Leute im Buch so reden zu lassen, wie sie im Leben tun, also – plattdeutsch.
Plattdeutsch reden zu lassen. Meinetwegen auch schlesisch und schwäbisch, wenn das Stück in Schlesien oder in Schwaben spielt. Das Plattdeutsche nenne ich, weil die Not des Plattdeutschen mir am nächsten liegt. Mir, dem niederdeutschen Bauerngeschichtenschreiber, brennt das Plattdeutsch meiner Gestalten auf den Fingernägeln.
Wie soll ich es machen? Soll ich meine Bauern plattdeutsch reden lassen?
Wäre es des Erzählers vornehmste Aufgabe, mit allen Mitteln der literarischen Photographie und Phonetik möglichst getreue Bilder eines innerlich gesehenen Vorgangs zu schaffen, dann wäre die Sache nicht fraglich. Dann müßten Erzählungen wie die, die ich im Auge habe, in zwei Sprachen geschrieben werden: der Dialog plattdeutsch, die Umrahmung, das Verbindende hochdeutsch.
Das ist auch die Weise vieler, vielleicht der meisten Erzähler. Daß der einheitliche Eindruck ihrer Schöpfungen dadurch beeinträchtigt wird, daß diese bunt und gesprenkelt erscheinen, übersehen sie ja sicherlich nicht, setzen sich aber darüber hinweg. Das Gebot des Realismus steht ihnen höher als das Gesetz der Einheitlichkeit. Auch das können sie nicht verkennen, daß ein Teil der Leser, an die sie sich wenden, sprachliche Schwierigkeiten zu überwinden hat, sich den in der Mundart geschriebenen Teil anzueignen, und daß die Feinheiten des Plattdeutschen von vielen nicht verstanden werden. Auch der Schaden muß durch die überzeugendere Realistik, die man vermeintlich erreicht, gedeckt werden.
Hie Realismus, hie Einheitlichkeit: restlos geht die Gleichung nicht auf – ein Abfinden bleibt. Und dabei handelt es sich um Gründe und Gegengründe, die im Boden des Geschmacks wurzeln, mithin dem Unwägbaren und Unmeßbaren angehören. Ich habe also, wie jeder, das Recht der eigenen Meinung. Und meine Meinung hat sich nach langem Schwanken dahin befestigt, daß ich die im Leben plattdeutsch sprechenden Bauern im Buch hochdeutsch reden lasse.
Zunächst stelle ich mich auf den Standpunkt des Lesers und frage ihn: Was ist dein Recht, was möchtest du am liebsten?
Und da finde ich: Der Leser hat das Recht, Genuß zu verlangen, selbstverständlich einen künstlerischen Genuß, aber doch immerhin eine Freude und zwar, soweit es möglich ist, eine durch keine Mühe beeinträchtigte. In gewissem Sinne hat das Aufschreiben einer erdichteten Geschichte doch nur den Zweck und keinen anderen als den, dem Leser diesen Genuß zu verschaffen. Versteht man die Mundart leicht, dann bleibt immer noch das Bedenken, daß man im Gehirn Umschaltungen vornehmen muß, um bald Hochdeutsches, bald Plattdeutsches entgegenzunehmen. Selten ist aber alles so gut bestellt, selten hat ein Leser beim Plattdeutschen einen verhältnismäßig mühelosen, also ebenso selten einen ganz reinen Genuß. Und das Gesprenkelte der Darstellung ist unter allen Umständen in Abzug zu bringen.
Man schelte diese Betrachtung nicht kleinlich. Der Leser soll die Ruhe und das Behagen haben, das ein wirkliches Kunstwerk gibt und nur dies geben kann. Ein wirkliches Kunstwerk hat aber etwas von Schmetterlingsflügeln an sich, denen der Duft abstäubt, wenn man sie greift. In diesem Fall: wenn der Leser sich an eine Wendung, an eine dem Verständnis und dem Gefallen nicht ganz eingehende Stelle stößt, dann ist die Blüte des Gefallens zerstoben.
Und noch ein Grundbedenken gegen die unverbrüchliche Treue der Wirklichkeitswiedergabe:
Ich bin Realist oder bemühe mich doch, es zu sein, ein Fanatiker dieser Richtung bin ich aber nicht. Muß denn alles durch Platte und Phonograph festgehalten werden? Gewinnt nicht manche Äußerung in einem zwar unwirklicheren, aber dafür dem Leser vertrauteren Gewand? Wenn ich literarische Kunst genieße, so soll meine Illusion kein Vergessen sein. Im Gegenteil, ich will mir bewußt bleiben, daß ich nicht die Dinge selbst sehe, sondern ihre Abbilder erblicke, wie sie sich in der Vision des Dichters darstellen. Was mir erzählt wird, will ich durch den wellentreibenden Duft, der an hellen Sommertagen über die Felder zieht, wahrnehmen. Ein zartes Blau der Ferne soll für und für Dinge und Personen umweben.
Wo der Dichter Tatsachen erzählt, hat er manche Mittel, diese Wirkung hervorzubringen, wo er Gespräche mitteilt, fördert die Übertragung ins Hochdeutsche sie in vielen Fällen. Vor allen Dingen das »Wie« der hochdeutschen Wiedergabe. Ich bin der Ansicht, plattdeutsche Helden sollen zwar hochdeutsch sprechen, sie sollen es aber in einer Weise tun, daß der Leser den plattdeutschen Grundton heraushört. Die Worte müssen danach gewählt sein, der Aufbau der Sätze muß plattdeutsch sein, die Gedanken und ihre Verbindungen auch. Ein Leser, der plattdeutsch versteht, muß sich in den Irrtum einlullen können, daß er Plattdeutsches höre oder lese. Und je vollständiger dies dem Dichter gelingt, desto mehr wird er auch der Kunst gerecht, den poetischen Sommerduft um seine Gestalten zu spinnen.
Bekanntlich sind die von den Evangelisten mitgeteilten Reden unsers Religionsstifters nicht in der uns überlieferten griechischen Sprachform, sondern, soweit sie überhaupt echt sind, in aramäischer Mundart gesprochen worden. Der Theologe Harnack braucht einmal das Bild, die griechische Sprache ruhe wie ein Schleier darüber, das Aramäische schimmere überall durch. Und das ist das, was ich für die hochdeutschen Äußerungen der plattdeutschen Bauern erreicht sehen möchte.
Wie soll der Dichter das machen?
Selbstverständlich muß er sich erst in plattdeutscher Sprache von seinen Figuren das sagen lassen, was sie vorzutragen haben. Das muß er festhalten und dann Wort für Wort recht getreu mit plattdeutschen Wendungen (sind sie im Hochdeutschen mit dem Anhauch von Unschuld ungebräuchlich und fehlerhaft: um so besser!) übertragen. Bei längeren Auseinandersetzungen leistet die indirekte Redeweise vortreffliche Dienste. Da läßt sich noch mehr als bei direkter Wiedergabe der Unterton schaffen, aus dem man den Plattdeutschen heraushört.
Der Leser soll herausfühlen, daß er Plattdeutsche vor sich hat. Zweckmäßig ist es, ihn hieran dann und wann durch kurzen Trommelschlag zu erinnern.
Meine Trommelschläge sind – plattdeutsch wiedergegebene Bemerkungen der Bauern, grob und kahl, ohne ersichtlichen Grund, in den hochdeutschen Text hineingestellt ... und zwar auf Kosten des für ein paar Sekunden in die Brüche gehenden Gesetzes der Einheit. ... Wenn der Verfasser Takt hat, dann wird er wissen, wann und wie oft er es tun darf.
Zu lang dürfen die Einschiebsel nicht sein. Der Leser soll darüber hinwegkommen wie ein Waghals, der über Eisschollen springt. Eigentlich ist sein Gewicht zu schwer für die Scholle, aber bevor diese dazu kommt zu zerbrechen, schwingt er sich schon über andere. Bevor dem Leser recht zum Bewußtsein kommt, daß der Dichter an dem Gesetz der Einheitlichkeit frevelt, hat er den Fuß schon wieder auf festem, schriftdeutschem Boden.
Zum Schluß ein Vorbehalt, der vielleicht ungesagt bleiben könnte:
Was ich ausgeführt habe, kann sich nur auf Erzählungen beziehen, die nicht wesentlich humoristisch wirken wollen und ein Hauptmittel ihres Humors gerade in der Aufzeichnung der in der Mundart enthaltenen oder doch durch sie schärfer beleuchteten Komik erblicken. Selbstverständlich wird der Verfasser solcher Erzählungen auf die unverfälschte und unübertragene Wiedergabe der Reden nicht verzichten können, und ebensowenig wird der Leser darauf verzichten wollen. In einigen Fällen dieser Art wird es sich freilich empfehlen, die ganze Geschichte in plattdeutscher Sprache vorzutragen.
Klaus Groth
Als ich noch jung war und von einem Lied und Gedicht persönliche seelische Vorteile erwartete: Erlösung von einem mir allein gehörigen Leid, Aufweichung von innerlich Verhärtetem oder auch Wach-machen, Zum-tönen-bringen einer bisher heimlichen, kaum eingestandenen Freude – da ich, mit einem Wort, noch nichts von der Objektivität wußte, die für höchst persönliche Seelennöte kein Gehör hat, da klang mir von allen Quickbornliedern des Altmeisters Klaus Groth keines so schön wie das frohe, im sicheren Besitz der Geliebten aufjubelnde »Min Anna is en Ros' so rot.«
Min Anna is en Ros' so rot, Min Anna is min Blom, Min Anna is en Swölk to Fot, Min Anna is as Melk un Blot, As Appel oppen Bom.
De Vullmach hett en Appelgarn Un Rosen inne Strat; De Vullmach kann sin Rosen wahrn, De Vullmach kann sin Appeln arn: Min Anna is min Staat!
Se is min Staat, se is min Freid Un allens alltomal, Un wenn de Wind de Rosen weiht, Un wenn de Wind de Appeln sleit, Se fallt mi nich hendal.
Se fallt ni af, se fallt ni hin, Se hett son frischen Mot; So blöht min Hart, so blöht min Sinn, Min Anna blift de Blom derin Bet an min seli Dod.
Ich war also noch sehr jung, aber lange dauerte es doch nicht, da begann ich selbst, an dem Mitleid, das ich mir zollte, herumzuzerren. Das Leben kam und half und reutete den größten Teil hinweg. Und als das meiste weggereutet war, da wollte ich die Gedichte des »Quickborn« anders lesen, es gelang mir aber nur halb. Zwar fand ich Edelsteine in dem unvergleichlichen Gedichtbuch, deren Leuchten mein Annalied sogar überstrahlte, aber die Vorliebe für das Annalied sproßte noch immer auf. Ja, ich will ehrlich sein, noch jetzt spüre ich etwas wie Streicheln und Kosen und höre Liebesworte, wenn ich meinen »Quickborn« hernehme und die Blätter bei dem Triumphgesang der Annahymne auseinanderfallen.
Es war im Herbst 1863, da sah ich den Dichter selbst.
Ich war ziemlich unverfälscht vom Lande her nach Kiel gekommen, um mich allmählich in einen Kandidaten der Gelehrsamkeit zu mausern. Im Düsternbrooker Weg begegnete mir und einem mich begleitenden Freunde eines Tags ein hochgewachsener Herr in einem schwarzen Rock. Ich erinnere mich, daß der Mann im besten Mannesalter stand, frische Farben zeigte und weiches, volles Haar hatte, ich meine: dunkles. »Da kommt Klaus Groth, der Dichter vom »Quickborn««, sagte mein Begleiter. Wir zogen unsere Kappen und erhielten dafür Gegengruß und ein freundliches Lächeln.
Seitdem zog ich immer Hut oder Mütze, wenn ich Klaus Groth in den Weg lief. Und immer dachte ich dabei an das Annalied. Und wenn ich an dies Lied dachte, füllte das Weh nach meinem Dorf, nach Acker und Feld und Wald und der Schmerz um noch etwas die weichen Rinnsale meiner Seele.
Ich trug aber immer einen Gewinn von solcher Begegnung heim. Mir war, als liege eine Art Dichterweihe auf meinem Haupt. Groths persönliche Bekanntschaft zu machen, mich ihm zu nähern, der Gedanke kam selbstverständlich gar nicht auf. Gegenteilig – schließlich begann ich meine Berechtigung, vor ihm den Hut zu ziehen anzuzweifeln und schlich nun still vorüber.
Und wieder vergingen Jahre. Das Leben wirbelte mich, trieb mich nach verschiedenen Universitätsstädten und später als Beamten durch die Provinzen des preußischen Staats. Erst im Jahre 1892, als ich mich den Fünfzigern näherte, kam ich zum dauernden Aufenthalt nach des Dichters Wohnsitz, nach Kiel zurück.
Ich war inzwischen selbst Schriftsteller geworden, hatte ein paar Bücher geschrieben, die bei der Kritik Anerkennung gefunden hatten, bei dem Publikum aber unter den Tisch gefallen waren.
Nach dem ersten halben Jahr nahm ich dort Wohnung, wo ich noch jetzt hause, nicht weit vom Klaus-Groth-Platz und von dem bescheidenen, daselbst an der Ausmündung des Schwanenwegs belegenen Landhaus des Dichters. Ihn selbst erblickte ich selten. Am häufigsten geschah es noch, wenn ich vom Hafen her den Schwanenweg herauf ging, an der Dornenhecke des Grothschen Gartens entlang. Die Hecke war so unerzogen, so wild aufgewachsen, daß sie sogar die durch das Lied »Min Port« berühmt gewordene Gartenpforte für den Kommenden so lange verdeckte, bis er auf ihrer Höhe angekommen war.
Eines Tags schrak ich ordentlich zusammen – unmittelbar vor mir lehnte der alte Klaus Groth über seine Pforte und musterte mich mit seinem klaren grauen Auge.
In dieser Stellung traf ich den Altmeister wiederholt, und angesichts seines Auges nahm ich mir wieder die Freiheit, den Hut zu lüften. In meinen Jahren hätte ich Heimweh und ähnliche durch kein greifbares Ding gerechtfertigte Gefühle längst abtun sollen, hätte das sonst auch getan, nun aber, ich konnte mir nicht helfen, wollte wieder was aufkommen. Aber der Posaunenjubelton des Annaliedes brach durch die weinerliche Sehnsucht siegreich hindurch.
Einmal führte mich ein geschäftlicher Gang persönlich zu dem Dichter. Das brachte uns aber nicht näher. Der Dichter war nicht ganz wohl, das, was die Veranlassung meines Besuches gewesen, war in wenigen Minuten erledigt, unnötig durfte ich nicht verweilen. Die Flügelpforten klappten rasch wieder hinter mir zusammen, aus ihrem Ton hörte ich aber eine tröstliche Verheißung heraus.
Aber die Linden im Klaus-Groth-Garten grünten und blühten und warfen im Herbst ihr Jahresgold hin und taten es mehrere male, und immer noch hatte die alte Gartenpforte die mir gegebene Verheißung nicht eingelöst.
Im Herbst 1897 erschien mein Buch: »Die Wohnung des Glücks«. Da entschloß ich mich kurz und schickte es dem Dichter »als Nachbar vom Klaus-Groth-Platz« zum Zeichen der Verehrung. Schon nach wenigen Tagen erhielt ich ein überaus liebenswürdiges und anerkennendes Schreiben, und gleich darauf machte ich meinen Besuch.
Ich ging, ich wills gestehen, nicht wenig gehoben durch die Pforte und gehörte seitdem zu dem engeren Kreise, der sich zur Dämmerstunde um den Alten in der »Kajüte« versammelte. Seine Kajüte nannte er bekanntlich sein kleines, direkt mit dem Garten verbundenes Zimmer im Erdgeschoß, das er zu seinem Lieblingsaufenthalt erkoren hatte.
»Nicht da«, rief der Dichter, als ich bei meinem ersten Besuch, seiner Bitte folgend, mich setzen wollte und dafür einen am Fenster stehenden Stuhl zu wählen im Begriff war. »Nicht da, da springt Ihnen der Papagei auf den Kopf.«
Nun erst sah ich einen großen grünen Philosophen auf seiner Stange. Er schnatterte in seiner Gaumensprache etwas, was ich dahin deutete, er halte sich allerdings für berechtigt, den am Fenster sitzenden Leuten auf den Kopf zu springen. Ich respektierte alte Gebräuche und setzte mich in den von meinem Wirt freundlichst angebotenen Korbstuhl.
So atmete ich als alternder Mann denn doch noch Höhenluft und saß dem Patriarchen (Klaus Groth stand im 79. Lebensjahr), dem Vater der neueren plattdeutschen Literatur, dem Dichter des Annaliedes, gegenüber. Mit einer Art Stolz und doch in einer Stimmung, die nicht frei von Mitleid mit mir und mit meiner ins Grab gesunkenen Jugend war.
Aber, was wußte Klaus Groth davon, was sein Annalied mir, gerade mir, gewesen war? Er hatte »ein ganzes Heer von ewigen Liedern gedichtet«, darunter bessere als mein Annalied. Er hatte sie nicht für mich, er hatte sie für Tausende und Millionen gedichtet, und hatte Tausenden und Abertausenden ein anderes Leid, als das mir gehörige, vom Herzen weggedichtet. Was verschlug ihm mein Jugendschmerz? Und schließlich was denn? Ich war jetzt ja selbst ein mit objektivem mitleidslosen Maßstab ausgerüsteter Beurteiler.
Klaus Groth war ein vortrefflicher Plauderer, ein meisterhafter Erzähler, er sparte seinen Besuchern die Mühe, verlegen zu werden. Er hatte sich eine wunderbare Frische bewahrt, nicht nur die geistige, denn, von häufig auftretenden Erkältungskrankheiten abgesehen, war er ein rüstiger Alter. Jedenfalls zeigten seine geistigen Fähigkeiten nirgends ein Nachlassen. Natur hatte ein Meisterstück hergestellt, als sie den Heider Müllerssohn schuf. Sein Verstand, sein Gedächtnis, sein Humor und seine Laune, alles war erster Klasse freilich manchmal auch sein Zorn. Aber wenn der mal einkehrte, so kam er doch nur ein als Gast, der kein Hausrecht in seinem Herzen besaß. Und Humor und Laune, im ungünstigsten Fall Satire, waren die, die die Tür schließlich hinter ihm zumachten.
Ich vermute, daß ich zum ersten mal im November 1897 in der Kajüte ›schummerte‹. Am 1. Juni 1899 starb Groth, nachdem er seit Begehung seines 80. Geburtstages (24. April 1899) gekränkelt hatte. Ich möchte die Zeit nicht missen, wo ich seinen Umgang und auch seine Zuneigung genoß. In trauten Gesprächen, meistens in Gesellschaft anderer Freunde, nicht selten aber auch allein.
Da saß er in seinem Stuhl, eine hohe Gestalt – ein mehr an die Sachsen- als an die Friesenart erinnernder Charakterkopf, gern erzählend, nie um Stoff verlegen, ihn immer beherrschend, in plastischer, dem Gesprächston angemessener Darstellung immer und immer wieder aus seinen Erinnerungen heraufholend – aus seiner Jugend, von seinen Reisen, von berühmten Zeitgenossen, aber auch über Tagesereignisse und über wissenschaftliche Fragen Ansichten austauschend.
Er starb an seinem 80. Geburtstag; das heißt, an den Folgen der Mühen und Strapazen, die er sich auferlegt hatte, um den Glückwünschen seiner zahlreichen Verehrer gerecht zu werden.
Einmal tauchte noch während seiner Krankheit die Hoffnung auf, daß er es überwinden werde, aber der Ausblick erwies sich als trügerisch. Aber unter dem Lichtstrahl dieser Hoffnung sah ich ihn zum letzten mal.
Ein heller, sonniger und warmer Tag der letzten Hälfte des Mai. Der Kranke war nach seinem Garten hinausgegangen, da fand ich ihn. Als das Klipp-Klapp der Pforte meine Ankunft meldete, sah er auf. Er stand an der Ecke seines Hauses im Glanz der Abendsonne, und niemals vergesse ich es, wie seine hohe und noch immer ungebeugte, wenn auch am Stock gestützte Gestalt sich gegen den Versöhnungsglanz des vergehenden Tages abhob.
»Es wird noch mal wieder besser werden, lieber Freund«, sagte er. »Und wenn nicht, dann geh ich schlafen – dor is denn ok nix bi.«
Ich dachte gleich, vielleicht ist es doch sein Letztes, sah mich noch einmal um und erhob grüßend den Hut.
Da stand er. Drüben blühten rote Rosen. Ich dachte an das Annalied. Als ich durch die Pforte ging und den Fallriegel über die Flügel legte, da ging der Alte vorsichtig in seine Kajüte hinein ... Um zu schlafen.
Nach wenigen Tagen war er nicht mehr, und nach weiterer kurzer Frist begleiteten wir ihn, als man den Sarg mit großem Gepränge aus seiner Pforte hinaus trug.
»Un wenn de Port toletzt mal knarrt, Denn is't, wenn man mi rutdregen ward. Un denn vœr en Annern geit se as nu, Un he röppt to en Anner, wenn se geit: Dat büst Du! Un de hier plant hett un sett de Port, Em drogen se rut an en stillen Ort.«
Dreschermelodien
Ein Fünfziger bin ich, mehr nicht, und schon erinnert die Farbe meines Haares an die weiße Winterlandschaft draußen. Aber ich fühle mich bei Kräften, finde auch das Leben erträglicher, als es mir in der Jugend erschienen ist. Stille Spaziergänge an ruhigen Wintertagen, wenn der Himmel seinen Schneemantel über die Baumspitzen meines geliebten Stadtwaldes schleift, liebe ich vor allem. Drei Grad Kälte bei ruhiger Luft, in weicher, warmer Wolle, das ist die richtige Wärme.
Von meinem Häuschen gehe ich dicht an der großen Platane, die im Sommer ihren breiten Schatten zum Ärger meiner alten Haushälterin auf die Erdbeerbeete wirft, daran vorbei, aus der Gartenpforte direkt in den Wald.
Mit kräftiger Handkrücke schreite ich über die von keinem gemeinen Niederschlag beeinträchtigte Vornehmheit des gefrorenen Bodens. Die weißkörnigen Kristalle, die mit angenehmem Knistern unter meinem Fuß zerplatzen, der von überhängenden Ästen über die reinlichen Waldwege geschüttete Rauhreif, das gelbrote Eichenlaub, die satten Farben der Rotbuche – wie liebe ich das alles!
Trete ich ins Freie, dann nimmt mich eine weite, mit zerstreuten Gehöften bedeckte Ebene auf – eine stille, verschlafene Landschaft. Weit ab tobt die Stadt, müde und schwer stiegt eine Krähe über das Feld, setzt sich in einen frostigen Wipfel und späht nach Raub und Atzung aus.
Der Weg teilt sich. Gewöhnlich gehe ich links. An dieser Seite wogt der geschäftige Lärm. Die Turmuhr kündet – zunächst im feierlichen Halbklang der Schläge vier den Ablauf einer Vollstunde anzukündigen, dann elf gewichtige, kräftige, entschiedene, jeden Widerspruch ausschließende, peinlich genau ins Ohr gezählt. Ein breiter, brummiger, zuletzt kurz abgebrochener Nachklang als Bestätigung des schattenhaft aus dem Nebel drohenden langen Gesellen, der endgültig versichert, die elfte Frühstunde sei wirklich vollendet und daran solle keine Macht der Welt was ändern.
Seit Jahren dasselbe Bild. Doch nein, nicht ganz das gleiche. Früher hörte ich die lustige Musik der Dreschflegel vom Dorfe her. Jetzt summt und raucht in jedem Herbste, sobald der Wind über die Stoppeln zu wehen beginnt, vor den Bauernhöfen die unvermeidliche Dampfdreschmaschine; jetzt kreisen vor jedem Scheunentor in den aufgewühlten Ameisenhaufen geschäftigter Leute ruhelose Räder und Riemen. Staub, Qualm und Stroh! Und in der Dorfschenke, die sich roh, schmuck- und gardinenlos der Straße darstellt, sehe ich fremde, oft rothaarige Arbeiter mit Strohgefaser in Bart und Haar, kartenspielend, Bierseidel wie Steinkrüge aneinander stoßend. Ich sehe den dicken Wirt. Pustend bringt er den ihm klebrig von den Fingern tropfenden Kognak.
Heute aber ist ein besonderer Tag. Das erfrischende Klingklang der Handdrescher schlägt an mein Ohr. Kaum wage ich meinem zwar alten, aber noch zuverlässigen Auge die Sünde wider den Zeitgeist zu glauben.
Klipp-klapp! Duff-duff!
Wie kräftig das klingt, drollig lustig und drollig wehmütig! Ich wiege im Weitergehen das Haupt nach der urwüchsigen Melodie der Arbeit, im Geiste sehe ich der Dreschergruppe scharf umrissenes Bild.
Klipp-klapp! Duff-duff!
Wenn das erste Paar anschlägt: sanft hell und leicht auf strotzende Ährenköpfe (wuchtige Schläge zermalmen die Körner), genügt der Stoß des elastischen Handgelenks, die Werkzeuge kreisen nicht höher als die Hilgen der seitwärts belegenen Pferdeställe. Wie anders, wenn der Drescher im vollen Stroh arbeitet und das Werkzeug unter dem Druck der hocherhobenen, muskulösen Arme niederwuchtet! Der keulenartige Klapper stürmt hinauf bis zur Bodendecke der Tenne, verharrt dort wie ein aufblitzender Gedanke, dann reißt ihn des Armes Nerv in die Tiefe. Und gierig blinkt im Sprung das weiße Eschenholz.
Noch höre ich das milde zeitweilige ›Kling-klang‹, dann mischt sich genau im Halbstrich des Taktes das zweite Paar mit dunklerer Klangfarbe in den Reigen, endlich hastet im Sechsteltakt die lustige Melodie.
Der Dreschflegel ist ein feines Instrument, vornehm wie die Geige. Es offenbart die Persönlichkeit des Künstlers, ist es gleich ein plumpes Holz. Da gleicht kein Schlag dem anderen, und vollendeter Zusammenklang im scheinbaren Wirrwarr. Das alles freilich fühlt nur der Kenner. Dessen Ohr aber erlauscht die Eigenart aller Künstler. Das ist ein Diskurs, den er mit steigendem Interesse verfolgt: behaupten, bestreiten, beistimmen, widerlegen, einschränken, erweitern – eine Erörterung, die in den tiefsten Schacht seines Empfindens dringt, und jeder Redner ein Künstler. Erst ergießt sich der Strom des Vortrages mit ruhiger Kraft, dann in rollendem Glanz flammenden Zornes, verwoben, gehemmt, getragen von der Entgegnung ebenbürtiger Meister.
Ich schwelge.
Bei den leichten Schlägen ist das Gespräch munter und trostreich, aber von finstrer Tatkraft, was auf der Garben Mitte niedersaust. Jene Klänge scheinen sich tändelnd zu nähern, ab und zu hascht ein lieblicher nach uns im neckischen Frohmut. Aber dumpf entweicht er wieder und grollt ärger denn je vor Rache und Zorn.
Nun arbeiten die Werkzeuge mit gesteigerter, düsterer Gewalt. Und jählings Stille! In tiefster Erbitterung. Der Gewalt Raum und Atem zu verschaffen.
Das helle Klipp-klapp, das dumpfe Duff-duff! Was für Erinnerungen weckt dieser Ton!
Es ist lange her, da kannte ich einen jungen Burschen, der den Flegel zu führen verstand wie einer. Und wenn man bei dem widerspenstigen Buchweizen die doppelt halsstarrige Mitte abstäubte, dort, wo das dunkle stöhnende Buff-buff! vom Eschenholz widerklingt, wo den braunen Gesellen die Schweißperlen auf der nackten Brust blinken, dann setzte er seinen Stolz darin, daß sein Flegelschlag ebenso wuchtig auf die Tenne stürze, wie der Hieb des starken Großknechts, der neben ihm durch Stroh und Distel bis auf den harten Estrich schlug.
Aber es wurde nicht immer gedroschen. Feldarbeiten füllten die Sommertage aus, es kamen sonnige Tage, wo mein junger Freund hinter der Herde im grünen Grase lag. Ja, es gab Tage, wo er der grauen Fessel der Arbeit überhaupt ledig war, wo ihm Flegelgeklapper nur als Generalnenner der Arbeit wie aus weiter Ferne vor den Ohren lärmte.
Bei solchem Müßiggang verlor er seinen Frieden und fand, so glaubte er, sein Glück. Sein Bruder, der nach Landessitte und Landesrecht bestimmt war, den Hof zu übernehmen, hatte sich verlobt. Die ganze Familie fuhr zum Besuch nach den künftigen Schwiegereltern, die Mühle und Hof in der Niederung des Bruchlandes besaßen, hinüber.
Da der Hof in einer Talmulde lag, so gewahrte Steffen ihn erst, als der Wagen sich aus den hohen Knicken herausarbeitete. Und plötzlich lag eine Idylle vor ihm. Drüben am Teich der stattliche Hof mit dem mächtigen Wohngebäude und den lindenbeschatteten Wohnräumen, im blanken Wasser widergespiegelt das grüne Tafelwerk der Wände, das leuchtende Rot ihrer Ziegel; die Brücke unter den Rädern dumpf rollend und dröhnend, ein stäubendes Mühlrad und im Hintergrunde der weite, in der Frühlingssonne strahlende strotzende Wald.
Er drückte manche Hände, als der Wagen vor der Haustür im Schatten hielt. Alle waren beisammen: das noch rüstige Ehepaar, die schlanke Braut Lisbeth, die hurtig mit dem Verlobten in traulicher Zwiesprache verschwand, die freundliche Jugendgestalt seines Altersgenossen Hinrich, und noch ein blutjunges, süßes Geschöpf, ein liebes, blasses, von gelben Sommersprossen leicht betupftes Gesichtchen, dessen Köpfchen schlicht gescheiteltes, aber dichtes Haar bedeckte. Ein blondes Haar mit jenem leichten gelbroten Anflug, den mein Freund und auch ich (wir beide sind darin gleich) so sehr lieben. Und die Lippen, sie dünken meinem Freunde noch jetzt zart und weich gelagert, wie die Reime eines lyrischen Gedichtes.
Sie wurden schon am ersten Tage gute Kameraden, und das blieb den anderen kein Geheimnis. Hinrich neckte: »Hurra, wi wöllt Doppelhochtied fiern, Max und Lisbeth, Steffen und Marie!« Das gab viel Gelächter. »Ja, ja, dat weer 'n Spannwark, dat weern Passers.« Aber der Scherz klang im Kopfschütteln der Alten aus. Es ginge wohl, aber es gehe doch nicht. Steffen sei zu jung, und einen Hof müßten sie doch auch haben.
Und der Gedanke, daß er keinen Hof habe und daß er deshalb mit ihm und der Marie nichts werden könne, beeinträchtigte Steffens Freude an der rotblonden Schönheit sehr. Aber alle Wehmut hinderte ihn nicht, noch an demselben Tag der Marie zu versichern, daß sie gut sei und daß er sie sehr lieb habe.
Das geschah, als der hinterlistige Hinrich, mit dem Jagdgewehr im Anschlag, im tiefsten Dickicht hinter struppigem Dorn wie eine Waldtaube gurrte, um liebestolle Täuberiche in Schußweite zu locken, nachdem sein Wink die Begleiter in das Versteck des Unterholzes verbannt hatte. Jenes Bekenntnis war wider die Abrede unverbrüchlichen Schweigens; die falsche Waldtaube unterbrach daher für einen Augenblick ihren heuchlerischen Ruf durch ein scharf gezischtes, zorniges »St!«
Da wars still; nur fröhliche Syringen und ein Buchfinke beobachteten altklug den Gehorsam der Gemaßregelten, als unser von keinem falschen Lockruf bedrohtes Taubenpaar, bedeckt von der freundlichen Verschwiegenheit blühender Ranken, im langen Kuß sein junges Glück vergrub.
Am folgenden Tag wurde auf dem Heidehof gedroschen. Die Witterung hatte sich zu einer verläßlichen Wärme entwickelt; das Vieh war früher, als man hatte erwarten können, auf die Weide gekommen – da mußten die letzten Hafergarben, weil sie als Rauhfutter nicht mehr verwendet werden konnten, ausgedroschen werden. Bei dem Dreschen hat der Flegel allein das Wort, nur wenn das Stroh aufgeschüttet wird, wenn neue Garben gelegt werden, rinnt der Strom der Unterhaltung.
Karsten erzählte vom Vaterbruder, der bei dem Ältervater des jetzigen Besitzers auf der Mühle gedient hatte, Klaus war persönlich bei dem gegenwärtigen Herrn im Dienst als Hofjunge gewesen und war daraus entlaufen. Beide wühlten in der Familienchronik der Müllerfamilie und schätzten jedes einzelne Feld des Hofes ab. Der Wald sei groß und wertvoll, die Ländereien nach Westerborstel zu guter Roggenboden – aber was an der Feldmark von Elsfleth liege, damit wehe der Wind, wenn er stürmisch aus dem Osten komme. Mein Freund sagte gar nichts. Das junge Herz war ihm zu voll, das Antlitz der Blonden schwebte über allem Stroh und über allem landwirtschaftlichen Gerede. Er gehörte zu jenen Naturen, die mit vollem Herzen entweder sehr viel und laut reden oder (und das traf in den meisten Fällen zu) ganz still sind. Dafür nannte er jenen geheimen Zauber sein eigen, dem die lauten und geheimen Stimmen der Natur dienstbar sind, auf daß sie teilnehmen an seinem Leid und an seiner Freude.
Wenn die Garbenlage geordnet war, wenn man die Flegel vom Balken nahm, wenn das helle Klipp-klapp! das dumpfe Buff-buff! sich ablösten, dann war es für ihn nicht mehr der Klang vom Eschenholz, was rhythmisch auf und ab wogte, es war vielmehr der Dolmetsch der Empfindungen, die er seinen Gefährten andichtete, und auch in den eigenen Händen wurde der Holzstock zum melodiösen Instrument. Es entfaltete sogar große Beredsamkeit und verwickelte die Geräte seiner Mitdrescher in lebhafte Gespräche.
So trug es im hellen Kling-klang vor, wie unser Freund die Marie begrüßt hatte. Als er ihre zarten Farben beschrieb, antwortete lebhaftes Echo. Karsten sprach in seiner Flegelsprache davon, auch er liebe blasse, rotblonde Geschöpfe und habe Verständnis für den Reiz leuchtender Sommersprossen unter blauen Kinderaugen. Die andern waren mehr für gesunde, rote Gesichter, Klaus machte sich keinen Pfifferling aus Sommersprossen und roten Haaren: ein rotes, volles, dralles Ding mit Armen wie Blutwürste, das sei sein Geschmack. Und in diesem Fach, drosch er selbstbewußt hinzu, sei er nicht nur Liebhaber, sondern ein gewiegter und erfahrener Kenner.
Nun verriet auch unser Freund sein kleines, bisher nur den Syringen und einem gewissen Buchfink bekanntes Geheimnis. Wuchtig klang es von der Garben Mitte Buff-buff! Aber in heiteren Tönen verwob sich damit in nimmersatter Umarmung und hellem Kling-klang das altbewährte Motiv: ›Ich bin dir gut, ich hab dich lieb.‹
Vor ihm und neben ihm hastete unermüdlich die melodiöse Erklärung, daß es Frühling sei, sonniger, warmer Liebesfrühling. ›Er hat sie lieb‹ jauchzte das blinkende Gerät des freundlichen Bartel und überschlug sich vor Vergnügen. ›Sie ist ihm gut‹ versicherte der ehrenwerte Schlag des Johann. An den herzlichen Glückwunsch aller Dreschflegel schloß sich Klaus an, allerdings mit dem Vorbehalt, daß er für seine Person es vorziehe, viele Mädchen ein wenig, anstatt eines überschwänglich zu lieben.
Dann ging es an ein Verarbeiten der Bedenken, die mein Freund seinen Kameraden vortrug. Den fehlenden Hof hielten alle Dreschflegel für Unsinn. Gegen die engherzige Behandlung der Liebe, gegen die Ungerechtigkeit der Anerbenschaft erklärten sich alle Geräte, zumal Klaus mit einer Wucht, die jeden Widerspruch ausschloß.
Meinem jungen Freunde hat kein Ereignis jemals wieder ein solches Erstaunen über sich selbst abgenötigt, wie seine erste Liebe. Das war wie eine über ihn gekommene fremde Gewalt. Bei dem ersten Blick, den ihr Auge erwidert, ja verzehrt hatte, war ihm bewußt gewesen, daß er an dies Auge sein Lebenlang denken werde. Noch mehr war er über seinen Mut erstaunt. Es schien ihm schier unglaublich, daß er einen Mädchenmund geküßt habe. Der stille Bursche sann über diesen Vorgang tief nach, am meisten aber darüber, wie er den zum Heiraten erforderlichen Hof beschaffen könne, bevor ihm sein Mädchen, das ihn in der Heiratsfähigkeit zu überholen droht und bald begehrt sein wird von einem andern weggenommen werde.
Über allem Nachdenken kam ihm die frische Tatkraft abhanden. Vor Denken waren seine Gedanken niemals bei der Sache. Im Genuß der Lippen seines Mädchens freute er sich nicht so sehr über die ihm gewährte Gunst wie auf die Einsamkeit seines Heidehofs, wo er über Marie, ihre lieben Züge, über das rote Gold ihrer Haare, über ihre weichen Lippen tief und wunschlos nachdenken wolle. Dafür wurde er dann in den langen Zeiten, wo er sie nicht sah, (nach Verdienst) von der Begleiterscheinung jeder erotischen Zuneigung, der Sehnsucht, mit ausgesuchten Qualen bestraft.
Es fehlte meinem Freunde das Bewußtsein, daß er Rechte habe, daß sein Schöpfer ihm für Wünsche und Triebe, die er bei sich vorgefunden, aber nicht bestellt hatte, verpflichtet sei. Ihm war das Eia-Popeia der Entsagung zu sehr ins Blut gegangen. Im Genießen glücklich sein? Wahnsinniger Gedanke! Glücklich sein in der Liebe zum Weibe? Zwiefach moralischer Wahnwitz!
So war mein junger Freund ein armer, von seelischer Verkümmerung schwer bedrohter Sünder. Denn was er dachte, dachte er ganz geheim. Das Eschenholz mußte viel offenbaren, was der Ergießung harrte. Von all den seinen Stimmen, womit die Natur auf ihn einredete, ging nichts so tief in seine Seele wie dessen Weise. War aber der letzte Schlag verklungen, war auch der Zauber dahin. Karsten und Johann und Bartel und Jasper und Klaus pflegten sich ein Endchen Kautabak zu genehmigen und dann das Stroh so schlicht und recht aufzuschütteln, wie ein Drescher, der nichts von dem Leid und der Freude einer Herzensliebe weiß, zu tun pflegt.
Dem Frühling folgte ein schwüler Sommer und ein nasser, trüber Herbst. Die bleiche Lisbeth begann zu hüsteln sie war arg erkältet. Aber eine Braut darf nicht krank sein, es ist zu störend, paßt auch nicht zum bräutlichen Gesicht. Man muß es zu überwinden versuchen, dann wirds schon gehen. Die Sitte verlangt, daß eine Braut der Welt ihr Glück und den Mann ihrer Wahl zeigt, es ist schön, Braut sein und beneidet, auf Kirchweih und Jahrmärkten, auf Hochzeiten und Bällen in geschenktem Geschmeide glänzen.
Aber im November ging es nicht mehr. Da war sie ernsthaft krank, Ruhe zu empfehlen. Jawohl, Ruhe! Es kamen Fiebernächte und Fieberträume ... Auswurf ... große Schwäche. – Der Frühling soll helfen!
Aber bevor noch die erste Lerche auf der Mühlenkoppel trillerte, kroch der kalte Tod an der Kranken herauf. Gleichzeitig von den Fuß- und Fingerspitzen kletterte die kalte Erstarrung nach dem Herzen hinan.
Max hielt sie bis zum letzten Verröcheln im Arm. Sie wollte reden, konnte aber nicht mehr. »Lieber! ... Marie ....« Der Knochenmann schloß ihr die lallenden Lippen.
Damals standen die altväterlichen, freundnachbarlichen Verbindungen, die jetzt sogar auf dem Lande in voller Auflösung begriffen sind, noch in voller Blüte. Zumal die ungeschriebene, auf dem Wege der Überlieferung von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzte Sippengenossenschaft der ›Ploog‹ bildete noch immer die Sargfolge bei Trauerfällen. Zur Zeit der grundlosen Wege aus einem wirklichen Bedürfnis hervorgegangen, wobei es sich darum handelte, bei weit entfernten Friedhöfen die zur Leichenbeförderung erforderlichen Gespanne aufzutreiben, zeigte sie, nach ihrer Umwandlung in eine Gemeinschaft wechselseitiger Ehrenpflichten, die Erscheinung eines schönen nachbarlichen Verhältnisses. Die Ploog vertrat in der allgemeinen Schwermut den frischen Mut zum Leben. Auch bei den tränenreichsten Todesfällen war sie, wenn noch der Trauerzug langsam dahinschaukelte, beschäftigt, die von der Unabwendbaren zerschnittenen Fäden neu anzuknüpfen.
Nach beendigter Feier knatterten die Fuhrwerke in scharfem, frischem Trabe der Heimat zu. Der Magen verlangte sein Recht. Die Totenmahlzeit (›Gräff‹) darf nicht anders als üppig und reichlich sein. Die Ploog hat die Aufgabe (das verlangt die Schicklichkeit), das heitere, fröhliche Element an der Tafel zu vertreten. Sie muß sich gegenseitig necken, hänseln und – lachen. Nicht nur lächeln, nein, sie muß lachen, im befreienden Brustton laut lachen, als sei es die allergewöhnlichste Sache, einen Lieben im Sand des Kirchhofs zu verscharren.
Nichts ist so ansteckend wie das Lachen eines guten, wohlmeinenden Gesichts. Daher wurde die Tafel fast immer in einer Stimmung aufgehoben, die sich zur warmen Heiterkeit steigerte und im versöhnten Aufblick zum Leben ausklang.
Schon bei den Trauerfeierlichkeiten sollte es in der Ploog verhandelt worden sein, daß Max die Marie heiraten werde. Eigentlich selbstverständlich: die Braut war ihm gestorben, eine Frau mußte er haben, weil er den Hof übernahm. Eine Schwester der Braut war da, zwar noch etwas jung, aber doch heiratsfähig – es konnte nicht anders werden. Auch sollte Liesbeth es auf ihrem Totenbett ›bestellt‹ haben.
Ob dabei jemand wohl an unseren Freund dachte? Wir glauben kaum. Diejenigen, die etwas von seiner Schwärmerei ahnten, kannten jedenfalls nicht ihre Tiefe. Zu diesen dürfte der Bruder vor allen Dingen gehört haben. Selbstverständlich handelte es sich nur um eine Kinderei. Er, der Erbe des Hofes, und der liebe, dumme Junge, fast noch ein Knabe! Im allgemeinen hat der Landmann wenig Achtung vor den Träumen seiner Jugend. Kindereien finden bei ihm nicht viel Rücksicht. Und Kinderei ist alles, was seinem Verständnis, weil seiner Vorstellungskraft, entfallen ist, mag es auch früher seine Pulse in stürmische Bewegung versetzt haben. Es ist nun einmal so: wen das Leben hart und rücksichtslos drischt, der arbeitet auch an seinem Teil mit hartem, rücksichtslosem Flegel.
Das Gerücht von der bevorstehenden Verlobung verbreitete sich. Es sollte angeblich nur das Trauerjahr abgewartet werden, sie öffentlich zu erklären. Nur ihm, den es am meisten anging, verbarg man es. Aber er atmete wie in Gewitterschwüle.
Vieles war wunderlich, darunter die sich häufenden Besuche seines Bruders auf dem Mühlenhof. Einmal, zweimal, dreimal klapperte es verdächtig vom Dreschflegel des Klaus her. Auch das Verhalten von Marie war anders. Sie hatte viel an ihm zu tadeln, an seiner Zurückhaltung, an seiner Unbeholfenheit. Einmal stellte sie ihm gar Max und sein frisches Wesen als Muster hin.
Bei einer Besorgung, die er in der Stadt machte fiel es ihm endlich von den Augen. Überall fragte man, wann die Hochzeit seines Bruders mit Marie (die Verlobung wurde als selbstverständlich angesehen) stattfinden werde.
Als er es das erste mal vernahm (er war bei dem Kaufmann Ehmsen zum Familienkaffeetisch herangezogen), hätte er beinahe den Tassenkopf fallen lassen. So sehr hatte er sich erschrocken. Trotz des weichen Stuhls, in dem er sich strecken durfte, und trotz des guten Kaffees fühlte er sich namenlos unglücklich.
In seinem Gehirn drosch der Teufel eine eigene Dreschermelodie. Das hastete, klippte und klappte auf dem ganzen Weg nach der Mühle. Unser armer Freund hatte sich kurz und gut entschlossen, diesen Umweg zumachen. Weshalb? Zu ihr, in ihre Nähe – Licht, Luft, Lösung!
Und der Böse in seinem Kopfe fiedelte und drosch. Alles, was die Ploog schon vor einem Jahre so verständig erwogen hatte, brachte er in Verse und machte dazu eine hübsche Musik. Mit kicherndem Hohn zeigte er die Ungleichheit beider Liebhaber. Er, der schüchterne Junge, und Max – lächerlich! Der Teufel wandte sich in direkter Anrede an ihn und nannte ihn ›Kollege‹. – »Kollege, was kannst du bieten, armes Kerlchen du?« Den Kehrreim des Spottgesangs kicherte er in hohem Diskant: ›Wo du nicht bist, Herr Organist, da schweigen alle Flöten.‹ Und nun fing er an zu sticheln auf seine Blödigkeit, auf seine Weichheit, auf seine Schwäche; er bemängelte seinen Gang, seine Haltung, seine Manieren, seinen Anzug. Diesem Kapitel widmete er mehrere Strophen: ›Ik weer ok mal in Beiderwand to Köst ...‹ begann die eine, ›witte Hoor un krumme Näs!‹ die andere.
In dem Walde trieb es ihn nach dem Versteck, wo er einst unter blühenden Syringen geküßt hatte. Und auch diese Andacht begleitete der Musikant mit parodistischem Couplet. Das sprang und wendete sich in kurzem, gehacktem ›Klipp-klapp‹. Der eine küßt sie, der andere kriegt sie ... das war das wiederkehrende Motiv.
Der Ärmste kam nicht zur Sammlung. Seine Fassung war dahin, als er die alten Stätten des Glücks aufsuchte. Im Walde dämmerte der Oktobernachmittag, rotes und gelbes Laub fiel, es ruschelte unter seinen Sohlen. Eigentlich hatte er die Syringen, die sich so neidlos gefreut hatten wiedersehen wollen; aber welche Torheit, Syringen im Oktober! Auch der Buchfink, der sich damals die Geschichte so genau betrachtet hatte, als wolle er im Vogel-Kasino einen Vortrag halten »Über die Technik der Menschenkinder beim Schnäbeln«, war nicht anwesend. Anstatt dessen hämmerte ein bunter Specht an den Bäumen. Der prosaische Kerl dachte nur an seine Arbeit und Nahrung, und bei dem Anblick des langen Schnabels mußte Steffen unwillkürlich denken, dem hätte auch der lehrreichste Vortrag nicht gedient, und ob er überhaupt imstande sei, mit solchem Ungeheuer seine Eheliebste zu schnäbeln, sei zu bezweifeln.
So ungefähr waren die Betrachtungen, die das Geräusch eines schwer beladenen Bauernwagens störte, der auf der holprigen, neben dem Waldessaum daherlaufenden Landstraße fuhr. An den kurzen, metallenen Stößen der Wagenachsen erkannte Steffen den väterlichen Mühlenwagen (seines Wissens gab es ein zweites Lastfuhrwerk mit stählernen Achsen in der Gegend nicht); das Leitpferd prustete: es war das selbstzufriedene Niesen der alten braunen Liese.
Nun wußte er, wer ihm zuvorgekommen war. Zwischen den Wagenstößen hörte er die Stimme des Bruders in freundlich gelaunter Unterhaltung und das frische Auflachen, das sie hervorrief. Steffen kannte dies reizvolle, verschleierte Lachen.
Er war ein Anhänger jener sonderbaren Auffassung, die dafür hält, daß Empfindungsäußerungen etwas bedeuten sollten. Ein wunderlicher Kauz, der er war, klang ihm das fröhliche Lachen im Ohr, er konnte es aber nicht zusammenreimen mit einem Briefchen, das ihm am nächsten Tage zugesteckt wurde und folgendermaßen lautete:
»Teurer, liebster Steffen!
Die ganze Nacht habe ich geweint, und noch immer fließen meine Tränen. Lieber Freund, Geliebter, kannst Du mir vergeben, daß ich Dich verlasse? Es soll nicht sein, was wir beide gehofft haben. Gestern habe ich Max mein Wort gegeben. Er ist so lieb und gut, und meine Eltern wollen es so gerne, und in der Bibel steht, der Eltern Segen bauet den Kindern Häuser, der Vater Fluch reißet sie nieder. Da kann ich nicht anders. Du wirst es auch gewiß einsehen, Du hast ja ein so sanftes und himmlisches Herz, lieber Steffen, und ich weiß, daß Du mir vergeben wirst. Er hat Dich auch lieb, nur weiß er nicht, daß wir uns, sozusagen, einig waren. Und bist ja auch noch zu jung zum Heiraten, sagt Mutter, und darum, Lieber, sei gut und vergiß, daß wir uns so nahe gestanden haben, vergiß Deine Liebe zu mir und bleibe in Freundschaft, wie ich in Freundschaft verbleibe
Deine Schwägerin Marie.«
Das gab ein Geklapper, Geschwatze und Geklatsche unter den Dreschflegeln, und das Lied von der Falschheit der Weiber nahm kein Ende. Klaus konnte mit einem gewissen Recht auf seine frühere Äußerung verweisen, daß den mit zarten Sommersprossen Betupften so wenig zu trauen sei wie den blutwürstigen Weiblichkeiten, während Karsten einräumen mußte, sich in der Marie geirrt zu haben, was er sich übrigens zur Ehre anrechne. Johann meinte, man solle der Geschichte keine übermäßige Wichtigkeit beilegen. Ähnliches komme in den besten Familien vor.
Steffen schwang seinen Dreschflegel nur noch mechanisch, er rang nicht mehr um die führende Stimme in dem Konzert. Die trostvollen Betrachtungen vermochten ihn nicht zu trösten, den pessimistischen Erwägungen gegenüber fand sein Werkzeug keinen Mut zu energischer Verwahrung. Dessen Klang zerstob in dem mächtigen Dreiklang, und mit ihm zerstob und zerflatterte seine Hoffnung – aber nicht seine Liebe.
Auf der Heide
Links an der Straße begrüßte die Reisenden ein in Grün und Blüten halb vergrabenes, durch Durchfahrt und Futterkrippen als Wirtshaus gekennzeichnetes Anwesen. Die Durchfahrt befand sich in einem dem Hauptgebäude vorgezogenen Kreuzbau, und auf ihn stützte sich das grübelnde Giebelantlitz. Vielleicht dachte es an die Kosten der offenbar notwendigen Hauptreparatur seiner Ställe und Scheuern, jedenfalls blinzelte es widerwillig und verdrossen nach dem raschen Fuhrwerk, dessen sanftes Rollen es aus seinen Träumereien aufgestört hatte.
Das Leitpferd jenes Fuhrwerks hieß Lisch und war eine braune, verständige, würdige Matrone, ein erfahrenes Rößlein. Erfahrene Rößlein unterdrücken bei dem Anblick von Futterkrippen selten den Versuch, Stimmung für einen Imbiß zu erwecken. So bog auch Lisch kühn nach links, die Bemühungen und Zurufe eines kleinen Blondkopfes, der auf ihrem Rücken die ersten Reitübungen machte und mit dem Wirtshausbesuch nicht einverstanden war, zwar gut- und gleichmütig, aber mit gründlicher Nichtachtung entgegennehmend. Es war ein Glück, daß der Wagenlenker aus seinen Träumen von Superphosphat und Thomasschlacke aufgerüttelt wurde und noch rechtzeitig die dunklen Wege des Lasters kreuzen konnte. Ein kurzes Anziehen des rechten Zügels, ein halb warnender, halb strafender Peitschenhieb führte Mutter Lisch auf den Weg der Tugend, diesmal die breite Heerstraße der Chaussee, sanft zurück.
»Du schullst di wat schamen«, strafpredigte Karsten das Leitpferd an; »von Lotte will ik nix seggn, de is jung und jiddig; aber du büst in vernünftigen Jahren. Scham schust di wat, weest dat!«
Die Gemaßregelte machte eine Bewegung, als wollte sie antworten: »Wat schall ik dorto seggn? Ques du man to!« Sie hob, Karsten zum Hohn, graziös den Schweif, Lotte machte einige alberne Sprünge; sie wollte offenbar Karstens Ansicht von ihrem jugendlichen Übermut bestätigen.
Das Gefährt rollte rasch dahin. Es trug den Doktor Peter Holm, seine Gattin und seinen Sohn, die Karsten Wrich, der Großknecht seines Bruders, vom Bahnhof abholte.
Lisch und Karsten hatten sich vollständig ausgesöhnt. Die Rosse hatten an der Fahrt ebensoviel Vergnügen wie die Reisenden, und die Frische der Jugend teilte sich von Lotte den alten Gliedern der Lisch mit. Sie blickten sich mit verstohlener Vertraulichkeit an, bissen sich neckend in die Mähnen, schüttelten schäumend das Gebiß, und weiter und weiter ging es, mit rüstigem Aufschlag der Hufen auf den Granit der Chaussee.
In dem Knattern und Schütteln erstarb die Unterhaltung, aber um so inniger suchte Doktor Peter der neben ihm sitzenden Frau durch warmen Händedruck zu versichern, daß seine herzliche Zuneigung zur Familie auch diese Reise überdauere.
Es flogen rechts und flogen links vorüber auf den dichtbewachsenen Knickwällen des nordischen Flachlandes dunkel belaubte Erlen, schillernde Silberpappeln, nickende Haselsträuche und starre Stechpalmen, der Blütenschnee des Weißdornes, die licht rosa angehauchten Heckenrosen. Es eilten und zögerten in abnehmender Schnelle die im Hintergrunde auftauchenden Häuser und Höfe, Wiesen und Anger, Gebüschgruppen und alleinstehende Eichen, diese mit wirrem Haar in grüner Waldwiese, vor Gram ob ihrer Vereinsamung zerrauft.
»Sie spielen Greifen«, klang es vom Pferde her. Und in der Tat, die Flucht der Landschaft rings umher erinnerte an Greifen und Verstecken.
Die junge Frau lächelte ihrem Liebling zu. Mutterfreude warf Sonnenschein über die sanften Züge der schönen Frau und riß den Gatten zu stürmischer Zärtlichkeit hin. Er küßte ihre Lippen, die dunkle Haarpracht, die von ihr bedeckte reine Stirn und das treue Auge, in dem die zuversichtliche Frage nicht erstarb: ›Liebst du mich?‹ Und als er alle diese Herrlichkeiten unter den Augen grüner, glotzäugiger Giebel, stattlicher Strohdächer, unter dem hämischen Antlitz schwarzer, qualmiger Rauchhäuser wirklich küßte, lag Verwunderung in den Mienen der ersteren und scheinheilige Empörung in dem hinterhältigen Ausdruck der letzteren, denn so was war auf dem Dorf nicht der Brauch. Das mußte bei alten und jungen Häusern Anstoß erregen. Der blaue Himmel aber nahm die Bezeugung dieses trefflichen Einvernehmens gut auf. Seinen schönsten Duft legte er auf die Landschaft, als das Gefährt die Chaussee verließ, in eine weite Heide einbog und nunmehr im weichen Sande mahlte, wiegte, schaukelte. Der Gesang des ächzenden und knarrenden Riemen- und Federzeugs war gesättigt von Schmerz, Verzicht, Schluchzen und Tränen, aber aus weiter Ferne klang es wie leises, verhaltenes, frohes Gelächter alter, lieber Verwandten und Freunde.
Karsten ließ seine zur Vernunft und Ehrbarkeit zurückgekehrten Pferde verschnaufen, die Frau Doktor nestelte an ihrer Frisur, die Spuren der ehelichen Zärtlichkeit zu beseitigen. Dann steckte sie Kamm und Bürste ein. Ihr Blick umfaßte die braune, von grünen Gebüschgruppen besprenkelte Ebene, um leuchtend zu dem glücklichen Auge des Gatten zurückzukehren. »Sag mal, Liebster, ob die öde Heide wohl schon mal eine so verliebte Ehefrau gesehen hat?«