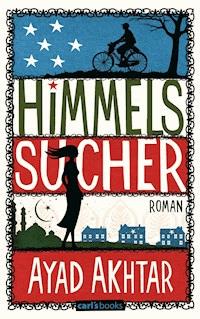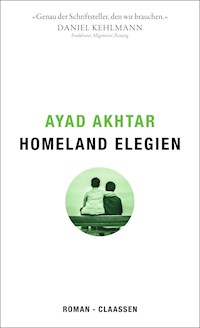
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Genau der Schriftsteller, den wir brauchen." Daniel Kehlmann "Leidenschaftlich, verstörend, fesselnd." Salman Rushdie Ayad Akthars "Homeland Elegien" ist ein intelligenter Roman über den zerrütteten Zustand des heutigen Amerikas. Über ein Amerika, in dem die Ideale der amerikanischen Demokratie den Göttern der Finanzindustrie geopfert wurden und eine TV-Persönlichkeit Präsident werden konnte. Es ist ein persönliches Memoir über die Erfahrungen von im Westen lebenden Muslimen, insbesondere nach 9/11, und eine Reflexion über die Möglichkeit einer westlichen muslimischen Identität. Es ist eine manchmal komische, manchmal bewegende, manchmal konfliktreiche Einwandererfamiliengeschichte und die intellektuelle Biografie eines künstlerischen Ausnahmetalents. Und nicht zuletzt erzählt der Roman mit großem Esprit und aus ungewohnter Perspektive globale Zeitgeschichte, vom Konflikt zwischen Pakistan und Indien über den ersten Afghanistan Krieg bis hin zu Osama bin Laden und dem islamistischen Terror der jüngsten Gegenwart.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Homeland Elegien
Der Autor
AYAD AKHTAR ist Dramatiker und Romancier und wurde mit dem Pulitzer-Preis in der Kategorie Theater sowie dem Arts and Letters Award in Literature von der American Academy of Arts and Letters ausgezeichnet. Sein bisheriges Werk umfasst vier Bühnenstücke und den Roman American Dervish, der in über zwanzig Sprachen übersetzt und von Kirkus Review als einer der besten Romane des Jahres 2012 bezeichnet wurde. Er lebt in New York City.
Ayad Akhtar
Homeland Elegien
Roman
Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Die amerikanische Originalausgabe erscheint 2020 unter dem Titel Homeland Elegies bei Little, Brown and Company
Claassen ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Deutsche Erstausgabe© 2020 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinMit freundlicher Genehmigung von Little, Brown and Company, New York, New York, USA© 2020 by Ayad AkhtarAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, HamburgTitelabbildung: © Nilufer Barin / arcangelE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-8437-2393-0
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Der Autor / Das Buch
Titelseite
Impressum
Ouvertüre: An Amerika
Eine Chronologie der Ereignisse
FAMILIENPOLITIK
1. Am ersten Jahrestag von Trumps Präsidentschaft
2. Über Autobiografie oder: Bin Laden
3. In den Namen des Propheten …
ERINNERUNGEN AN SCRANTON
4. Das Land Gottes
5. Riaz oder: Der Schuldenhändler
AMERIKANISCHER AUSSCHLAG
6. Von Liebe und Tod
7. Über Pottersville
8. Langford gegen Reliant oder: Wie die amerikanische Geschichte meines Vaters endete
Redefreiheit – Eine Coda
Anhang
Quellen
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Ouvertüre: An Amerika
Widmung
Für Mark Warren und Annika
Motto
Ich kann mir nur etwas über Dinge ausdenken, die schon geschehen sind …
Alison Bechdel
Ouvertüre: An Amerika
Auf dem College hatte ich eine Professorin namens Mary Moroni, die Melville und Emerson unterrichtete und von der ihr Mentor, der einst berühmte Norman O. Brown, einmal gesagt hatte, sie sei der klügste Kopf ihrer Generation; eine kleine, engelsgleiche Frau Anfang dreißig, deren Ähnlichkeit mit einem raffaelischen Putto nicht ganz zufällig war (ihre Eltern stammten aus Urbino); eine Gelehrte von schwindelerregender Belesenheit, die ebenso mühelos aus der Edda wie aus Moby Dick oder den Schriften von Hannah Arendt zitieren konnte; eine Lesbierin, was ich nur erwähne, weil sie es selbst oft erwähnte; eine Lehrerin, deren Sprache so präzise und scharf wie ein deutsches Schälmesser war und neue Rillen für alte Gedanken in die graue Hirnmasse kerbte. Zum Beispiel an jenem Februarmorgen zwei Wochen nach Bill Clintons erster Amtseinführung, als sie während eines Seminars über das Leben in der Frühzeit des amerikanischen Kapitalismus plötzlich einem faszinierenden Gedanken folgte, vom Boden, auf den sie beim Sprechen immer sah, aufblickte und – die Linke wie stets in der Tasche der weiten Hose, die ihr Markenzeichen war – fast beiläufig sagte, Amerika habe als Kolonie begonnen und sei es bis heute geblieben, nämlich etwas, das noch immer definiert sei durch seine Plünderung, ein Ort, wo Bereicherung vorrangig und die bürgerliche Ordnung nur ein Nebengedanke sei. Das Vaterland, in dessen Namen – und zu dessen Nutzen – dieses Rauben andauere, sei kein physisches mehr, sondern ein geistiges: das amerikanische Ich. Längst darauf abgerichtet, jedem noch so verborgenen oder banalen Verlangen nachzugeben, anstatt es zu hinterfragen, wie es die Klassiker gelehrt hätten, sei die stetig anschwellende amerikanische Selbstverliebtheit zum plündernden patria geworden und die Räuberjahre der Regierung Reagan hätten diesen fortdauernden Wesenszug des amerikanischen Lebens nur klarer und deutlicher denn je zum Vorschein gebracht.
Im vorangegangenen Semester hatte Mary mit ähnlich anregenden Bemerkungen über amerikanische Hegemonialbestrebungen im Zuge der Operation Desert Storm einigen Ärger provoziert. Ein Student aus dem Ausbildungsprogramm der Army beschwerte sich bei der Collegeleitung, die Professorin schwinge Reden gegen die Streitkräfte. Er stellte einen Tisch im Gebäude der Student Union auf und sammelte Unterschriften. Das Ganze führte zu einem Leitartikel in der Collegezeitung und der Androhung von Protesten, aus denen aber nie etwas wurde. Mary ließ sich nicht einschüchtern. Immerhin war das in den frühen Neunzigern, und die Konsequenzen ideologisch gefärbter bissiger Bemerkungen – oder sexuellen Machtmissbrauchs – waren kaum mit den heutigen zu vergleichen. Wenn irgendjemand das, was sie an diesem Morgen sagte, problematisch fand, so hörte ich nichts davon. Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass viele von uns überhaupt verstanden, worauf sie hinauswollte. Ich jedenfalls verstand es nicht.
Dem Verlangen nachgeben. Anschwellende Selbstverliebtheit. Definiert durch Plünderung.
In ihren Worten steckte die Kraft einer großen Verneinung, eines Korrektivs für die Tradition unendlicher amerikanischer Selbstgefälligkeit. Das war mir neu. Ich war an die von Gott gesegnete Licht-der-Welt-Einzigartigkeit gewöhnt, mit der jede einzelne Geschichtsstunde unterlegt gewesen war. Ich war in einer Zeit aufgewachsen, in der die Stadt auf dem Hügel so hell strahlte, dass die ganze Welt sie sehen konnte. Das waren die überhöhten Sprachbilder, die uns in der Schule präsentiert wurden, nur waren es für mich keine Bilder, sondern die Wahrheit.
In Uncle Sams grimmigem, wissendem Blick im Postamt sah ich amerikanische Güte; im eingespielten Studiogelächter der Sitcoms, die meine Mutter und ich uns jeden Abend ansahen, hörte ich amerikanischen Überschwang; wenn ich auf meinem Schwinn-Zehngangrad an den anderthalb- und zweistöckigen Häusern unseres Mittelschichtsviertels vorbeifuhr, spürte ich amerikanische Kraft und Sicherheit. Allerdings war auch mein Vater damals ein großer Amerika-Fan. Für ihn gab es auf der ganzen Welt kein großartigeres Land, kein Land, wo man mehr tun, mehr haben, mehr sein konnte. Er bekam gar nicht genug davon, zeltete in den Tetons, durchquerte mit dem Wagen das Death Valley und fuhr in St. Louis zum höchsten Punkt des Gateway Arch und dann auf einem Raddampfer nach Louisiana, um in den Bayous Barsche zu fangen. Er liebte historische Orte. Wir hatten gerahmte Fotos von unseren Ausflügen nach Monticello und Saratoga und dem Haus in der Beals Street in Brookline, wo die Kennedy-Brüder zur Welt gekommen waren.
Ich erinnere mich an einen Sonntagmorgen in Philadelphia, als ich acht war: Mein Vater schimpfte mit mir, weil ich im Gedränge einer Führung durch Räumlichkeiten, die irgendwas mit der Verfassung zu tun hatten, quengelte. Danach nahmen wir ein Taxi zu der berühmten Treppe vor dem Museum und machten, als Hommage an Rocky Balboa, ein Wettrennen hinauf zum Eingang – und er ließ mich gewinnen!
Die Liebe zu Amerika und der feste Glaube an seine Überlegenheit – in moralischer und sonstiger Hinsicht – waren in unserem Haus ein Credo, das meine Mutter lieber nicht infrage stellte, auch wenn sie es nicht ganz teilte. Wie Marys Eltern – von denen Mary mir später erzählte – fand meine Mutter in den diversen reichen Gaben ihrer neuen Heimat nie eine auch nur annähernd ausreichende Entschädigung für den Verlust dessen, was sie zurückgelassen hatte. Ich glaube nicht, dass meine Mutter sich hier je zu Hause fühlte. Sie hielt Amerikaner für materialistisch und verstand nicht, was an dieser Kauforgie, die sie als Weihnachten bezeichneten, so heilig sein sollte. Es ärgerte sie, dass jeder sie fragte, woher sie stamme, und anscheinend nichts dabei fand, dass er, wenn sie es ihm sagte, keine Ahnung hatte, wovon sie sprach. Amerikaner kannten sich weder in Geografie noch in Geschichte aus. Und am beunruhigendsten fand sie etwas, das für sie mit diesem Desinteresse für wichtige Dinge verbunden war, nämlich die amerikanische Verleugnung von Alter und Tod. Diese Irritation verdichtete sich im Lauf der Jahre zu einer bösartigen Angst, einer schreckenerregenden bête noire, die sie bis zum Tod begleitete: dem Gedanken, dass alt zu sein hierzulande bedeutete, irgendwann in eine Einrichtung abgeschoben zu werden, die alles andere als ein »Heim« war.
Die Ansichten meiner Mutter hätten mich – auch wenn sie nur selten geäußert wurden – auf Marys gallige Bemerkungen über dieses Land vorbereiten sollen, taten es aber nicht. Nicht einmal mein Verständnis vom Islam hatte mich darauf vorbereitet zu sehen, was Mary sah, auch nicht nach 9/11.
Ich erinnere mich an einen Brief von ihr, geschrieben in den Monaten nach diesem schrecklichen Tag im September, der das Leben von Muslimen in den USA für immer veränderte, einen zehnseitigen Brief, in dem sie mir Mut machte, mich ermahnte, aus den Schwierigkeiten, die vor mir lägen, möglichst viel zu lernen, und mir anvertraute, dass all die Widrigkeiten, mit denen sie als homosexuelle Frau in diesem Land zu kämpfen habe – das ständige Gefühl der Bedrängnis, die unaufhörlichen Angriffe auf ihr Streben nach Ganzheit, die Hindernisse, die man ihrem Anspruch auf Autonomie und Authentizität in den Weg gelegt habe –, nichts weiter seien als die Flamme unter ihrem Schmelztiegel, die eine kreative Wut erzeuge, Sentimentalität verbrenne und sie davor bewahre, ihre Hoffnung in eine Ideologie zu setzen. »Benutze diese Schwierigkeiten, mach sie dir zu eigen«, trug sie mir auf. Sie seien der Schleifstein, an dem sie ihren analytischen Verstand geschärft habe, um das Wie und Warum dessen zu erkennen, was sie sehe – etwas, das ich, obwohl das Leben als Muslim in diesem Land zunehmend beschwerlicher wurde, erst fünfzehn Jahre später wirklich wahrnahm. Nein. Was Mary sah, sah ich erst, nachdem ich Zeuge des sozialen Abstiegs einer Generation von Kollegen geworden war, die, ausgelaugt von unterbezahlten Jobs, in Schulden erstickten, weil sie für Kinder mit unheilbaren Krankheiten sorgen mussten; nachdem ich erlebt hatte, dass zwei Cousins – und mein bester Freund aus der Highschool – in Obdachlosenunterkünften oder auf der Straße gelandet waren, vertrieben aus Häusern, die sie sich nicht mehr leisten konnten; dass sich in einem Zeitraum von nur drei Jahren beinahe ein Dutzend meiner etwas über vierzig ehemaligen Klassenkameraden entweder umgebracht oder eine Überdosis verpasst hatten; dass Freunde und Verwandte Medikamente gegen Verzweiflung, Angst, Antriebslosigkeit, Schlaflosigkeit und sexuelle Dysfunktionen nahmen; dass die zeitsparenden chemischen Abkürzungen für alles – von dem Essen, das sich durch den gereizten Darm bewegte, bis hin zu den Lotionen, die wir auf die sonnenvergiftete Haut auftrugen – Krebs erzeugten.
Das alles sah ich erst, als sich unser Privatleben in den öffentlichen Raum ergossen hatte und anschließend vereinheitlicht, zunichtegemacht und verramscht worden war; als die Apparate, die unseren Geist knechteten, ihn mit dem toxischen Treibgut einer Kultur gefüllt hatten, die diese Bezeichnung nicht mehr verdiente; als die intelligente Geschmeidigkeit menschlicher Empfindung, die Aufmerksamkeit selbst, zum teuersten Gut der Welt geworden war und die Bewegungen unserer Gedanken sich für irgendwen irgendwo in nie versiegende Ströme von Einnahmen verwandelten. Ganz deutlich sah ich es erst, als das amerikanische Ich es im Plündern zu wahrer Meisterschaft gebracht, den Vorgang idealisiert, die Aufteilung der Beute gesetzlich geregelt und die restlose Ausbeutung nicht nur der sogenannten Kolonie – wie provinziell das klingt! –, sondern der ganzen Welt beinahe vollendet hatte. Kurz gesagt: Ich konnte erst sehen, was sie damals sah, als alle Versuche, es anders zu sehen, gescheitert waren, als ich an die Lüge meiner Erlösung nicht mehr glauben konnte, als das Leid anderer in mir einen Schrei hervorrief, unmittelbarer und klarer als jede Hymne auf meine Sehnsucht. Mit Mary las ich zum ersten Mal Whitman. Ich vergötterte ihn. Die grünen Blätter, das trockene Laub, die Speerspitzen der sommerlichen Grashalme, der schräg gelegte Kopf, neugierig auf das, was als Nächstes kam. Auch meine Zunge ist einheimisch – jedes Atom meines Blutes ist aus dieser Erde, dieser Luft entstanden. Doch diese Massen sind nicht meine. Und diese Lieder werden keine Loblieder sein.
Eine Chronologie der Ereignisse
1964–68
Meine Eltern lernen einander in Lahore, Pakistan, kennen, heiraten und wandern in die USA aus.
1972
Ich werde auf Staten Island geboren.
1976
Wir ziehen nach Wisconsin.
1979
Geiselkrise in Iran; erste Krebserkrankung meiner Mutter (weitere 1986, 1999 und 2010).
1982
Erster Versuch meines Vaters, eine eigene Praxis zu eröffnen.
1991
Die Praxis meines Vaters meldet Konkurs an, er kehrt in die Forschung zurück.
1993
Erste Begegnung meines Vaters mit Donald Trump.
1994
Abendessen mit meiner Tante Asma; ich lese Rushdie.
1997
Letzte Begegnung meines Vaters mit Donald Trump.
1998
Latif Awan in Pakistan ermordet.
2001
Angriff auf das World Trade Center.
2008
Familienreise nach Abbottabad, Pakistan.
2009
Autopanne in Scranton.
2011
Bin Laden getötet.
2012
Erste Premiere eines von mir geschriebenen Stücks in New York City; ich lerne Riaz Rind kennen; Christine Langford und ihr ungeborenes Kind sterben.
2013
Pulitzer-Preis für Theater.
2014
Ich trete in den Vorstand der Riaz Rind Foundation ein; lerne Asha kennen.
2015
Syphilis; meine Mutter stirbt; Trump gibt seine Kandidatur bekannt.
2016
Trump wird zum Präsidenten gewählt.
2017
Ich verkaufe meine Anteile an Timur Capital; Der Schuldenhändler in Chicago uraufgeführt; mein Vater wegen eines ärztlichen Kunstfehlers vor Gericht.
2018
Ich beginne, dies zu schreiben.
FAMILIENPOLITIK
1. Am ersten Jahrestag von Trumps Präsidentschaft
Mein Vater lernte Donald Trump in den frühen Neunzigerjahren kennen, als beide Mitte vierzig waren – mein Vater war ein Jahr älter als Trump – und nach einem finanziellen Ruin wieder auf die Beine kamen. Über Trumps unbändigen Hang zu Schulden und seine Schwierigkeiten mit geliehenem Geld wurde auf den Wirtschaftsseiten der Zeitungen ausführlich berichtet: 1990 brach die nach ihm benannte Organisation unter der Last der Schulden zusammen, die er aufgenommen hatte, damit seine Casinos im Geschäft, sein Plaza Hotel geöffnet und seine Flugzeuge in der Luft blieben. Die Kredite hatten einen Preis. Er war gezwungen, einen Teil davon pfandrechtlich abzusichern, und persönlich haftbar für über achthundert Millionen Dollar. Im Sommer jenes Jahres zeichnete ein langer Artikel in Vanity Fair ein besorgniserregendes Bild nicht nur seiner Finanzen, sondern auch seines Geisteszustands. Trump hatte sich von seiner Frau getrennt und war aus der gemeinsamen Triplex-Wohnung in eine kleinere auf einer tieferen Etage des Trump Towers gezogen. Er lag tagsüber stundenlang im Bett und starrte an die Decke, verließ das Gebäude weder für Besprechungen noch zum Essen und lebte von Burgern und Pommes, die er sich liefern ließ. Sein Leibesumfang nahm ebenso zu wie seine Schulden, sein Haar wurde länger, wellte sich und sah zerzaust aus. Und nicht nur sein äußeres Erscheinungsbild gab Anlass zur Sorge: Er war ungewöhnlich still. Ivana vertraute Freundinnen an, sie sei beunruhigt und befürchte, er werde sich von diesem Schlag nicht erholen.
Wie Trump hatte mein Vater in den Achtzigerjahren wie verrückt Schulden gemacht, und Ende des Jahrzehnts war seine finanzielle Zukunft ebenso ungewiss. Zu Beginn der Geiselkrise hatte er seine Arbeit in der kardiologischen Forschung gerade aufgegeben und eine Praxis eröffnet, und ein paar Jahre später, während Reagans Präsidentschaft, hatte er dann begonnen, Geld zu drucken, wie er es nannte. (Durch den singenden Tonfall seines Punjabi-Akzents klang es für mich eher so, als würde er nicht eine Tätigkeit, sondern vielmehr das Aroma dieses Geldes beschreiben.) 1983, als er so viel Geld angehäuft hatte, dass er nicht wusste, was er damit machen sollte, nahm er im Radisson Hotel in West Allis, Wisconsin, an einem Wochenendseminar über Investitionen in Immobilien teil. Am Sonntagabend kaufte er seine erste Immobilie – sie stand auf einer Liste, in die einer der Seminarleiter ihm in der Mittagspause »Einblick gegeben« hatte: eine Tankstelle in Baraboo, nur ein paar Blocks von der Stelle entfernt, wo die Ringling Brothers ihren ersten Zirkus gehabt hatten. Wozu er eigentlich eine Tankstelle brauche, lautete die sehr vernünftige Frage meiner Mutter, als er uns seine Entscheidung in der darauffolgenden Woche bekannt gab. Zur Feier des Tages hatte er einen Krug Lassi mit Rooh Afza gemacht – meine Mutter mochte diesen Sirup mit Rosengeschmack besonders gern. Als Antwort auf ihre Frage zuckte er nur die Schultern und hielt ihr das Glas hin. Ihr war nicht nach Lassi zumute.
»Was verstehst du von Tankstellen?«, fragte sie verärgert.
»Vom Tagesgeschäft brauche ich nichts zu verstehen. Die Tankstelle läuft gut – sie hat einen guten Cashflow.«
»Cashflow?«
»Sie wirft Geld ab, Fatima.«
»Wenn sie so viel Geld abwirft, warum wollten die Vorbesitzer sie dann verkaufen, hm?«
»Die Leute haben ihre Gründe.«
»Was für Gründe? Das alles klingt so, als hättest du keine Ahnung, wovon du eigentlich redest. Hattest du getrunken?«
»Nein, ich hatte nicht getrunken. Willst du jetzt ein Lassi oder nicht?« Sie schüttelte knapp den Kopf. Er hielt das Glas mir hin, aber ich wollte es auch nicht – ich hasste das Zeug. »Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Ich erwarte nicht, dass du mich unterstützt. Aber in zehn Jahren wirst du, werdet ihr beide zurückblicken und sehen, dass ich eine großartige Investition getätigt habe.«
Ich wusste nicht ganz, was ich damit zu tun hatte.
»Investition?«, wiederholte sie. »Du meinst so, wie du dir jedes Mal, wenn du in den Laden gehst, eine neue Sonnenbrille kaufst?«
»Ich verliere die Dinger immer.«
»Hier im Haus liegen fünfzehn Sonnenbrillen herum.«
»Aber die mag ich nicht.«
»Wie schade für dich«, sagte sie mit von Sarkasmus triefender Stimme und ging hinaus.
»Du wirst schon sehen!«, rief mein Vater ihr nach. »Du wirst schon sehen!«
Was wir sahen, waren weitere »Investitionen« in ein Einkaufszentrum in Janesville und ein zweites in Skokie, Illinois, in einen Campingplatz bei Wausau und eine Forellenzucht bei Fond du Lac. Wenn Sie in diesem Portfolio keinen roten Faden entdecken können, sind Sie nicht der Einzige. Es stellte sich heraus, dass diese wahllosen Käufe allesamt auf den Rat von Chet erfolgt waren, dem Seminarleiter, der ihm auch die Tankstelle verkauft hatte. Sie wurden allesamt mit Krediten finanziert, wobei jede Immobilie als Sicherheit für eine andere diente. Das Ganze führte zu einer bizarren Konfiguration von Briefkastenfirmen, die sich Chet ausgedacht hatte – und für die er nach der Savings-and-Loan-Krise vor Gericht gestellt wurde. Mein Vater hatte Glück, dass es ihm nicht ebenso erging. Und ja, auch in unserem Wohnzimmer stand das obligatorische Exemplar von Trumps The Art of the Deal im Bücherregal – allerdings erst ein paar Jahre später.
Mein Vater erschien mir immer ein bisschen rätselhaft: der Sohn eines Imams, dessen einzige heilige Namen – Harlan, Far Niente, Opus One – die der großen kalifornischen Cabernets waren, für die er schwärmte; der Diana Ross und Sylvester Stallone verehrte und das hier erlernte Poker dem Rung vorzog, das er in Pakistan gespielt hatte; ein Mann von unberechenbaren Wünschen und Impulsen, der dazu neigte, ein Trinkgeld in Höhe der Rechnungssumme (und manchmal sogar noch mehr) zu geben; ein unablässiger Bewunderer amerikanischen Mumms, der mich wegen meines jugendlichen Mangels daran fortwährend tadelte: Wenn er das Glück gehabt hätte, hier geboren zu sein? Dann wäre er nicht nur auf keinen Fall Arzt geworden! Nein, dann wäre er vielleicht glücklich geworden! Es stimmt: Ich kann mich nicht erinnern, ihn je so zufrieden gesehen zu haben wie während dieser wenigen Jahre in der Mitte von Reagans Präsidentschaft, als er – auf der Basis der Verheißung, das System werde endlos billiges Geld bereitstellen – jeden Morgen erwachte und im Spiegel einen erfolgreichen Selfmademan sah. Die Freude erwies sich als kurzlebig. Die Krise von 1987 löste eine Kaskade unerfreulicher »Kreditereignisse« aus, die sein Nettovermögen in den frühen Neunzigern auf weniger als nichts reduzierten. Ich hatte gerade das zweite Jahr auf dem College beendet, als er mich anrief, um mir zu sagen, dass er, um den Bankrott abzuwenden, seine Praxis verkaufen werde und dass ich das College würde verlassen müssen, es sei denn, ich bekäme einen Studienkredit. (Ich bekam einen.)
Mein Vater war durch diese Rückschläge zwar nicht vollkommen geläutert, aber für eine Weile ernüchtert. Er kehrte als Professor für klinische Kardiologie an die Universität zurück und warf sich wieder auf die Forschung – etwas, für das er, trotz seiner Abneigung, offenbar hervorragend geeignet war. Tatsächlich gehörte er schon drei Jahre nach seiner Rückkehr zur wissenschaftlichen Arbeit wieder zu den führenden Spezialisten und bekam eine Auszeichnung für seine neuesten Forschungen über eine wenig bekannte Krankheit namens Brugada-Syndrom. Es war das zweite Mal, dass ihm das American College of Cardiology die Medaille »Forscher des Jahres« zuerkannte. Damit war er der Dritte in der Geschichte dieser Institution – und bestimmt der Insolventeste –, der diese Auszeichnung zweimal bekommen hatte.
Es waren seine Forschungen über das Brugada-Syndrom, eine seltene und oft tödliche Herzrhythmusstörung, die zu seiner ersten Begegnung mit Donald Trump führten.
1993 hatte Trump noch immer viele, viele Probleme. Er musste seine Geschwister um einen Kredit aus dem Familienvermögen bitten, um Rechnungen bezahlen zu können. (Ein Jahr später bat er um mehr.) Er war gezwungen, seine Jacht, die Fluggesellschaft und seine Anteile am Plaza Hotel aufzugeben. Die Banken, die die Umstrukturierung seiner Holdings überwachten, bewilligten ihm nur ein strikt begrenztes monatliches Taschengeld. Und auch die Journalisten ließen nicht nach: Trumps Geliebte Marla Maples war schwanger, und die im Umgang mit der Presse äußerst geschickte Ivana, jetzt endlich geschieden, machte ihm vor dem Gerichtshof der öffentlichen Meinung die Hölle heiß.
Kurz: Er hatte eine Menge am Hals. So war es weder für ihn noch für seine Ärzte besonders verwunderlich, dass er eine Herzrhythmusstörung entwickelte. Wie Trump meinem Vater erzählte, hatte er das erste beunruhigende Erlebnis beim Golfen an einem ungewöhnlich warmen Morgen in Palm Beach gehabt: ein seltsames Gefühl in der Brust, wie der dumpfe Schlag einer entfernten Trommel. Als er sich auf den Golfwagen gesetzt hatte, war das Trommeln näher gekommen und intensiver geworden. »Es hat sich angefühlt, als würde mein Herz in dieser großen leeren Trommel herumgeschleudert.«1 Ich fand diese Beschreibung eigenartig poetisch. Mein Vater sagte immer, der Mann sei schlau. Wie tief Trump in seiner Achtung gesunken war, kann man daran ermessen, dass er mir, als ich ihm sagte, dass ich über Trump schrieb, anbot, ins Büro zu gehen – wo er nicht mehr arbeitete, weil er sich inzwischen zur Ruhe gesetzt hatte –, um mir Einblick in Trumps Patientenakte zu geben. Ich war in Versuchung, fand es aber nicht nötig. Mein Vater erinnerte sich sehr gut an viele seiner Begegnungen mit »Donald«; er konnte die unbedeutendsten Einzelheiten der trivialsten Unterhaltungen mit einer Detailfreudigkeit schildern, die gewöhnlich für die romantischen Höhepunkte des Lebens reserviert ist. ↑
Einige Tage nach dieser Episode auf dem Golfplatz war Trump zum Abendessen im Breakers, dem damals luxuriösesten Luxusresort in Palm Beach. Er hasste das Breakers – mein Vater erinnerte sich, dass Trump diesen Umstand während der ersten Untersuchung betont hatte –, doch er musste hingehen, denn er traf sich mit einem Mitglied des Stadtrats, der, vermutete Trump, von seiner Abneigung gegen das Breakers wusste und ihn absichtlich dorthin eingeladen hatte. Über Trumps Antrag, das Mar‑a-Lago in einen privaten Club umzuwandeln, war noch nicht entschieden, und er brauchte im Stadtrat jede Unterstützung, die er bekommen konnte. Also dann eben das Breakers, auch wenn das Essen, wie er sagte, ekelhaft und überteuert war. »Warten Sie nur, bis ich meinen Club habe. Wir werden das Breakers abservieren.« Er hatte ein Rib-Eye-Steak am Knochen bestellt – »Und zwar well done, Doc, immer well done, denn man weiß ja nicht, wie’s bei denen in der Küche aussieht und was für Dreck da rumliegt. Wer was macht und das Essen anfasst. Nur so kann man sicher sein – bei Steak, bei Fisch oder was auch immer: well done. Außer es kommt aus meiner Küche, und wir werden eine großartige Küche in Mar‑a-Lago haben, die großartigste überhaupt. Und trotzdem … trotzdem will ich mein Essen auch da well done haben, weil ich eben finde, dass es so besser ist.« –, und als man das Essen servierte, wurde ihm flau. Er entschuldigte sich und ging zur Toilette, wo er feststellte, dass er unglaublich blass war. Wieder hatte er das Gefühl, das ihn auf dem Golfplatz überkommen hatte: dass sein Herz wie in einer leeren Trommel herumhüpfte. Er wusste, dass etwas nicht stimmte und dass er nach Hause musste.
Es war nicht weit zum Mar‑a-Lago, nur vier, fünf Kilometer, aber sobald der Wagen den Parkplatz verließ, fühlte er sich schlechter. Auf dem Ocean Boulevard sagte er dem Fahrer, er solle anhalten, und verlor das Bewusstsein. Das Nächste, an das er sich erinnerte, war, dass er auf dem Bürgersteig lag und die Brandung hörte. Später erfuhr er, dass er bäuchlings im Fußraum gelegen hatte. Der Fahrer war ausgestiegen, hatte ihn auf den Rücken gedreht und von Trumps Augen nur noch das Weiße gesehen. Er hatte weder am Hals noch am Handgelenk einen Puls fühlen können und keinen Herzschlag gehört. Als der Fahrer ihn heftig geschüttelt hatte, war Trump so abrupt, wie er ohnmächtig geworden war, wieder aufgewacht. Sein Gesicht hatte Farbe bekommen, die Stirnadern hatten pulsiert. Benommen war er ausgestiegen und hatte sich auf die Strandpromenade gelegt. Der beständige Rhythmus der Brandung, sagte er zu meinem Vater, habe das seltsame Pochen in seiner Brust anscheinend beruhigt.
Untersuchungen in den nächsten Tagen und Wochen ergaben, dass es tatsächlich eine Herzinsuffizienz gegeben hatte, doch Trumps Herzmuskel war gesund, und in den Herzkranzarterien gab es keinerlei Verschlüsse. Eine weitere Reihe von Untersuchungen erbrachte einen Stapel von EKG-Streifen, auf denen gelegentliche Muster zu erkennen waren, die der Spezialist in Palm Beach noch nie gesehen hatte: Die Kurve hatte dann ungefähr die Form einer Haifischflosse. Selbst 1993 wussten die meisten Kardiologen nicht, dass dies für das Brugada-Syndrom charakteristisch ist.
Die Streifen wurden zum Mount Sinai Hospital in New York geschickt, von wo ein Kardiologe sie an meinen Vater in Milwaukee weiterleitete. Als führender Brugada-Spezialist in den USA und an Kenntnis auf diesem Gebiet nur von den Brüdern Brugada übertroffen, die das Syndrom in Belgien identifiziert hatten, war mein Vater es gewohnt, dass ihm EKG-Streifen und Patienten aus dem ganzen Land – und später auch aus dem Fernen Osten – geschickt wurden. Tatsächlich war Trump nicht der erste einigermaßen berühmte Mensch, der sich von ihm behandeln ließ. Ein Jahr zuvor war mein Vater erster Klasse nach Brunei geflogen, wo er den Sultan persönlich in einem nach den Wünschen und Vorgaben meines Vaters ausgestatteten Raum untersucht hatte. Trump war zwar kein Sultan – jedenfalls noch nicht –, hatte aber nicht vor, in ein Flugzeug nach Milwaukee zu steigen. Also flog mein Vater – abermals erster Klasse – nach Newark und anschließend in Trumps Hubschrauber zu einem Heliport am Hudson, von wo ihn eine Limousine zum Mount Sinai Hospital brachte. Man führte ihn in einen Untersuchungsraum, wo die Apparate bereits aufgebaut waren – er wollte das übliche Ruhe-EKG mit zwölf Elektroden anfertigen, gefolgt von einem Belastungs-EKG, und wenn beides keine Brugada-Arrhythmie auslöste, würde er intravenös ein Alkaloid verabreichen. Dann wartete er auf seinen Patienten. Doch Trump kam nicht.
Am Abend, als mein Vater in dem für ihn reservierten Zimmer im Plaza Hotel gerade dabei war einzuschlafen, klingelte das Telefon. Es war Donald persönlich. Im Folgenden ihr Gespräch, wie ich es mir vorstelle. Mein Vater erinnerte sich vor allem daran, wie sehr der Mann um ihn besorgt war.
»Niemand scheint zu wissen, wie man ihn ausspricht, Doktor.«
»Das höre ich oft.«
»Wie sprechen Sie ihn denn aus?«
»Akhtar.«
»Also ›Ak‹ wie in ›Aktion‹.«
»Genau.«
»Aber sagt man das da, wo Sie herkommen, auch so? Wo kommen Sie eigentlich her?«
»Aus Pakistan.«
»Pakistan …«
»Dort klingt es anders.«
»Ich habe Talent. Ich kann das.«
»Wir sagen ›Achtar‹.«
Mein Vater sprach unseren Namen mit jenem harten Reibelaut aus, den noch kein Amerikaner, dem er begegnet war, je gemeistert hatte. Am anderen Ende blieb es für einen Moment still.
»Oh, das klingt schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, Doktor.«
»Akhtar ist gut genug, Mr Trump.«
Beide lachten.
»Okay, okay, dann also Akhtar. Und Sie nennen mich Donald. Bitte.« Dann entschuldigte sich Trump dafür, dass er den Termin verpasst hatte. Entwaffnet von seiner Wärme, sagte mein Vater, das sei nicht so schlimm. Trump fragte, ob das Zimmer groß genug sei. »Wir sind in New York. Da hat man nie das Gefühl, genug Platz zu haben. Aber ich hab denen gesagt, sie sollen Ihnen eine nette Suite geben. Gefällt sie Ihnen? Wir haben sämtliche Räume renovieren lassen, als wir das Hotel gekauft haben.«
»Mr Trump –«
»Das Hotel ist ein Schmuckstück, Doktor. Die Mona Lisa. Ja, das ist es.«
»Mr Trump –«
»Nennen Sie mich Donald, bitte …«
»Entschuldigen Sie, Donald, aber ich bin nicht nach New York gekommen, um in einem schönen Hotel zu übernachten. Ich bin gekommen, um Ihnen zu helfen. Ich bin nicht sicher, ob Sie verstehen, wie gefährlich dieses Problem mit Ihrem Herzen sein könnte. Wenn es tatsächlich ein Brugada-Syndrom ist, dann übertreibe ich nicht, wenn ich sage, dass Sie eine wandelnde Zeitbombe sind. Dann könnten Sie morgen tot sein.« Schweigen. Mein Vater fuhr fort: »Ich bin geschmeichelt von Ihrer Gastlichkeit, Donald, wirklich. Aber ich bin vor Kurzem aus Brunei zurückgekommen, wo ich den Sultan behandelt habe. Er ist ein Sultan, aber er war pünktlich. Denn er hatte verstanden, dass er, wenn sein Herz nicht behandelt würde, am nächsten Tag tot sein könnte.«
Nach kurzem Schweigen sagte Trump ausdruckslos: »Okay, Doktor, ich werde da sein. Wann?«
»Morgen früh um acht.«
»Es tut mir leid, dass ich heute nicht gekommen bin. Es tut mir sehr leid, Doktor. Ich bin nicht respektvoll mit Ihnen oder Ihrer Zeit umgegangen. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ehrlich.«
»Schon gut, Donald.«
»Sie verzeihen mir?«
Mein Vater lachte.
»Okay, gut – Sie lachen«, sagte Trump. »Die Sache heute tut mir leid, aber morgen werde ich da sein. Gleich als Erstes. Versprochen.«
Zu Beginn des Wahlkampfs für die Präsidentschaftswahl 2016, als alle Welt Trumps Charakter und Stil analysierte – und über seine tatsächlichen Chancen spekulierte –, wurde eine Behauptung oft wiederholt: dass Trump nicht imstande sei, sich zu entschuldigen. Während er von einer Lüge und Ungehörigkeit zur nächsten taumelte, wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass dieser Mann anscheinend unfähig war zu sagen, etwas tue ihm leid, selbst wenn es ihm vielleicht geholfen hätte. Das Eingeständnis, unrecht gehabt zu haben, wäre ein Zeichen von Schwäche gewesen und ließ sich, wie es schien, weder mit seinem Geschäftssinn noch mit seiner ganzen Lebenseinstellung vereinbaren. Jedes Mal wenn ich sah, wie er in seiner Fernsehshow The Apprentice einen Mitarbeiter feuerte, hatte ich den Eindruck einer überwältigenden Verachtung für Schwäche. Jedes Mal wurde der Kandidat, den Trump mit knapper Geste und seinem Markenzeichenspruch »You’re fired!« abservierte, sogleich ausgestoßen, vom Sicherheitsdienst hinaus auf die Fifth Avenue begleitet und in einer schwarzen Limousine an einen Ort geschafft, der weit, weit entfernt war von der olympischen Suite in der Spitze des Trump Towers, wo die verbliebenen Kandidaten Champagner schlürften und Mr Trumps weise Entscheidung rühmten; und jedes Mal war der Ausgestoßene derjenige, der zuvor versucht hatte, die Verantwortung zu verteilen, der zu sehr bereit gewesen war zuzugeben, dass ein Teamversagen eben genau das war: das Versagen eines Teams, nicht eines Individuums. Dass Trump in seiner Fernsehrolle seine Fassungslosigkeit über diesen Beweis von Vernunft und Teamgeist zur Schau stellte, erschien mir bizarr. Konnte es wirklich sein, dass er glaubte, es sei eine legitime Geschäftsstrategie, die Schuld auf einen anderen zu schieben, um selbst das Gesicht zu wahren? Inzwischen wissen wir natürlich, dass es weit mehr ist als das: das summum bonum der Trump’schen Weltanschauung. Gespielt hat er wahrscheinlich an dem Abend, als er meinen Vater anrief, wie auch am nächsten Morgen, als er pünktlich zur Untersuchung erschien und zwei Becher Kaffee und eine kleine weiße Schachtel mit einer »LOVE LIFE!«-Anstecknadel mitbrachte, die mein Vater, wie Trump hoffte, als Zeichen seiner Zerknirschung verstehen würde – eine Geste, die mein Vater nie vergaß.
Man denke: Ein wertloses Stück Plunder, das Trump wahrscheinlich im Souvenirgeschäft seines Trump Towers eingesteckt hatte – mehr brauchte es nicht. Mein Vater tat noch Jahre später all die Behauptungen, der Mann wisse nicht, wie man sich entschuldigt, im Brustton der Überzeugung als Quatsch ab. »Wenn die ihn nur kennen würden«, zischte er, sobald die Fernsehkommentatoren das Thema aufgriffen, und erinnerte uns zum soundsovielten Mal an die Anstecknadel. »Wenn die ihn kennen würden, würden sie so was nicht sagen. Dann wüssten sie, dass sie unrecht haben.«
Es dauerte Jahre, der Ursache für Trumps Leiden auf die Spur zu kommen. Mein Vater hielt ein Brugada-Syndrom noch immer für möglich, war sich aber nicht sicher. Es war eine heikle Frage, denn unbehandelt war das Brugada-Syndrom meist tödlich. Die einzige Behandlungsmöglichkeit bestand darin, einen Herzschrittmacher zu implantieren, und den wollte Trump nicht, es sei denn, mein Vater war absolut sicher, dass es nötig sei. Diese hundertprozentige Sicherheit konnte mein Vater ihm nicht geben, denn die charakteristische Haifischflosse war weder bei den Langzeit-EKGs noch bei den halbjährlichen Untersuchungen aufgetaucht, für die Trump meinen Vater nach New York hatte einfliegen lassen. Es gab auch keine neuen Ohnmachtsanfälle, obwohl Trump weiterhin berichtete, er spüre von Zeit zu Zeit dieses seltsame hohle Poltern in der Brust. Dann gerate er außer Atem und müsse sich setzen und warten, bis es vorbei sei. Mein Vater war sicher, dass es sich um Herzrhythmusstörungen – wenn auch vielleicht nicht um die Brugada-Variante – handelte, und verschrieb einen milden Betablocker und reichlich Flüssigkeitszufuhr. Vier Jahre lang schien das die Symptome in Schach zu halten.
1997 stellte man mithilfe neu entwickelter Gentests fest, dass Trump nicht die lebensbedrohliche Krankheit hatte, auf die seine ersten EKG-Ausdrucke hingewiesen hatten. Da das Brugada-Syndrom damit vom Tisch war, gab es keinen Grund mehr, meinen Vater nach New York zu holen. Die Besuche hörten auf. Trump rief nie mehr an. Tatsächlich hatte mein Vater außerhalb des Untersuchungsraums im Mount Sinai Hospital nur wenig Zeit mit ihm verbracht. Abgesehen von den morgendlichen Untersuchungen hatte es mal ein Mittag- oder Abendessen gegeben, die Gratis-Suite im Plaza und einen Ausflug nach Atlantic City, wo er sich an den Baccaratisch gesetzt und unter den Augen von Trump binnen zehn Minuten fünftausend Dollar verloren hatte. Es war nicht vernünftig, dass er sich Trump so nahe fühlte, aber das sind solche Gefühle ja selten. Er machte eine Art Entzug durch – im Grunde trauerte er. Trumps bloße Erwähnung in den Abendnachrichten oder in der Zeitung konnte seine Stimmung trüben und ihn in brütendes Schweigen verfallen lassen.
Schließlich aber nahm er seine Reisen nach New York wieder auf. Unter dem Vorwand, an irgendeinem Ärztekongress oder einer Tagung zu einem Thema teilnehmen zu müssen, das irgendwie, und sei es nur peripher, mit seinem Forschungsgebiet zu tun hatte, flog er erster Klasse dorthin, nahm sich ein Zimmer im Plaza, aß im Fresco by Scotto (wo er und Donald einmal Spaghetti mit Hackfleischbällchen gegessen hatten) zu Abend, ging zur Anprobe zu Greenfield Clothiers in Brooklyn, wo Trumps Anzüge gemacht wurden und die Angestellten meinen Vater noch immer als »Mr Trumps Arzt« bezeichneten, und rief dann die Person an, die er, wie ich später erfuhr, noch mehr vermisste als Trump: eine Prostituierte namens Caroline. Von ihrer Existenz erfuhr ich erst nach dem Tod meiner Mutter, und ich muss sagen, ich war schockiert. Nicht weil mein Vater untreu gewesen war, sondern weil er dafür bezahlt hatte. Ich bin mit einem Bild von ihm als einem zu großen Pfadfinder aufgewachsen, einem hilflosen, aber gutwilligen ewigen Jungen, der, getragen von seinen natürlichen Gaben, durchs Leben schlenderte.
Ich hatte angenommen, dass er für die zwielichtigeren Aspekte des Lebens kein Interesse hatte. Ich irrte mich. Für seinen ersten Besuch bei einer Prostituierten brauchte es nicht viel mehr Ermunterung als ein bisschen Männergequatsche zwischen zwei Nachmittagsuntersuchungen, in dessen Verlauf Trump die Freuden von käuflichem Sex in den höchsten Tönen pries. Da er bemerkte, dass mein Vater große Augen machte, und annahm, dass er auf diesem Gebiet keine Erfahrung besaß, gab er ihm eine Telefonnummer. Ich vermute, mein Vater legte erst ein paarmal auf, bevor er der, wie ich mir vorstelle, samtweichen Stimme am anderen Ende der Leitung antwortete, der Stimme der Madame eines Clubs in den East Forties. Es war ein Brownstone-Gebäude nicht weit von den Vereinten Nationen, in dessen erster Etage mein Vater sich eine zierliche, großbusige Blondine mit schmalem Gesicht aussuchte, die offenbar auch Trump schon »kennengelernt« hatte und, wie es hieß, einen Mund aus Samt hatte. Mein Vater vögelte Caroline fünfzehn Jahre lang – ausschließlich sie, wie mir später klar wurde (abgesehen von meiner Mutter natürlich).
Ich erfuhr von ihrer Existenz, als ich entdeckte, dass ich eine Halbschwester in Queens hatte – aber dies ist nicht der rechte Augenblick für diese Pirandello-Geschichte. Ich will nur sagen: Trumps scheinbar opulente Geste oder vielmehr die Sehnsucht meines Vaters nach einem Leben in jener kitschigen Flitter-und-Seide-Schummrigkeit, die Opulenz nur vortäuschte – all dies hatte große Auswirkungen auf die Familie Akhtar. Und sie erklärt etwas, das niemand versteht: Mein Vater unterstützte Trump, und zwar weit über den Punkt hinaus, bis zu dem irgendein vernünftig denkender nicht-weißer Amerikaner (geschweige denn ein Immigrant!) dies vor sich selbst oder irgendjemandem sonst hätte rechtfertigen können. Und ja, die Stadien der Leidenschaft meines Vaters für den Kandidaten Trump (anfangs keimend, dann werdend, dann euphorisch, dann enttäuscht, dann betrogen und verwirrt und schließlich erschöpft, eine Skala intensiver Gefühle, deren Reihenfolge und Wesen wohl denen aller Süchte entsprechen) und eine punktuelle Schilderung seiner Sucht, seiner unvermittelt umschlagenden Gefühle, seiner Ausflüchte, Geständnisse und Widerrufe, seines zunehmenden Verzichts auf Höflichkeit, seiner täglichen Obsession, seiner von Fall zu Fall wechselnden Rationalisierungen – all das könnte uns wertvolle Hinweise liefern und uns, aus der Perspektive des denkbar unwahrscheinlichsten muslimischen Amerikaners, das wahre Ausmaß der furchterregenden Lust am Unwirklichen vor Augen führen, die uns alle erfasst hat. Ja, es könnte von Wert sein, aber ich weiß nicht, ob ich ertrage, es aufzuschreiben. Ich liebe meinen Vater. Ich glaube, er ist ein guter Mann. Ich will nicht Wochen, Monate – womöglich Jahre – für ein Porträt meines Vaters als bedrohlicher Dummkopf aufwenden. Darum muss die kurze Schilderung eines Nachmittags genügen.
Nämlich:
Ein Frühstückslokal in Waukesha, wo wir beim Brunch die einzigen Nicht-Weißen waren. Es war das Wochenende, an dem Trump mit seinen infamen Bemerkungen, mexikanische Einwanderer seien Vergewaltiger und Mörder, ins Rennen um die Präsidentschaft eingetreten war.
»Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst. Er ist ein Showman. Er will Aufmerksamkeit erregen. Er meint es nicht so.«
»Wenn er es nicht so meint, sollte er es nicht sagen.«
»Du bist kein Politiker.«
»Er auch nicht.«
»Warten wir’s ab.«
»Sag nicht, du hältst das für eine gute Idee.«
Worauf er nichts erwiderte, sondern bloß auf die Kellner wies, die allesamt Trikots der mexikanischen Fußball-Nationalmannschaft trugen. »Jedenfalls müssen diese Leute Englisch lernen.«
Und:
Seine lebhafte, zunehmende Schadenfreude angesichts der Debatten im Zuge der Vorwahlen, bei denen Trump die anderen Kandidaten beleidigte. »Sieh sie dir an – lauter Wachsfiguren. Leere Anzüge, leere Worte. Die haben das verdient. Er sagt nur, was alle denken.«
Und:
Trumps Vorschlag, alle Muslime in einer Datenbank zu erfassen, was aber meinen Vater, wie er seltsamerweise glaubte, nicht betreffen würde. »Ich bete nicht, ich faste nicht, ich bin eigentlich gar kein Muslim, und für dich gilt dasselbe. Er meint uns nicht. Und außerdem war ich sein Arzt, also brauchen wir uns keine Sorgen zu machen.«
Und:
Die mentalen Verrenkungen, die er machen musste, um Trumps Quatsch irgendeine Art von Sinn abzugewinnen, und die in mir den Verdacht weckten, er werde vielleicht langsam senil. »Alles, was er über die Medien sagt, stimmt. Die Nachrichten sind manipuliert. Um Geld zu verdienen. Denk doch mal nach. Die berichten nicht, die verkaufen Nachrichten. Und was meinst du wohl, welche Nachrichten die verkaufen? Hm? Dass Donald nicht gewinnen kann. Dass er nicht gewinnen wird. Aber je mehr Stimmen er kriegt, desto weniger wahr ist diese Story. Jeder weiß, dass es eine Lüge ist. Er ist im Aufwind, aber die versuchen, ihn unten zu halten. Er ist ein Kämpfer. Und weißt du, was ein Kämpfer macht? Er kämpft. Und darum lieben wir ihn!« (Was?)
Und:
Der Ausbruch einer Bigotterie, wie ich sie bei ihm niemals für möglich gehalten hätte: Weiße waren faul und dachten nur an ihre Wochenenden und ihren Urlaub; Schwarze bezahlten ihre Arztrechnungen nicht, weil sie noch immer eine Sklavenmentalität hatten und das System als einen Herrn betrachteten, gegen den sie rebellieren mussten; Frauen besaßen ein tieferes Verständnis vom Leben, weil sie Kinder gebaren und zum Leiden erschaffen waren, was übrigens auch erklärte, warum es ihnen gleichgültig war, dass Trump Gemeinheiten über sie sagte – letztlich erwarteten sie nichts anderes; Muslime waren rückständig, weil der Koran Unsinn und der Prophet ein Verrückter war; Juden waren neurotisch, weil die Väter nicht imstande waren, die Mütter zum Schweigen zu bringen und diese die Kinder in den Wahnsinn trieben. Und das ist nur das, was mir auf Anhieb einfällt.
Er war ein umsichtiger Mann oder hatte jedenfalls im Lauf der Jahre mit beruhigender Häufigkeit Anwandlungen von Umsicht gezeigt, doch nun schien er sich in einen Trottel zu verwandeln, und seine krausen Ansichten waren wie mentale Flatulenzen – ein übler Gestank nach dem anderen. Um die Metapher noch ein wenig weiter zu führen: Das Ganze war wie ein Durchfall, eine Infektion seines politischen Bewusstseins, die zu einer ungehemmten, stinkenden Ausscheidung führte. Und noch weiter: Ein Kind scheißt auf den Boden, knetet den Kot mit den Fingern durch und erfreut sich an dem Ekel, den das bei anderen erzeugt. Kindliche Freuden – das war es, in was mein Vater (und wir alle) aufs Neue eintauchten, und Trump war derjenige, der es uns ermöglichte.
Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass mein Vater, der Mann, den ich kenne und liebe, den ich noch immer in vielerlei Hinsicht bewundere, nicht spürte, dass irgendetwas nicht stimmte. Doch irgendwie wollte er das nicht sehen, sondern suchte einen triftigen Grund für den um sich greifenden Verfall. Wie andere begann er sich zu fragen, ob die Verrohung unseres Lebens nicht vielleicht ein Akt der Befreiung war, ein notwendiges Ätzmittel, der Anbruch einer neuen Ära politischer Wahrhaftigkeit. Selbst im unfassbaren Oktober 2016, als der Mitschnitt von Trumps Bemerkung, man müsse den Frauen zwischen die Beine fassen, und Comeys Brief an den Kongress veröffentlicht wurden und wir uns zum Gespött der Welt machten; selbst Ende Oktober, als der Glaube meines Vaters, wie es schien, infolge von Trumps ständigen Grenzüberschreitungen, seiner geistigen Beschränktheit, seiner offensichtlichen Bosheit und seinen ekelhaften Bemerkungen über Frauen und ihre Geschlechtsorgane ins Wanken geriet; selbst noch eine Woche vor der Wahl sagte er mir am Telefon, Trump habe zwar seine Fehler, sei aber der bessere Kandidat. Ich ertrug es nicht mehr.
»Dad. Ich verstehe dich nicht. Was siehst du bloß in diesem Kerl? Er ist ein Lügner. Er ist ein Lügner, ein bigotter Mensch, er ist inkompetent –«
»Er ist eigentlich nicht bigott.«
»Tja, dann hat er alle getäuscht. Ich verstehe jedenfalls nicht, was du in ihm siehst.«
»Das habe ich dir doch gesagt: Er ist eine Abrissbirne.«
»Du warst auf Facebook und hast einen Brief gelesen, den irgendein Schüler an seinen Lehrer geschrieben hat. Den kenne ich.«
»War doch gut, oder?«
»Dad! Du bist kein Bergmannssohn aus West Virginia oder wo dieser kleine Scheißer wohnt –«
»Keine Kraftausdrücke, beta. Beruhige dich.«
»Ich werde mich beruhigen, wenn ich verstehe, warum es dir egal ist, dass dieser Kerl, der uns, wenn er erst mal Präsident ist, das Leben schwer machen wird, warum es dir nichts ausmacht, dass –«
»Das meint er nicht so. Das sind nur starke Sprüche.«
»Woher weißt du das?«
»Du weißt, woher ich das weiß. Ich kenne ihn.«
»Du hast seit zwanzig Jahren nicht mehr mit ihm gesprochen.«
»Achtzehn. Würdest du dich jetzt bitte beruhigen?«
»Du hast sie gezählt?«
»Er will Aufmerksamkeit, das ist alles. Ich habe gehört, er will einen neuen Fernsehsender gründen.«
»Beantworte mir nur eine Frage, Dad. Nur eine. Eine einzige. Spielt es für dich keine Rolle, dass deine Kinder davon betroffen sein könnten?«
»Dir wird’s prima gehen.«
»Deine Schwestern in Florida, die Tanten, die Cousinen und Cousins?«
»Reg dich nicht auf.«
»Nein, Dad, ich will wissen, was du denkst. Ich weiß, dass du denkst, sie werden dich nicht als Muslim erfassen, aber –«
»Du wirst sehen, es wird keine Erfassung geben.«
»Und was ist mit dem Einreiseverbot, von dem er redet? Hm? Was ist, wenn Mustafa und Yasmin uns nicht mehr besuchen können?«
»Ich sage, reg dich nicht auf.«
»Und dann? Was kommt dann? Wie lange wird es dauern, bis sie dir sagen, dass du kein richtiger amerikanischer Staatsbürger bist, weil du nicht hier geboren bist?«
»Das wird nicht passieren.«
»Oder ich? Weil ich der Sohn von jemandem bin, der ihrer Meinung nach nie die Staatsbürgerschaft hätte kriegen dürfen.«
»Du bist berühmt. Niemand wird dir irgendwas tun.«
»Ich bin nicht berühmt.«
»Du stehst andauernd in der Zeitung.«
»Dass ich in Milwaukee in der Zeitung stehe, macht mich noch lange nicht berühmt. Und ich verstehe nicht, was das damit zu tun hat.«
»Außerdem wird er nicht gewinnen.«
»Außerdem?«
»Du bist intelligent genug, um das zu erkennen. Er will gar nicht gewinnen. Er will eine Botschaft senden.«
»Ich denke, er will einen neuen Fernsehsender gründen.«
»Das ist doch dasselbe.«
»Er führt einen Wahlkampf, den er nicht gewinnen will, damit er einen Fernsehsender gründen kann, um eine Botschaft zu senden?«
»Genau.«
»Und diese Botschaft lautet?«
»Das System ist kaputt.«
Was mich an dieser selbstbezogenen Sophisterei so verrückt machte, war die Tatsache, dass mein Vater das alles vollkommen einleuchtend fand.
»Du weißt nicht, was du da sagst, Dad.«
»Ich sage, er wird nicht gewinnen. Also beruhige dich.«
»Und woher weißt du das?«
»Von Nate Silver.«
»Und wenn er doch gewinnt?«
»Wird er aber nicht.«
»Aber wenn doch? Ich meine, du sagst doch selbst, dass er der bessere Kandidat ist.«
»Ist er auch.«
»Inwiefern?«
»Er will die Steuern senken.«
»Das kann nicht dein Ernst sein.«
»Wenn du mehr Geld verdienen würdest, würdest du das verstehen.«
»Im letzten Jahr hab ich mehr verdient als du.«
»Wurde ja auch Zeit.«
»Das klingt so, als hättest du vor, ihn zu wählen.«
Ein kurzes Innehalten. »Nein.«
»Klingt aber so. Und ich muss sagen, ich weiß noch immer nicht, was du gegen Hillary hast.«
»Ich habe nichts gegen sie. Aber wir brauchen eine Veränderung.«
»Ist es, dass sie eine Frau ist? Ich meine, sie kann nicht mehr schwanger werden, also dürfte das für dich eigentlich kein Problem sein.«
»Dein Ton gefällt mir nicht.«
»Was würde Mom sagen? Wenn sie noch da wäre?«
»Worüber?«
»Was hätte sie wohl gesagt, wenn ihr einer zwischen die Beine gegriffen hätte?«
»Du vergisst dich!«
»Mochte Caroline das? Mochte sie es, wenn du ihr zwischen die Beine gegriffen hast?«
»So redest du nicht mit mir, verdammt! Hast du gehört? Ich bin noch immer dein Vater!«
Mein Herz klopfte. Er hatte recht. Ich hatte eine Grenze überschritten. Ich litt Schmerzen. Ich wollte ihm wehtun. Mir war das, was geschah, zuwider. Was mit ihm geschah. Mit dem Land. Mit mir. Ich wollte ihm sagen, es tue mir leid. Dass nicht ich das gesagt hatte. Eigentlich nicht. Dass es vielmehr das war, was Trump mit uns allen machte. Aber das tat ich nicht. Ich wusste, dass er es nicht verstehen würde.
Am Wahltag war ich in Chicago. Man hatte mich zu einem Seminar an der Northwestern University eingeladen, und so hatte ich eine Woche früher gewählt, und zwar in der Kirche in Harlem, in der ich meine Stimme bei vier der letzten fünf Präsidentschaftswahlen einem Demokraten gegeben hatte. Ich erinnere mich an die beinahe überschäumende Gelöstheit, die auf dem Campus zu spüren war, an die aufgekratzte Gewissheit, dass der Trump’sche Wahnsinn nun endlich vorbei sein würde. Meine leise Bangigkeit, Trump könnte vielleicht doch gewinnen, gestand ich niemandem ein. Ich hatte in den vergangenen Wochen eine Veränderung an mir festgestellt, eine neue, suchtartige Abhängigkeit von meinem Handy, einen heftigen Drang, der aber gar nicht dem Gerät selbst galt, sondern dem täglichen Tosen der Empörung über Trump, das es übermittelte. Ich erinnere mich, dass ich in den letzten zwei Wochen vor der Wahl ein Verlangen nach Heimsuchungen entwickelte. Nacht für Nacht träumte ich von ihm. Einmal ejakulierte ich in einem Albtraum über Trumps Frauen und Töchter, einer verschworenen Gruppe vollbusiger Blondinen, die reihum ihren Lippenstift auf meinem Penis hinterließen. Jeden Morgen griff ich als Erstes nach dem Handy. Eine solche Fixiertheit hatte ich noch nie erlebt. Ich spürte Trump, wie ich mich selbst spürte, Medium und Botschaft wurden eins. Und ich war besorgt, dass ich nicht der Einzige war. Wenn es anderen ebenso ging, verhieß das nichts Gutes. Die unwahrscheinliche Geschichte seiner Kampagne, die blitzartigen Haken, die sie geschlagen, die perverse Lust, die sie bereitet hatte – erforderte eine derart wahnsinnige Story nicht auch ein ebenso wahnsinniges Ende? Der Schriftsteller in mir wusste, dass Geschichten nicht aus Moral, sondern aus Bewegung bestehen, dass sie nicht Harmonie, sondern ein Ende brauchen und oft gerade die Schrecken heraufbeschwören, die durch das Schreiben gebannt werden sollten. Als Schriftsteller wusste ich das. Aber da waren der Zeiger am Gebäude der Times und Nate Silvers rote und blaue USA-Karte auf FiveThirtyEight.com. Beide versicherten mir, meine Sorge sei unbegründet.
Bis sie es nicht mehr versicherten.
Als die ersten Ergebnisse gemeldet wurden, beunruhigten mich die aus Wisconsin am meisten. Ich kannte den Staat gut und wusste, dass die bereits ausgezählten Stimmen aus Bezirken stammten, wo Hillary die meisten Unterstützer hatte, und darum verstand ich nicht, warum die Kommentatoren die Zuwächse für Trump nicht für entscheidend hielten. Es dauerte noch eine Stunde, bis der Zeiger am Times-Gebäude zur anderen Seite ausschlug und Nate Silvers Karte sich rot färbte.
Um halb elf, als mir klar war, dass Trump nicht nur meinen Heimatstaat, sondern vermutlich auch die Wahl gewonnen hatte, rief ich meinen Vater an. Er hatte getrunken. Ich konnte seine Stimmung nicht einschätzen.
»Sitzt du vor dem Fernseher?«, fragte ich.
»Sieht ganz so aus, als würde er gewinnen«, sagte er mit schwerer Zunge. Im Fernsehen zeigte John King das Ergebnis aus Sheboygan County, wo mein Vater seine Praxis gehabt hatte. »Sheboygan auch?«, hörte ich ihn verwirrt sagen.
»Hast du gewählt?«
»Was?«
»Ob du gewählt hast, Dad.«
»Was geht dich das an?«
»Ich weiß nicht. Wir haben ja oft genug darüber geredet.«
»Da hast du verdammt recht – wir haben oft genug darüber geredet.«
»Du klingst, als würdest du dich ärgern.«
»Hm?«
»Du klingst, als würdest du dich ärgern.«
»Er gewinnt. Siehst du das nicht?«
»Hast du denn nicht für ihn gestimmt?«
»Verdammt, ich hab dir doch gesagt, darüber spreche ich nicht.«
Dann legte er auf.
Er sagte mir nie, wen er gewählt hatte, aber die Scham in seiner Stimme war unverkennbar. Ich glaube, an jenem Abend gab er zu – und zwar auf die einzige Art, wie es ihm möglich war –, dass er es getan hatte. Wider besseres Wissen hatte er Trump gewählt.
Ich fragte mich, was ihm wohl durch den Kopf gegangen war, als er in der Vorortgemeinde, in der er lebt, den Allzwecksaal des altmodischen Rathauses betreten hatte, wo an jenem Tag vermutlich hauptsächlich jene Weißen waren, die seiner Meinung nach zu viel an ihren Sommerurlaub dachten. Ich fragte mich, ob er es schon wusste, als er seinen Ausweis vorzeigte und sich in die Schlange stellte. Und was fühlte er, als er in die Kabine trat, den Vorhang zuzog und auf die Namen starrte? Was trieb ihn, die Hand nach dem kleinen Hebel auf der roten Seite auszustrecken und ihn zu drücken? Ich fragte mich, ob irgendein Teil von ihm nicht glauben konnte, dass er das wirklich tat, oder ob er es für unerheblich hielt – denn galt es zu diesem Zeitpunkt nicht als ausgemacht, dass Hillary gewinnen würde? Und wenn er Trump nur wählte, weil er annahm, dass sie gewinnen würde – was wollte er dann damit sagen? Welchem privaten Gedanken, welchem Gefühl folgte er? Welche Treue wollte er nicht verraten? Ich glaube nicht, dass es aus Frauenfeindlichkeit geschah; er verehrte Benazir Bhutto – als sie ermordet wurde, war er am Boden zerstört. Nein, ich glaube, es war eine tiefe Liebe zu Donald Trump.
Wodurch fühlte er sich diesem Mann so sehr verbunden? War es wirklich bloß die Erinnerung an die Hubschrauberflüge, die geräumige Suite, die Prostituierte, das Maßband des Schneiders, eine Anstecknadel? Konnte es wirklich so banal sein? Oder stand das alles stellvertretend für etwas anderes, etwas Größeres, Ungreifbares? Mein Vater bezeichnete Amerika immer als Land der Möglichkeiten. Nicht sehr originell, ich weiß. Aber ich frage mich: Möglichkeiten für wen? Für ihn doch, oder? Die Möglichkeit, das zu werden, was er sein wollte? Ja, natürlich auch für andere, aber nur insofern, als mit andere eigentlich er gemeint war. Und ist es nicht das, was Mary vor vielen Jahren gesagt hat? Dass unser gepriesener amerikanischer Traum, in dem wir selbst so viel größer und stärker sind, in Wirklichkeit die Flagge ist, für die wir bereit sind, alles zu opfern – unsere Nachbarn zu erpressen, unsere Nation zu beschmutzen. Oder vielmehr: für die wir bereit sind, alles zu opfern außer uns selbst. Ein Traum, in dem das Gedeihen anderer nichts weiter als ein Wegweiser ist, ein Stachel des Neids, der nötige Ansporn zur eigenen überaus wichtigen Selbstverwirklichung. Ist es vielleicht das, was mein Vater in Trump sah? Eine Vision von sich selbst, unglaublich vergrößert und vergröbert, befreit von der Last der Schulden, der Wahrheit oder der Geschichte, befreit von aller Konsequenz, ganz der reinen Selbstbespiegelung hingegeben, vollkommen aufgegangen in der individualistischen Verheißung der amerikanischen Ewigkeit? Ich glaube, mein Vater suchte nach einem Bild, das zeigte, wie viel mehr sein amerikanisches Ich enthalten konnte als das pakistanische Ich, das er zurückgelassen hatte. Ich glaube, er wollte wissen, wo die Grenze war. In Amerika konnte man alles haben, oder? Sogar die Präsidentschaft? Wenn ein Idiot wie Trump es schaffen konnte, müsste man selbst es doch auch schaffen können. Selbst wenn man die Präsidentschaft gar nicht wollte. Immerhin wollte dieser Idiot sie offenbar auch nicht. Er wollte nur wissen, dass er sie haben konnte. Aber vielleicht muss man hier die Betonung verschieben: Er wollte nur wissen, dass er sie haben konnte.
Ja. Ich glaube, so stimmt es.
An anderer Stelle habe ich Trumps Triumph als Vollendung des lange angestrebten Aufstiegs der Kaufmannsklasse ins Allerheiligste der amerikanischen Macht bezeichnet, als Endpunkt des Eroberungszugs des Merkantilismus und der ihm innewohnenden Vulgarität, in dessen Verlauf jede moralische Richtschnur durch reines Gewinnstreben ersetzt worden ist, als ein Ereignis in unserem politischen Leben, das zwar nicht den Kollaps der Demokratie verkündet – die dieses Ereignis überhaupt ermöglicht hat –, wohl aber die Schleifung aller Bollwerke gegen jenes Streben nach gottgefälligem Reichtum, das offenbar die einzige verbliebene amerikanische Leidenschaft ist. De Tocqueville wäre nicht überrascht. Und mein Vater ist keine Ausnahme. Trump ist nur der Name dieser Geschichte.