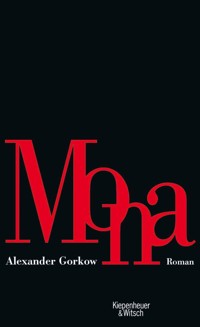9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine moderne Tragikomödie über unsere Sehnsucht nach dem Meer, Urlauben der Kindheit und Träumen, die ein Leben lang halten. Nach mehr als 30 Jahren kehrt Alexander Gorkow ins Paradies seiner Kindheit zurück: ins mallorquinische Dorf Canyamel. Hier verbrachte er einst prägende Urlaube mit seiner Familie - der Mutter, der Schwester und dem gütigen wie exzentrischen Vater. Nun reist Gorkow als preisgekrönter Reporter und vom Leben gezeichneter Familienvater erneut an die Nordostküste Mallorcas. In Hotel Laguna entspinnt sich eine berührende Erzählung über Erinnerungen an Sommerferien, damals und heute, die Menschen unseres Lebens - und die ewige Sehnsucht nach dem Meer. »Alexander Gorkows melancholische Familiengeschichte ist eine Liebeserklärung an Mallorca, an Ferien der Kindheit und an Träume, die man sich lange darüber hinaus bewahrt.« Petra »Das Buch hat Herz und Witz und: eine große Seele.« Matthias Brandt »Das schönste Buch des Sommers« Christine Westermann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Alexander Gorkow
Hotel Laguna
Meine Familie am Strand
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Alexander Gorkow
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Alexander Gorkow
Alexander Gorkow, 1966 in Düsseldorf geboren, studierte Germanistik, Mediävistik und Philosophie; seit 1993 arbeitet er bei der Süddeutschen Zeitung in München und zählt als Reporter, Essayist und Interviewer zu den renommiertesten Journalisten des Landes. Er wurde ausgezeichnet mit dem Theodor-Wolff-Preis und dreimal mit dem Deutschen Reporterpreis. Seit 2009 leitet er die Seite Drei der SZ. Bei Kiepenheuer & Witsch veröffentliche Alexander Gorkow 2007 den Roman »Mona« und 2008 den Band »Draußen scheint die Sonne«, eine Auswahl seiner Interviews. 2013 war er Herausgeber des Gedichtbandes »In stillen Nächten« von Till Lindemann.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Eine ereignisreiche Ewigkeit lang war er nicht mehr in der kleinen Bucht von Canyamel auf Mallorca, wo er seit den späten 60ern prägende Kindheitsurlaube verbrachte. Plötzlich aber fragt sich der weit gereiste Autor und preisgekrönte Journalist: Was wurde eigentlich aus Canyamel? Eine Erforschung mit Vollpension nimmt ihren Lauf, auch eine Komödie in der alten, zugleich völlig neuen Welt. Das Hotel Laguna ist bloß ein liebenswertes, altes Familienhotel. Für Alexander Gorkow aber gehört es zu den schönsten Hotels der Welt, denn in der Bucht von Canyamel fand er die Heimat in der Fremde. Hier kam die Familie zur Ruhe, hier fand sie zu sich und entkam der Einflugschneise, in deren Lärmkorridor sich der Alltag in einem Vorort Düsseldorfs abspielte. Mit seinem bewunderten Vater, einem lässigen wie exzentrischen Kleinfamilienpatriarchen, lief Alexander Tag für Tag in die siedend heiße Telefonzelle: die einzige Verbindung zur Außenwelt. Zurück in Canyamel, mehr als 30 Jahre später, in einer Welt, die nicht mehr die alte ist, trifft er nun Freunde von damals – und findet neue. Ausgerechnet seine Rückkehr auf die »Insel der Deutschen« wird zur Reise seines Lebens. Hier sieht er klar: seine, unsere Träume und Verluste.
Gorkows leidenschaftliches und sehr heiteres Buch ist zugleich Familienroman und Mentalitätsgeschichte: über unsere Urlaube, unser Land und unsere Sehnsüchte.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2017, 2019, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Alexander Gorkow, Mitternachtsfeuerwerk in der Bucht von Canyamel, Juli 2016
Lektorat: Olaf Petersenn
ISBN978-3-462-31787-9
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Das Paradies
Der Plan
In der Einflugschneise
Meine Leute
Die Telefonzelle
Teo
Das Gespräch mit dem Mond
Pleasuredome erect
Die schwarzen Ziegen der Familie
Der Untergang Mallorcas
Zerstreuung
Die Metaphysik der Esel
Adorno 2016
Schönheit
No porn
Service
Abschied
Südwind
Foto: Der Autor mit seinem Vater
Foto: Der Autor heute
Das Sonnenlicht der
Kindheit hat immer
einen anderen Glanz.
Rafael Chirbes
Das Paradies
Eine kurze Einführung in die Kindheitsbucht, die ersten Tiere erscheinen in der Wirklichkeit, aber auch in Hotel- und Häusernamen
Im Jahr 1967 begann der Mallorca-Boom, sowohl der deutsche wie der unsrige. Ich war noch klein, erst ein Jahr alt, aber meine Eltern und meine Schwester, die schon sieben war, redeten in diesem Sommer auf die Esel ein, die auf den trockenen goldfarbenen Wiesen herumstanden, uns zuhörten und schauten, als ob sie etwas wussten oder sich dachten oder immerhin ahnten.
»Esel heißt burro«, sagte mein Vater. Kam einer von uns dem jeweiligen Esel zu nah, mahnte mein Vater zur Vorsicht: »Provoziert ihn nicht, er schnappt sonst unweigerlich.« Ich habe aus dem Mund meines Vaters außer dem Namen meiner Mutter kein Wort so oft gehört wie unweigerlich.
Im Sommer des Jahres 1967 lebten wir im Nordosten Mallorcas, in der kleinen Bucht von Canyamel zwischen Cala Ratjada und Son Servera, in einem würfelförmigen Haus mit hellblauen Fensterläden. Das Haus hieß Le Bœuf, das Rind, keiner weiß mehr, warum.
Heute vermuten die Leute in Canyamel, und so auch mein Freund Juan, der Direktor des Hotels Laguna: weil das Le Bœuf einst von algerischen Auswanderern hier hingebaut worden war, den pieds-noirs, die in ihrer Heimat wie später auch in Frankreich behandelt wurden wie Dreck, also zogen sie an den Llevant und schauten von der anderen Seite auf das Meer. Das Haus steht heute noch an derselben Stelle, heißt aber nicht mehr Le Bœuf, es ist zugewachsen, und neben dem Haus ist eine Baubrache, in der, wie so oft in Spanien, und vermutlich im Jahr der großen Krise 2008, etwas angefangen und dann nicht beendet wurde. Es gibt dann noch ein paar bescheidene und ein paar bessere Ferienhotels, und bleiche Urlauber ziehen im Ort Frauen und Kinder hinter sich her, als sei auch dieser Urlaub, wie alles andere daheim in Deutschland, vor allem etwas, das bewältigt werden muss.
Im Jahr 1967 war es kahl und alleine, das Haus, so wie heute manchmal Häuser in preisgekrönten Fotografien im Algerien Albert Camus’ herumstehen, daneben nur ein paar wenige Häuser in zweiter Reihe. Unter Schweizer Führung lag direkt am Strand das Hotel Laguna, erbaut 1963, da waren aber nur die ersten drei Stockwerke fertig, dann war erst einmal kein Geld mehr da gewesen. Endgültig sechs Stockwerke hat es erst seit 1964. Meine Mutter hätte gerne im so verheißungsvoll dastehenden Laguna Urlaub gemacht, aber mit der Globalisierung des Reisewesens war es noch nicht weit her. Der Reiseunternehmer Alfred Erhart, der das Laguna baute, war Schweizer, sein Unternehmen Universal Reisen war ein Schweizer Unternehmen, also machten dort Schweizer Urlaub, keine Deutschen.
Am Strand lag meine schöne Mutter, sie wendete sich zum mystischen Laguna um, das weiß mit seinen hübschen roten Fensterläden dastand, als wäre dies hier Miami oder die Côte, und wieder und wieder sagte meine Mutter traurig: »Es ist in Schweizer Hand, es ist nur für Schweizer.«
Weiter hinten wurde von Herrn Gero Gödecke aus Hannover gemeinsam mit dem aus Argentinien ausgewanderten Miguel Blanche das kleine Hotel Mi Vaca Y Yo (Meine Kuh und ich) erbaut. Hier nun würden wir in den folgenden Jahren wohnen, wenn wir nach Canyamel kamen. Anders als im Le Bœuf gab es in der Vaca Service. Miguel Blanche bewohnte in seinem Hotel ein winziges, gegen die Sonne abgedunkeltes, kühles, vertrauenerweckend nach Zigarrenrauch und einem süßen spanischen Herrenparfüm duftendes Apartment in Parterre mit Wuchtmöbeln, Zierdecken und einem Ölgemälde, das die argentinische Pampa zeigte. Mit weißem Hemd, Pullunder, nur matt schattierter Sonnen-/Weitsichtbrille, mit geöltem, nach hinten gekämmtem Haar und einem Schnurrbart patrouillierte er gemeinsam mit dem Schäferhund Chico durch den botanischen Vorgarten des Hotels. Miguel schnarrte mit dem Personal, mit den Gästen. Sah er mich, legte er seine behaarte argentinische Hand auf meinen damals noch sehr kleinen rheinischen Kopf und brüllte: »Caballero!« Lange lag die Hand auf dem Kopf. Endlich war etwas los. Meine einheimischen Freunde Patricia und Pedro machten seit zwei Stunden Siesta und noch eine weitere Stunde würden sie fehlen. Täglich von dreizehn Uhr bis sechzehn Uhr fehlten sie. Ich wusste, dass man sich mittags hinlegt. Mein Vater machte es daheim und im Urlaub auch so. Aber wieso fehlten Patricia und Pedro so lange?
Ich nahm an, dass sie unter einer Krankheit litten, offenbar wurden sie jeden Tag gewissermaßen ohnmächtig und mussten sich erholen, ich musste Rücksicht nehmen. Seine Hand auf meinem Kopf. Seine großen Augen glotzten durch die getönte Brille. Ich stand kerzengerade.
»Miguel?«
»Wo ist der Papa, Caballero?«
»Weiß nicht.«
»Was machst du?«
»Weiß nicht.«
»Du weißt nicht, was du machst? Wo ist die Mama, Caballero?«
»Weiß nicht.«
Dann beugte er sich herunter, ich durfte seinen Schnurrbart berühren, ein schwerer schwarzer Balken, von dem meine Schwester erzählt hatte, der Balken sei ein Tier, es sei aber tot. Ich hatte ihr nicht geglaubt, aber wer weiß, ich berührte den Balken immer nur vorsichtig.
Die Vaca war ein längliches, zweistöckiges Apartmenthaus, etwas weiter hinten im Ort, eine schmale Straße führte hinauf. In wenigen Jahren wuchs alles drum herum zu, und dass alles zuwuchs und Schatten und Sauerstoff spendete, das war das Ziel. Blüten, groß wie Fußbälle. Der Name für das Hotel Mi Vaca Y Yo wurde von Miguel Blanche der Legende nach in Sekunden erfunden, und zwar erst, als das Hotel Ende 1967 fertig gebaut war. Zwar gibt es in Canyamel die Theorie, dass die Vaca zu ihrem Namen kam, weil bis zum Bau der Vaca nun mal Kühe auf jener Wiese herumgestanden hatten (in ganz Canyamel standen bis dahin Kühe herum und eben Esel). Aber Miguel hatte die bessere Geschichte, und wer die bessere Geschichte hat, geht als Sieger vom Platz.
Die bessere Geschichte: In das Restaurant seines argentinischen Heimatdorfes in der Pampa kam eines Tages, als Miguel Blanche noch klein war, ein alter Mann, und zwar nicht alleine. Als der alte Mann das Lokal betreten hatte, wunderten sich der kleine Miguel und sein Vater über den gespannten Strick, den der Mann in der Hand hielt und der nach draußen führte. Er knurrte nach hinten, zog an dem Strick, und so folgte dem Mann ins Lokal eine Kuh.
Der Wirt brüllte: »Wer seid ihr denn?«
Der Mann brüllte: »Wer? Wir?«
»Wer sonst?«
»Wir sind meine Kuh und ich!«
Dann trank der Mann ein Bier, aß einen Teller Bohnen und ging mit der Kuh wieder hinaus. (Damals wurden noch nicht viele Worte gemacht.)
So weit die Legende. Tiere: Chico, der Hund, das Hotel Meine Kuh und ich, dann die Sache mit den Eseln. Wir waren fanatisch hinter Eseln her, wir umarmten und küssten sie. Wurden wir ihrer habhaft, zogen wir an ihnen und klopften auf ihnen herum, machten Fotos, lasen Bücher über sie, sogar Bücher, in denen sie laut Titel eine Rolle spielten und dann doch kaum vorkamen. In meinem Bücherregal steht heute noch eine schwere, alte Ausgabe von »Der Mann auf dem Esel« der britischen Historikerin Hilda Francis Margaret Prescott (1896–1972), erschienen Anfang der 1950er-Jahre. Mein Vater war an historischen Büchern so interessiert, wie er im Grunde an allem ständig interessiert war, aber Prescotts fast achthundert Seiten starkes, mit aufwendigen Landkarten versehenes Werk über Heinrich VIII. hatte ihn offenbar enttäuscht. Irgendwann einmal zog ich das Buch aus dem Regal und fragte ihn: »Gut?«
Er schaute über die Kante der Zeitung, wischte den Zigarettenrauch aus der Luft, er war in Gedanken, und wenn das so war (und es war oft so) und man störte ihn, benahm er sich, als habe man ihn geweckt. Er legte die Zeitung runter, er kam von weit her, er fragte: »Was ist das für ein Buch? Bring nicht die Bücher durcheinander!«
»Prescott, Der Mann auf dem Esel. Ist es gut?«
Er schob sich wieder hinter die Zeitung, ich hörte eine Weile nichts, er inhalierte, eine neue Rauchwolke, dann sagte er: »Esel kommen quasi nicht vor.«
Lebende Tiere spielten in unseren Urlauben eine große Rolle. Daheim am Niederrhein interessierten Tiere uns wesentlich, wenn sie tot und zubereitet worden waren. Lebend fanden wir vor allem die Vögel im Garten schön. Dann hatten wir noch einen störrischen Hund, dem ich mal den Rindermarkknochen abnehmen wollte, um ihn fertig abzunagen. Ich war damals noch klein, aber immerhin kurz vor der Einschulung, meine Mutter hörte das Geknurre und führte mich vom Hund weg, der immer, wenn ich mich linkisch näherte (»Na, alles okay?«), kurz aufhörte zu nagen und die Zähne fletschte.
Der Hund ging nicht gerne Gassi, er ging einige Schritte und setzte sich dann so lange auf den Bürgersteig, bis wir mit ihm wieder hineingingen. Meine Mutter blieb beim Warten auf den Hund mondän. Sie fuhr sich durch die dunklen Locken, zupfte an ihrem lilablauen Missonimantel herum, schaute auf den Hund herunter und machte einen schiefen Mund. Man sah sie auf der Bonhoefferstraße dann eine Weile auf den Hund einreden, der sie nicht anguckte. Dann zündete sie sich eine Zigarette an und rauchte sie in Ruhe zu Ende, während der Hund erst saß und sich dann hinlegte. Langsam schüttelte meine Mutter den Kopf und ging schließlich mit dem Hund wieder hinein.
Ging mein Vater mit dem Hund Gassi, hörte man ihn sogar durch das geschlossene Küchenfenster reden, denn mein Vater nahm dem Hund sein Verhalten übel, anders als meine Mutter fühlte er sich vom Hund provoziert. Zwar rauchte auch er, aber dabei schnauzte er auf den zwischen seinen O-Beinen herumliegenden Hund ein: »Allez-hop!« Er ging einige Schritte vor. »Woooooosses Herrchen? Geeeehdes Herrchen allein zum Rhein?« So weit reichte daheim das Interesse an den Tieren, die nicht die geliebten Vögel im Garten waren.
In der Ferne hingegen, in Canyamel, trafen wir keine Tiere, sondern sie erschienen uns, Tiere aller Art, sie spielten eine Rolle, und wie man sehen wird, wird das nach meiner Rückkehr in die Bucht viele Jahrzehnte später wieder so sein: Ich werde mit Pferden und Eseln reden, mit Möwen, Kormoranen und Bergziegen, über einige Monate, die ich als inzwischen fünfzigjähriger Mann alleine in Canyamel verbringen werde, also ohne meine Frau, meine Tochter und meine Söhne. Ich werde, da ich nicht immer meinen alten und neuen mallorquinischen Freunden auf die Nerven fallen darf mit meinen vielen Fragen, Weisheiten und Gefühlen: mit diesen Tieren sogar das eine oder andere längere Gespräch führen. Außerdem werde ich beim täglichen Morgenbad im Meer, also meiner Schwimmtour zum Embarcador del Rei, plötzlich einem Delfin begegnen, immerhin sehe ich seine Flosse direkt vor meiner Schwimmbrille auftauchen. Wenn man die Flosse eines Delfins sieht, zumal, wenn man schon eine Dreiviertelstunde geschwommen ist, verharrt man nicht, niemand hat einem das wunderbare Ereignis angekündigt, und so ist man dann halt überrascht. Ein Delfin, wie romantisch. Dann, kurz danach schon, denkt man: Und wenn es die Rückenflosse von einem anderen Tier ist? Schnell schwimmt man an den Strand zurück. Angst macht dumm.
Miguel, der mit seinem Schnurrbart und mit Chico auf vielen unserer Urlaubsfotos herumsteht, meine Mutter, meinen Vater, meine Schwester im Arm, mich auf dem Arm, er war damals, Ende der 60er, Anfang der 70er, schon sehr, sehr alt, wie mir schien, Mitte vierzig. Heute sind alte Menschen immerhin von Weitem nicht mehr so gut von den Jungen zu unterscheiden, denn auch alte Menschen (allerdings keine alten Mallorquiner, nur alte Deutsche) tragen in unseren Sommern T-Shirts, auf denen »Rave Society« steht oder »Markisen Klaiber«, oder es steht dort »Elektro Loibl« und drunter eine Telefonnummer und »www.elektro-loibl.de«.
Vor Jahren kaufte mein Freund Juan Massanet, der Direktor des Laguna, die runtergekommene, verschimmelte Vaca. Es kam zu einer Totaloperation außen und innen, helle Farben, die alte dunkle Bar raus, eine neue weiße Bar rein, statt Bedienung ein Buffet und ein neuer Name: Canyamel Sun. Als ich Juan im Sommer 2016 sage, dass der alte Name Mi Vaca Y Yo schöner war als Canyamel Sun, fragt Juan mich, ob ich ihm den schönen alten Namen bitte erklären könne, denn: »Meine Kuh und ich – auf Spanisch, welcher Tourist soll sich diesen Namen merken, mein Freund, hm?«
»Wir haben ihn uns gemerkt, Juan.«
»Ihr seid ja auch verrückt gewesen. Ihr habt mit Eseln geredet. Kein Mensch kann mit einem Namen, in dem eine Kuh vorkommt, heute etwas anfangen. Leute, die mit Eseln reden und ganze Spanferkel verschlingen, die vielleicht. Sonst niemand.«
»Mi Vaca Y Yo ist ein poetischer Name, Juan. Die Poesie ist rätselhaft. Es ist nicht schlecht, wenn Dinge rätselhaft sind. Sie tragen ein Geheimnis in sich. Dinge, die ein Geheimnis in sich tragen, machen süchtig. Das Problem heute ist nicht, dass die Dinge zu rätselhaft sind, im Gegenteil: Es ist vieles zu banal. Das macht uns alle fertig, dich doch auch, Juan, ich weiß es.«
»Was redest du da?«
»Ich versuche es dir zu erklären.«
»Du bist verrückt.«
Dann schaut er traurig in sein Whiskyglas. Sofort verzeihe ich ihm alles. Still und zärtlich sitzen wir nebeneinander.
»Vielleicht ist der neue Name nicht besonders originell«, sagt er plötzlich. »Aber so heißt die Vaca jetzt nun mal. Ich kann den Namen nicht wieder ändern. Die Vaca heißt jetzt Canyamel Sun.« Er tut mir jetzt so leid, dass ich ihn umarme. Was maße ich mir an, meinem eingeborenen und hier sein Leben lebenden Freund mit blasierten Vorschlägen zu kommen? Ich Arschloch.
Juan erhebt sich, wie immer fasst er sich dabei kurz an den unteren Lendenwirbel und verzieht das Gesicht im Schmerz. (No sports.) Dann geht er in sein Büro und kehrt mit einer alten Kachel zurück, in eine Serviette verpackt: »Ein Geschenk. Diese Kachel habe ich bei der Renovierung gerettet, mein Lieber.«
Die Kachel ist hellblau, darauf in Dunkelblau eine tuscheartige Zeichnung, die davon erzählt, was es 1967 bedeutete, in den Urlaub zu fahren: ein Mann mit Pagenschnitt, Hut und im Anzug, untergehakt eine fast schon asiatische Märchenprinzessin, seine Frau mit einem Vogelkäfig (das Vögelchen kommt also tatsächlich mit in den Urlaub), etwas dahinter schwebt mit zwei Köfferchen und Flügeln das Kind. Unterhalb des Motivs das Signet der Vaca: die Kuh unter dem Sonnenschirm. Urlaub in der Vaca, so erzählt diese Kachel, auf die ich im Sommer 2016 starre wie auf ein Artefakt aus dem Bernsteinzimmer, das war damals, in den Jahren ab 1967 leicht, heiter und schön. Zwar war der massenhafte Andrang aus Nordeuropa nach Spanien wesentlich eine Erfindung des Diktators Franco gewesen, es sollte Geld ins Land. Aber die Menschen, wir, durften Vögelchen in Volieren mitnehmen. Kindern wuchsen Flügel auf dem Weg an diesen Traumort.
Ich umarme Juan und bitte ihn um Verzeihung für meinen blasierten Auftritt von eben. Ich denke an die mit Kuhfell überzogenen Barhocker aus der Vaca, an die Sodaflaschen mit dem Sprühhebel aus glänzendem Chrom, mit denen ich 1970 den Frauen aus Hannover, Düsseldorf und Bremen ins Gesicht sprühte, weil es jedes Mal eine Freude war, wie sie losquiekten und ein Aufruhr in dem schmalen, nach Rauch, Anisschnaps und Parfüm riechenden Raum losbrach. Ich, bei meinem Vater auf dem Arm, irgendwann einschlafend, den Kopf auf seiner Schulter, im Rauch, im Lärm, mit der Nase in seinem Eau de Toilette von Dunhill.
Es ist egal, wohin ich reiste in den Jahrzehnten seit meinem Abschied aus Canyamel: Der nur wenige Hundert Meter lange, durch bewaldete Hügel und prächtige Steilwände kinderbuchgleich akkurat eingegrenzte Ort, das Wasser, die Lagune, die lächerliche Ladenstraße, die Menschen von hier – Möglichkeit des Paradieses, Traumort, Kindheitsbucht.
Ich bin das Kind von der Kachel.
Der Plan
Ich beschließe, nach Canyamel zurückzukehren. Alle erklären mich für verrückt, müssen dann aber einsehen, dass ich genial bin
Im Frühjahr 2015 sagte der italienische Premier Matteo Renzi im Angesicht der Flüchtlingskrise und so vieler Gestrandeter und Toter: »Das Mittelmeer ist eine Bestie.« Zur selben Zeit hörte ich, als ein Busfahrer der Linie 185 der Münchner Verkehrsgesellschaft den anderen ablöste, wie sich die beiden Männer über ihre Urlaube unterhielten. Der eine Fahrer sagte, er komme gerade aus Jamaika. »Supa, oder?«, fragte der andere. »Ja … scho«, sagte der eine, als habe er noch mal eben nachdenken müssen, während er den Bus die letzten Meter in die verregnete Haltebucht lenkte, aber auch so, als habe er im Grunde genommen keine rechte Erinnerung mehr an Jamaika. Der andere: »I fliag nach Vancouver mit der Soffi nexte Woch.« »Aa ned schlecht.« Ich kam gerade aus einem Redaktions-Hochhaus im Münchner Stadtteil Berg am Laim, den mein Freund Matthias so hässlich findet, dass er ihn Dreck am Stecken nennt. Ich dachte: Früher sind Busfahrer nicht in die Karibik oder nach Kanada geflogen. Gut, dass sie es jetzt tun, wenn sie wollen, die netten Leute der MVG, die mich immer überall in der Stadt aufsammeln und mitnehmen.
Ich hingegen werde nach Mallorca zurückkehren, ans Mittelmeer, das Menschen verschlingt und in dem andere, glücklichere Menschen baden. Ich werde nachschauen, ob es den Ort meiner Kindheit noch gibt, Canyamel, die Menschen von Canyamel, zum Beispiel Teo und María, die Freunde meiner Eltern, die damals so jung waren wie meine Eltern und die jetzt sehr alt sein müssen. Wenn sie noch leben. Ihre Kinder Patricia und Pedro, die jetzt so alt sein müssen wie ich, um die fünfzig. Wenn sie, was wahrscheinlicher ist als bei ihren Eltern, noch leben.
Ich möchte wissen, was aus der Vaca geworden ist, unserem kleinen Hotel, das ich in den Reiseportalen im Internet nicht mehr finde. Ich finde dort aber das alte Hotel Laguna, und es sieht auf diesen Bildern so schön aus wie immer. Stolz steht es am Strand mit seinen immer noch roten Fensterläden. Ein fabelhafter Sommerfrischler. Eine Ikone. Das Laguna behauptet offenbar die Stellung, und es gehört tatsächlich immer noch dem Unternehmen Universal Reisen, nicht irgendeiner Group. Es ist immer noch in Schweizer Hand. Aber Urlaub machen darf dort jetzt jeder. Jeder darf heute alles, reisen, schreiben, kaufen, Meinung sagen, alles fordern, alles zurückschicken, die Welt hat die Türen aufgerissen.
Zwei Vorhaben wurden mir in den letzten Jahren vergeblich ausgeredet, beide haben erst einmal nichts, dann doch vieles miteinander zu tun. Zum einen bewege ich mich seit nunmehr drei Jahren ohne eigenes Auto durch München und die Welt, zum anderen bin ich nach Mallorca zurückgekehrt.
Zunächst also legte ich den Schlüssel für den komfortablen Dienstwagen in die Hände des fassungslosen Herrn von der Leasingfirma. Ich mochte nicht mehr jeden Tag zwei Mal unter Hitlers Balkon am Münchner Prinzregentenplatz im Stau stehen und kaufte mir stattdessen ein neues schickes Fahrrad und ein Jahresticket bei den Münchner Verkehrsbetrieben. Wieso sollte man, nur, weil die anderen es auch tun, mit der vom BMW-Bordcomputer hämisch errechneten Durchschnittsgeschwindigkeit von zwölf Stundenkilometern zur Arbeit fahren und am Abend in Schwabing fünfundvierzig Minuten lang einen Parkplatz suchen? Als verzweifelte, tonnenschwer gepanzerte, dem Tode geweihte Kriechtiere kurvten meine Nachbarn und ich in unseren pfeilschnell gedachten, böse schauenden, total überkomplexen Todesmaschinen durch unsere Privilegiertenviertel mit ihren Altbaustraßen.
Ich muss mich nicht mehr um den Wagen kümmern und ihn erst heimbringen und derlei Sachen. Ich muss nicht mehr im BMW-Innovations-Laboratorium zwei Stunden lang die Windjacken und Leichtmetallfelgen in der Auslage betrachten, während die Bordelektronik für meine 12-km/h-Fahrten neu programmiert wird oder mein Wagen seine Sommerreifen bekommt, mit denen er endlich wieder 250 km/h fahren könnte, wenn es nicht so viele andere Autos gäbe. Ich war mit Auto ein neurotischer Mensch, der sich mit anderen Menschen durchs offene Fenster anpöbelte.
»Fick dich!« – »Fick du dich!«
Dialoge wie dieser waren deprimierend. Die Langeweile ist eine tödliche Macht. Trump und der Brexit und die AfD, all dies passierte in diesen Jahren weniger aus Not. Es passierte aus Langeweile, aus klammernder, stumpfer Sinnlosigkeit. Die Leute werden dann paranoid. So konnte es nicht weitergehen.
Tatsächlich lag meinem Vorhaben, nach Canyamel zurückzukehren, nicht nur der Plan zur Rückeroberung des Kindheits-Paradieses zugrunde. Da war noch der Gedanke der Abrüstung, und die hatte beim Verzicht auf den Dienstwagen schon funktioniert. Canyamel war nicht nur eine sentimentale Chance, die furchtbar enden konnte. Sondern auch eine praktische. Ich wollte kein teures Haus mieten mit insgesamt zehn Leuten in abgelegenen Gegenden am Atlantik oder in der Toskana und dort dann jeweils in Supermärkten gigantische Einkaufswagen herumschieben.
Im Laguna zu wohnen, hieß, Zeit für sich zu haben. Es hieß, sich um nichts kümmern zu müssen, nicht zum Strand fahren zu müssen, weil es am Strand steht, kein Essen kaufen und kochen zu müssen, weil das Hotel das Essen kauft und es für einen kocht. Es hieß, keine Wäsche waschen zu müssen, weil das Hotel die Wäsche wäscht, und wenn man sich also bald langweilte und schon fünfmal in Artà war und siebenmal in Cala Ratjada, hieß es allerdings auch: Okay, dann jetzt doch mal das abendliche Entertainmentprogramm auf der Hotel-Terrasse, einschließlich des wöchentlichen Bingo-Abends. Es hieß kennenzulernen: Alte, Junge, Kinder, Kleinkinder, Babys, Deutsche, Schweizer, Beamte, Angestellte, Trauernde, Hoffende, Hessen, Storchenbeinige mit in der Mitte plötzlich gigantisch abstehenden, schwangerschaftsgleichen Bäuchen, Grippekranke, Durchfallkranke, Gesunde, Alleinreisende, Alleinreisende mit Kind, Alleinreisende mit Kind in der Gruppe, um sich kennenzulernen, einen Antifaschisten mit »Niemand-muss-Bulle-sein«-Shirt, einen möglicherweise Deutschnationalen, der jeden Tag mit einem weißen T-Shirt, auf dem schlicht »Deutschland« steht, böse sein Müsli reinbaggert, während seine Frau verängstigt am Käse herumschneidet, ein (!) Hipsterpärchen, das jede Kuchengabel im Laguna bestaunt, als sei es auf einem ironischen Flohmarkt. Es hieß auch: Konservative, Männer mit SPD-Stofftaschen, Steinalte mit Billy-Idol-Frisuren, sowieso Totaltätowierte, Freundliche, Bescheuerte, junge, hübsche Paare mit unfassbar niedlichen, schnullerspuckenden Kindern, Freche, Lustige, die brillanten Kafka-Biografien von Reiner Stach stoisch, mitunter wissend lächelnd am Pool Weglesende, Humorlose, geistig Behinderte, die als einzige Hotelgäste am Showabend mit dem galizischen Tom-Jones-Tribute-Sänger John Romero den Spaß ihres Lebens haben und tanzen, tanzen, tanzen, körperlich Behinderte, komplett Nicht-Behinderte, aber im Gegensatz zu den Behinderten Gehemmte – es hieß: andere Menschen, es hieß: Bevölkerung.
Menschen sind das, von denen sich viele schon seit Jahr und Tag hier im Laguna, dem Hotel des Volkes, einmieten, weil das Leben ist hart genug.
Schnell und vorsichtshalber beschloss ich, alles, was ich sonderbar oder unangemessen finden würde, mit Humor zu nehmen. Danach würde ich sicher auch mal wieder Lust auf ein Haus mit Freunden an der Atlantikküste haben, wie damals im wunderschönen St. Girons zwischen Biarritz und Bordeaux. Aber noch war nicht Danach, noch war Jetzt beziehungsweise Vorher: Und die Süchtigen dieser Welt wissen, dass die Minuten vor dem Kokain immer die besseren sind als die mit dem Kokain.
Der Plan zu dieser Vollpensionsreise klang nicht cool, und das Gute an fünfzig Lebensjahren ist dann, dass einem das, wie anderes auch, egal ist. Wer sein Leben jetzt nicht lebt, für den ist es bald zu spät. Trotzdem beschloss ich, dem Unterfangen einen durchdachten, ironischen Anspruch zu geben, mich also wichtigzumachen und die Sache anders zu verkaufen, nämlich als aufregende Rückkehr in meine Kindheitsbucht.
Viele Menschen halten Journalisten für kleine niederträchtige Gesellen, die immer eine Begründung brauchen, um ihre weinerlichen Tänze wie großes Ballett aussehen zu lassen. (Wir Journalisten selbst nennen es übrigens nicht Begründung, sondern Überhöhung. Die Überhöhung ist das ganz große Ding.) Menschen, die Journalisten für kleine niederträchtige Gesellen halten, sind bösartig und interessengesteuert. Außerdem haben sie meistens recht. Über die Rückkehr in meine Kindheitsbucht würde ich, wie ich mir vornahm, einen weinerlichen, gleichzeitig zynischen, desillusionierten und vor allem kalten, frustrierten und frustrierenden, letztlich vor allem unangreifbaren, total zermürbenden Text für meine Zeitung schreiben und behaupten, dass man so etwas nie tun sollte mit fünfzig Jahren, weil: Das Leben geht weiter, wir alle werden sterben, alles ist deprimierend. Den Kollegen schnarrte ich zu: »Hamburger Schule.« Sie nickten wissend.
In Wahrheit, so der Plan (der nicht aufging), würde ich während meiner Recherche jeden Tag zufrieden auf Redaktionskosten mit dem Auto vom verlotterten Canyamel aus an den wilden Strand von Cala Torta fahren, um mich dort mit den brillanten Kafka-Biografien von Reiner Stach zu zeigen, schließlich, um mich im Strandcafé mit anderen netten Leuten, die zu zehnt eine Finca nahe Artà gemietet hatten, anzufreunden.
Ins Laguna reiste ich also im Juni 2015 zunächst für eine Woche alleine, und zwar, um zu testen, ob meiner Frau all das hier später im Sommer zumutbar wäre oder ob sie hier im folgenden August, dem Hauptreisemonat, weinend mit dem Kind auf dem Zimmer sitzen würde, während ich unten kreischte: »Bingo!«
Dann wollte ich testen, ob es passieren könnte, dass sie unten »Bingo!« kreischte, während ich oben weinend mit dem Kind auf dem Zimmer sitze, weil mich jede Kiefer, Parkbank oder Telefonzelle in Canyamel an etwas erinnerte, das es nicht mehr gibt: Mein Leben als Kind.
In der Einflugschneise
Fliegen und überflogen werden: Wir diskutieren unter startenden und landenden Flugzeugen, ich werfe mit einem Ei durch die Caravelle und duelliere mich Jahrzehnte später mit der tapferen, untergehenden Fluglinie Air Berlin
»Ich bin dafür, dass man für
Flugreisen per se entschädigt wird.
Egal, ob verspätet oder nicht.«
Ruth Herzberg
1967 quetschten wir uns auf dem Flughafen Düsseldorf-Lohausen zum ersten Mal in eine Caravelle der LTU. So sollte es daraufhin Jahr für Jahr weitergehen, mal im Frühjahr, immer im Sommer, mal im Herbst, mal mehrfach pro Jahr. Wenige Stunden nach dem Abflug, insgesamt circa vier Stunden später, waren wir dann im Nordosten der Insel angekommen, in Canyamel.
Die Wahrscheinlichkeit, dass der Laguna-Direktor Juan Massanet und ich uns hier 1967 zum ersten Mal begegneten, ist sehr hoch, setzt man voraus, dass ein Siebenjähriger (Juan) und ein Einjähriger (ich) zu dem in der Lage sind, was man unter auch nur trivialphilosophischen Gesichtspunkten als Begegnung versteht. Vermutlich lag ich an einem Frühlingsnachmittag des Jahres 1967 auf einem Handtuch und schlief, bedröhnt vom Odeur aus Baumharz und Meersalz. Am Strand von Canyamel gab es weder von der Gemeinde Capdepera hingestellte und verwaltete Liegen noch Sonnenschirme noch Tretboote noch in nennenswerter Anzahl Menschen, schon gar nicht solche, die Sand aus iPhones pusten. Es war alles einfach, aber nicht billig. Zum Beispiel flog das einmotorige Flugzeug mit dem Banner des Schnäppchenportals Urlaubsguru.de noch nicht am Strand von Canyamel vorbei, denn Sparen war ein Gebot irgendwie normaler haushälterischer Vernunft, Geiz noch keine Religion, und als unsympathisch wäre der hinter dem Urlaubsguru.de-Flugzeug herumflatternde Befehl aufgestoßen: »Für wenig Geld / Rund um die Welt!«.
Vom Flughafen Düsseldorf-Lohausen selbst loszufliegen, statt sich weiter auf der anderen Rheinseite in der Einflugschneise mit Lärm vollmachen zu lassen, war an sich schon ein Ereignis. Die maximale Erhebung für Menschen, die in der Einflugschneise aufwachsen, ist es, sich aus der Einflugschneise herauszubegeben, um dann selbst durch die Einflugschneise und über die anderen Menschen hinwegzufliegen und diese also mit dem Lärm der frühen, pfeifenden, knallenden Massentransportmaschinen zu terrorisieren. Selten, je nach Windrichtung und wenn die Familie auf der richtigen (nämlich linken) Seite des Flugzeugs saß, sahen wir für Sekunden nach dem Start unseren Garten auf der Dietrich-Bonhoeffer-Straße Nummer 1 in Meerbusch-Büderich. Da standen sie, puppenhaushaft: die Korbmöbel auf der Wiese, wir über sie hinwegschwebend mit dem Lärm, der nun in den Nachbargärten für die Verheerungen sorgte und unter dem sonst dort unten wir zu leiden hatten.
Wer in der Einflugschneise eines Großflughafens aufwächst, weiß später, warum er nicht alle Tassen im Schrank hat. Die üblichen Lärmintervalle waren klar ausschlaggebend für einige schwere Neurosen und Marotten in meiner Familie, mindestens war die Einflugschneise ein besonders fruchtbares Gelände, um schon vorhandene neurotische Anlagen zu kultivieren. So wird die unter Mitteilungsbedürftigen schon normale Sorge, nicht ausreichend zu Wort zu kommen, zu einer manifesten Angstneurose. In den bis zu dreiundfünfzig Jahren, die meine Familienmitglieder in der Gartenwohnung der Dietrich-Bonhoeffer-Straße Nummer 1 verbrachten, fiel sehr oft der Satz: »Ich möchte bitte ausreden«, gerne auch sogleich im ersten Anlauf durch die gereizte Zufügung: »Ich möchte bitte ausreden dürfen.« Bevor das nächste Flugzeug kam, musste, was gesagt werden musste, gesagt sein. Da alles gesagt werden musste, entstand in den kurzen Pausen, die uns der Flughafen Düsseldorf-Lohausen schenkte, stets Streit darüber, wer bisher wie lange geredet hatte und wer jetzt ausreden durfte. Mein Vater brüllte irgendwann, dass er seinen Garten verlassen werde, da man ihn nicht ausreden lasse. Dann stampfte er die Treppe zur Terrasse rauf und rauchte dort. Ein geschickt gewähltes Exil.
Von hier aus konnte er so tun, als ob er die FAZ läse, in Wahrheit inszenierte er vor dem zu bestrafenden Publikum seine Verbannung, gleichzeitig registrierte er unsere Reaktion auf seine für uns doch sicher schmerzliche Abwesenheit. Klein, gespannt und gekränkt saß er auf der Terrasse und tat, als läse er die Zeitung. Napoleon auf Elba. Wir würden doch betreten sein? Wann würde seine Frau ihn bitten, zurückzukehren in den Garten? Er tat uns doch leid? Noch aber schmollten alle, nur ich nicht, ich war noch zu klein und fragte doof: »Wann kommt der Papa wieder runter und darf ausreden?«
»Misch dich nicht ein, du kleiner Idiot«, bat meine Schwester freundlich, die ihn nicht hatte ausreden lassen, weil er sie zuvor auch nicht hatte ausreden lassen, wie sie fand, was er anders gesehen hatte, denn wiederum davor, also ganz ursprünglich hatte sie ja schon ihn nicht ausreden lassen. (Sie sah das alles anders. Denn davor wiederum …)
»Der Papa liest nur die Zeitung, sicher kommt er bald wieder runter in den Garten«, sagte meine Mutter und: »Der Papa darf immer ausreden, alle dürfen immer ausreden, und wenn mal einer nicht ausreden durfte, dann reden wir nachher darüber.«
»Wieso ist es Papas Garten und nicht unser Garten?«
»Das würde ich auch gerne wissen«, sagte meine Schwester.
Ein Flugzeug kam. Es war eine weiße Decke am Himmel, es waren keine Wolken erkennbar, der Himmel war schlicht weißgrau, schwül, diesig, niederrheinisch, es roch nach feuchter, schwerer Erde. Dies hieß: langer, sich unter der Decke kaum verfügender Lärm. Der nicht endende Knall eines Schusses. Dann doch Ruhe. (Von ganz weit hinten, überm Rhein, hörte man unterdessen das nächste Flugzeug herankriechen.) Meine Mutter seufzte, zündete eine Dunhill aus der weinroten Packung an und schaute hoch auf die Terrasse: »Rudi?«
Stand die Terrassentür im Sommer offen, saß man im Garten unter dem Quittenbaum in der Gartenstadt Meerbusch-Büderich bei Düsseldorf, so erstarrten routiniert Vater, Mutter und Schwester sowie unsere Gäste, das waren der damals schon legendäre Kunstprofessor Werner Schmalenbach (Übervater der Klassischen Moderne, Gründer der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, die zu seiner Verbitterung lange nach seiner Pensionierung umgetauft wurde in »K20«, also etwas, das, wie er sich zu Recht ausdrückte, »nun heißt wie etwas total Lächerliches, zum Beispiel ein Schokoriegel«), der Pfarrer Hans Hütt und seine Gattin, meine Patentante Ilse Hütt, schließlich mit Gattin Renate der Schuldirektor Wolfgang Gewaltig – Leiter des Gymnasiums, in dem ich die finstersten Stunden meines Lebens verbrachte. Hier saß insgesamt, in heller Sommerkleidung, mit geflochtenen Lederschuhen der Marke Bally und im kurzärmeligen Hemd, wie es spanische Senioren heute noch tragen: die analoge Moderne. Der Halbjude Schmalenbach war Schweizer und wählte nicht, und hätte er wählen dürfen, so hätte er, wie er ein ums andere Mal sagte, um meine damals linksradikale Schwester zu provozieren, die FDP gewählt, und zwar trotz der übernommenen FDP-Nazis nach dem Krieg, da es eine Partei braucht, die sich »raushält«, wie er sagte, außerdem hegte er so große Vorbehalte gegen das Volk, dass er keine Volksparteien gewählt hätte und andererseits schon gar nicht die Grünen, die er besonders lächerlich fand. Der Literaturfreund Gewaltig verehrte (immer noch) Konrad Adenauer und wählte Barzel und dann Kohl (»Ich glaube, der Kohl wird unterschätzt!« Ein Prophet, so oder so), die Hütts hingegen waren nicht einfach für Willy Brandt, sie glühten für Willy Brandt.
Alleine der Pfarrer Hütt hatte sieben Kinder. Wir alle waren die Einflugschneisenprofis. Die Hütt-Kinder hatten auf dem Flachdach ihres weißen Pfarrhauses am Ende der kleinen Bonhoefferstraße zwei Scheinwerfer in Stellung gebracht, mit denen sie am späten Abend in der Dunkelheit die startenden und landenden Flugzeuge bekegelten. Da ich bei der Recherche zu diesem Buch überlege, ob ich mir das (wie so vieles) nur einbilde, rufe ich den Sohn von Hans Hütt und meiner Patentante Ilse Hütt an. Er heißt praktischerweise ebenfalls Hans Hütt, lebt als genial luzider Publizist gemeinsam unter anderem mit seinem verehrungswürdigen Twitter-Account in Berlin und kann sich sogleich erinnern: Auf dem Dach des Hütt’schen Pfarrhauses in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße 7 befanden sich demnach, so Hans, nicht nur zwei Baustellenscheinwerfer, sondern, wie Hans begeistert anfügt: »Es befand sich dort auch das, was man ein Mondfernrohr nannte!« Die Scheinwerfer, hier wird es jetzt juristisch etwas heikel, stammten offenbar aus dem Fundus aufgelöster Baustellen in der niederrheinischen Umgebung, sicher wurden sie dort nach Fertigstellung der schlichten westdeutschen Vorstadtmehrfamilienhäuser oder antifaschistisch-reformevangelischen Kirchenanbauten schlicht zurückgelassen, die halbe Vorstadt Meerbusch-Büderich war damals, Hans kennt das schöne Wort auch noch: »Bauerwartungsland«. Andere Kinder aus Pfarrhäusern jener Zeit verschwanden im Idealismus, dann im Terrorismus, diese sieben aber mit Namen Hütt vom Niederrhein der 60er- und frühen 70er-Jahre beleuchteten Flugzeuge von unten, übrigens immerhin zum Teil in der Tradition des mittlerweile streng sozialdemokratischen Vaters, des Pfarrers Hütt, der vor nicht zu langer Zeit als Oberleutnant bei der Flak vor Rotterdam noch die feindlichen Fluggeräte von unten nicht nur beleuchtet, sondern auch abgeschossen hatte. Mit rotem Kopf, dünnem, weißem, nach hinten gekämmtem Haar und fein geschnitztem Lächeln verfolgte der Pfarrer die Umtriebe seiner zahlreichen Kinder auf dem Dach, und zwar so lange, bis die dörfliche Öffentlichkeit Wind von der Sache bekam und die Scheinwerfer vom Dach mussten.
Jeder lebte hier, jeder beurteilte das Leben in der Einflugschneise als menschenunwürdig, keiner zog weg, alle blieben hier wohnen. Noch heute sagt meine Mutter: »Ich weiß nicht, wieso nie jemand weggezogen ist. Die Hütts, die Gewaltigs, die Schmalenbachs, alle klagten über den Fluglärm in unserem Garten, in ihren Gärten.« Pause. »Aber nie ist jemand weggezogen.«
Beleidigungen, Belehrungen und Infamien aller Art im Garten wurden durch den Fluglärm unterbrochen wie heute Fernsehtalkshows durch Einspieler. Von oben ausgebremst, verharrten die Diskutanten missmutig, rauchend, Campari oder Wein nachschüttend, auf die Toilette stapfend, bis das jeweilige Flugzeug weg war. Ist es nicht schlimm, dass alle in den Urlaub fliegen müssen? Müssen denn alle fliegen?
Millionen in diesem Land verhungern und werden ausgebeutet, rief der Vater, durch den Garten eilend, von einem Rosenstrauch zum anderen, an diesen Rosen herumzupfend wie ein irrer Friseur, gleichzeitig fliegen dieselben Millionen jedes Jahr in den Urlaub. Ob ihm das wer erklären könne?
Das könne man nicht vergleichen, entgegnete die Schwester, das eine habe mit dem anderen nichts zu tun.
So kann man also verhungern und sich ausbeuten lassen und gleichzeitig nach Mallorca fliegen, so der Vater, und … Das kann man nicht … Ich möchte bitte ausreden dürfen, rief der Vater. Können denn nicht all die vielen Menschen aus Nordrhein-Westfalen ins Sauerland oder nach Holland an die Nordsee fahren auf den Campingplatz und dort Kibbeling essen mit Mayonnaise? Ist das denn nicht auch lecker? Und nur wenige fliegen ins Ausland? Zum Beispiel wir?
Zur Hochsaison im Minutentakt begab sich die durch Iberia, Condor und LTU portionierte Bevölkerung des mit Menschen randvollen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen hinunter in den Süden. Meine Schwester und mein Vater verfielen aus dem Stand, nur wenige Hundert Meter unter einem startenden Flugzeug, in politisch motivierte Mordlust. Wenn das Flugzeug weg war, würde sie ihn oder eben er sie umbringen. Der mit geballter Faust das Feuerzeug bearbeitende Vater schnauzte eben noch wie eine Zeichentrickfigur, die Schwester keifte, der Vater knallte den Aschenbecher auf den Korbtisch, die Mutter rief, der Pfarrer Hütt bat um ein Glas Wein, die Schwester heulte, und all dies konnte dann für die Dauer eines Starts oder einer Landung wie mit der Pausetaste eingefroren werden.
»Schleyer war einer der übelsten Nazis, Papa! Er hat in Prag …«
»Der Mann ist TOT! Ich dulde nicht, dass meine Tochter gedungenen Mördern …«
»Schleyer war …«
»Ich dulde nicht …«
»Mein Gott, Rudi!«
»Anneliese, sei bitte …«
»Schleyer war …«
»Ich verlange …«
»Ich möchte bitte ausreden dürfen!«
Pfarrer Hütt: »Ich finde, da hat der Rudi recht.«
Start eines Flugzeugs. Fluglärm, für rund sechzig, eher neunzig Sekunden. Der Vater zieht an der Dunhill-Zigarette. Seine Tochter schaut in den Rhododendron, damit niemand sieht, dass sie weint. Wolfgang und Renate Gewaltig schauen ernst auf den Tisch. Schmalenbach und Hütt lächeln. Dann, das Flugzeug ist weg, das nächste kann jede Sekunde kommen, weiter:
Pfarrer Hütt: »Anneliese, ist das der Moselwein, von dem ihr neulich spracht? Den kaufen wir auch, Ilse, oder? Der ist fabelhaft, nicht wahr.«
»Den gibt es bei Otto Mess auf der Düsseldorfer Straße.«
»Na also, das auch noch, wie praktisch, die Politik der kurzen Wege, nicht wahr, Rudi? Anders als in Russl…«
»Schleyer war ein Nazi, Papa!«
»Ich dulde nicht, dass gedungene Mörder in meinem Garten als Widerstandskämpfer stilisiert …«
»Genau, Schleyer war ein Mörder, immerhin hat er von Massenmördern arisiertes …«
»Mama, was ist gedungen?«
»Gedungen ist, äh …«
»Ich vertrage eigentlich keinen Moselwein, aber dieser hier ist herrlich.«
»Ich verlasse jetzt meinen Garten. Anneliese, wenn meine Tochter damit nicht aufhört, verlasse ich unweigerlich …«
Schmalenbach: »Rudi! Hahaha. Das ist ja zu komisch. Wieso sagst du es denn der Anneliese? Sag es deiner Tochter, sie sitzt doch neben dir. Hahahaha!«
»Ich verlasse jetzt meinen Garten.«
Noch etwas druckvoller wurden die Zustände kurz vor ihrer Umkehrung, also unserem eigenen Abflug in die Freiheit. Wie man weiß, war das Verreisen damals nichts Profanes, es war in dem Sinne nie leicht und ist es bis heute nicht. Wir behaupten in Stil-Beilagen und Entschleunigungs-Magazinen, wie schön und würdig doch das Reisen damals war und wie billig und egal sich all dies heute gestaltet zwischen tückischen, stressauslösenden Reiseportalen und Quick-Check-in und Buchung kurz vorm Abflug und alldem. Holidaycheck wirbt mit: »Wer nicht checkt, reist dumm!«. Wer will schon dumm reisen? Wir tun nun so, als sei Fliegen etwas gewesen, wie heute bei Manufactum einzukaufen, wertiger, handgemacht, analog, gut. Wir verdrängen dabei die Qualen und Hässlichkeiten der frühen Jahre.
Ich habe zwei erste Erinnerungen aus meinem Leben, beziehungsweise ich weiß nicht, welche von beiden die erste ist. Ich vermute, diese hier ist die erste: Ich saß im Garten, es war mein vierter Geburtstag, es handelte sich demnach um den 22. August 1970, ich spielte mit einem froschgrünen Spielzeugbagger der massiv bauenden Firma Tonka (natürlich pleite inzwischen, wie alles Massive) und schaute immer wieder hoch zu den Flugzeugen, die über das Haus flogen und jeweils eine braune Spur am blauen Himmel hinterließen, durch die dann das jeweils nächste Flugzeug startete, um eine weitere braune Spur am blauen Himmel zu hinterlassen. Es könnte sein, dass ich exakt an meinem vierten Geburtstag und beim Anblick von startenden Urlaubsfliegern angefangen habe, zu reflektieren.
Die zweite Erinnerung: Wir sitzen in einem schwarzen Mercedes-Taxi des Meerbusch-Büdericher Taxiunternehmens Schlieper von der Mozartstraße um die Ecke (so war die Vorstadt: Mozart, gekreuzt mit Bonhoeffer). Das Taxi war eine Art Halle, weiträumig, ein dunkler, nach Leder duftender Pool. Ich schaute vom Rücksitz aus nur so eben aus dem Fenster, bis ich mich auf die Knie hockte und hinten rauswinkte. Gurte gab es nicht, Kindersitze gab es nicht, alles war gefährlich, schwach gesichert. Wir fuhren über die nasse, seit Jahren vollgeregnete Theodor-Heuss-Brücke zum Flughafen auf die andere Rheinseite. Das Herauswinken durch die Heckscheibe in Richtung müde am Lenker die Hand hebenden, aus einem Opel Kapitän herausglotzenden Hintermann, über dessen Gesicht der Scheibenwischer glitt, gehörte zum Standard-Repertoire reisender Kinder, und wenn sie auch nur zehn Minuten vom einen Rheinufer ans andere wechselten. Haben die Eltern im Taxi zum Flughafen geraucht? Sie haben immer geraucht. Daheim, im Taxi, im Flughafen, im Flugzeug.
Ältere Leserinnen und Leser, die noch klar bei Verstand sind, erinnern sich womöglich an den Flugzeugtyp Caravelle, weniger ältere (aber auch schon alte) zusätzlich an die Fluggesellschaft LTU. Die Caravelle war eine Kreuzung aus einem Düsenjäger und einem Passagierflugzeug, eine französische Erfindung aus den 50er-Jahren, die in den 60er-Jahren und bis weit in die 70er-Jahre hinein Touristen durch die Gegend schoss, und zwar in einer lasziven Lautstärke sowohl im Flieger selbst als auch draußen. Da sie schmal war, war sie eng. Für die Mallorcatouren in der Caravelle der LTU warb in großen Zeitungsanzeigen der Schlagersänger Heino, ein gelernter Bäcker, der aussah und auch so klang wie eine der reitenden Leichen aus den entsetzlichen Horrorfilmen, die meine Schwester mit mir und den Hütt-Kindern tapfer besuchte immer sonntags um elf Uhr in der Kindermatinee des Kinos an der Ecke Poststraße/Düsseldorfer Straße. Tote, denen die Fetzen vom Leib hingen, vergriffen sich in diesen Filmen an Kindern wie mir, an anderen Tagen bot das Kino die Monsterfilme aus Japan auf und nie mehr, nicht einmal beim Hoeneß-Elfmeter von Belgrad ’76, habe ich so geweint wie in dem Moment auf dem Holzklappstuhl des Büdericher Dorfkinos, als King Kong, der nur die Liebe suchte, vom Empire State Building geschossen wurde.
Ich fragte mich, wieso der furchterregende Heino für Mallorca warb und ob ich Heino in Canyamel begegnen würde. Offenbar flog er ja auch hin, wieso sonst stand der unheimliche Mann auf den in der Rheinischen Post abgedruckten Werbefotos vor der Caravelle der LTU und bat auf die Gangway: Hereinspaziert, in diesem Flugzeug singe ich und schneide euch dann in Stücke! Strahlend und mit seiner bedrohlichen Dunkelbrille stand »der Nazi« (meine Schwester) vor der Caravelle. Ich hatte große Angst vor Heino und ich habe sie heute noch.
In dem Caravelle-Modell, das die damals aufstrebende Düsseldorfer LTU in den 60ern second hand von der Finair erwarb, nahm erstmals 1967 meine Familie Platz. Wir mögen keine beengten Verhältnisse, meine Mutter saß als junges Mädchen lange im Bombenkeller, mein Vater war als junger Soldat und verkappter Halbjude (nur väterlicherseits, für die Nazis hätte es aber gereicht) in Russland von der eigenen Wehrmacht bombardiert worden, als er sich mit Kameraden in einer Scheune versteckte. Er hatte zwei Tage unter Trümmern gelegen, bevor jemand draußen eine Hand sah, die sich bewegte. So schlimm war die Caravelle nicht. Aber fast. Sie weckte Erinnerungen.
Schon früh solidarisiere ich mich damals mit den kriegsbedingten Traumata meiner Eltern, ich esse alles, was ich sehe und bis mir schlecht ist, weil es vielleicht morgen nichts mehr zu essen gibt, ich tanze, sobald wer Musik auflegt, wer weiß, ob es morgen noch Musik gibt, ich liebe Helligkeit und Raum, Dunkelheit und Enge lehne ich ab. In der Caravelle war es dunkel und eng. Jahr für Jahr lächle ich noch einfältig auf dem Weg zum Flughafen, während meine Mutter schon nervös ihre hübsche Unterlippe zerkaut, da sie weiß, was gleich losgeht.
Schon vor dem Start drücke ich meine Beine gegen den Vordersitz und rudere mit den Armen. So kann ich nicht verreisen, es ist zu eng, ich möchte, dass die Familie in ein Flugzeug wechselt, in dem ich mehr Platz habe. Da niemand meiner Bitte nachkommt, raste ich aus, drücke das Kreuz durch und schlage um mich. Ich werde so lange mit diesem Verhalten fortfahren, bis wir in ein größeres Flugzeug wechseln. Ich bin zwar noch nicht groß, aber sogar für mich ist dieses Flugzeug zu klein. Auf dem Schoß meiner Mutter sitzend stoße ich meinen Ellbogen in den Kartoffelsalat des Sitznachbarn, dann greife ich nach dem hart gekochten Ei und werfe es durch die Caravelle, weit nach vorne, an den Hinterkopf eines Mannes, der daraufhin einen Schock erleidet und behandelt werden muss. Dies alles ist wirklich passiert.
Im Sommer 2015 komme ich anlässlich meiner (für mich) spektakulären Rückkehr nach Canyamel um 5 Uhr früh am Münchner Flughafen an, da mein Flieger nach Palma de Mallorca um 6 Uhr startet. Am Gate informiert die Anzeige die schon eingecheckten Fluggäste darüber, dass es eine Verspätung geben wird – mit dem Abflug werde nun für 12:30 Uhr statt für 6 Uhr gerechnet.
Ich weiß im Sommer 2015, dass die Fluglinie Air Berlin im Sterben liegt, bald werden Nachrichten die Runde machen, dass ganze Strecken, also Flugzeuge samt Slot und Personal, im sogenannten Wet-Lease-Verfahren vermietet werden, damit irgendwie noch Geld reinkommt. Aber eine Verspätung von sechseinhalb Stunden? Kurz darauf flimmert auf der Anzeige eine neue Uhrzeit für den Abflug, nun wird sich alles aufklären.
Neue erwartete Abflugzeit: Statt 12:30 Uhr nun 13:30 Uhr.
Müde und beladen starren Männer in Adiletten und ihre tätowierten Frauen auf das Schild. Ein alter Mann legt die Zeitung auf den Schoß und presst die Lippen aufeinander. Keiner spricht.
Am Gate sitzt eine junge, schöne Frau, eine Vertreterin der durch die Kräfte des Marktes zum Tode verurteilten Fluglinie. Sie starrt auf ihr Smartphone. Dass sie nicht angesprochen werden will, dafür habe ich Verständnis. Sie ist schuld, denn sie ist die lady von Air Berlin.
Ich gehe zu ihr, um mich ein wenig einzuschleimen und mir einen Vorteil zu verschaffen. Ich lächle und muss mich benehmen. Vor Kurzem habe ich in der Zeitung gelesen, dass ein Mann an einem Flughafengate von der Polizei abgeführt wurde, weil er wegen einer Verspätung »ausfällig« geworden war. Ausfällig ist ein dehnbarer Begriff.
Ölig nähere ich mich der jungen Dame von Air Berlin. »Verzeihung, siebeneinhalb Stunden Verspätung?«
Sie schaut weiter auf ihr Smartphone. Sie sieht nicht, wer vor ihr steht, und hört mich nur. Sie sagt: »Ja, hey, das ist nicht schön, oder? Das tut uns auch leid.«
»Lässt sich das Problem lösen?«
»Wie meinen Sie das?«
»Dass es doch früher losgeht?«
»Hahaha, Sie sind ja süß. Nein. Die siebeneinhalb Stunden sind ja die Lösung.«
»Verstehe.«
»Doof, klar.«
Es entsteht eine Pause. Ich schaue sie an, während sie weiter auf ihr Smartphone schaut. »Sie dürfen gerne erst einmal wieder Platz nehmen. Wir geben Bescheid, wenn sich etwas ändert.«
»Was könnte sich ändern?«
»Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Sie dürfen so lange, wie gesagt, gerne erst einmal wieder Platz nehmen.«
»Ich weiß, dass ich Platz nehmen darf. Aber ich will nicht.«
Ich bekomme einen dicken Hals. Hat meine Familie nicht genug gelitten? Wann eigentlich lässt man uns in Frieden?
Ich frage die Dame von Air Berlin: »Wissen Sie, was das Lustige ist?«
Sie antwortet nicht.
»Wissen Sie, was das Lustige ist?«
»Das Lustige?«
»Ja.«
»Nein.«
»Das Lustige ist: Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich das mit den siebeneinhalb Stunden nur träume. Ich habe mitunter konkrete Träume … Haben Sie auch manchmal konkrete Träume?«
Sie wischt über das Smartphone, sie wischt weiter, irgendwo waren sie gestern noch, die geilen Schuhe bei Zalando.
Ich sage: »Können Sie mich mal bedrohen? Dann werde ich wach! Hahahaha!«
»Ich muss Sie bitten, wieder Platz zu nehmen und zu warten.«
»Ich glaube nicht, dass Sie das müssen. Können Sie mir bitte den Grund nennen für eine siebeneinhalbstündige Verspätung?«
(Was will ich mit dem Grund? Fliegt die Maschine pünktlich, wenn ich den Grund kenne? Es ist alles so sinnlos.)
»Ich muss Sie bitten, wieder Platz zu nehmen und zu warten. Bitte.«
»Hier sitzen Menschen, die heute Nacht aufgestanden sind und jetzt erfahren, dass sie noch sieben Stunden hätten schlafen können, dass sie einen Urlaubstag weniger haben werden. Können Sie nicht wenigstens den Grund nennen für eine siebeneinhalbstündige Verspätung?«
»Ich kann Ihnen den Grund erst nennen, wenn ich ihn weiß.«
»Sie wissen den Grund nicht?«
Es entsteht eine schreckliche Stille, in der sie fortwährend auf ihr Smartphone starrt und zwischendurch auch zum Hörer des Gate-Telefons greift, um mit Annette (nein, sie hieß nicht Annette, aber es war grundsätzlich eine Annette) zu reden. Wo ist der verlässliche Hass meiner klagenden Landsleute? Warum ist in der Deutschen Bahn auf diesen Hass stets absoluter Verlass? Wieso fallen sie dort über junge Schaffner her? Wieso treten hoch bezahlte Manager, die auf Kongressen längliche Vorträge über die Digitalisierung halten, in der 1. Klasse gegen die Getränkewagen von unterbezahlten Bahnangestellten bei nur geringfügigster Verspätung? Wieso rasten dieselben Menschen, die am Flughafen leer ins Nichts starren, im Zug sofort aus, benehmen sich wie die Schweine und verlangen Sondersendungen im Fernsehen? Wieso dieser kochende, pöbelnde Hass auf die Bahn und diese unheimliche Ruhe am Flughafen?
Es ist 5:20 Uhr, in vierzig Minuten sollte das Flugzeug starten, das nun erst um 13:30 Uhr starten wird. Ich beginne zu hassen. Ich hasse meine Mitmenschen, weniger hasse ich die arme Fluglinie Air Berlin, die sich im Hospiz befindet, und zwar wesentlich, wie die klugen Wirtschaftsteile der Zeitungen wissen, weil sie zu lange ein zu umfangreiches Streckennetz und einen zu guten Service angeboten hatten, die Trottel. Sie waren zu gut für diese Welt. Menschen werden ihren Arbeitsplatz verlieren, alles ist traurig, und wenn Ryan Air eines Tages die Gesamtmacht übernommen hat, werden im Cockpit Praktikanten aus Zeitarbeitsfirmen sitzen, die stolz sind, dass sie sich beweisen können. Sie werden das Flugzeug mit einer selbst entwickelten App navigieren.
Meine Mitmenschen hier am Gate: Sie treten auf der Bahn herum, weil es heute wieder keine Heißgetränke gibt, und sie buckeln vor einer Fluglinie. Weil sie Angst haben, zu sterben. Es ist erbärmlich.
Um mich zu beruhigen, wage ich einen neuen Anlauf.
»Wie wird übrigens die Entschädigung seitens Air Berlin aussehen, wenn man mal so freundlich und sonor wie möglich fragen darf?«
»Das würde mich auch interessieren!«, brüllt plötzlich einer von hinten. Nicht, wenn es um einen verlorenen Tag Urlaub mit ihren streitsüchtigen Familien geht, ausschließlich, wenn es um Geld geht, werden die Menschen munter.
Die Dame: »Das regeln wir traditionell auf Gutscheinbasis.«
»Traditionell?«
»In vergleichbaren Fällen.« Sie seufzt, legt das Smartphone weg, greift wieder zum Gate-Telefon.
Ich sage: »Zu einer Regelung gehören immer zwei. Da ist es hier wie im normalen Leben, oder? Insofern wird dann interessant werden, ob ich mit der Regelung, die Air Berlin mir anbietet, einverstanden bin.«
Annette erscheint. Ihr musternder Blick sagt, dass ihre junge Kollegin gemailt hat, dass sie in Not ist: Hier steht ein Opfer. Will den Grund wissen, wieso wir um 13:30 Uhr fliegen statt um 6 Uhr. Will sich nicht setzen, bis er den Grund kennt (Smiley mit Lachtränen). Jetzt wird sein Hals dick, Annette!LOL