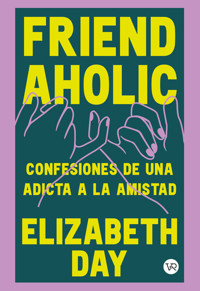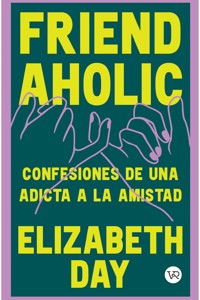16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Glück, wenn's schiefläuft
Egal ob die Schwierigkeit, mit 40 eine neue Sportart zu erlernen, eine unerwartete Trennung oder das plötzliche Karriereaus – die wirklich großen Momente unseres Lebens erwachsen immer aus einer Krise, so die These der erfolgreichen englischen Journalistin und Autorin Elizabeth Day: »Zu scheitern hat mir in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet. Ich habe mehr aus meinen Krisen gelernt als aus den guten Zeiten.« Ermutigend, inspirierend und mit vielen Beispielen aus ihrem Leben zeigt Elizabeth, dass wir uns nicht länger über unsere vermeintlichen Misserfolge definieren sollten. Denn wenn wir verstehen, warum wir etwas nicht geschafft haben, gewinnen wir an Stärke. Es ist an der Zeit, das Streben nach Perfektion endlich abzulegen, das so viele Frauen heutzutage antreibt: Lasst uns aus unseren Fehlern lernen, stark, gelassen und glücklich sein – nicht Angst vorm Leben haben!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Egal ob das plötzliche Karriereaus, eine unerwartete Trennung oder die Schwierigkeit mit vierzig eine neue Sportart zu erlernen – die wirklich großen Momente unseres Lebens erwachsen immer aus einer Krise. Die inzwischen höchst erfolgreiche englische Journalistin und Autorin Elizabeth Day zeigt auf einfühlsame Weise, was für ein Glücksfall es ist, wenn nicht alles glattläuft im Leben: »Das Scheitern hat mich Lektionen gelehrt, die ich sonst nie begriffen hätte.« Ermutigend, inspirierend und mit vielen Beispielen erklärt Elizabeth Day, dass wir uns nicht länger über unsere vermeintlichen Misserfolge definieren dürfen. Denn wenn wir verstehen, warum wir etwas nicht geschafft haben, gewinnen wir Kraft und Stärke. Höchste Zeit, das Streben nach Perfektion abzulegen, das so viele Frauen antreibt. Keine Angst mehr vorm Versagen! Lasst uns aus unseren Fehlern lernen und selbstbewusst, stark und gelassen weitergehen!
Autorin
Elizabeth Day schreibt als mehrfach ausgezeichnete Journalistin für The Times, Telegraph, Guardian, Observer, Harper’s Bazaar und Elle. Außerdem hostet sie den erfolgreichen Podcast How To Fail With Elizabeth Day. Sie ist in Nordirland aufgewachsen, hat in Cambridge studiert und lebt in London.
Elizabeth Day
HOW TO FAIL
Warum wir erst durch Scheitern richtig stark werden
Aus dem Englischenvon Sylvia Bieker und Henriette Zeltner
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »How To Fail. Everything I’ve Ever Learned from Things Going Wrong« bei 4th Estate, an imprint of HaperCollins Publishers, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeiftung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstveröffentlichung April 2020
Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 2020 dieser Ausgabe by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright der Originalausgabe © 2019 by Elizabeth Day
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Redaktion: Antje Steinhäuser
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
KF · Herstellung: kw
ISBN: 978-3-641-24909-0V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für meine Patenkinder: Imogen, Tabitha, Thomas, Walt, Billy, Uma, Eliza, Elsa und Joe
Scheitern ist die Würze, die dem Erfolg Geschmack verleiht.
TRUMAN CAPOTE
Inhalt
Einleitung
Wenn man nicht dazugehört
Scheitern und Prüfungen
Scheitern ab zwanzig
Scheitern und Dating
Scheitern und Sport
Scheitern und Beziehungen
Scheitern als Gwyneth Paltrow
Scheitern am Arbeitsplatz
Scheitern und Freundschaft
Scheitern und Kinderkriegen
Scheitern und Familie
Scheitern und Wut
Scheitern und Erfolg
Schluss
Dank
Einleitung
Eine meiner frühesten Erinnerungen ist eine ans Scheitern.
Ich bin drei Jahre alt, und meine Schwester ist gerade krank. Sie hat die Windpocken und liegt fiebernd und wimmernd oben in ihrem Kinderzimmer. Die Bettdecke hat sich um ihre kleinen Arme und Beine gewickelt, während meine Mutter versucht, sie zu beruhigen, indem sie ihr die Hand auf die Stirn legt. Meine Mutter hat immer kühle Hände, die sich bei Fieber sehr angenehm auf der Haut anfühlen.
Ich bin es nicht gewohnt, meine Schwester so zu sehen. Sie ist vier Jahre älter und war für mich bisher immer der Inbegriff von Klugheit. Ich verehre und bewundere sie gleichermaßen. Sie passt auf mich auf und lässt mich auf ihrem Rücken sitzen, während sie auf allen vieren durchs Zimmer krabbelt und so tut, als wäre sie ein Pferd. Sie ist diejenige, die vor meiner Geburt unseren Eltern entschieden erklärte, dass sie gerne eine Schwester hätte und sie sich nur ja Mühe geben sollten, eine zustande zu bringen. Immer wenn meine Schwester ein Bild malt oder eine Lego-Burg baut, ist das Ergebnis so viel besser als meine eigenen Versuche. Über diese vermeintliche Ungerechtigkeit kann ich richtig wütend werden, weil ich mir doch so verzweifelt wünsche, dass wir gleich wären, sie und ich. Meine Mutter muss mich dann immer daran erinnern, dass ich jünger bin und nur ein paar Jahre zu warten brauche, um sie einzuholen. Aber ich bin ungeduldig und will nicht warten. Ich wünsche mir mehr als alles andere, so wie meine Schwester zu sein.
Als ich sie jetzt sehe, mit nassen Wangen und bleichem Gesicht, bin ich erschrocken und verärgert. Ich will nicht, dass es ihr in irgendeiner Weise nicht gutgeht. Unsere Mutter fragt sie, was sie sich wünscht, damit es ihr besser ginge. Da jammert meine Schwester: »Eine Wärmflasche«. Und ich sehe eine Möglichkeit zu helfen. Ich weiß, wo unsere Mutter die Wärmflaschen aufbewahrt. Also tapse ich zu dem entsprechenden Schrank und hole mein Lieblingsexemplar heraus: mit einem kuscheligen Überzug und einem schwarzen Punkt, sodass das Ding wie ein Bär mit einer Knopfnase aussieht. Ich weiß, dass man eine Wärmflasche, wie der Name schon sagt, mit warmem Wasser füllen muss. Ich nehme den Bär mit ins Badezimmer. Das ist der Ort, den ich mit den verhassten Abenden verbinde, an denen meine Mutter mir die Haare wäscht und ich die Augen fest auf den Riss in der Zimmerdecke gerichtet halte, bis die unangenehme Prozedur vorbei ist. Das Einzige, was ich noch mehr hasse als Haarewaschen, ist Fußnägelschneiden.
Weil ich an den Wasserhahn am Waschbecken nicht herankomme, nehme ich den an der Badewanne. Ich beuge mich über den Rand aus weißem Email und muss mich strecken, um die Öffnung darunter zu halten. Dann drehe ich den Hahn mit dem roten Kreis auf, nicht den mit dem blauen, denn ich weiß schon, dass Blau kalt bedeutet. Was ich nicht weiß, ist, dass man warten muss, bis das Wasser heiß wird. Ich stelle mir vor, es fließt automatisch mit der gewünschten Temperatur heraus.
Als ich versuche, die Wärmflasche wieder zuzuschrauben, schaffe ich das mit meinen Patschehändchen nicht richtig. Egal, denke ich, das Wichtigste ist ja, diese Wärmflasche so schnell wie möglich der Patientin zu bringen. Damit sie sich bald wieder besser fühlt, aufhört zu weinen und wieder zu meiner unerschütterlichen, ruhigen und klugen großen Schwester wird.
Zurück im Kinderzimmer überreiche ich die Wärmflasche meiner Schwester, deren Tränen bei ihrem Anblick tatsächlich versiegen. Meine Mutter sieht überrascht aus, und ich bin stolz, etwas geleistet zu haben, das sie nicht erwartet hat. Aber kaum hat meine Schwester die Wärmflasche in der Hand, löst sich der Verschluss und kaltes Wasser läuft über ihren ganzen Pyjama. Sie heult auf, und das klingt noch schlimmer als das Weinen vorhin.
»Das ist so k-k-kalt!«, stottert sie und starrt mich verständnislos an. Meine Mutter beginnt sofort, das Bett abzuziehen, und versichert ihr, alles würde wieder gut. Beide scheinen zu vergessen, dass ich überhaupt dastehe. Heftige Scham flammt in meiner Brust auf. Ich habe das schreckliche Gefühl, den Menschen, den ich auf der ganzen Welt am meisten liebe, enttäuscht zu haben, obwohl ich doch nur helfen wollte. Ich bin mir nicht sicher, was ich falsch gemacht habe, aber mir dämmert, dass man Wärmflaschen wohl nicht auf diese Weise befüllt.
Meine Schwester erholte sich auch ohne mein Zutun von den Windpocken, und ich lernte zu gegebener Zeit, dass man Wasser im Kessel erhitzt, dann einige Minuten wartet, bevor man es vorsichtig durch den Gummihals einfüllt, und den Verschluss so fest wie möglich zuschraubt, nachdem man die überschüssige Luft herausgedrückt hat. Ich lernte auch, dass guten Absichten zum Trotz die Ausführung einer Aufgabe daran scheitern kann, dass man nicht über genügend Erfahrung verfügt. Dies ist eine der lebhaftesten Erinnerungen an meine Kindheit: Meine Unfähigkeit zu helfen, als ich es mir am meisten wünschte, hinterließ enorm großen Eindruck bei mir.
Es war ja eigentlich kein großes oder außerordentliches Scheitern, aber eine Niederlage muss auch gar nicht besonders bemerkenswert sein, um Bedeutung zu haben. In späteren Jahren würde ich größere Niederlagen erleben, die schwerer zu verwinden waren. So fiel ich beispielsweise durch Prüfungen und den Führerschein.
Es gelang mir nicht, den Jungen, der mir gefiel, für mich zu interessieren.
Ich gehörte in der Schule nicht wirklich dazu.
In meinen Zwanzigern kannte ich mich selbst nicht gut genug, was zu einer Reihe von Langzeitbeziehungen führte, in denen ich mein Selbstempfinden einem anderen überließ.
Ich begriff damals nicht, dass Gefallsucht niemals eine erfüllende Lebensweise sein konnte. Dass, wenn man versucht, anderen zu gefallen, man am Ende sich selbst nicht gefällt. Einfach weil man dabei versucht, das schwindende Selbstvertrauen durch das Sammeln positiver Rückmeldungen anderer zu stützen, ohne zu begreifen, dass das nicht funktioniert. Es ist ungefähr so, als würde man einen feuerspeienden Drachen ignorieren, indem man eine Kerze an seiner Flamme anzündet.
Ich scheiterte in einer Ehe und ließ mich mit sechsunddreißig scheiden.
Ich bekam die Kinder nicht, von denen ich immer geglaubt hatte, sie mir zu wünschen.
Ich versagte wieder und wieder im Tennis, egal, mit wie viel Selbstvertrauen ich auf den Platz ging.
Es gelang mir nicht, große, schwierige Gefühle wie Wut oder Trauer zuzulassen. Lieber kaschierte ich sie mit einfacheren, geschmeidigeren wie Traurigkeit.
Ich scheiterte, weil ich zu viel Aufmerksamkeit auf Unwichtiges und Dinge, die ich ohnehin nicht kontrollieren konnte, verwendete.
Ich schaffte es nicht, zu widersprechen und mir Gehör zu verschaffen, wenn man mich im Job übervorteilte und in Beziehungen ausnutzte.
Ich konnte meinen eigenen Körper nicht lieben. Das gelingt mir bis heute nicht. Es ist eine ständige Herausforderung, aber immerhin mag ich meinen Körper inzwischen schon lieber als früher. Ich bin jetzt dankbar für die Ehre, dieses wundersame, funktionierende Gebilde bewohnen zu dürfen.
Sich selbst zu akzeptieren, das ist meiner Ansicht nach ein revolutionärer Akt, der im Stillen passiert. Jahrelang scheiterte ich auch daran.
Im Laufe der Jahre habe ich geliebt und verloren. Mein Herz wurde gebrochen. Ich wechselte meine Jobs, verließ Häuser und Länder. Ich schloss neue Freundschaften und verabschiedete mich von alten. Ich ertrug Zusammenbrüche und Trennungen.
Ich wurde älter, lernte mich besser kennen. Endlich begriff ich, warum man Geld für Koffer mit Rädern und Winteranoraks ausgibt. Während ich das hier schreibe, steht mein vierzigster Geburtstag an. Damit bin ich älter als meine Mutter damals, in meiner frühen Erinnerung an die Sache mit der Wärmflasche und der schwesterlichen Zuneigung. Inzwischen habe ich eines bei diesem schockierend schönen Abenteuer namens Leben gelernt: Das Scheitern hat mich Lektionen gelehrt, die ich sonst nie begriffen hätte. Meine Weiterentwicklung ist eher eine Folge von Dingen, die schiefgelaufen sind, als davon, dass alles glattging. Krisen führten zu Klarheit und manchmal sogar zur Katharsis.
Im Oktober 2017 endete eine ernsthafte Beziehung. Die Trennung kam unerwartet und brutal plötzlich. Kurz bevor ich neununddreißig wurde. Meine Scheidung lag gute zwei Jahre zurück. Das war kein Alter, in dem ich erwartet hatte, Single und kinderlos zu sein und in eine ungewisse persönliche Zukunft zu blicken. Ich brauchte, im Sprachgebrauch der modernen Selbsthilfe-Kultur, Heilung.
Also ging ich nach Los Angeles, in eine Stadt, die ich immer wieder aufsuche, um meine Akkus aufzuladen und zu schreiben. Es ist ein Ort, an dem ich leichter atmen kann, weil ich sicher weiß, dass die Sonne mit größter Wahrscheinlichkeit auch morgen scheinen wird. Außerdem bedeutet die Zeitverschiebung von acht Stunden, dass nach 14 Uhr zum Glück nur noch wenige E-Mails eingehen werden. Ich schrieb damals als Ghostwriter die Autobiografie einer politischen Aktivistin. Obwohl ich mich verletzlich und wie einer Hautschicht beraubt fühlte, verbrachte ich meine Tage damit, die Stimme einer starken Frau anzunehmen, die genau wusste, was sie dachte. Das war ein spannender Gegensatz: nach einem Arbeitstag am Laptop, an dem ich die kraftvollen und eloquenten Überzeugungen dieser Frau in Worte gefasst hatte, wieder zu meinem verunsicherten Ich zurückzukehren. Aber es half. Nach und nach fühlte auch ich mich wieder stärker.
Damals in L.A. hatte ich erstmals die Idee zu dem Podcast »How To Fail With Elizabeth Day«. Ich hatte mir eine Menge Podcasts runtergeladen, weil mich nach der Trennung Musikhören traurig machte und Stille einsam. Einer der Podcasts, die ich abonniert hatte, war Where Should We Begin? der berühmten Paartherapeutin Esther Perel. Wo sollen wir anfangen? Darin stimmten anonyme Paare zu, dass ihre Problemgespräche mitgeschnitten wurden. Perel brachte die Paare zum Reden und vermittelte behutsam ihre Einschätzungen. Ich fand es faszinierend, wie die Patienten ihre verletzlichsten und intimsten Seiten preisgaben. Gleichzeitig sprach ich mit meinen Freundinnen und Freunden über Herzeleid und Verlust und hörte mir ihre diesbezüglichen Erfahrungen und Weisheiten an.
Ich begann zu überlegen, wie es wäre, eine Reihe von Interviews mit Leuten darüber zu führen, was sie daraus gelernt hatten, wenn Dinge schiefgelaufen waren. Wenn ich mein eigenes Leben betrachtete, wusste ich, dass die Lektionen, die mir Episoden des Scheiterns beschert hatten, unsagbar viel tiefgründiger waren als alles, was ich seinem glatten heimlichen Zwilling, dem Erfolg, verdankte. Ob andere Leute das genauso empfanden, sich aber aus Furcht vor der Peinlichkeit nicht darüber zu reden trauten? Was wäre, wenn wir darüber sprechen müssten, um uns besser und weniger isoliert zu fühlen, wenn das Leben nicht nach Plan lief?
Wir leben in einem Zeitalter der betreuten Perfektion. Auf Instagram werden unsere täglichen Posts gefiltert und manipuliert, um dem Eindruck zu entsprechen, den wir vermitteln wollen. Wir sind einer permanenten Flut ausgesetzt, von Promis, die ihre Bikini-Figur-Selfies teilen wollen, von gestylten Clean-Eating-Gurus, die uns erklären, welches Quinoa-Getreide wir essen sollen, von Politikern, die Bilder von den Großtaten posten, die sie in ihren Wahlbezirken vollbringen. All das kann sich schon überwältigend anfühlen. In dieser Blase lächelnder, glücklicher Menschen, übersät mit Lachgesicht-Emojis und Herzchen-GIFs, bleibt kaum noch Raum für sinnstiftende Reflexion.
Doch es ändert sich etwas. Inzwischen findet man in den sozialen Medien schon leichter diese bewundernswerten Menschen, die es wagen, offen von ihren Problemen mit allem Möglichen – von Body-Image bis zu psychischen Erkrankungen – zu berichten. Manchmal allerdings fühlen sich solche Beiträge genauso manipuliert an wie alles andere. Als wäre Ehrlichkeit einfach nur ein weiterer Hashtag geworden.
Und dann sind da ja noch die Meinungen. Endlose, lautstarke Meinungen, generiert durch einen bloßen Klick auf den Tweet-Button. Als ehemalige Journalistin der Guardian Media Group, die als einer der ersten Zeitungsverlage Online-Kommentare nicht nur hinter einer Bezahlschranke zuließ, kann ich persönlich bezeugen, was für eine Menge aggressiver, rechthaberischer Internet-Wut da draußen vorhanden ist. In meinen acht Jahren als Feature-Autorin beim Observer wurde mir einfach alles unterstellt – von Sand in meiner Vagina bis zu Unkenntnis über den Unterschied zwischen Misogynie und Misandrie. Es hieß auch, man hätte mich nur eingestellt, weil ich eine Frau bin oder irgendwelche heimlichen nepotistischen Beziehungen zu den Mächtigen hätte (hatte ich nicht). Und wenn mir dann mal ein Fehler unterlief – weil ich auch nur ein Mensch bin, manchmal mit Deadline schreiben musste und vielleicht etwas durchrutschte, was auch die Korrektoren übersehen hatten –, dann kam es gleich zu einer bellenden Hetze, die in sofortiger Verdammung gipfelte. Natürlich hätten meine Fakten stimmen sollen, genau wie bei jeder anderen Journalistin oder jedem Journalisten – aber dieser Aufschrei fühlte sich im Verhältnis zur Verfehlung schlicht überzogen an.
In diesem Klima wird es zunehmend schwierig, neue Dinge auszuprobieren oder Risiken einzugehen, weil man die sofortige öffentliche Schmähung fürchtet. Ein guter Freund von mir, Jim, war im Amerika der 1960er-Jahre Bürgerrechtsanwalt. Er nahm damals Fälle an, bei denen er keine Hoffnung hatte, sie zu gewinnen. Einfach weil es moralisch richtig war. In letzter Zeit fühlt er sich entmutigt, wenn er sieht, dass die von ihm als Mentor betreuten Junganwälte zu viel Angst haben, sich in Fällen zu engagieren, bei denen ein für sie positives Urteil nicht garantiert ist.
»Und dann sage ich zu ihnen: Versucht es doch wenigstens mal! Ihr müsst auch mal scheitern, um zu erkennen, wie man es richtig macht«, erzählte Jim mir einmal bei einem Abendessen. »Wen kümmert es, was andere Leute denken? Wenn du ganz allein auf einer einsamen Insel strandest und ums Überleben kämpfst, wirst du dann etwas drauf geben, was andere denken? Nein! Weil du viel zu beschäftigt damit bist, mit einer Lupe Feuer zu machen und vorbeifahrenden Schiffen ein Zeichen zu geben, damit du nicht krepierst.«
Aber Jims Junganwälte sind in einer Zeit aufgewachsen, in der man Versagen als Endpunkt betrachtete und nicht als nötigen Zwischenstopp auf einer Reise zu größerem Erfolg. In einer Gesellschaft, in der jeder den Anspruch erhebt und ermutigt wird, reflexartig auszuteilen und auf allen möglichen Plattformen gleichzeitig zu kritisieren. Ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als Erfolg zur überwältigenden Erwartung geworden ist, gilt Scham als öffentliches Leiden. Kein Wunder, dass diese jungen Juristen sich wie gelähmt fühlten. Kein Wunder, dass wir davor zurückschrecken, unsere Fehler oder falschen Entscheidungen zuzugeben.
Und doch wollte ich, je länger ich darüber nachdachte, meinen Niederlagen Anerkennung zollen, weil erst sie mich zu der gemacht haben, die ich bin. Obwohl negative Erfahrungen nie ein Vergnügen sind, bin ich rückblickend dankbar für sie. Ich sehe, dass ich wegen ihnen andere, bessere Entscheidungen getroffen habe. Ich kann sehen, dass ich stärker geworden bin.
So kam es zu »How To Fail With Elizabeth Day«, einem Podcast, in dem ich »erfolgreiche« Leute fragte, was sie aus Niederlagen gelernt haben. Die Prämisse war ganz einfach: Ich bat jeden Interviewgast, mir drei Beispiele dafür zu nennen, wo er oder sie gescheitert war. Erlaubt war alles, von misslungenen Dates, verhauenen Führerscheinprüfungen bis zu Jobverlust und Scheidung. Das Schöne daran war, dass der Gast die Kontrolle darüber hatte, was er oder sie besprechen wollte, und sich folglich im besten Fall bereitwilliger öffnete. Mir war auch klar, dass die Entscheidungen jedes Gasts auch schon für sich sprechen würden.
Nachdem ich siebzehn Jahre lang Prominente für Zeitungen und Zeitschriften interviewt hatte, empfand ich die Aussicht, eine Begegnung nicht auf einen bestimmten Aspekt hin, den ein gewisser Chefredakteur sich wünschte, schreiben zu müssen, als großartige Befreiung. Ich zeichnete die Sendung live auf, ungefähr fünfundvierzig Minuten bis eine Stunde, und ließ dann das Interview für sich selbst sprechen: als ehrliche Konversation über Themen, die sonst nicht so viel Sendezeit bekommen.
Als die erste Folge des Podcast live gestellt wurde, interessierten sich über Nacht Tausende Hörer dafür. Die zweite katapultierte sich in die iTunes-Charts – noch vor My Dad Wrote a Porno, Serial und Desert Island Discs. Nach der achten Episode war ich plötzlich bei 200 000 Downloads und besaß einen Buchvertrag. Täglich bekam ich Dutzende Nachrichten von besonderen Menschen, die schwierige Dinge durchmachten und mich wissen lassen wollten, wie sehr der Podcast ihnen dabei geholfen hatte.
Die Frau, der man mit fünfzehn gesagt hatte, sie würde niemals Kinder zur Welt bringen können.
Der Werbemanager, dem man wegen chronischer Fatigue seinen Job gekündigt hatte.
Der Mann, den ich einst für eine Zeitung interviewt hatte, meldete sich bei mir, um zu erzählen, dass seine Mutter sich nach einer Stammzellen-Transplantation und neun Tagen Chemo auf der Intensivstation befände. Sie könne kaum atmen oder sprechen, aber sie würde meinem Podcast lauschen, weil sie das so beruhige. »Es bewirkt eine echte Besserung«, schrieb er. Ich las das, während ich mir gerade einen Toast machte, und brach in Tränen aus. Der Toast verbrannte.
Der Universitätsprofessor, der meinte, er habe dadurch die Problematik weiblicher Unfruchtbarkeit begriffen und könne jetzt seine Frau und die Töchter besser verstehen.
Die gut zwanzigjährige Studentin, die mir in ihrer Nachricht jegliche Hilfe anbot, weil sie die Idee so überzeugend fand.
Diejenigen, die mir berichteten, sich weniger allein, weniger beschämt, weniger traurig, weniger bloßgestellt zu fühlen.
Diejenigen, die mich wissen ließen, sie seien jetzt besser imstande, mit etwas fertigzuwerden, positiver und fühlten sich eher verstanden.
Diejenigen, die mir von Selbstmordgedanken in der Vergangenheit erzählten, mir depressive Episoden gestanden und ihr Leben mit einer Offenheit vor mir ausbreiteten, die mich ehrte.
All diese Menschen hatten zugehört. All diese Menschen überzeugte die Idee, die Arthur Russell auf so elegante Weise im Refrain von »Love Comes Back« ausdrückt: dass – ›being sad is not a crime‹ – Traurigkeit kein Verbrechen ist und Scheitern mehr bedeutsame Lektionen lehrt als Erfolg ohne Umwege.
Ich war überwältigt und gerührt. Insgeheim überraschte mich auch, welche Saite ich da offenbar zum Klingen brachte. Persönlich war ich schon lange davon überzeugt gewesen, dass Ehrlichkeit im Hinblick auf die eigenen Schwächen der Ursprung wahrer Stärke sei, doch erzeugte diese Botschaft eine Resonanz, die ich mir nicht hätte träumen lassen.
Der Podcast ist zweifellos das mit Abstand Erfolgreichste, was ich je zustande gebracht habe. Und mir ist die Ironie, die darin liegt, durchaus bewusst. Sie entging auch anderen nicht. Eine meiner Freundinnen begann jede Nachricht an mich mit den Worten: »An die berühmte Versagerin, Elizabeth Day«. Es gab auch Kommentare, in denen argumentiert wurde, eine Vielzahl von Prominenten in meinem Podcast über verlorene Kricketpartien (Sebastian Faulks) oder peinliche One-Night-Stands (Phoebe Waller-Bridge) jammern zu lassen, sei eine ungeheuerliche Form von gespielter Bescheidenheit.
Die Überlegung dahinter schien zu sein, dass jemand, der letztlich Erfolg hat, keine wahre, allumfassende Niederlage erlitten haben kann. Warum hatte ich keine Gäste in meinem Podcast, die sich gerade mitten im Prozess des Scheiterns befanden? Oder warum konnte ich nicht jeden für sich allein und auf seine eigene Weise versagen lassen, so gut es eben ging? Denn war Scheitern nicht etwas, mit dem man einfach fertigwerden und was man überwinden musste, anstatt darüber zu reden?
Meine Antwort darauf lautet, dass ich das Scheitern doch nicht propagiere. Aber es ist etwas, das jeder von uns zu irgendeinem Zeitpunkt des Lebens erfahren wird. Und anstatt es als Verhängnis zu fürchten, über das man nie hinwegkommen wird, können wir vielleicht den Muskel unserer emotionalen Resilienz trainieren, indem wir von anderen lernen. Auf diese Weise sind wir, wenn das nächste Mal etwas schiefgeht, besser gerüstet, damit umzugehen. Hört man einem erfolgreichen Menschen – jemand, der von außen betrachtet, alles zu haben scheint – offen über seine Niederlagen sprechen, wirkt das inklusiv, nicht ausgrenzend. Insbesondere wenn man solche Leute über Depression, über Irrwege in ihrer beruflichen Laufbahn oder misslungene Beziehungen reden hört. Denn so viele von uns erleben ähnliche Dinge und sorgen sich, dass sie uns auf negative Weise definieren werden.
Ich will auch nicht behaupten, dass sich jede Form von Scheitern leicht überwinden lässt. Weil es manches gibt, über das man nie hinwegkommt und worüber man schon gar nicht sprechen möchte. Und es gibt natürlich viele Bereiche, in denen ich über gar keine persönliche Erfahrung verfüge. Mir ist, während ich dieses Buch schreibe, absolut bewusst, dass ich keine Expertin bin und meinen Leserinnen und Lesern keine anderen als meine selbst gemachten Erfahrungen anzubieten habe. Ich bin eine privilegierte weiße Frau aus der Mittelschicht in einer Welt, in der leider Rassismus, Ungleichheit und Armut existieren. Ich weiß nicht, wie es ist, wegen meiner Hautfarbe täglich Mikro-Aggressionen ausgesetzt zu sein, auf der Straße angespuckt oder bei einer Beförderung übergangen zu werden. Ich habe keine Ahnung davon, wie es ist, von Mindestlohn zu leben, Geflüchtete, behindert oder schwerkrank zu sein oder in einer Diktatur ohne Meinungsfreiheit zu leben. Ich bin nicht Mutter, kein Mann und keine Immobilienbesitzerin, daher kann ich über keines dieser Themen aus Erfahrung sprechen. Es wäre eine Anmaßung und Beleidigung der tatsächlich Betroffenen, es zu versuchen. Aus diesem Grund basieren die folgenden Kapitel auf persönlichem Erleben und tiefem Respekt vor meinen diskriminierten Mitmenschen. Ich schildere in diesem Buch nur eine Version von Versagen. Vielleicht können Sie sich darin wiederfinden, vielleicht haben Sie Ihre eigene. Und vielleicht werde ich die eines Tages zu hören bekommen.
Durch den Podcast und beim Schreiben dieses Buchs habe ich eine Menge gelernt. Besonders interessant fand ich, als ich anfing, auf potenzielle Gäste zuzugehen, wie verschieden Frauen und Männer Niederlagen betrachten. Alle Frauen konnten meine Idee sofort nachempfinden, und alle – bis auf eine – behaupteten, schon so oft gescheitert zu sein, dass sie gar nicht wüssten, wie sie daraus die gewünschten drei Beispiele aussuchen sollten.
»Ja, ich bin sehr gut im Versagen, wohl deshalb, weil ich Risiken eingehe und mich selbst dazu bringe, Neues auszuprobieren«, meinte Gina Miller, die politische Kampagnen organisiert. »Und wenn man das tut, setzt man sich der Möglichkeit zu scheitern aus. Aber es bedeutet gleichzeitig, sein Leben wirklich zu leben … Im Leben scheitern wir alle mal, deshalb denke ich, man muss sich einfach daran gewöhnen. Es passiert sowieso, da legt man sich doch besser eine Strategie zurecht, wie man damit umgehen will. Sobald man die in der Hinterhand hat, kann man sich ins Leben stürzen und wirklich Risiken eingehen.«
Die meisten Männer (natürlich nicht alle) reagierten mit der Äußerung, sie seien sich nicht sicher, ob sie überhaupt schon mal gescheitert seien, und vielleicht nicht unbedingt der richtige Gast für ausgerechnet diesen Podcast.
Dieser Unterschied lässt sich wissenschaftlich untermauern: Die Amygdala, das primitive Angstzentrum, das dem emotionalen Gedächtnis bei der Verarbeitung hilft und Reaktionen auf stressige Situationen steuert, lässt sich bei Frauen leichter als bei Männern durch negative emotionale Stimuli aktivieren. Frauen entwickeln daher eher als Männer starke emotionale Erinnerungen an negative Ereignisse oder grübeln eher über Dinge, die in der Vergangenheit schiefgegangen sind. Zudem ist der anteriore cinguläre Cortex, also der Teil des Gehirns, der uns hilft, Fehler zu erkennen und Optionen abzuwägen, bei Frauen größer.
Quasi als Dominoeffekt dieser Gegebenheiten werden Frauen, wie Katty Kay und Claire Shipman in ihrem Buch »Das neue Selbstbewusstsein« schreiben, routinemäßig Opfer ihrer eigenen Selbstzweifel: Im Vergleich zu Männern hielten Frauen sich nicht im gleichen Maß für eine Beförderung bereit. Sie neigten zu der Annahme, in Prüfungen schlechter abzuschneiden und unterschätzten grundsätzlich ihre Fähigkeiten.
Ich vermute, dass sich das ändern würde, wenn Frauen sich eher in der Lage fühlen würden, zu ihren Niederlagen zu stehen. Ich selbst war jedenfalls total perplex, als der Autor Sebastian Faulks mir erklärte, Scheitern sei sowieso nur eine Frage der Perspektive. Vor unserem Podcast-Interview schickte er mir eine lustige E-Mail, in der er seine Niederlagen schon mal kurz erläuterte:
»… als mein Freund Simon und ich das Endspiel der Ü 40 im Doppel verloren und uns mit der Glasvase für die Zweitplatzierten zufriedengeben mussten.
Beim Kricket erinnere ich mich, einmal Out gewesen zu sein, als ich schon 98 Punkte hatte und mir der Wurf zurück zum Bowler misslang …
Eines meiner Bücher schaffte es in die Auswahl der Nominierten für die Bancarella, einen großen italienischen Literaturpreis, gewann aber nicht. (Der Preis ging an den Schwager des Jury-Vorsitzenden.)
Und natürlich war es eine peinliche Niederlage, als mein berühmtes Soufflé à la nage de homard nur um 288 Millimeter anstatt der gewünschten 290 aufging.«
Er scherzte natürlich. Als ich ihn für den Podcast interviewte, erzählte er wortgewandt von seinen depressiven Phasen und dass er sich an der Schule nicht dazugehörig gefühlt hatte. Der Punkt, den er hatte vermitteln wollen, war jedoch ein ernster: Scheitern ist immer eine Frage der Perspektive. Zum Beispiel sagte er zum nicht gewonnenen italienischen Literaturpreis: »Ist das eine Niederlage? Ich dachte eigentlich nicht, denn es ist doch sogar ein Erfolg, nach Mailand zu reisen und in einem fremden Land für das eigene Buch gefeiert zu werden, das nicht einmal einen Bezug zu Italien hat.«
Der Autor James Frey sah das ähnlich, obwohl er öffentlich dafür angefeindet worden war, Teile von »Tausend kleine Scherben«, seinem Debüt von 2003, erfunden zu haben. Das Buch war ursprünglich als Autobiografie vermarktet worden, doch der schlechte Ruf des Autors schadete ihm nicht. Es wurde weltweit ein Bestseller.
»Ich sehe Dinge, die andere Leute vielleicht als Niederlagen betrachten, nicht als solche. Es ist schlicht ein Prozess, oder etwa nicht?«, meinte er. »Und entweder kommt man damit klar oder nicht. Wenn nicht, dann verschwinde. Aber ich empfinde die ganzen Bücher, die ich vor ›Tausend kleine Scherben‹ zu schreiben versucht habe und verworfen habe, weil sie nicht gut waren, nicht als Scheitern, sondern als Teil eines Prozesses.«
Bis heute, sagt Frey, laute sein Mantra: »Scheitere schnell. Scheitere oft.« Das ist ein Mantra, das auch in der (männerdominierten) Welt der Unternehmer und Existenzgründer viel Gewicht hat. Auch dort muss man Risiken eingehen, um anders zu denken. In diesen Kreisen ist Scheitern nicht nur akzeptiert, sondern wird manchmal regelrecht gefeiert. Es gibt sogar Risikokapital-Anleger, die nicht einmal daran denken zu investieren, wenn der Entrepreneur nicht mindestens einmal mit einem Start-up gescheitert ist. Dahinter steht der Gedanke, dass der Unternehmer aus dieser Niederlage gelernt hat und die gleichen Fehler kein zweites Mal begehen wird. Thomas Edison perfektionierte seine Glühbirne schließlich auch erst nach tausend Prototypen. Bill Gates erste Firma war ein Flop. Und der berühmte Babe Ruth stellte während seiner Baseball-Karriere den Negativ-Rekord von 1330 Strike-Outs auf, schaffte aber gleichzeitig auch den Rekord von 714 Homeruns.
Als man den Spieler nach seiner Schlagtechnik fragte, erwiderte Babe Ruth: »Ich schlage, so hart ich kann … Ich hole weit aus, mit allem, was ich habe. Dann schlage ich großartig oder haue in großem Stil daneben. Es gefällt mir, im Leben immer aufs Ganze zu gehen.«
Was er damit letztlich meinte, war: Um im großen Stil Erfolg zu haben, muss man bereit sein, in genauso großem Stil zu verlieren. Oft bedingt Ersteres ja Letzteres. Daher kann Scheitern ein integraler Bestandteil von Erfolg sein, nicht nur auf dem Baseballfeld, sondern im Leben.
Was bedeutet Scheitern eigentlich? Ich denke, es bedeutet im Grunde genommen nur, dass wir unser Leben in vollen Zügen leben. Wir machen Erfahrungen auf verschiedenen Ebenen, anstatt uns nur mit der Eintönigkeit eines einzigen, gleichbleibenden Gefühls zu begnügen.
Wir leben in Farbe, nicht in Schwarz-Weiß.
Wir hören niemals auf zu lernen.
Und bei allen Herausforderungen, die uns noch begegnen werden, kann ich immer nur denken: Es ist wirklich ein unglaubliches Abenteuer.
Wenn man nicht dazugehört
Als ich vier Jahre alt war, zog meine Familie nach Nordirland. Das war 1982, auf dem Höhepunkt des Nordirlandkonflikts. Regelmäßig explodierten damals Bomben in Einkaufszentren und Hotellobbys. Wenn sie mich zum Kindergarten brachte, wurde meine Mutter an Checkpoints von Soldaten in Tarnkleidung und mit umgehängten Maschinenpistolen kontrolliert. Abends in den Fernsehnachrichten wurde die Stimme des Anführers von Sinn Féin, Gerry Adams, synchronisiert, was ich schon als Kind seltsam fand.
Als ich dann Jahre später seine Stimme hörte, war ich enttäuscht. In meiner Vorstellung hatte ich erwartet, er würde wie eine unfreundliche Version von Darth Vader klingen. Stattdessen erinnerte er eher an einen Geografielehrer, der die Störenfriede aus den letzten Bänken nicht im Griff hatte.
Ich selbst sprach übrigens mit einem präzisen, allgemein akzeptierten englischen Akzent und stach daher vom ersten Tag in der Vorschule an heraus. Zur Welt gekommen war ich in Epsom, einem vergleichsweise sicheren Vorort in Surrey. Alljährlich fand gleich neben unserem Haus das Epsom Derby auf den Downs statt. Meine Mutter veranstaltete dann ein Picknick, zu dem sie zahlreiche Verwandte und Freunde einlud. Einmal sah ich den legendären Jockey Lester Piggott von seinem Pferd stürzen. Er wurde, kreidebleich, auf einer Trage weggebracht. Obwohl ich damals selbst noch ziemlich klein war, wunderte ich mich darüber, wie schmal und zierlich er war.
In Irland gab es weder Picknicks noch Freunde der Familie. Wir alle erlebten die Zeit dort relativ isoliert, vor allem aber meine Mutter, die keinen Job hatte, über die sie neue Leute hätte kennenlernen können. Mein Vater war wegen seiner Arbeit mit uns hergezogen. Im Altnagelvin Hospital in Derry hatte er eine neue Stelle als Facharzt für Chirurgie angetreten. Er sollte dort viele Fälle von knee-capping, also Schusswaffenverletzungen von Knien, Knöcheln und anderen Gelenken, behandeln.
Ich bekam die Unruhen mit und akzeptierte sie so, wie man das als Kind eben tut. Sie gehörten zum Alltag. Anstatt Monster fürchtete ich unter meinem Bett Terroristen mit Sturmhauben. Ich gewöhnte mich auch daran, dass die Damen an den Supermarktkassen uns misstrauisch fragten, ob wir »im Urlaub« seien, wenn wir unseren Wocheneinkauf bezahlten. Nicht klar war mir damals, dass sie tatsächlich fragen wollten, ob wir etwas mit der dort stationierten britischen Armee zu tun hätten. Ich erinnere mich noch, dass man uns Angst vor IRA-Bomben machte, und daran, dass meine Mutter zu erwidern pflegte, mein Vater behandle »Menschen beider Seiten«. Das stimmte: Er versorgte Loyalisten wie Republikaner. Als 1998 eine vernichtende Bombe in Omagh hochging, eilte er zu Hilfe. Später arbeitete mein Vater mit Ärzte ohne Grenzen noch in vielen anderen Kriegsgebieten, darunter Tschetschenien, Sierra Leone und Afghanistan. Als ich ihn Jahre später fragte, welcher Schauplatz ihm am meisten zu schaffen gemacht hatte, sagte er Omagh und beschrieb mir detailliert das Gemetzel, das er dort mit eigenen Augen gesehen hatte.
Trotz allem gab es aber auch absurde Momente. Ungefähr ein Jahr lang lebte meine Familie an einer Straße oberhalb eines Dorfs namens Muff (was übrigens ein Slang-Ausdruck für Schamhaar ist). Ich machte mir über diesen ungewöhnlichen Namen nie Gedanken, bis ich viele Jahrzehnte später meinem Freund Cormac davon erzählte und der in schallendes Gelächter ausbrach.
»Muff?«, wieherte er. »Da hättet ihr ja genauso gut in einem Ort namens Vagina wohnen können.«
Das Dorf lag nur wenige Autominuten von unserem Haus in Nordirland entfernt, aber trotzdem jenseits der Grenze im County Donegal, das zum Süden des Landes gehörte. Meine Mutter pflegte meine Schwester und mich zu unseren Irish-Dance-Stunden nach Muff zu fahren (sie waren Teil des Versuchs, dafür zu sorgen, dass wir dazugehörten). Damals fand ich es verblüffend, dass gleich die Straße runter ein ganz anderes Land liegen sollte. Das kam mir so willkürlich vor, und genau das war es ja auch. Ich konnte mit vier Jahren einfach nicht begreifen, dass Menschen sich nur wegen dieser auf einer Landkarte gezogenen Grenzlinie gegenseitig umbrachten.
Der Tanzunterricht war nicht der einzige Versuch unserer Familie, etwas für unsere Zugehörigkeit zu tun. Als wir aus der Nähe von Muff weiter aufs Land und in die Nähe von Claudy zogen, schaffte mein Vater eine Eselin, einen rot-blau gestrichenen Wagen und vier Schafe an, die wir auf dem Hügel hinter unserem Haus hielten, den meine Familie »The Rath« nannte, ohne dass ich damals gewusst hätte, warum. Prähistorische Kultorte sagten uns nichts.
Die Eselin Bessie bekam bald ein Fohlen, das wir ausgesprochen fantasievoll Little Bess tauften. Bei den Namen der Schafe ließen wir uns mehr einfallen und gaben ihnen Namen wie Lamborghini und Lambada. Jeden Sommer versuchten meine Eltern heldenhaft, die Schafe von Hand mit etwas, das für mich wie eine riesengroße Küchenschere aussah, von ihrer Wolle zu befreien. Meine Schwester und ich hatten dann als Hirtenhunde zu fungieren und die blökenden Tiere zusammenzutreiben, was uns mal besser, mal schlechter gelang.
Zur Paarungszeit liehen wir Schafböcke von einheimischen Bauern, die unsere Schafdamen schwängern sollten. Bei dieser Tätigkeit fiel einer der Böcke tot um. Wir informierten den Bauern, und dann hob mein Vater ein tiefes Loch aus, um das Tier darin zu begraben. Der Bock war so schwer, dass man ihn nur auf dem Rücken und mit den Beinen in der Luft ziehen konnte. Rätselhafterweise reichte, als der Bock in der Grube lag, das Erdreich nicht aus, um ihn komplett zuzudecken. So stakten danach monatelang seine Beine wie unheimliche Totempfähle aus den Erdklumpen hervor. Ich gewöhnte mir an, diesen Bereich zu meiden.
Regelmäßig verschwanden auch plötzlich Lämmer, und ich stellte das lange nicht in Frage. Erst später zählte ich eins und eins zusammen und begriff, dass jedes Mal viele Plastikbeutel mit Fleisch in der Gefriertruhe auftauchten, nachdem ein Lamm von The Rath verschwunden war.
»Ist … das … Lämmchen?«, stotterte ich eines Sonntags beim Mittagstisch und starrte auf den mit Kartoffeln und Minzsoße servierten Braten.
Nach einer Weile begannen meine Eltern, den Schafen statt Namen nur noch Nummern zu geben, damit meine emotionale Bindung an sie nicht so intensiv wurde. Keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert hat, aber bis heute esse ich lieber gebratenes Hühnchen.
Weil das die Zeit vor dem Internet und vor Netflix war, hatten meine Schwester und ich, wenn wir nicht gerade Schafe zusammentrieben, selbst für unsere Unterhaltung zu sorgen. Ich verstand unter Vergnügen, in dem riesigen Gebüsch aus Rhododendren zu verschwinden, um einen Krimi von Nancy Drew zu lesen, oder am Fluss Faughan zu spielen. Dessen Name klang, wenn man ihn mit nordirischem Akzent aussprach, wie ein Schimpfwort. Außerdem tapezierte ich den Dachboden mit Zeitungsausschnitten, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass Anne Frank das in ihrem Versteck vor den Nazis auch getan hatte. Ich war damals seltsam gefesselt vom Zweiten Weltkrieg. Wenn ich heute darüber nachdenke, dann lag das vielleicht daran, dass ich an einem von politischen Konflikten geprägten Ort lebte.
Der Großteil der Terroranschläge erfolgte außerhalb meiner unmittelbaren Umgebung. Meine Grundschule war ein schöner Ort mit guten Lehrkräften und Kindern, die mich so, wie ich war, zu akzeptieren schienen. Der Nordirlandkonflikt schien unser Bewusstsein auf vertraute und zugleich abstrakte Weise zu beeinflussen. Alle wirkten abgehärtet. In den 1970er-Jahren, als Bomben und Sprengfallen und Schießereien in Teilen Nordirlands fast an der Tagesordnung waren, gewöhnten die Ärzte vor Ort sich an, »Nerventabletten« zu verschreiben, und der Verbrauch von Beruhigungsmitteln war der höchste in ganz Großbritannien. Paradoxerweise waren laut Patrick Radden Keefes Buch »Say Nothing«, nach Angaben der Ärzte, diejenigen, die am ehesten unter behandlungsbedürftigen Angstzuständen litten, nicht die aktiven Kämpfer. Sie hielten sich in den Straßen auf und hatten ein Gefühl von Handlungsmacht. Betroffen waren vielmehr die Frauen und Kinder, die hinter verschlossenen Türen Schutz suchten und festsaßen.
Als ich nach Nordirland kam, hatte diese traumabedingte Duldungsstarre sich schon zu einer Kultur des Schweigens entwickelt. Worte benutzte man sparsam, und oft waren sie mit symbolischer, historischer Bedeutung aufgeladen. Die zu unserem Wohnort nächstgelegene Stadt hieß auf den Straßenschildern Londonderry, doch wenn man in einem Gespräch den vollen Namen verwendete, kam das einem probritischen politischen Statement gleich. Man sagte also Derry oder riskierte die entsprechenden Konsequenzen. Das sagte mir niemand ausdrücklich, aber ich nahm dieses Wissen auf, ohne dass es laut ausgesprochen wurde.
Manchmal war das Schweigen besonders akut. Als der Vater eines Jungen in einer Klasse unter mir mit Maschinengewehrfeuer getötet wurde, weil er in seinem Laden auch an Angehörige der britischen Armee verkaufte, kann ich mich nicht erinnern, dass jemand von uns das erwähnte. Ich merkte, dass meine Eltern in ernstem Ton leise miteinander sprachen. Ich gewöhnte mir an, genauso auf das zu achten, was nicht gesagt wurde, wie auf das, was man sagte. Meistens machte ich einfach weiter und versuchte, nicht zu viel über die Dinge nachzudenken, die mir Angst einjagten.
Aber als ich auf die weiterführende Schule in Belfast kam, wurde mir mein Anderssein deutlicher bewusst. Unter der Woche besuchte ich dort ein Internat, und als ich einmal am Wochenende zum Bus ging, um nach Hause zu fahren, führte mein Weg über einen Platz, an dem es am Vorabend einen Bombenanschlag gegeben hatte. Ich kam an den Überresten eines Autos vorbei, dessen Metall bis zur Unkenntlichkeit verbogen war. Jede einzelne Scheibe des Europa Hotels war geborsten. Unter meinen Füßen knirschten Konfetti aus Glas.
Damals bedeutete ein englischer Akzent in manchen Vierteln, dass man als verhasster Besatzer erkannt wurde. Weil ich das wusste, versuchte ich, nur wenig zu reden, wenn ich neue Leute kennenlernte oder mich an fremden Orten aufhielt. In der Schule musste ich jedoch sprechen und konnte mich nirgends verstecken.
Meine eigene Fremdheit wurde mir niederschmetternd bewusst, als man mich zu Beginn des zweiten Jahrs an der weiterführenden Schule wissen ließ, ein Junge aus meinem Jahrgang stehe nicht auf mich, »weil sie Englisch ist«. Das war nicht mal ein besonders attraktiver Typ. Ich stand meinerseits nicht auf ihn, weil er immer ein rötliches Gesicht hatte und ein bisschen nach rohen Würsten roch.
Trotzdem traf mich seine Zurückweisung bis ins Mark. Plötzlich begann ich, mich mit den Augen anderer Leute zu betrachten: Mein neonorangefarbener Rucksack, den ich auf beiden Schultern trug, war modisch nicht gerade der letzte Schrei; Cordhosen waren noch nie cool gewesen; mein Akzent war so auffällig fremd, dass er sogar Jungs abschreckte, die nach Wurst rochen; mein Haar war eher platt und nicht lockig wie Charlenes in der TV-Serie »Die Nachbarn«. Ich besaß kein Welleisen, und meine Mutter erlaubte keine Dauerwelle. Tatsächlich schnitt sie mir selbst die Haare, was natürlich nicht gerade hilfreich war.
Wie um die Kränkung noch zu verschlimmern, hatte ich ein Jahr übersprungen und war damit die mit Abstand Jüngste in meiner Klasse. Aber am schlimmsten war, dass ich Englisch war.
Ich begann zu merken, dass die Mädchen, die ich für meine Freundinnen gehalten hatte, eher über mich als mit mir sprachen. Sie schmiedeten Pläne, um mit gefälschten, laminierten Ausweisen in Nachtclubs zu gehen, bezogen mich aber nicht mit ein. Ich hörte sie miteinander lachen, aber wenn ich dazukam, erstarb das Lachen, so wie eingeschlafener Wind plötzlich ein Segel erschlaffen lässt. Ich war die ständig wechselnde Spannung zwischen Gesagtem und Unausgesprochenem so gewohnt, dass mir gar nicht einfiel, das in Frage zu stellen. Ich nahm es einfach hin und gewöhnte mich daran, nicht dazuzugehören.
Die Situation spitzte sich in der Woche zu, als unsere Schulfotos gemacht wurden – diese peinlich verlegenen Porträts in Blazern, mit unbehaglich gezwungenem Lächeln und misstrauischen jugendlichen Blicken.
Mein Foto war ein besonders gutes Beispiel. Ich hatte schiefe Zähne, Ohren, die durch die schlaffen, schulterlangen Haare hervorstanden, die mir immer noch meine Mutter schnitt. Dazu grinste ich bescheuert in die Kamera und saß mit einer Schulter zur Kamera gedreht, wie der Fotograf es verlangt hatte. Die Ärmel meines Blazers waren zu lang und hingen mir über die Hände. Meine Mutter war nämlich nicht nur der Meinung, mein Haar sollte immer relativ kurz sein, sondern auch überzeugt, dass es sinnlos wäre, in eine Schuluniform zu investieren, die tatsächlich passte, wenn man doch auch Kleider kaufen konnte, die noch reichlich Zuwachs erlaubten.
Es passierte, als ich den vollen Schulflur zur Doppelstunde Geschichte bei Mrs O’Hare entlangging. Das beliebteste Mädchen meines Jahrgangs – nennen wir sie Siobhan – hatte einen Lachkrampf. Sie schaute auf ein Stück Papier in ihrer Hand und gab es dann an eine Schar williger Gefolgsleute weiter, die es jeweils ansahen und dann ebenfalls hysterisch loslachten. Siobhan sagte irgendetwas im Flüsterton und hielt sich dann eine Hand vor den Mund. Noch mehr Gelächter. Dann bemerkte sie, dass ich sie ansah, und fing meinen Blick auf.
»Wir haben uns gerade dein Foto angeschaut«, kicherte sie. »Du siehst …« Kichern. »… echt …« Kichern. »… hübsch aus.«
Schallendes Gelächter. Sogar ich wusste, dass ich nicht hübsch aussah. Tränen brannten in meinen Augen. Halt sie zurück, sagte ich mir. Tu so, als wäre es dir egal. Aber natürlich war es mir nicht egal. Es war mir schrecklich wichtig. Als Zwölfjährige hatte ich das denkbar größte Bedürfnis, durch Tarnung dazuzugehören. Ich wollte nicht auffallen. Ich hatte noch nicht genug Selbstvertrauen, um eine eigene Identität als Teenager zu entwickeln. Und bis es so weit war, wollte ich einfach nur eine von ihnen sein.
In dem Moment dämmerte es mir: Ich war die Witzfigur der Schule. Ich gehörte nicht dazu und hatte es nie getan. Ich war das seltsame, hässliche englische Mädchen mit den üblen Klamotten. Ich kam mir dumm vor, als hätte ich meinem eigenen Unterbewusstsein diese große Lüge aufgetischt. Anscheinend hatte ich mir selbst vorgemacht, so zu sein wie all die anderen normalen Kinder. Dummerweise hatte ich geglaubt, die Eigenschaften, die meine Eltern und meine Schwester schätzten – Sinn für Humor, Eigenwilligkeit und eine leicht exzentrische Vorliebe für die Radio-Soap »The Archers« – würden sich nahtlos in eine andere Umgebung übertragen lassen. Aber Teenager sind bei Unterschieden unerbittlich. Außerdem ist da eine feine Trennlinie zwischen Eigenwilligkeit und schamloser Frühreife, oder? Wahrscheinlich war ich unerträglich.
Es ist wirklich interessant, worauf das Gedächtnis sich fixiert. Bestimmt passierten zu jener Zeit noch andere Dinge, die für sich genommen weitaus schlimmer waren. Meine Mutter erzählte mir kürzlich, dass ich mich einmal mitten auf der Straße vor sie hinkniete, die Arme wie ein jammernder Büßer ausbreitete, heulte und sie anflehte, mich nicht zur Schule zu bringen. Das hatte ich komplett vergessen, doch als sie davon sprach, flackerte die Erinnerung in mir auf, und ich erinnerte mich wieder an das Gefühl des rauen Asphalts an meinen Knien.
Mir war stattdessen Siobhans Reaktion auf mein Foto im Gedächtnis geblieben. Auch wenn das in jedem anderen Kontext eine flüchtige, gedankenlose Bemerkung gewesen wäre, wurde es in meinem Bewusstsein zum definitiven Beweis dafür, dass ich nicht genügte. Schlimmer noch: Ich wusste, dass der Ursprung meines Andersseins und der damit verbundenen Scham mein wahres Ich war. Dieses Ich, von dem ich bis dato angenommen hatte, es würde um seiner selbst willen akzeptiert. Meine Eltern förderten meine Schwärmereien und meine Individualität. In der Schule erkannte ich zu spät, dass meine Charakterstärke als Seltsamkeit wahrgenommen wurde. Von dem Augenblick an begann mein Selbstbewusstsein zu bröckeln.
Ich wollte mich ändern und angleichen, doch ich hatte keine Ahnung, wie ich vorgeben sollte, jemand anders zu sein. Es kam mir sogar zutiefst unehrlich vor, das auch nur zu versuchen. Ich lebte in einer Gesellschaft, in der es so viele verschiedene Versionen der Wahrheit gab und die Gefahr in den stummen, sich verändernden Klüften zwischen diesen Wahrheiten lag. Daher hatte ich nicht nur das Bedürfnis, dazuzupassen, sondern zugleich das geradezu angeborene Verlangen, an der einen Sache festzuhalten, von der ich wusste, das bin ich: meine Stimme. Ich fühlte mich hin- und hergerissen, unglücklich und total durcheinander.
Fortan redete ich in der Schule weniger. Ich meldete mich nicht mehr, um Fragen zu beantworten. Wenn niemand mein Englisch-Sein hörte, dachte ich, würden sie mein Anderssein vielleicht nicht sehen. Tagsüber blieb ich für mich und trottete, Ordner vor die Brust gepresst und mit hochgezogenen Schultern, durch die Schulflure. Ich setzte mich im Klassenzimmer nach hinten, verschmierte meine Bücher mit Tipp-Ex und kämpfte mein natürliches Bedürfnis, mich anzustrengen, nieder, weil ich wusste, das würde mich seltsam wirken lassen. Ich fing an, bei Prüfungen zu schummeln, und versteckte Papierschnipsel mit den Antworten in meinem Stiftemäppchen. Ich leistete nur noch das absolute Minimum.
Es war eine große Schule, und so konnte ich mich tagsüber ganz gut in der graublau uniformierten Menge verlieren. Am Abend nahm ich in den Gemeinschaftsschlafräumen des Mädcheninternats die Poster niedlicher Seehunde (zu babymäßig) und schicke Calvin-Klein-Anzeigen (wenn eine Frau mit drauf war, nannten mich die anderen Mädchen »schwul«) von der Wand und ersetzte sie durch Schwarz-Weiß-Aufnahmen männlicher Levi’s-Models und Popstars. An den Wochenenden durfte ich erst am Samstagmorgen gehen, um den Fernbus nach Hause zu nehmen. Die Fahrt dauerte neunzig Minuten. Wenn meine Mutter mich an der Haltestelle abholte, ließ ich vor lauter Erleichterung darüber, wieder ich selbst sein zu können, die Schultern sinken.
Aber mir blieb nur eine Nacht als Gnadenfrist, denn am frühen Sonntagabend mussten wir zur Abendmesse wieder zurück sein. Meine Mutter kochte mir vorher ein Abendessen, immer meine Leibspeisen, aber ich hatte schon einen Kloß im Hals und bemühte mich, nicht zu weinen. Mir graute davor, an die Schule zurückzukehren, und ich suchte Trost in kleinen vertrauten Dingen, zum Beispiel indem ich mir Essen von zu Hause mitbrachte. Ich las Bücher und genoss die Möglichkeit, dabei in eine andere Welt abzutauchen. Wenn ich weinte, tat ich das heimlich, hinter einer abgeschlossenen Klotür. Im Laufe der Zeit fand ich ein paar Freunde, die genau wie ich gesellschaftliche Außenseiter waren.
Meine Noten wurden immer schlechter. Ich fiel durch Prüfungen. Einmal schaffte ich in einem Chemie-Test nur 47 Prozent – dafür schäme ich mich heute, dreißig Jahre später, immer noch. Ich entwickelte zwei unterschiedliche Persönlichkeiten: ein Zuhause-Ich und ein Schul-Ich; und ich nahm große Schmerzen auf mich, um sicherzustellen, dass die beiden nie zusammentrafen. Niemals lud ich jemand übers Wochenende zu uns ein. Meinen Eltern erzählte ich nicht viel darüber, was los war, weil ich mir selbst nicht ganz im Klaren darüber war. Ich wusste nur, dass ich unglücklich war.
Allerdings setzte ich dadurch einen Bewältigungsmechanismus in Gang, der mich bis ins Erwachsenenleben begleiten und mir noch viel Kummer bereiten sollte. Es war so eine Arte innere Dislozierung, bei der ich mich vom Schmerz meiner Traurigkeit distanzieren und ihn beiseitestellen konnte wie ein Stück Geschirr, das man nach dem Abwasch abtrocknen lässt. Gleichzeitig existierte und funktionierte ich scheinbar effektiv weiter. Doch die Loslösung von meiner Verletzung bedeutete, dass ich nach und nach die Verbindung zu meinen tatsächlichen Gefühlen verlor, was zur Folge hatte, dass ich diese nur noch mit Mühe ausdrücken konnte. Ausgerechnet ich, die ich über einen so großen Wortschatz verfügte, fand nicht mehr die richtigen Worte, wenn es um mich selbst ging. Gleichzeitig bemühte ich mich verzweifelt, anderen zu gefallen, weil ich immer noch hoffte, mir dadurch den geheimen Zugangscode zum Dazugehören zu verdienen. Folglich verstellte ich mein Wesen je nach der Gesellschaft, in der ich mich befand. Ich gab vor, Popstars, Klamotten und Fernsehsendungen zu mögen, die mich eigentlich nicht interessierten. Gleichzeitig klammerte ich mich an meinen englischen Akzent wie an ein Rettungsfloß, das meine verschiedenen Persönlichkeiten doch noch zu meinem wahren Ich bringen könnte. Ich war wütend und hatte ein schlechtes Gewissen wegen des von mir selbst als Täuschung betrachteten Verhaltens. Diese Gefühle behielt ich allesamt für mich und machte mir gleichzeitig Sorgen über Myriaden von Dingen, die ich falsch machte.
Irgendwann war ich so weit, dass ich mich schlichtweg weigerte, an die Schule zurückzukehren. Meine Mutter flehte mich an, das Schuljahr zu Ende zu bringen, aber ich konnte nicht. Ich hatte den Punkt erreicht, an dem ich keinerlei emotionale Energie mehr besaß. So stimmten meine Eltern schließlich zu, mich mitten in meinem dritten Jahr aus der Schule zu nehmen. Danach erhielt ich ein Stipendium für ein Internat in England, auf dem mein Akzent niemand auffiel. Ab September ging ich wieder in die Klasse, die genau meinem Alter entsprach. Es handelte sich im Unterschied zur vorigen um eine reine Mädchenschule, was mir weniger Angst machte.
Außerdem hatte ich einige wertvolle Lektionen gelernt, wie man sich beliebt macht. Ich wusste, dass man sich besser erst einmal zurückhielt und eine Bestandsaufnahme machte. Ich würde nicht zu rasch zu viel von mir preisgeben. Erst musste ich die anderen Mädchen einschätzen und die Gruppendynamik kennen, bevor ich die Initiative ergriff.
So ging ich im Alter von dreizehn Jahren meinen ersten Schultag mit machiavellianischem Vorsatz an. Meine Strategie war einfach: Ich würde das beliebteste Mädchen meines Jahrgangs ausfindig machen und mich mit ihr befreunden. Dazu würde ich mir genau ansehen, wie sie sich kleidete, was sie mit ihren Haaren machte, und darauf achten, wie sie redete. Das würde ich dann alles kopieren. Genauso machte ich es. Es funktionierte reibungslos.
In gewisser Weise war das ja sogar aufrichtig, denn es ging darum, das Richtige zu tun oder sich anzueignen. Ich kaufte mir schwarze Hipster-Hosen von River Island. Ich behauptete, auf Robbie Williams von Take That zu stehen. Ich trank Cinzano auf einer Parkbank direkt aus der Flasche, weil man sich betrinken musste, um cool zu sein. In meinem letzten Schuljahr hatte ich einen Freund und verreiste mit einer Gruppe Freunde an die Algarve, um unsere bestandenen Prüfungen zu feiern. Damals blieb ich das erste Mal so lange auf, dass ich den Sonnenaufgang sah. Oberflächlich betrachtet, schien ich dazuzugehören. Ich war eine von den Coolen.
Nach meinen frühen Niederlagen beherrschte ich das Spiel inzwischen zweifellos besser. Ich hatte gute Noten und schloss echte Freundschaften. Die Lehrer mochten mich. Trotzdem gefiel mir die Schule nicht besonders. Ständig ärgerte es mich, dass ich mein eigenes Leben nicht unter Kontrolle hatte. Mehr als alles andere wünschte ich mir, endlich erwachsen und für mich selbst verantwortlich zu sein. Ungeduldig wartete ich darauf, voranzukommen, einen Job zu finden, in einer eigenen Wohnung zu leben und meine Miete selbst zu bezahlen. Tatsächlich konnte ich es nicht erwarten, rauszukommen.
Mit vierzehn bekam ich einen Wachstumsschub und bekam oft zu hören, ich würde älter wirken. Das sorgte für eine gewisse Verwirrung, als ich meine Schwester an der Universität besuchte. Als wir mit einigen ihrer Freunde, die schon im Aufbaustudium steckten, chic zum Essen ausgingen, war ich eifrig darum bemüht, sie nicht zu blamieren. Ich trug ein schwarzes Kleid, das vorne mit weißen Knöpfen durchgeknöpft war (wieder von River Island, denn die Marke liebte ich damals wirklich). Das Essen in einem chinesischen Lokal war ungefähr zur Hälfte vorbei, als jemand mir verriet, dass ich einem der jungen Männer gefiel. Er versuchte, quer über den Tisch ein Gespräch mit mir anzufangen. Ich fragte höflich, auf welchen Abschluss er sich im Moment vorbereitete, und nach ein bisschen Geplauder meinte er: »Und was machst du gerade so?«
»Ich bin in der Zehnten und mache dann meinen mittleren Schulabschluss«, antwortete ich.
Daraufhin zitterte seine Unterlippe, als hätte jemand ihn geschlagen. Danach kam das Gespräch nicht mehr richtig in Gang. Mit dieser Förmlichkeit konnte er wohl nichts anfangen.
Was ich damit ausdrücken will, ist, dass ich so oder so nie ganz dazugehörte. In manchen Dingen war ich unreif (fürchterlich weltfremd) und in anderen viel zu weit für mein Alter (zum achtzehnten Geburtstag wünschte ich mir einen dreiviertellangen Kamelhaarmantel). Erwachsene hielten mich für kompetent, weil ich inzwischen ziemlich groß war, gute Noten erzielte und mich im Unterricht benehmen konnte. Doch in Wirklichkeit versuchte ich einfach, es irgendwie hinzukriegen, und kannte mich immer noch selbst kaum. Irgendwie fühlte ich mich immer wie eine Außenseiterin – in Irland, weil ich wie eine Ausländerin sprach, in England, weil ich dort nicht aufgewachsen war.
Doch dieses soziale Scheitern an der Schule hatte auch einen gewissen positiven Nebeneffekt. Ich begann, mehr zuzuhören als zu reden. Diese Fähigkeit hat sich für mich als Autorin als äußerst nützlich erwiesen. Und da ich nicht cool geboren bin, sondern erst lernen musste, so zu tun, als ob, habe ich eine Menge Verständnis für Menschen, die auch nie das Gefühl hatten, dazuzugehören. Als ich meinen vierten Roman »Die Party« schrieb, griff ich für meinen Protagonisten Martin Gilmour auf eigene Erfahrungen als Stipendiatin am ersten Schultag in einer unbekannten Umgebung zurück.
Auf Literaturfestivals wurde ich oft gefragt, wie es mir gelungen ist, mich in die Figur eines Teenager-Jungen in der Außenseiterrolle einzufühlen, und die Wahrheit lautet, dass ich meine eigenen Erfahrungen von damals nutzte. Diese Emotionen waren so stark, dass ich sie heute noch spüren kann. (Obwohl ich noch darauf hinweisen möchte, dass es sich bei Martin um einen Soziopathen mit Borderline-Syndrom handelt, der sich mit katastrophalen Folgen in das Leben seines besten Freundes drängt. Da enden die Gemeinsamkeiten von ihm und mir.)
Es ist interessant, wie viele erfolgreiche Menschen ich sowohl für den Podcast als auch als Journalistin interviewt habe, die mir von einer ähnlichen Entfremdungserfahrung während ihrer Schulzeit erzählten. Eine erstaunlich große Zahl von darstellenden Künstlern – insbesondere Comedians – hatten Eltern im Militärdienst und zogen daher als Kinder oft um. Dadurch gewöhnten sie sich an die Anpassung an eine neue Umgebung. Und die einfachste Methode, um Freunde zu finden, bestand darin, Witze zu reißen oder den Klassenclown zu spielen. Es ist nicht gerade weit hergeholt, dass sich dadurch ihr Talent als Performer entwickelte. Jennifer Saunders, Dawn French, Adrian Edmondson, Jessica Alba und Christina Aguilera stammen alle aus Familien von Militärangehörigen.
Es wird auch behauptet, dass diejenigen, die nicht dazugehören, Unabhängigkeit und Resilienz entwickeln. Wer viel umzieht, gewöhnt sich ans Alleinsein. Und wenn man so wie ich ist, verliert man sich in Geschichten, der eigenen Fantasie oder erfindet reiche innere Welten als Gegengewicht zur Komplexität der Realität, die einen umgibt.
Als ich 2008 Clint Eastwood interviewte, erinnerte der sich an seine Kindheit auf Wanderschaft. In den 1930er-Jahren war sein Vater, ein Stahlarbeiter, auf Arbeitssuche die amerikanische Westküste hinaufgezogen.
»Es war so gesehen einsam, weil man nie länger als sechs oder sieben Monate in eine Schule ging, sondern immer wieder irgendwohin umzog«, sagte Eastwood.
Der Rapstar Wiz Khalifa war auch ein Soldatenkind. 2015 sprach ich für die Zeitschrift Elle mit ihm darüber. Wir trafen uns in einer klassischen Hip-Hopper-Bude in L.A. – mit schneeweißen Wänden, klaren Linien und dichten »Gras«-Wolken, die den Blick auf die Hollywood Hills vernebelten. Dort erzählte er mir, dass sie alle paar Jahre von einer Militärbasis zur anderen umgezogen waren – nach Deutschland, Großbritannien und Japan.
Immer das neue, »besondere« Kind in der Klasse zu sein, machte ihn nervös. Daher wurde die Musik seine Zuflucht. »Zu sehen, wie selbstbewusst alle anderen waren und dass sie einander alle kannten, während ich irgendwie von außen dazukam, fühlte sich gar nicht gut an«, meinte er. »Aber als ich dann meine Musik machte, war das mein Weg, der Beste in etwas zu sein, das mich interessierte.«
Später wurde aus dieser Musik eine Karriere, die ihn bis an die Spitze der Charts führte und ihm ein Vermögen von 45 Millionen Dollar einbrachte.
Aber nicht nur die Kinder von Armeeangehörigen kämpften darum, dazuzugehören. Der Romancier Sebastian Faulks erzählte mir, er habe das Internat gehasst, auf das man ihn schon mit acht Jahren schickte. Später besuchte er das Wellington College, gegen das er ebenfalls eine ausgeprägte Abneigung entwickelte.