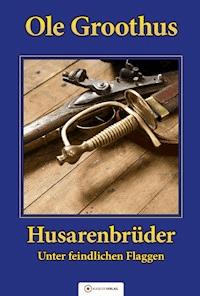
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kuebler
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Groothus
- Sprache: Deutsch
Wir schreiben das Jahr 1760. Das Schicksal hat zwar die beiden Zwillingsbrüder Peter und Paul von Morin voneinander getrennt, doch auf See werden sich ihre Lebenswege auf der jeweils gegnerischen Seite wieder kreuzen. Für Frankreich verläuft der Krieg in Übersee verheerend. Der frischgebackene Leutnant der französischen Marineinfanterie Peter von Morin soll daher mit seiner Einheit die Zuckerinsel Martinique vor einer Invasion durch die Briten bewahren. Aber schon auf der Reise nach Brest wird sein Schiff in ein schweres Gefecht mit einer britischen Fregatte verwickelt. Was er nicht weiß: Auf der Thunderbolt dient sein Bruder Paul als Midshipman. Was er nicht ahnt: Zu einem späteren Zeitpunkt wird die Royal Navy seinen Konvoi vor Erreichen Westindiens abfangen und nahezu völlig aufreiben. Paul von Morin hat es mittlerweile zum diensttuenden Dritten Leutnant auf der Thunderbolt gebracht, die Sklavenschiffe von Westafrika nach Westindien geleiten soll. Doch Gelbfieber dezimiert auf der Überfahrt deren Besatzung derart, dass ein Angriff französischer Freibeuter nur unter Aufbietung von an Tollkühnheit grenzendem Mut abgewehrt werden kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 546
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ole Groothus
Husarenbrüder
Reihe: Peter und Paul von Morin, Band 2
Kuebler Verlag
Das Buch
Unter feindlichen Flaggen
Peters französischer Onkel holt ihn aus der Festungshaft heraus und sorgt dafür, dass er aus den Händen von Madame Pompadour sein Leutnantspatent der Marineinfanterie erhält. Auf der Überreise nach Westindien wird der Konvoi fast vollständig aufgerieben, aber Peter überlebt. Auch Paul wird durch die hannoverisch-englischen Verwandten von Bord der Thunderbolt geholt. In London stellt ihn sein Onkel, der Graf Wolfenstein, dem König vor. Anschließend kommt er als Midshipman wieder an Bord der Thunderbolt, wo er bald zum diensttuenden Leutnant befördert wird.
Band 2 der Reihe Peter und Paul von Morin von Ole Groothus
Der Autor
Ole Groothus war Seemann und weltweit als Wachoffizier und in leitender Position auf Schiffen der Großen Fahrt unterwegs. Neben seiner Tätigkeit als Autor hat er als Übersetzer etwa 60 Romane und Fachbücher – zum größten Teil historische maritime Romane aus den Napoleonischen Kriegen – vom Englischen ins Deutsche übertragen. Ole Groothus verknüpft in der Reihe um die Brüder von Morin Spannung mit historischen Fakten und viel Wissen über die Lebensumstände der damaligen Zeit.
Ole Groothus
Husarenbrüder
Unter feindlichen Flaggen
Band 2 der Reihe „Peter und Paul von Morin“
Mehr Informationen zu diesem Buch, zum Autor und zu anderen maritimen Romanen erhalten Sie hier:
www.kueblerverlag.de
Impressum
Neu durchgesehene und ungekürzte Ausgabe im Kuebler Verlag.
Copyright © 2016 Kuebler Verlag, Lampertheim.
Alle Rechte vorbehalten.
Titelbild: © cosma – shutterstock.com.
Dieser Titel ist 2009 erstmals unter dem Titel „Husarenbrüder: Gegner unter feindlichen Flaggen“ im Ullstein Taschenbuch Verlag erschienen.
Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Kuebler Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zugänglich gemacht werden.
ISBN Printausgabe 978-3-86346-014-3
ISBN Digitalbuch 978-3-86346-262-8
Vorwort
In Europa tobt der Dritte Schlesische Krieg, besser bekannt als der Siebenjährige Krieg, den man aber auch mit einigem Recht den Ersten Weltkrieg nennen könnte, denn für die beiden Großmächte England und Frankreich geht es um die Eroberung von Weltreichen in Amerika und Indien. Hätte man damals einen durchschnittlichen Parlamentarier des Unterhauses nach Schlesien gefragt, so hätte jener den Fragesteller von oben herab angeblickt und erstaunt zurückgefragt: „Wovon reden Sie, Mann? Vergeuden Sie nicht meine Zeit!“
Paul und Peter von Morin aus der Neumark, die beiden Kornetts der Ziethenhusaren, müssen sich nach einem unerlaubten Duell ins Ausland absetzen, weil Peters Gegner anscheinend seinen erlittenen Verletzungen erliegt. Auf ihrer Flucht durch die Mark und Pommern, auf der sie von ihren Burschen Karl und Franz begleitet werden, verfolgt sie eine Bande litauischer Pferdetreiber, die ihnen ans Leder wollen. Bei einem Kampf auf Leben und Tod fällt ihnen das Geld in die Hände, das die Litauer bei dem Verkauf der Herde erzielt haben, was selbstredend die Wut der Verfolger erst recht anstachelt.
In Danzig heuern sie auf dem holländischen Küstensegler Oranjeboom an, auf dem besonders Paul die Grundkenntnisse der Seemannschaft und der Navigation erlernt. Nach einer stürmischen Überfahrt wird das Schiff kurz vor der Themsemündung von einem französischen Freibeuter gekapert. Während sich Paul zusammen mit Karl durch einen Sprung in die Nordsee rettet, geraten Peter und Franz in Gefangenschaft. Sie werden in die Festung Fécamp geschafft, wo sie darauf hoffen, von den de Partouts, den französischen Verwandten der Morins befreit zu werden. Derweil dienen Paul und Karl als einfache Seeleute vor dem Mast auf der britischen Fregatte Thunderbolt, die den Freibeuter vertrieben hatte. Nach einem Gefecht mit einer französischen Geleitfregatte und der Wegnahme eines wertvollen Westindienfahrers läuft die Thunderbolt Plymouth an, um notwendige Reparaturen durchführen zu lassen. Hier hofft Paul, von Verwandten, die im Gefolge der hannoverschen Welfen nach England gekommen waren, von Bord geholt zu werden.
Hier endet der Kundendienst für die Leser, die es bedauerlicherweise versäumt haben, den ersten Band mit den Abenteuern der beiden preußischen Husarenbrüder mit heißem Herzen zu verschlingen – aber das lässt sich ja nachholen!
Viel Spaß und auch reichlich Spannung beim Verfolgen der verschlungenen Lebenswege der ach so verschiedenen Zwillinge.
Ole Groothus
Teil I
Die beiden durch das Schicksal auseinander gerissenen Brüder gehen ihren Weg getrennt weiter: Peter versucht mit einem Pferderennen, das Herz der spröden Amélie zu erobern. Er stolpert dabei fast schon wieder in ein Duell. Glücklicherweise wird er vorher von seinem Cousin befreit und nach Paris gebracht. Dort lernt er die vielfältigen Verführungen der Großstadt und des Palastes kennen und teilweise – leider – auch zu schätzen. Mit dem Offizierspatent eines Leutnants der Marineinfanterie macht er sich auf den Weg nach Brest. Bei der Überfahrt auf einem Freibeuter entgeht er nur knapp der Gefangennahme durch die Engländer.
Auf Paul wird an Bord der Thunderbolt ein Anschlag verübt. Bevor er herausfinden kann, wer dahinter steckt, wird auch er von seinen Verwandten von Bord geholt. Auf der Reise nach London rettet er eine schöne junge Dame und ihren einflussreichen Vater aus den Händen einer Räuberbande. In London sorgt sein Onkel dafür, dass sein theoretisches Wissen über alle Bereiche der Nautik vertieft wird. König Georg II. macht ihn als Dank für seine mutige Rettungstat zum Peer of Great Britain und belehnt ihn mit einem Anwesen in Kent. Er steigt als Midshipman wieder auf der Thunderbolt ein. In einem nächtlichen Gefecht gelingt es ihnen, einen französischen Freibeuter zu entern, aber ein guter Teil der Franzosen schafft es, sich mit der von ihnen eroberten englischen Prise davonzustehlen. Darunter sind auch Peter und sein Bursche Franz.
Kapitel 1
Plymouth, ]uni 1760
Es war stockdunkel im niedrigen Wohndeck von Seiner Britannischen Majestät Fregatte Thunderbolt, einem Schiff der Sechsten Klasse, die auf dem Plymouth Sound hinter Drake Island im Wechsel der Gezeiten um ihren Anker schwoite. Die Luft war stickig und verbraucht. Sie unterschied sich – was den Gestank anging – kaum von einem Raubtierkäfig, der von einer vielköpfigen Großfamilie Löwen bewohnt wird. Nahezu zweihundert Männer, ungewaschen und am Abend mit Salzfleisch und Hülsenfrüchten abgefüttert, sorgten für eine mit kräftigen Düften überreich gesättigte, höchst aromatische dicke Luft. Aus den dicht an dicht aufgeriggten Hängematten ertönten lautstarke Flatulenzen – sie bildeten die Kopfnote – satte blubbernde Rülpser und sonore sägende, plötzlich stockende Schnarchgeräusche, die dann mit erneuter Intensität wieder einsetzten. In diese trauliche, heimelige Atmosphäre hinein mischte sich als Basisnote der Gestank der Bilge, in der fauliges Wasser schwappte und tote Ratten verwesten. Die Ausdünstungen des allgegenwärtigen Schimmelpilzes rundeten als Herznote das rustikale Dufterlebnis ab. An der Bordwand gurgelte das Wasser des ablaufenden Ebbstroms. Zuerst gelegentlich, dann immer öfter klatschten Wellen laut gegen die Beplankung der Außenhaut, als der Wind zunahm und das Schiff quer zum Strom drehte. Die straff gespannten Wanten und Stage begannen zu vibrieren und dumpf zu summen. Irgendwo schlug klappernd ein Block gegen eine Spiere. Ab und zu begann die frische Brise im Rigg zu jaulen und zu heulen.
Leichtmatrose Paul von Morin hatte die Arme hinter dem Kopf verschränkt, was aufgrund des knappen Raumes gar nicht so einfach war, ohne dass er seinen beiden Nebenmännern den Ellenbogen gegen den Kopf rammte. Er lauschte dem Konzert im Zwischendeck und den Geräuschen der See und seufzte. Nun lagen sie schon zwei Wochen in Plymouth. Sie warteten auf einen Platz in der Werft und waren unterdessen mit der Ausbesserung der Schäden beschäftigt, soweit das mit den beschränkten Bordmitteln möglich war. Die Schäden hatte das Schiff in den Seegefechten mit den Franzosen vor dem Kanal davongetragen. Ihn bedrückte, dass er immer noch keine Nachricht von seinen Verwandten aus London erhalten hatte. Vielleicht hatten sie seine Nachricht, die er nach der Vertreibung der französischen Freibeuter und der Wegnahme der Oranjeboom durch die Briten dem versoffenen Midshipman Fisher mitgegeben hatte, nicht erreicht? Das war eher unwahrscheinlich, denn der junge Mann mochte zwar ein Tunichtgut und als Offizier untragbar sein, aber sein ausgeprägter Sinn für das Ergattern eines guten Gratisschlucks und eines möglichen Geldgeschenks hatte ihn todsicher in das Haus des Grafen von Wolfenstein geführt. Nun war der Weg von London nach Plymouth zwar weit und unbequem, aber Paul begann sich ernsthaft Sorgen zu machen, dass seinem Schiff vielleicht schon bald ein Platz in der Werft zugeteilt wurde. Dort würde es endgültig repariert werden und sich bald danach wieder auf hoher See befinden, möglicherweise noch bevor sein Großonkel dafür sorgen konnte, dass er die Thunderbolt in allen Ehren verlassen konnte. Der Gedanke, einfach zu desertieren, war ihm zwar auch schon gekommen, er hatte ihn aber sofort wieder energisch verworfen. Wenn er in der Royal Navy Karriere machen wollte, dann hätte ein „R“[1] hinter seinem Namen in der Musterrolle der Thunderbolt das Ende dieser Karriere bedeutet, noch bevor diese überhaupt begonnen hatte. Er kämpfte gegen die in ihm aufsteigende Panik an. Kühl überlegte er: Zuerst musste ein berittener Bote die Depeschen des Kommandanten der Thunderbolt nach London befördern, dann war es an der Admiralität, den Bericht über das erfolgreiche Gefecht zu veröffentlichen und den Liegeplatz bekanntzugeben. Erst dann konnte sein Onkel davon auch Kenntnis erhalten. Der Teufel mochte wissen, ob den Grafen maritime Dinge überhaupt interessierten. Vielleicht waren für ihn Spekulationsgeschäfte, politische Intrigen oder Fuchsjagden und Pferderennen der Lebensinhalt. Aber selbst wenn sein Onkel die Nachricht zur Kenntnis nahm, war noch lange nicht gesagt, dass er es für nötig befand, einen entfernten Verwandten aus dem Mannschaftslogis eines Schiffes des Königs heim in den Schoß der Familie zu holen. Und ein sehr entfernter Verwandter war er nun ja weiß Gott. Paul seufzte wieder tief auf, denn schließlich waren nur seine beiden älteren Brüder und Schwestern aus der ersten Ehe seines Vaters über deren Großmutter Amalie mit den Wolfensteins aus dem Hannoverschen blutsverwandt. Außerdem mochte fraglich sein, ob der Hannoveraner als zugewanderter neuenglischer Hofmann im Gefolge des Königs bei den entsprechenden Regierungsstellen über genügend Einfluss verfügte, um ausreichend Druck auf die Admiralität ausüben zu können, seinen Neffen aus dem Dienst zu entlassen. Schließlich hatte Paul die Musterrolle freiwillig unterschrieben und das Handgeld des Königs genommen. Nach dem geltenden Recht musste er als einfaches Besatzungsmitglied vor dem Mast auf der Thunderbolt dienen, bis das Schiff anlässlich einer Generalüberholung außer Dienst gestellt und die gesamte Besatzung bis auf die fünf ständig an Bord verbleibenden Männer[2] abgemustert wurde. Aber das konnte in Kriegszeiten lange dauern, denn die Marine verfügte immer über zu wenige Fregatten. Diese Arbeitspferde wurden als die Augen der Flotte zumeist im aktiven Dienst gehalten, bis sie buchstäblich auseinanderfielen. Aber selbst wenn Graf Wolfenstein entsprechend intervenierte, mussten erst die richtigen Strippen gezogen, Briefe geschrieben und wieder über den langen Landweg nach Plymouth befördert werden. Es nützte nichts, er musste sich in Geduld fassen und hoffen, dass die Thunderbolt nicht zu schnell wieder seetüchtig gemacht wurde und auslief – wohin auch immer.
Paul verspürte ein menschliches Rühren. Das kommt von der verdammten Grübelei, dachte er missmutig. Geschickt rollte er sich aus der Hängematte, wobei er zwangsläufig seine Nebenschläfer störte, die das mit schlaftrunkenen Flüchen quittierten, ließ sich auf das Deck hinuntergleiten und kroch bäuchlings unter den Hängematten hindurch in Richtung des Niedergangs. Oben in der Kuhl sog er gierig die frische nächtliche Brise ein. Er fröstelte in seinem dünnen Hemd und blickte sich um. Achtern sah er den Umriss des wachhabenden Midshipman vor den hell leuchtenden Hecklaternen, der sich mit beiden Armen auf die vordere Reling des Achterdecks stützte. Welcher der jungen Gentlemen es war, konnte er nicht erkennen, und es interessierte ihn auch nicht besonders. Vermutlich war es Luke Cully, der älteste Midshipman im Gunroom, dem Verschlag im Zwischendeck für die angehenden Seeoffiziere. Er war bereits fast dreißig Jahre alt und schaffte es immer wieder, durch das Leutnantsexamen zu fallen. Böse Zungen behaupteten, dass er mindestens doppelt so dämlich wie Pauls unglaublich starker, aber einfältiger Messekamerad Bully Sullivan war, aber gleichzeitig mehr als dreimal so hinterhältig und niederträchtig. Zwar beherrschte er den täglichen Routinebetrieb an Deck aufgrund seiner fast achtzehnjährigen praktischen Erfahrung im Schlaf, aber seine größte Passion war das Schikanieren der einfachen Seeleute und das Triezen seiner Kameraden in der Messe, von denen zumindest einer noch ein halbes Kind von zwölf oder dreizehn Jahren war.
Wie Paul erfahren hatte, war er deshalb schon mehrfach vom Ersten Leutnant verwarnt worden. Das war zwar stets unter vier Augen geschehen, aber auf einem Kriegsschiff blieb nichts geheim, irgendjemand hörte immer mit. Mister Cully ging seitdem vorsichtiger bei seinen geistlosen Anschuldigungen zu Werke, die sich meist auf offensichtlich banale Pflichtverletzungen bezogen, aber die alten Matrosen hatten ihren neuen Kameraden dringend geraten, dem miesen Typen soweit irgend möglich aus dem Weg zu gehen, um ihm keine Gelegenheit zu geben, sie dem Ersten zu melden und eine strenge Bestrafung zu verlangen. Er hatte eine kleine, ihm blind ergebene Clique um sich geschart, die auf Nachfrage seine abstrusen Vorwürfe im Brustton der Überzeugung bestätigte. Allerdings klappte das nur, wenn keine neutralen Zeugen zur Stelle waren.
Aber auf diese Weise hatte schon manch Unschuldiger die Katze zu schmecken bekommen – dem Ersten und dem Kommandanten war aus disziplinarischen Gründen einfach keine andere Wahl geblieben. Sie mochten ein Komplott wittern, konnten das Strafmaß auch entsprechend milde halten, aber eine Strafe musste verhängt werden, daran führte kein Weg vorbei. Sobald sich dann ein Mann unter den Schlägen der siebenschwänzigen Katze an der Gräting wand, schien das Cullys persönliches Wohlbefinden zu steigern. Blickte er sonst zumeist mit verschleierten Augen und einem fest zusammengekniffenen Mund eher dümmlich um sich, so leuchteten dann seine weit aufgerissen Augen, und sein vor Erregung halb geöffneter Mund verzog sich gar zu einem zufriedenen Grinsen. Wie oder womit der Midshipman seine kleine Truppe zusammenhielt, war Paul nicht klar, aber auf irgendeine Weise musste er eine unerklärliche Macht über sie ausüben. War er wohlhabend genug, um sie mit blanken Münzen zu kaufen? Nun, er konnte es sich immerhin leisten, seit nahezu achtzehn Jahren ohne Sold bei der Navy zu dienen[3]. Alimentierte ihn seine Familie großzügig? Sie war sehr wahrscheinlich froh, den Versager fern von zu Hause auf See zu wissen. Möglich war natürlich auch, dass er in seiner langen Dienstzeit reichlich Prisengeld verdient hatte. Paul von Morin ging langsam nach vorne, sein Darm gab kollernde Geräusche von sich. Er passierte die leeren Bootsknacken, stieg an der Backbordseite über die Treppe auf die Back, um sich dann auf die Gräting des Galions herunterzulassen. Dort öffnete er seinen Gürtel, ließ die Hose herunter, setzte sich auf das Toilettenloch in Lee, lehnte sich mit Kopf und Schultern an den Bugspriet hinter sich und verrichtete sein Geschäft. Dabei blickte er tief in Gedanken versunken hinüber zu den Lichtern hinter Plymouth Hoe und in der Festung an der Küste.
Aber plötzlich hatte er das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Seine Nackenhaare sträubten sich, ein untrügliches Warnzeichen, das er aus seiner Zeit als Ziethenhusar nur zu gut kannte und auf das er sich blind verlassen konnte. Ohne nachzudenken, ließ er sich nach vorne fallen und rollte zur Seite. Er hörte etwas durch die Luft sausen und gegen die Unterseite des massigen Bugspriets knallen, dort hatte sich eben noch sein Rücken befunden. Eine dunkle, untersetzte Gestalt tauchte unter der Spiere hindurch, ragte über ihm auf und machte alle Anstalten, erneut zum Schlag auszuholen. Paul wollte aufspringen, aber seine Hose, die ihm noch um die Knöchel hing, behinderte ihn. Wütend vor sich hin knurrend, zog er die Beine an, stieß mit den Füßen mit aller Kraft nach den Beinen des Angreifers. Der Knüppel des Mannes sauste herab, aber weil er aus dem Gleichgewicht gebracht worden war, traf er nur das Netz, das die seewärtige Begrenzung des Galions bildete. Dort verfing sich das Holz, und Pauls zweiter schwungvoller Fußstoß aus der Hüfte heraus traf den Mann in den Bauch. Der stöhnte schmerzerfüllt auf, ließ den Knüppel los und warf sich auf den immer noch am Boden liegenden Jungen. Eine Zeitlang rangen sie keuchend miteinander. Der Mann war stark und versuchte Pauls Hals zu umklammern, um ihn zu erdrosseln, aber der junge Preuße war im Nahkampf erfahren und seine Muskeln waren durch die harte Arbeit an Deck und im Rigg gestählt. Immer wieder gelang es ihm, den tödlichen Klammergriff aufzubrechen. Sie rollten auf dem engen Deck hin und her, und schließlich kam Paul in die Oberlage. Er kniete sich mit Schwung wuchtig auf den Bauch seines Kontrahenten, der daraufhin zischend die Luft ausstieß, mit dem rechten Knie fixierte er den linken Arm des Mannes und mit seiner linken Hand presste er dessen rechten Arm auf die Planken. Dann holte er weit aus und schlug dem Kerl die geballte rechte Faust so fest er konnte ins Gesicht. Es knirschte und knackte. Wieder und wieder schlug er zu, der weiße Fleck, der das Gesicht des Gegners markierte, verfärbte sich dunkel. Er spürte nicht, dass die Haut über seinen Knöcheln aufplatzte und die Hand höllisch schmerzte, blinde heiße Wut ließ rote Kreise vor seinen Augen tanzen. Der Mann fing an zu winseln. „Hör auf, Mann! Gnade!“
„Hättest du aufgehört, du abscheulicher Feigling?“, fauchte Paul keuchend.
„Ja, ja! Ich sollte dich ja nur etwas erschrecken, weil du so ein eingebildeter Pinkel bist.“ Die Antwort klang seltsam undeutlich, anscheinend hatten einige von Pauls Schlägen voll seinen Mund getroffen. Der Mann spuckte aus, Blut spritzte und Zähne fielen klappernd auf das Deck.
„Wer hat dir den Auftrag dazu gegeben, du niederträchtiger Hundsfott?“
Bevor der andere Mann antworten konnte, ließ Paul ihn abrupt los, weil er Stimmen auf der Back hörte. Keinesfalls durfte er mitten in einer Prügelei erwischt werden. Selbstverteidigung hin oder her, wurden sie auf frischer Tat ertappt, konnte sie das beide an die Gräting bringen. Er sprang auf, griff nach seiner Hose, zerrte sie hastig hoch, zog den Gürtel fest und sah sich gehetzt nach einer Fluchtmöglichkeit um. Sein Blick fiel auf die Ankertrosse, die durch die Klüse im Schott unter der Back verschwand. Die zweite Klüse daneben war unbelegt. Er zwängte sich durch die Ankerklüse, suchte sich seinen Weg in der Finsternis am Verschlag für den lebenden Proviant des Kapitäns und der Offiziere vorbei weiter nach achtern, passierte die Kombüse und gelangte in die Kuhl. Geduckt eilte er, lautlos jede Deckung nutzend, zum Niedergang. Gerade als er unter Deck verschwand, glaste auf dem Achterdeck die kleine Glocke, dann wiederholte die große Schiffsglocke auf der Back volltönend die beiden Doppelschläge. Also deshalb waren die Männer auf der Back gewesen. Ob sich sein Gegner auch unentdeckt hatte verdrücken können? Oder waren die anderen Männer eingeweiht gewesen? Unter den Schläfern hindurch erreichte er wieder seine Hängematte und kroch, ohne allzu viel Rücksicht auf seine Kameraden zu nehmen, hinein. Die herzhaften Verwünschungen der Kumpel klangen ihm wie reine Poesie in den Ohren. Aufatmend zog er die Decke über sich hoch, ein dankbares Gefühl durchströmte ihn, irgendwie war es, als wäre er nach Hause gekommen. Er massierte sich die aufgeplatzten, schmerzenden Knöchel der geschwollenen rechten Hand. Wer konnte ein Interesse daran haben, ihn verprügeln, ja, umbringen zu lassen? Nun, eins war sicher, er würde den Kerl bei Tageslicht ganz gewiss wiedererkennen, so wie er ihm die Visage poliert hatte. Und wenn der nicht mit dem Namen seines Auftraggebers herausrückte, dann würde Bully mal ein ernsthaftes Wort mit ihm reden müssen. Bevor er einschlief, zuckte noch ein Gedanke durch seinen Kopf: Er war sich verdammt sicher, dass eine der Stimmen oben auf der Back dem fiesen Midshipman Cully gehört hatte. Sollte diese miese Type hinter dem Anschlag stecken? Man würde sehen.
Als nur wenige Minuten später – jedenfalls erschien das Paul so – die Pfeifen der Bootsmannsmaaten zwitscherten und der Bootsmann mit rauer Stimme den alten Weckruf aussang – „Reise, reise, nach alter Seemanns Weise! Jeder weckt den Nebenmann, dass der nicht länger schlaaaafen kann!“ – kam Leben ins Zwischendeck. In der Finsternis knurrte eine verschlafene Stimme: „Jeder scheißt den anderen an, der Letzte scheißt sich selber an!“ Irgendjemand konnte sogar über diesen uralten Witz müde kichern. Paul rollte aus der Hängematte, zog sich an und begann seine Hängematte regelgerecht zusammenzurollen und zu verschnüren. Es gelang ihm nur unter Stöhnen und Ächzen, denn seine rechte Hand war dick angeschwollen und tat bei jeder Bewegung weh. Karl, sein Bursche, bemerkte schnell sein Handicap und half ihm wortlos. Inwendig musste Paul lächeln. Wahrscheinlich war er der einzige Leichtmatrose im Dienste von König Georg, der einen eigenen Leibburschen hatte. Der gute Karl fragte nicht, wie er sich die Blessuren an der Hand zugezogen hatte, sehr wahrscheinlich machte er sich Vorwürfe, weil er nicht zur Stelle gewesen war, als er gebraucht wurde.
Aber auch jetzt war seine Hilfe äußerst wertvoll, denn der Profos wachte mit seinen Gehilfen mit Argusaugen darüber, dass die Hängematten richtig gepackt in die Finknetze gestaut wurden. Übrigens gehörte auch einer dieser Gehilfen zu Cullys Truppe. Er musterte Paul scharf, dabei verzog sich sein Gesicht kurz zu einer hasserfüllten Fratze, dann wandte er sich jäh um und schnauzte einen anderen Mann an.
Die tägliche Routine des Deckschrubbens begann. Das kalte Wasser tat Pauls Hand gut, aber so fest wie sonst konnte er den Scheuerstein nicht auf das Deck pressen. Glücklicherweise entging das den scharfen Augen des Bootsmannes. Unauffällig ließ Paul seine Augen herumwandern, aber er entdeckte keinen Seemann, der ein übel zugerichtetes Gesicht hatte. Wo mochte der Kerl stecken? Hatte er sich krank gemeldet und ließ den lieben Gott im Lazarett einen guten Mann sein? Dann wurde endlich zum Frühstück gepfiffen. An der Messeback musterte ihn Bully in seiner unbefangenen Art und brummte: „Wenn ich nicht wüsste, dass du ein Gen'leman und ganz friedlicher Mensch bist, Chefchen, und die ganze Nacht schlafend in der Furzmulde gelegen hast, würde Bully denken, dass du jemand ganz fürchterlich die Fresse poliert hast, Master Paul.“ Er zog nachdenklich die Stirn kraus. „Zumindest könnte ich das Letztere beschwören, denn ich bin während der ganzen Nacht nicht einmal aufgewacht.“ Karl und Jan Priem blickten sich an und kniffen ein Auge zusammen. Sie schliefen direkt neben Paul und hatten seinen nächtlichen Ausflug natürlich mitbekommen. Jack, der Quartermastersmaat, schaute auf Pauls geschwollenen Flunken, räusperte sich und meinte dann gedehnt: „Also reden wir nicht um den heißen Brei herum: Was ist heute Nacht passiert, Junge?“
Paul wusste, dass es keinen Zweck hatte, seinen Kameraden etwas vorzumachen. „Nun, ich musste gegen vier Glasen auf der Mittelwache nach vorne auf die Galion. Dort hat mich irgend so ein Schweinehund hinterrücks angefallen. Der Kerl wollte mich umbringen!“ Er zog sein Halstuch zur Seite, so dass seine Kameraden die blutunterlaufenen Stellen sehen konnten, die die Finger des Killers hinterlassen hatten. „Ich konnte mich ziemlich erfolgreich wehren und habe ihm sicher ein paar eindeutige Spuren im Gesicht verpasst. Seine Augen dürften zugeschwollen, die Nase gebrochen und der Mund ziemlich zahnlos sein. Seht und hört euch doch mal um, wer seit heute Morgen so verändert herumläuft. Vielleicht hat er sich auch ins Lazarett abgeseilt.“ Seine Messekameraden redeten aufgeregt durcheinander, bis Paul beschwichtigend eine Hand hob. „Ich möchte wissen, wer ihm den Auftrag gegeben hat, mich aus dem Verkehr zu ziehen. Notfalls müssen wir nach Mitteln und Wegen suchen, es aus ihm heraus zu prügeln, denn schließlich könnte er es nochmals versuchen.“ Die Männer blickten sich erschrocken an. Nur Bully rieb sich erwartungsfroh seine klosettdeckelgroßen Pranken. Paul tippte ihm mit dem Zeigefinger an die gebrochene Nase. Bully zuckte zusammen, er erinnerte sich sehr gut daran, dass ihm Paul bei ihrem ersten nicht ganz friedlichen Zusammentreffen das Bordmesser in ein Nasenloch gesteckt hatte, um ihn zum Aufgeben zu bewegen. „Bully, ich weiß, du willst dich nur nützlich machen, aber du unternimmst nichts, bevor ich dir ausdrücklich den Befehl dazu gebe, claro, mein Kleiner?“
Bully nickte heftig. „Aye, Chefchen, ganz klar, Bully hört auf Leute, die mehr Grütze im Kopf haben als er – manchmal“, fügte er leise hinzu.
Am Verlauf des Vormittags kam Bootsmann Ben Fist zu der Arbeitsgruppe geschlendert, der Paul angehörte, und sah ihnen beim Spleißen zu. Natürlich entdeckte er sehr schnell Pauls lädierte Hand und dass die anderen einen Teil seiner Arbeit wortlos miterledigten. Paul versah die Tampen und die Kardeele mit Behelfstaklingen, bevor er sie weitergab, denn die Arbeit mit dem Fitt aus Pockholz, mit dem die Zwischenräume zwischen den durch den Drall aneinandergepressten Kardeelen aufgebohrt wurden, um die zu verspleißenden einzelnen Kardeele hindurchzustecken, war zu schmerzhaft. „Du solltest zum Pillendreher gehen, Junge, und dir den Flunken versorgen lassen, immerhin könnte etwas gebrochen sein. Wobei ist denn das passiert?“
„Ich habe gestern bei der Übernahme des Frischproviants alleine eine unter Last stehende Leine gelöst, und die hat meine Hand nach vorne gezogen und am Koffeinagel eingequetscht, Sir. Mein Fehler, Sir. Aber ich bin fit und werde meine Arbeit tun.“
„So, so, eine böse Leine war also schuld, ist mir gar nicht aufgefallen, nun, selbst ich kann meine Augen nicht überall haben. Aber du enttäuschst mich, Junge, ich dachte, du könntest schon abschätzen, wann man eine auf Zug stehende Leine nicht mehr alleine handhaben kann.“ Der Bootsmann drehte sich um und schien weitergehen zu wollen. „Eine Leine, dass ich nicht lache!“, schnaubte er unterdrückt vor sich hin. Er fuhr schnell herum, sah Paul in die Augen und fragte scharf: „Du weißt nicht zufällig, wo der Matrose Ken Little abgeblieben ist?“
Paul schüttelte energisch den Kopf und antwortete wahrheitsgemäß: „Sir, das ist das erste Mal, dass ich diesen Namen höre. Was ist mit dem Mann?“
Ben Fist musterte ihn aufmerksam, dann brummte er: „Der Bursche ist ein ziemlicher Raufbold, aber seit heute Nacht ist er verschwunden. Nun ja, vielleicht ist er im Schutze der Dunkelheit auf ein Fischerboot geklettert und desertiert. Er stammt ja wohl hier aus der Gegend, da kann man leicht so etwas arrangieren.“ Der Bootsmann zuckte wieder mit den Schultern und setzte seinen Kontrollgang fort. Nach einiger Zeit sah ihn Paul mit dem Ersten Leutnant reden. Die beiden blickten zu ihm herüber. Hinter ihnen stand in Hörweite Midshipman Cully, der ebenfalls den jungen Mann mit verschleiertem Blick musterte. Es dauerte nicht lange, bis der Midshipman neben Paul stehenblieb und ihn mit schnarrender Stimme anfuhr: „Leichtmatrose, das ist keine Arbeit, die man mal eben mit der linken Hand erledigen kann. Wenn das etwas Ordentliches werden soll, muss man schon beide Hände benutzen, oder sind deine zarten Händchen harte, ehrliche Arbeit nicht gewohnt, Muttersöhnchen?“
Paul blickte konzentriert auf seine Arbeit. Er legte eine Bucht aus Segelgarn auf die geschlagene Leine, wickelte sie stramm von hinten von vorne ein, schob das Ende des Garns durch die Bucht und zog es unter Zuhilfenahme der Zähne mitsamt der Bucht am anderen Ende unter die gewickelten Törns, dann schnitt er das Ende kurz ab. Gedehnt antwortete er mit ruhiger Stimme: „Ich bemühe mich, meine Arbeit so gut zu machen, wie ich das vermag, Sir. Leider bin ich noch nicht so gut wie meine Kameraden, die Vollmatrosen, aber ich arbeite hart daran, richtig spleißen zu lernen, Sir. Ich hoffe aufrichtig, bald Ihren hohen Ansprüchen gerecht werden zu können.“
„Bullenscheiße, Mann, spar dir dein dämliches Gelaber für die Offizierstrottel auf, die anscheinend einen Narren an dir gefressen haben. Ich werde dich scharf im Auge behalten, und ich garantiere dir, dass du bei der kleinsten Verfehlung an der Gräting tanzen wirst, du holländischer Hanswurst oder von wo auch immer du wirklich herkommen solltest. Damit wir uns richtig verstehen, das ist keine Warnung, das ist ein Versprechen.“
Paul hörte, wie Karl, Jan Priem und Hendrik hastig den Atem tief einzogen. Bully begann ganz tief hinten in der Kehle wie eine gereizte, sehr übellaunige Bulldogge dumpf zu knurren. Ganz leise, so dass selbst seine Kameraden ihn kaum verstehen konnten, murmelte Paul: „Mit den Versprechen ist das so eine Sache, Sir, manch einer hat später gemerkt, dass er sich versprochen hatte.“
Midshipman Cully lief rot an, fauchte wütend: „Jetzt wird dieser impertinente Kerl auch noch witzig und macht sich über mich lustig. Diese Subordination werde ich umgehend dem Ersten Offizier melden! Männer, ihr seid meine Zeugen, ihr habt alle diese unerhörte Frechheit gehört!“
Die Männer blickten sich an, schüttelten dann den Kopf, und Jan Priem meinte in betont schlechtem Englisch. „Ick nix verstahn, Sir, ick holländischer Kaaskopp, sorry, nix verstahn!“ Hendrik, der ebenfalls Matrose auf der Oranjeboom gewesen war, nickte energisch. Karl deutete auf seine Ohren, um dann entschuldigend zu stammeln: „Sir, ich seien Deutscher, Sie verstehen, Preuße, King Frederic the Great. Änglisch nix gut spreken, so sorry, Sir.“
Bully blickte den wütenden Midshipman düster aufreizend lange von unten an, dann sagte er sorgfältig artikuliert, wie man es von ihm nun wahrlich nicht gewohnt war: „Ich habe alles, was Sie gesagt haben, sehr genau verstanden, Sir. Sie sollten in Zukunft nie wieder, ich wiederhole, niemals wieder allein in stürmischen Nächten an Deck oder in anderen finsteren, abgelegenen Ecken des Schiffes herumstehen. So etwas kann lebensgefährlich sein, Sir … und auch das ist ein Versprechen!“
„Du Kretin, du wagst es…!“ Cully wäre beinahe explodiert. „Ich werde dich sofort…“
„Beim Ersten Leutnant anschwärzen, Middy, tu das. Ich habe schon so oft an der Gräting gestanden, dass ich eigentlich langsam mal wieder an der Reihe bin. Man kommt ja sonst völlig aus der Übung. Und, mein Kleiner, ich habe noch nie dabei geschrien, und werde das für dich auch nicht einreißen lassen.“
„Meuterei!“, zischelte ein bleicher Cully, drehte sich zornbebend weg und eilte mit langen Schritten zum Niedergang.
„Der wird nu mal erst einen ordentlichen Schluck aus der Pulle nehmen“, meinte Jan Priem gedehnt und sah Bully bewundernd an. „Das war einsame Spitzenklasse, Bully, den hast du nach allen Regeln der Kunst zusammengefaltet. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut.“
Bully grinste breit, wodurch seine Zahnlücken wieder deutlich hervortraten. Sein grobes, plattes Gesicht, das von den Narben unzähliger Faustkämpfe gezeichnet war, wurde durch sein Lächeln beinahe schön, er errötete sogar ein wenig. „Ich war so wütend auf diesen aufgeblasenen Trottel, der meinen Master so gemein bedroht hat, dass mir die Worte von ganz allein aus dem Mund kamen.“
„Dann solltest du öfter mal richtig wütend werden, Bully, vielleicht wird dann aus dir noch ein richtiger Volksredner“, meinte Paul lächelnd. Bully sah ihn fröhlich an, streckte dann seine Pranke aus und packte Pauls verletzte Rechte. „Wenn ich nicht zur See fahre, dann verdiene ich mein Geld mit Boxkämpfen auf Jahrmärkten, Chefchen. Buddy kennt sich mit Verletzungen an den Händen aus. Zeig mal her!“ Vorsichtig nahm er Pauls Hand in seine gewaltigen Pfoten. Mit den Fingerspitzen fuhr er langsam – fast zärtlich – über die Knochen. „Bewege mal die Finger, einen nach dem anderen! Langsam, langsam!“ Schließlich nickte er zufrieden. „Nichts gebrochen, Chefchen, da hast du Glück gehabt. Aber merk dir für die Zukunft: Nie mit den Knöcheln schlagen, und wenn möglich, nimm einen Stein oder ein Stück Holz in die Handfläche, bevor du eine Faust machst. Das erhöht die Wirkung des Schlags und schont deine Hand. Aber ich hätte zu gerne gesehen, wie die Fresse von dem Kerl aussieht, den du in der Mangel hattest. Wo mag der abgeblieben sein?“
Diese Frage stellte sich auch Paul. Er glaubte nicht daran, dass der Mann desertiert war. Warum sollte er das ausgerechnet dann machen, nachdem er einen Anschlag auf ihn verübt hatte. So etwas musste doch geplant werden. Wenn der Mann aus dieser Gegend stammte, hätte er während der vergangenen zwei Wochen ganz gewiss schon Gelegenheiten genug gehabt, sich aus dem Staub zu machen. Allerdings mochte es auch folgendermaßen geplant gewesen sein: Der Mann brachte ihn um, ein Fischerboot kam längsseits, Pauls Leichnam wurde hineingeworfen, der Mörder sprang hinterher, und ab ging es. Am nächsten Morgen wurden sie beide vermisst, und der Kapitän würde annehmen, dass Paul mit Hilfe eines Ortskundigen desertiert war. Er schnaubte angewidert vor sich hin. Quatsch, alles Quatsch! Woher sollten die Kerle Tage vorher wissen, dass er ausgerechnet in dieser Nacht gegen vier Glasen seinen Darm entleeren musste? Er steigerte sich offensichtlich in blödsinnige Spekulationen hinein. Nein, der Angriff musste spontan erfolgt sein. Der Auftraggeber hatte eine günstige Gelegenheit gewittert und seinen Schläger von der Kette gelassen, über die möglichen Folgen hatte er sich in der Eile keine Gedanken gemacht. Vielleicht hatte dieser Ken Little tatsächlich die Wahrheit gesagt, und seine Anweisung hatte hur dahingehend gelautet, ihn windelweich zu prügeln. Was hatte der Bootsmann von ihm gesagt? Er sei ein übler Raufbold gewesen, das war genau der richtige Typ für so einen Auftrag. In der Hitze des Kampfes mochte der Mann wegen der heftigen Gegenwehr die Kontrolle über sich verloren haben und hatte voller Wut versucht, ihn zu ermorden. So war der Überfall sicher nicht geplant gewesen. Gleich der erste Schlag hätte Paul wehrlos und der zweite bewusstlos machen sollen. Dann hätte ihn der Kerl nach allen Regeln der Kunst vertrimmt und hilflos liegen lassen, anschließend wäre er unerkannt und unverletzt wieder verschwunden.
Ein fürchterlicher Verdacht stieg in ihm auf. Er schluckte schwer. Hatten gar die eigenen Spießgesellen den stupiden Schläger zur Seite geschafft? Hatten sie befürchtet, dass Paul den Anschlag bei der Schiffsführung melden würde? Der Schuldige wäre durch seine Verletzungen leicht herauszufinden gewesen, und möglicherweise galt er bei seinesgleichen als unsicherer Kantonist, wenn es darum ging, die Namen der Mitverschwörer zu verschweigen. In Gedanken versunken, betakelte er das letzte Kardeel einer Leine und reichte den Tampen an Hendrik weiter, dabei fiel sein Blick zufällig auf die Eingangspforte in der Reling, wo der Wachoffizier gerade einen Besucher in Zivil begrüßte. Der Mann war mit einem langen, weiten grün-gelb-karierten Reisecape bekleidet und trug einen steifen, sich nach oben verjüngenden grünen Zylinder mit einer silbernen Schnalle und einem langen gelben Seidenband, das ihm bis weit über die Schulter hinunterhing. Er klopfte sich angewidert die Kleidung ab, verteilte dabei aber nur noch mehr weißen Ton von den frisch geweißten Handläufern, an denen er sich beim Aufstieg festgehalten hatte, auf dem wallenden Gewand. Er klemmte sich ein Monokel ins Auge und sah sich neugierig um. Er wirkte an Bord der Fregatte völlig deplatziert. Der W.O. hielt die Hand vor den Mund, hüstelte diskret und machte eine einladende Bewegung mit der Hand. Der Mann nickte und folgte dem Leutnant nach achtern. Paul vergaß die kleine Episode sofort wieder. Im Zusammenhang mit der Reparatur und der Ausrüstung des Schiffes kamen unzählige zivile Besucher an Bord, allerdings war dies ein besonderer Paradiesvogel gewesen. Bully kniff die Augen zusammen und blickte abschätzend zur Sonne empor, die sich immer wieder hinter den schnell ziehenden Wolken versteckte. Er leckte sich die Lippen. „Bully hat Appetit auf seinen Becher Grog zum Mittag. Es müsste gleich so weit sein, schätze ich mal.“
Hendrik bemerkte trocken: „Da brauchst du gar nicht zur Sonne zu gucken, Bully, das meldet dir doch schon dein trockner Hals.“
„Schon recht, schon recht, aber man will ja sicher sein, Henny, nicht wahr?“
Ehe Hendrik antworten konnte, ertönte ein barscher Ruf vom Achterdeck. Der Zweite Leutnant Hannibal Excom stand an der vorderen Reling und rief ihnen durch seine zum Trichter geformten Hände zu: „Leichtmatrose Morin auf das Achterdeck!“ Die Männer blickten sich erschrocken an. Paul wurde der Mund trocken. Hatte dieses intrigante Schwein Cully eine Verschwörung gegen ihn angezettelt und ihn bei der Schiffsführung angeschwärzt? „Alles Gute, Paul, wird schon gut gehen“, brummte Jan, und Karl ergänzte ungewohnt förmlich: „Sie können sich auf mich verlassen, gnäd'ger Herr.“ Der junge Mann erhob sich und schritt kerzengerade nach achtern, hölzern erklomm er die Treppe zum Achterdeck und salutierte stramm vor dem Zweiten Leutnant. Der Offizier musterte sein Äußeres kritisch, fand aber an seinem sauberen, noch fast neuen Arbeitszeug aus Danzig offensichtlich nichts auszusetzen. „Besuch für Sie, Leichtmatrose Morin.“ Die ungewohnt höfliche Anrede ging Excom offensichtlich leicht von den Lippen. Der Offizier blickte ihn nochmals durchdringend an. „In der Staatskabine des Herrn Kommandanten. Nun ja, ich bin sicher, Sie werden sich in dieser Umgebung entsprechend zu benehmen wissen. Sie kennen den Weg?“ Er deutete auf den Niedergang hinter sich. „Viel Glück, Morin.“
Paul wusste zwar nicht, wie der Mann das meinte, aber er meinte, ehrliche Sympathie herausgehört zu haben. Seine Kehle war wie zugeschnürt. Hatte man diesen Little tot oder lebendig gefunden? War der Besucher vielleicht der Friedensrichter des Ortes, der seine Auslieferung an die örtliche Justiz verlangte? Mühsam stieß er hervor: „Danke, Sir.“ Er stieg mit schwerem Schritt den Niedergang vor dem großen Spill hinunter auf das Hauptdeck, dann wandte er sich nach Backbord, wo vor der Tür zum Vorraum des Kapitänslogis ein Seesoldat auf Posten stand. Als er den einfachen Seemann auf sich zukommen sah, ließ er sich seine Verwunderung nicht anmerken, erinnerte sich an seine Order, stieß den Kolben der Muskete auf die Decksbalken und röhrte: „Seemann Morin zum Kapitän, Sööör!“
„Soll reinkommen!“, erklang es gedämpft von innen.
Ein Steward öffnete die Tür und Paul trat ein, durchquerte den Vorraum, in dem ein Neunpfünder düster auf seiner Lafette dräute. Darüber hing das Reisecape des Besuchers. Offensichtlich war der Steward damit beschäftigt gewesen, es mit einer Bürste zu reinigen. Bewundernd hielt Paul die Luft an, als der Flunky ihn in die große, von Licht durchflutete Kabine des Kapitäns schob. Hier ließ es sich leben, edles Holz, schwere Stoffe, weiches Leder bestimmten die Einrichtung. Aber ehe er sich ausgiebig umsehen konnte, kam Kapitän Archibald Stronghead mit ausgestreckten Armen auf ihn zugeeilt, packte seine Hand und drückte sie herzhaft. Es war natürlich die Rechte, und Paul sah Sterne vor seinen Augen tanzen, nur mühsam konnte er die Tränen zurückhalten und unterdrückte einen Schmerzensschrei. Der Kommandant schien das nicht zu bemerken und flötete leutselig: „Nehmen Sie doch bitte Platz, mein lieber Baron. Ich habe gerade erfahren, dass es Ihnen, aus mir unverständlichen Gründen übrigens, gefallen hat, auf meinem Schiff als einfacher Seemann anzumustern. Wenn Sie sich mir von Offizier zu Offizier anvertraut hätten, wäre ein anderes Arrangement sicher möglich gewesen, Sir.“
„Oh, dessen bin ich mir gewiss, Sir“, stimmte ihm Paul zu, obwohl er gar nicht so sicher war, ob man ihm, so wie die Umstände lagen, geglaubt hätte. „Aber ich wollte mich mit dem Beruf des Seemanns gründlich vertraut machen, und da ist die Arbeit an Deck die beste Schule, nicht wahr, Sir?“
„Sicher, sicher! Selbstverständlich kann man von den alten Teerjacken alles über die seemännischen Arbeiten erlernen, aber die hohe Schule der Seefahrt wird auf dem Achterdeck gelehrt, lieber Baron von Morin. Wie ich mit Befriedigung höre, haben Sie schon ganz gut unsere Sprache gelernt. Das freut mich.“
Paul lächelte und fuhr dann aus purer Bosheit, es war so etwas wie die kleine Rache eines Bewohners des Zwischendecks an dem König des Achterdecks, auf Französisch fort: „Nun, aber in der Sprache unserer Feinde kann ich mich noch immer besser ausdrücken, deshalb möchte ich diese jetzt benutzen, selbstverständlich nur, wenn Sie gestatten, Sir?“
„Nur zu, nur zu!“ Strongheads Akzent war stark und das deutete darauf hin, dass er selten Gelegenheit hatte, seine Sprachkenntnisse anzuwenden. „Aber als Erstes möchte ich Ihnen diesen Gentleman vorstellen.“ Er deutete auf den Fremden am Tisch, der sich erhoben hatte und ebenfalls auf Paul zutrat. Stronghead blickte stirnrunzelnd auf die Visitenkarte, die er schnell herauszog. „Darf ich vorstellen, äh, Baron, das ist Mister Gothellf Donierhell, ein enger Vertrauter Ihres Onkels, des Count von Wolfenstein.“ Der Mann verzog schmerzlich das Gesicht, wirkte dabei aber müde, so als würde er kaum noch die Kraft aufbringen, die Verballhornung seines Namens zu korrigieren. „Gotthilf Donnerhall, Euer Hoch- und Wohlgeboren.“ Er verbeugte sich tief. „Ihr sehr ergebener Diener, verfügen Sie ganz über mich.“
Der Kapitän räusperte sich. „Ahem, wollen wir uns nicht endlich setzen, Gentlemen? Darf Ihnen mein Steward eine kleine Erfrischung servieren?“ In der Ferne ertönte dumpf ein Kanonenschuss und über ihnen auf dem Achterdeck wurde die kleine Schiffsglocke am Kompasshaus achtmal angeschlagen. „Zeit für das Mittagessen der Mannschaft. Da ich immer erst eine gute Stunde nach den Männern zu lunchen pflege, sollten wir uns vorher ein Gläschen Sherry gönnen, denke ich. Ich habe da einen ganz trinkbaren Oloroso[4], der Ihnen zusagen wird.“ Er hob die Stimme: „Henry!“ Der Steward erschien umgehend, als ob er hinter Tür schon in Bereitschaft gestanden hätte. Er balancierte ein Tablett mit Gläsern und mehreren Schälchen mit Mandeln und Nüssen auf der rechten Hand. Kapitän Stronghead machte zu Paul eine dringende Geste, sich endlich zu setzen. Nachdem die Herren auf den glücklichen Tag angestoßen und einen Schluck des wirklich ausgezeichneten Weines, der eine an dunklen Bernstein erinnernde rotgoldene Färbung und ein duftiges Nussaroma hatte, genüsslich über die Zunge hatten rollen lassen, konnte Paul in Ruhe seinen merkwürdigen Retter betrachten. Er trug ein moosgrünes Samtjackett mit goldenen Borten und Knöpfen, darunter lugte eine gelbe, ornamental gemusterte Seidenweste hervor. Das Halstuch und die Manschetten, die seine Hände halb verdeckten, bestanden aus teurer flämischer Spitze. Die Kniehosen und Strümpfe waren aus bester Nankingseide. Feinste Lederschuhe mit schweren Silberschnallen vervollständigten den Anzug. Offensichtlich handelte es sich nicht um den Dorfarmen von London. Der Mann musterte Paul über den Rand seines Glases scharf. „Herr Baron, die besten Grüße von Ihrem Oheim und der übrigen Familie.“ Er verzog amüsiert das Gesicht. „Besonders die Frau Gräfin und die Komtessen können es gar nicht erwarten, die Bekanntschaft eines berühmten Husaren des großen Preußenkönigs zu machen.“ Wenn sich Paul nicht sehr irrte, verzog der Mann bei der Erwähnung Friedrichs leicht abschätzig den Mund. Nun ja, in den Beziehungen zwischen den Welfen und den Hohenzollern herrschte nicht immer das beste Verhältnis. „Aber bevor wir weiter in die Details gehen, Sie können mir doch sicher einen Beweis für Ihre Identität vorlegen?“
Paul fixierte ihn ärgerlich. Wenn du diese Frage an mein Brüderchen gerichtet hättest, wäre dessen Degen ganz sicher schon wieder halbwegs aus der Scheide gewesen. Das hätte dir als Beweis ausreichen müssen. Aber natürlich hatte der Mann recht. Paul lächelte verbindlich und streifte ein aus Tauwerk kunstvoll geflochtenes Halsband über den Kopf. Er reichte Donnerhall den eingearbeiteten Siegelring. Der warf einen kurzen Blick darauf, nickte dann dem Kapitän zu und verbeugte sich nochmals im Sitzen. „Der Krebs mit der zerbrochenen Kette und der Bär unter dem Baum, darüber die Freiherrenkrone. Verzeihen Sie mir, Euer Hochwohlgeboren, aber ich habe meine Anweisungen.“ Paul machte eine abwehrende Handbewegung und streifte das Halsband wieder über.
„Woher stammten die blauen Stellen an Ihrem Hals und die Verletzung Ihrer rechten Hand?“, erkundigte sich plötzlich Kapitän Stronghead scharf.
Paul stieß scharf den Atem aus. Er saß in einer Zwickmühle. Er durfte seinen Kapitän nicht belügen, konnte ihm aber auch seinen Verdacht nicht mitteilen, weil er dafür keinerlei Beweis hatte. Er blickte Stronghead gerade in die Augen – das wäre vor zehn Minuten noch streng bestraft worden – und sagte langsam: „Herr Kapitän, ich möchte darüber nicht reden, Sir. Wie Sie wissen, gibt es da so gewisse Angelegenheiten im Zwischendeck, die man am besten intern regelt. Ich kann Ihnen nur Folgendes ehrenwörtlich versichern: Ich habe erst heute Morgen von dem Verschwinden des Seemanns Ken Little erfahren. Vorher kannte ich noch nicht einmal seinen Namen und weiß bis jetzt nicht, wie er aussieht.“
Stronghead wiegte sein Haupt, nickte dann, trank einen Schluck und meinte ruhig: „Belassen wir es dabei. Ich nehme an, dass Sie nicht lange brauchen werden, um Ihre persönlichen Effekten zu packen und sich von Ihren Kameraden zu verabschieden, daher schlage ich vor, dass Sie das auf der Stelle tun und dann anschließend hier bei mir zu Mittag essen. Danach können wir dann den leidigen Papierkram mit dem Zahlmeister erledigen. Ich muss gestehen, dass ich Sie ungern ziehen lasse, denn ich habe Sie beobachtet und festgestellt, dass Sie aus dem Holz geschnitzt sind, aus denen vorzügliche Seeleute gemacht werden.“
„Sir, es gibt da noch ein Problem!“ Der Kapitän blickte ihn verwundert an. „Sir“, fuhr Paul fort, „ich kann Ihr schönes Schiff unmöglich verlassen, ohne meinen Burschen Karl in Schlepp zu nehmen. Verstehen Sie, Sir, er ist für mich so etwas, wie für Sie Ihr Bootssteurer! Selbstverständlich werden wir sein Handgeld zurückzahlen.“
Der Kommandant überlegte, dann nickte er langsam: „Eine noble Einstellung, Baron, die Ihnen alle Ehre macht. Was wären wir ohne unsere Schatten, die uns den Rücken freihalten.“ Er stockte, grinste jungenhaft und fügte hinzu: „Aber immer scheint das nicht zu klappen – jedenfalls nicht bei Ihnen. Aber sei es drum, der Mann soll sich fertig machen und bereithalten. Ich denke, dass Sie spätestens bei acht Glas auf der Nachmittagswache wieder eine verdammte Landratte sein werden.“
***
[1] R: Run, desertiert
[2] Die „Standing officers“ waren mit Ausnahme des Zahlmeisters Decksoffiziere ohne Zugang zur Offiziersmesse. Sie blieben prinzipiell immer an Bord eines bestimmten Schiffes, auch wenn es aufgelegt worden war. Es handelte sich um den Zahlmeister, den Zimmermann, den Bootsmann, den Stückmeister und den Koch, wobei der auch wieder eine Ausnahme darstellte, denn er verdankte seine Einstellung als warrant officer meist seiner langen Dienstzeit – meist als vom Kommandanten ernannter Unteroffizier (petty officer) – und der Tapferkeit in einem Gefecht, in dessen Verlauf er schwer verwundet worden war. Daher fehlte ihm häufig ein Bein oder er war halbblind. Der Leser mag sich seine Gedanken machen, ob das die besten Voraussetzungen für den schweren und verantwortungsvollen Job waren, auch wenn er im Wesentlichen nur drüber wachen musste, dass das Wasser in den Töpfen kochte oder simmerte. Allerdings war er dafür verantwortlich, dass alle Backen prinzipiell gleichmäßig mit den Rationen (z. B. Fleischstücke) versorgt wurden, die nicht vom Zahlmeister direkt an den Messekoch ausgeteilt wurden, der sie dann in markierten Tüchern oder Netzen in die Kombüse brachte.
[3] In der Royal Navy war es lange sogar üblich, dass die Familie für die „Ausbildung“ als Midshipman dem Kapitän eine gewisse Summe pro Monat zahlte. Eine Heuer für Midshipmen wurde erst später eingeführt.
[4] Eine Sherry-Variante, etwas kräftiger als ein Fino, 17 – 20° Alkoholgehalt.
Kapitel 2
Fécamp, Juni 1760
Die Säbelklingen schlugen krachend aneinander, das helle Klirren wurde vom frischen Westwind von der freien Fläche oben auf der Bastion hinüber zu den hinter ihr aufragenden grauen Wällen geweht und von diesen zurückgeworfen. Die beiden Fechter schenkten sich nichts. Trotz der steifen Brise hatten sie ihre Jacken abgelegt, und die weiten Ärmel der Hemden blähten sich kräftig im Wind. Die Kämpfer umkreisten sich lauernd mit vorgebeugtem Oberkörper, die Klingen nach vorne gestreckt, die Spitze halb zum Boden gesenkt. Beide warteten auf einen Fehler des anderen. Ihre Hemden klebten schweißgetränkt am Rücken. Peter von Morin sprang vor, schlug von oben auf die Klinge seines Gegners, aber der wich trotz seines massigen Körpers geschickt zurück, machte einen Schritt zur Seite und griff seinerseits an. Sein Schlag wurde abgeblockt. Ein neuer Angriff, eine Finte, ein kurz angedeuteter Rückzug, ein rasches Nachsetzen, und die Waffe landete klatschend auf dem semmelblonden Schopf des Gegners.
„Touché! Puh! Franz, du altes Schlachtross, du wirst immer besser! Jetzt brauche ich schon fast eine geschlagene Viertelstunde, um dich mürbe zu klopfen.“ Peter von Morin schnaufte und wischte sich mit der Rückseite seiner linken Hand den Schweiß von der Stirn, sein dunkles Haar mit dem geflochtenen Zopf und den langen Husarenlocken an den Schläfen klebte am Kopf. Er rammte die stumpfe Übungswaffe mit der abgerundeten Spitze in den Boden.
„Ich habe eben einen guten Fechtlehrer, Euer Gnaden“, erwiderte Franz bescheiden, grinste aber über sein ganzes breites, offenes märkisches Bauerngesicht. Peter winkte wegen der falschen, weil nur einem Herzog oder Markgrafen zustehenden Anrede müde ab. Franz war nicht gerade für seine überbordenden intellektuellen Fähigkeiten bekannt, eigentlich war er eher berüchtigt für seine außergewöhnlichen Körperkräfte. Man erzählte sich, dass er einen Stier mit einem Schlag der bloßen Faust betäuben konnte, aber wie viele kräftige Männer konnte er sich, wenn es sein musste, flink und lautlos wie ein Bär bewegen.
Allerdings war Peters Bruder Paul sich oft nicht ganz sicher gewesen, ob sich Franz nicht dümmer stellte, als er war. Lieber überließ er seinem wortgewandten Freund Karl das Reden und dachte sich seinen Teil, aber der Karl befand sich jetzt zusammen mit seinem Herrn irgendwo da drüben auf der anderen Seite des Kanals. Wohlweislich verschwieg Franz, dass er eben im Gefecht zwei- bis dreimal eine Möglichkeit gesehen hatte, seinen Herren entscheidend zu treffen. Er wusste genau, dass das dem eitlen Peter gar nicht behagen würde. Ganz besonders dann, wenn er ihm auch noch unverblümt klarmachen würde, was die Ursache dafür war: Peter hatte während der Gefangenschaft zu lange auf der faulen Haut gelegen und sich intensiv dem ganz ohne Frage sehr guten und reichlichen Essen gewidmet: den leckeren legierten Fisch- oder Pilzsuppen, den kräftigen Pasteten mit grünem Pfeffer, den edlen Lachsterrinen mit Dill, den dampfenden Braten mit den fein abgeschmeckten Sahne- oder Rotweinsoßen und frischen Gemüsebeilagen, den knusprig gebratenen oder sanft gedämpften Fischen. Von den anderen exquisiten Meeresfrüchten, wie frischen oder überbackenen Austern, mit Krebsfleisch gefüllten Blätterteigtaschen und Garnelen mit gebräunter Butter ganz zu schweigen, dazu kam, dass das duftige weiße Brot mit der gelben sahnigen Butter aber auch zu verführerisch war. Und dann erst noch die unglaubliche Auswahl an Käsesorten, die vom milden weichen Ziegen- über würzigen halbfesten Schafskäse bis hin zu kräftigen harten Kuhmilchkäsespezialitäten reichte. Dazu waren große Mengen von Capitaine Dufours leckeren Weinen und Obstbränden durch seine Gurgel geflossen. Das hatte sein Gewicht nach oben getrieben, hatte ihn kurzatmiger und langsamer gemacht. Wie hieß es doch so richtig: Hätt' sich ein Ränzlein angemäst' als wie der Doktor Luther.
Peter war wohl selber aufgefallen, dass sein Hosenbund über dem besagten Ränzlein spannte, und so übten sie seit einigen Tagen regelmäßig nach dem Frühstück auf der Bastion den Nahkampf mit Übungssäbeln und Messern. Franz hatte sich mit der landwirtschaftlichen Arbeit in dem Gartenparadies von Capitaine Dufour, den alle nur Papa Nezrouge nannten, dem väterlichen Freund von Peter, fit gehalten, außerdem fiel seine Verpflegung nicht ganz so üppig aus wie die seines Herrn. Trotzdem war sie bei weitem besser und raffinierter als das meiste, was im Gesindehaus und auch im Speisezimmer der Herrschaften der Morins in der Neumark auf den Tisch kam. Dort liebte man es schlicht und unprätentiös.
„Ah, Messieurs, wenn man Ihnen so zuschaut, weiß man, warum unsere armen Soldaten in Deutschland gegen die Preußen so einen schweren Stand haben“, erklang eine Stimme von der Treppe her, die nach unten in einen der Innenhöfe der Zitadelle führte. Dort stand ein junger Leutnant und applaudierte mit seinen behandschuhten Händen. Er musste sie schon seit einiger Zeit beobachtet haben. Peter erinnerte sich augenblicklich schmerzlich daran, dass er auf dieser Treppe die süße Amélie, die Tochter des Generals d'Armant, zum ersten Mal geküsst hatte – und sich damit prompt ein Duell mit Amélies widerlichem Verlobten, dem Freibeuter Jean de Gravelotte, eingehandelt hatte. Nun, das war Vergangenheit, denn der Feigling war verschwunden, nachdem er bei dem Duell auf höchst peinliche Weise gekniffen hatte. Peter winkte dem jungen Offizier aufmunternd zu. „Kommen Sie doch heran, Leutnant de la Marche, treten Sie näher und lassen Sie uns ein Tänzchen wagen, wenn ich das mal so ausdrücken darf.“ Yves de la Marche war der Adjutant des Festungskommandanten Général d'Armant. Seine Uniform strahlte in makellosem Weiß, seine Perücke war frisch gepudert und der Zopf tadellos geflochten. Der Offizier zögerte nur kurz, kam dann aber entschlossen näher. Er nahm sein Wehrgehänge ab, dann entledigte er sich seines Rockes, faltete ihn sorgfältig zusammen und deponierte ihn auf der Lafette einer der Kanonen. Obendrauf kam sein Dreispitz. Er ließ sich den Übungssäbel von Franz geben, wog die Waffe in der Hand und hieb ein paar Mal mit ihr zischend durch die Luft. Er schien nicht besonders begeistert von der Qualität zu sein, denn sein Gesicht verzog sich abschätzig. „Ach, kommen Sie, de la Marche, mein Käsemesser ist auch nicht besser“, lachte Peter.
„Käsemesser“, schmunzelte der Franzose, „das ist genau der richtige Ausdruck für dieses Ding, das eine Beleidigung für jeden anständigen Säbel ist. Ich wusste gar nicht, dass wir so einen Schund herstellen können.“
„Nun, mon cher, der Armee kann man alles verkaufen! Hauptsache, die richtige Bezeichnung steht auf der Rechnung und es ist schön teuer.“
Der Leutnant presste die Augen zu schmalen Schlitzen zusammen und meinte verärgert: „Vermutlich haben Sie recht, Monsieur, irgendjemand wird an diesem Schrott eine Menge Geld verdient haben.“
„Irgendjemand, mon ami? Ich kann Ihnen sagen, wer! Der Hersteller, der Einkäufer der Armee, der Spediteur und der Kontrolleur im Arsenal, der die Lieferung geprüft hat. Alle diese Herren sind glücklich, nur Sie ziehen einen Flunsch und sind bekümmert.“
„Monsieur, darüber sollte man nicht spotten!“
„Bei uns sagt man: Was man nicht ändern kann, soll man wenigstens lächerlich machen.“
„Seit wann gibt es in den öden Steppen jenseits der Elbe Philosophen?“, fragte ein schon wieder heiterer Leutnant.
„Ha! Was für eine Perfidie! Da müssen die Waffen sprechen. En garde, Sie welscher gueulard![5]“, rief Peter scheinbar zutiefst entrüstet und stellte sich in Position. „Prêts? Allez!“
Der Kampf wogte unentschieden hin und her. Beide jungen Männer waren gute Fechter. De la Marche hatte zwar offensichtlich die bessere Technik, aber der Preuße verblüffte ihn immer wieder mit unorthodoxen Attacken und Finten, die er in den blutigen Kämpfen auf den Schlachtfeldern und in den Wäldern Böhmens und Schlesiens auf die harte Art gelernt hatte. Nach reichlich fünfzehn Minuten hob Peter die Waffe grüßend vor sein Gesicht und japste völlig außer Atem: „Ich nehme den gueulard zurück, Monsieur.“ De la Marche salutierte ebenfalls und keuchte dann nicht minder außer Puste: „Ich gebe zu, dass es jenseits der Elbe von Philosophen nur so wimmelt … ich kenne nur keinen.“[6] Die beiden jungen Männer mussten lauthals lachen und umarmten sich freundschaftlich.
Nachdem sie sich angezogen hatten, gingen sie nach vorne an die Brustwehr und blickten auf das grüne Meer hinaus, über dem ein feiner Dunstschleier lag. Kleine weiße Katzenpfoten tanzten auf den Wellenkämmen. De la Marche spürte, dass sein Begleiter plötzlich von einer schwermütigen Stimmung erfasst wurde. „Was bedrückt Sie, Monsieur? Sagen Sie es mir, vielleicht kann ich Ihnen helfen.“
„Das wird Ihre Kräfte und Möglichkeiten übersteigen, mein lieber Leutnant. Sie müssen verstehen, immer wenn ich hinaus auf das Meer blicke, muss ich an meinen Zwillingsbruder Paul denken, der die See in so kurzer Zeit lieben gelernt hat und der jetzt da drüben bei den Roastbeefs eine Karriere als Seeoffizier machen wird, während ich hier als geborener Husar noch nicht mal einen Gaul zwischen die Schenkel bekomme.“
Yves de la Marche blickte ernst vor sich hin, dann lächelte er plötzlich. „Was den ersten Teil Ihrer Betrübnis angeht, so haben Sie recht, da kann ich Ihnen wirklich nicht helfen, das ist traurig, aber“, er zuckte mit den Schultern, „c'est la guerre. Andererseits, was spricht eigentlich gegen einen täglichen Ausritt in die Umgebung von Fécamp? Natürlich müssten Sie mir Ihr Ehrenwort geben, dass Sie diese Ausflüge nicht zur Flucht nutzen werden, Baron.“
Peter blickte ihn verwundert an, überlegte kurz, reichte ihm aber dann schnell die Hand und meinte ernst: „Versprochen, Monsieur, für die Zeit der Ausritte! Bei meiner Ehre!“
„Dann wollen wir mal in die Ställe gehen und einen vernünftigen Gaul für Sie aussuchen. Natürlich muss der General noch zustimmen, aber daran habe ich keinen Zweifel.“ Der Franzose lachte leise glucksend in sich hinein. „Sie müssen wissen: Er mag Sie. Kein Wunder, denn Sie verfügen über mächtige Fürsprecher.“
„So, wen denn?“, erkundigte sich Peter neugierig.
De la Marche schüttelte verdrossen den Kopf: „Monsieur, verspotten Sie mich nicht. Sie wissen ganz genau, dass Ihnen alle mannbaren Weiber der Garnison zu Füßen liegen – und deren Mütter und Tanten gleich mit. Für die Damen sind Sie so etwas wie ein Märtyrer, ein unschuldig eingekerkerter stiller Dulder. Fehlt nur noch die Dornenkrone. Pah!“ Er schnaubte entrüstet. Peter blickte ihn überrascht an. Seine Gefühle waren so auf die süße kleine Amélie fixiert, dass er sich um die anderen Damen nie ernstlich gekümmert hatte, mit denen er gelegentlich bei seinen Spaziergängen oder einem festlichen Bankett im Offizierskasino der Festung in Berührung gekommen war. Er hatte sie immer sehr höflich gegrüßt, war ihnen behilflich gewesen, wenn es sich so ergab, hatte aber dann immer sofort seinen Weg allein fortgesetzt oder hatte versucht, Amélie in ein längeres Gespräch zu verwickeln und mit ihr zu tanzen. Vielleicht war es diese zurückhaltende Art gewesen, welche ihn für die Demoiselles so interessant gemacht hatte. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass Peter mit seinen verwegenen schwarzen Husarenlocken, dem sichelförmigen Tatarenbärtchen, dem dunklen Teint und den braunen Augen, die unter den langen, seidigen dunklen Wimpern so schön melancholisch blicken konnten, für die jungen Fräulein ein durchaus attraktiver Anblick war, von dem man in einsamen Nächten gut träumen konnte. Manch verlangender, auffordernder Blick wurde ihm über den Rand eines Fächers zugeworfen, manch ein Spitzentaschentuch, das er zuvorkommend aufgehoben hatte, wurde heimlich des Nachts an die bebenden Lippen gedrückt, besonders dann, wenn er vorher galant einen Kuss darauf gehaucht hatte. Aber er blieb unnahbar, so wie sich sein Objekt der Begierde, die eine, die liebliche, die reizende Amélie, von ihm fernhielt. Aus gutem Grund hatte ihr der Vater, Général d'Armant, streng den Umgang mit dem Preußen verboten. Er kannte seine Tochter und wusste, dass sie bis über beide Ohren in den charmanten Jungen verliebt war.
Aber ein preußischer Schwiegersohn war so ziemlich das Letzte, was er zur Förderung seiner Karriere gebrauchen konnte, auch wenn ihn seine Damen noch so sehr bedrängten und ihn als herzlos und unromantisch beschimpften. Dabei mochte auch er den jungen Husaren, denn er war von seinem Mut, seiner eloquenten Art und den nahezu perfekten Französischkenntnissen äußerst angetan, aber im Krieg musste ein Gegner ein Gegner bleiben: Punktum! Außerdem war der Bursche noch viel zu jung, um ans Heiraten denken zu können. Finis!
Inzwischen hatten die drei Männer die Ställe erreicht. Der vertraute Geruch nach Pferdemist, Heu, Leder und Schweiß schlug ihnen entgegen. Ein paar Soldaten waren mit dem Ausmisten der Boxen beschäftigt. Nur etwa die Hälfte der Boxen war belegt, wahrscheinlich befand sich der Rest der Herde vor der Stadt auf einer Weide. De la Marche überlegte offensichtlich sehr angestrengt, während er langsam mit den beiden Deutschen ganz nach hinten durchging. Je weiter sie in die Tiefen des Stalls eintauchten, desto besser wurde die Qualität der Pferde, wie Peter mit sachkundigem Blick feststellte. „Entschuldigen Sie, aber ich kann Ihnen natürlich kein Pferd anbieten, das schon in festen Händen ist. Aber unter diesen hier“, er deutete auf zwei Pferde, „haben Sie die freie Auswahl.“ Peter blickte ihn fragend von der Seite an. „Vermutlich gehören die Rösser Ihnen, mon ami, oder sollte ich mich da täuschen?“
„Schon recht, Herr Baron“, erwiderte der Franzose nonchalant und machte eine wegwerfende Handbewegung, „aber auch ich kann nur ein Pferd zur selben Zeit reiten, nicht wahr?“
Peter machte sich so seine Gedanken. Der junge Leutnant musste aus einer sehr begüterten Familie stammen, wenn er sich privat ein halbes Dutzend Pferde halten konnte, denn er war sich sicher, dass ihm de la Marche nicht seine zwei oder drei Lieblingspferde angeboten hatte. Sorgfältig musterte er die Pferde. Es handelte sich um eine Fuchsstute und einen grauen Wallach, beide sehr gutes Material, dachte er. Die Pferde blickten ihn neugierig an, ihre Ohren spielten nervös. Wussten sie, worum es ging? Aus einer Nachbarbox erklang ein zorniges Schnauben, gefolgt von einem wütenden Wiehern, das wie eine Fanfare klang, die zum Angriff rief. Hufe krachten donnernd gegen die Bohlen. Ein großer schwarzer Pferdekopf mit ärgerlich rollenden Augen, flach nach hinten zurückgelegten Ohren und einem gefährlich entblößten gelben Gebiss schob sich über die Trennwand. Fast meinte man aus den geblähten Nüstern Flammen der Entrüstung schlagen zu sehen. Da war jemand sehr, sehr verstimmt und wartete nur darauf, einen dieser Winzlinge, die sich vor seiner Box tummelten, unter die Hufe zu bekommen.
„Was ist denn mit diesem Tier los?“, erkundigte sich Peter neugierig. Franz, der hinter den beiden Offizieren stand, verdrehte resignierend die Augen, er wusste, was kommen würde!
„Puh“, der Franzose seufzte teils erbost, teils mitleidig tief auf, „puh, dieser Teufelsgaul gehört mir auch. Aber ich fürchte, ich werde ihn erschießen müssen. Er war ein richtig vielversprechender junger Hengst mit den besten Anlagen. Sie sehen ja, wie kräftig sein Körperbau ist. Aber leider hat er, weil er draußen auf der Weide eines Nachts einfach über das Gatter auf die Stutenkoppel gesprungen ist, auch schon ein paar Stuten gedeckt. Für den Truppendienst war er danach einfach untragbar, weil er wegen seiner Hengstmanieren unberechenbar wurde. Da habe ich ihn legen lassen – leider hat er seine schlechten Manieren danach nicht befriedigend genug abgelegt. Die Kastration kam wohl einfach zu spät. Man hat beinahe den Eindruck, er macht mich persönlich für den Verlust seiner Familienjuwelen verantwortlich, Monsieur.“
Peter nickte langsam und rieb sich das Kinn: „Ein alter Wachtmeister meiner Schwadron pflegte immer zu sagen: ‚Sobald so ein Kerl einmal eine Stute gedeckt hat, vergisst er niemals, dass er eigentlich ein Hengst ist.‘“ Er räusperte sich: „Ahem, wenn ich ehrlich sein soll, mir würde es genauso gehen, Ihnen nicht auch, mon cher ami





























