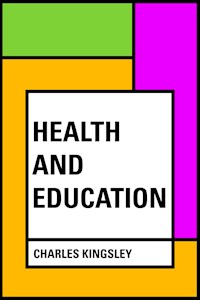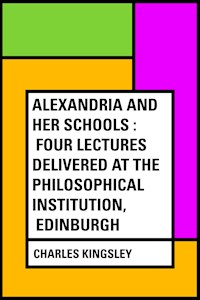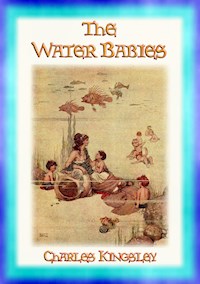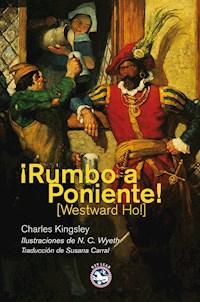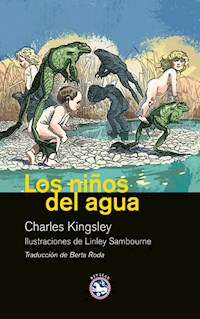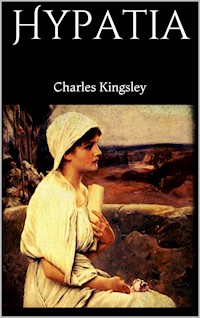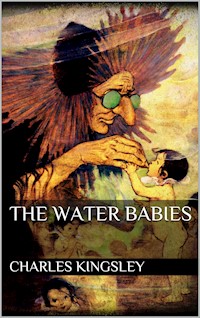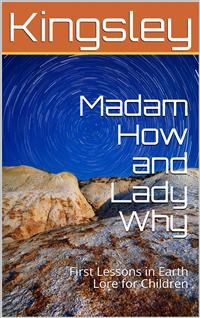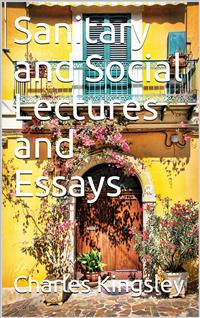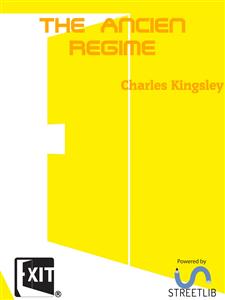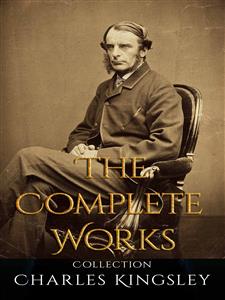Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Lebensgemälde des fünften Jahrhunderts muss notwendig vieles enthalten, was jedem Leser peinlich ist, und wovon Jugend und Unschuld wohl tun das Auge gänzlich abzuwenden. Es stellt ein grauenhaftes, aber dennoch großartiges Zeitalter, eine jener kritischen, jener Hauptepochen im Leben des Menschengeschlechts dar, wo Tugend und Laster dicht beieinander — ja oft in einem und demselben Individuum vereinigt — in überraschender Offenheit und Stärke sich zeigen. Wer ein solches Zeitalter beschreibt, hat einen lästigen Missstand zu bekämpfen. Er wagt nicht zu sagen, wie schlecht die Menschen waren, und er wird keinen Glauben finden, wenn er erzählt, wie viel Gutes sie besaßen. Im gegenwärtigen Fall ist jener Missstand ein doppelt großer; denn während die Sünden der Kirche, obgleich entsetzlich, sich doch in Worten ausdrücken lassen, ist es unmöglich, die Sünden der heidnischen Welt, die sie bekämpfte, zu beschreiben; der christliche Verteidiger ist daher, des Anstands wegen, genötigt, den Zustand der Kirche weit schwächer vorzustellen, als die Tatsachen es verdienen. Inhaltsverzeichnis Vorwort Vorwort des Verfassers Erster Teil 1. Die Laura 2. Die sterbende Welt 3. Die Goten 4. Miriam 5. Ein Tag in Alexandria 6. Der neue Diogenes 7. Diejenigen, durch welche Ärgernis kommt 8. Der Ostwind 9. Der zu straff gespannte Bogen zerspringt 10. Die Unterredung 11. Wiederum die Laura 12. Die Laube der Üppigkeit 13. Der Boden des Abgrunds 14. Die Klippen der Sirenen 15. Nephelococcygyia Teil 2. 1. Venus und Pallas 2. Ein verirrter Strahl 3. Der geprüfte Statthalter 4. Juden gegen Christen 5. Sie beugt sich um zu siegen 6. Der reisige Kirchenfürst 7. Pandämonium 8. Nemesis 9. Verlorene Lämmer 10. Sie sucht nach einem Zeichen 11. Miriams Anschlag 12. Die Rückkehr des verlorenen Sohns 13. Frauenliebe 14. Nemesis 15. Jeder an seinem Platz
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 864
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hypathia: Neue Feinde mit altem Gesicht
von
Charles Kingsley
Übersetzer: Sophie von Gilsa
2020 © Verlag Heliakon, München
Umschlaggestaltung: Verlag Heliakon
Coverbild: (Hypatia von Alfred Seifert 1850-1901)
Überarbeitete und korrigierte Fassung
Alle Rechte vorbehalten
www.verlag-heliakon.de
Impressum
2020 © Verlag Heliakon, München
Umschlaggestaltung: Verlag Heliakon
Coverbild: (Hypatia von Alfred Seifert 1850-1901)
Druck und Herstellung: epubli – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Übersetzer: Sophie von und zu Gilsa
www.verlag-heliakon.de
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verfassers unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Über-setzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Inhaltsverzeichnis
Titelseit
Vorwort
Vorwort des Verfassers
Teil 1
1. Die Laura
2. Die sterbende Welt
3. Die Goten
4. Miriam
5. Ein Tag in Alexandria
6. Der neue Diogenes
7. Diejenigen, durch welche Ärgernis kommt
8. Der Ostwind
9. Der zu straff gespannte Bogen zerspringt
10. Die Unterredung
11. Wiederum die Laura
12. Die Laube der Üppigkeit
13. Der Boden des Abgrunds
14. Die Klippen der Sirenen
15. Nephelococcygyia
Teil 2
1. Venus und Pallas
2. Ein verirrter Strahl
3. Der geprüfte Statthalter
4. Juden gegen Christen
5. Sie beugt sich um zu siegen
6. Der reisige Kirchenfürst
7. Pandämonium
8. Nemesis
9. Verlorene Lämmer
10. Sie sucht nach einem Zeichen
11. Miriams Anschlag
12. Die Rückkehr des verlorenen Sohns
13. Frauenliebe
14. Nemesis
15. Jeder an seinem Platz
Vorwort
Als ein persönlicher Freund des berühmten Verfassers von „Hypatia“ und als treuer Verehrer des seltenen Kunstwerkes, konnte ich mich dem Wunsche der edlen Übersetzerin nicht entziehen, ich möchte die deutsche „Hypatia“ mit einigen einleitenden Worten bei dem vaterländischen Leserkreise einführen. Nicht als ob die Übersetzung meines Zeugnisses bedürfe, dass sie treu sei und sich leicht lese: es genügt über diesen Punkt zu sagen, dass „Hypatia“ zu den Werken gehöre, bei deren Übertragung schon die bloße Treue eine größere Kenntnis der englischen Sprachweise vorausfetzt, als unsere gewöhnlichen Übersetzungen aus dem Englischen verraten.
Noch weniger bedürfen das Buch selbst und sein berühmter Verfasser einer empfehlenden Einführung von meiner Hand in einen so gebildeten Kreis. Charles Kingsley, der geniale und gelehrte, fromme und volksmäßige Pfarrer von Eversley, der Verfasser von „Alton Locke“ und von „Westward Ho!“, ist fast jedem gebildeten deutschen Leser bekannt als einer der einflussreichsten und kräftigsten Volksschriftsteller der Zeit. Auch muss er ohne Widerstreit der tiefste und ursprünglichste unter den Vertretern jener ruhmwürdigen, von Charles Dickens gestifteten Schule heißen, welche man mit großem Unrecht eine sozialistische nennen würde, die aber mit einem europäischen Namen die soziale heißen mag, weil sie unsere Zustände der Gesellschaft, die Verhältnisse der Klassen zeichnet, und deren Mängel und Gebrechen künstlerisch und ohne Hass hervorhebt. So ist auch „Hypatia“ bei uns nicht unbeachtet geblieben in denjenigen Kreisen, welche das Tiefere und allein Bleibende im englischen Schrifttum verfolgen, und ungern sehen, wenn solch edle und seltene Gewächse von den Eintagskindern eines fabrikartigen Talents und den Günstlingen der Mode oder Partei überwuchert werden. Davon zeugt zum Beispiel eine Folge von Artikeln, welche vor mehreren Jahren in der augsburger „Allgemeinen Zeitung“ über dieses Werk erschienen. Nichtsdestoweniger ist es eine Tatsache, dass „Hypatia“ und der Erstling von Kingsleys Dichtungen, das klassische Drama von der Heiligen Elisabeth („The Saintʼs Tragedy“), nie übersetzt sind: allerdings ist „Hypatia“, aber erst im vorigen Jahre, in die verdienstliche Sammlung der Tauchnitzschen Abdrücke ausgenommen. Jenes Drama, welches 1848 erschien, erwarb sich auch in England erst allmählich die Beachtung und die Liebe, deren es jetzt sich dort erfreut. „Hypatia“ ward dagegen schon bei dem allmählichen Erscheinen in „Frasers Magazin“ begierig gelesen und nicht minder bewundert als vollendetes Werk im Jahr 1852. Einem Beobachter der englischen Zustände konnte es jedoch nicht zweifelhaft sein, dass es vorzugsweise auch dort die Beliebtheit jener sozialen Romane und die unverkennbare Rüstigkeit und Kampfbereitheit des Volksschriftstellers waren, welche jenen beiden Werken eines höheren Fluges allgemeine Anerkennung sicherten und die Feindschaft desjenigen Teiles der Lesewelt verstummen machten, den wir in Deutschland mit Goethe die Philister zu nennen pflegen.
Ich stehe jedoch nicht an, gerade in jenen beiden Werken die bei weitem bedeutendsten und vollendetsten Werke des genialen Mannes zu erkennen. In ihnen liegt ganz besonders die Rechtfertigung einer Erwartung, welche ich mir erlauben möchte hier auszusprechen: nämlich, dass er Shakespeares Historien fortsetze. Ich habe seit mehren Jahren kein Hehl daraus gemacht, dass Kingsley mir der Genius des Jahrhunderts zu sein scheine, berufen, jenem erhabenen dramatischen Epos der Neuzeit, von Johann ohne Land bis Heinrich VIII, eine ebenbürtige Reihe, von Eduard VI. bis zur Landung Wilhelms von Oranien, an die Seite zu stellen: die einzige geschichtliche Entwickelung Europas, die alle Lebenselemente in sich vereinigt, und deren Entwicklung man ohne überwältigenden Schmerz vor sich vorbeigeführt sehen und betrachten könnte. Das tragische Drama von der Heiligen Elisabeth zeigt, dass Kingsley nicht allein dem Roman, sondern auch der strengeren Form des Dramas gewachsen ist: „Hypatia“ aber beweist im größten Maßstab, dass er in den Erscheinungen einer weltgeschichtlichen Vergangenheit das Menschheitliche, Tiefere, Bleibende erkennt und zur Darstellung zu bringen versteht. Wie er bei dieser Fähigkeit zugleich den frischen Ton des Volkslebens zu treffen und humoristische Charaktere und Verwickelungen mit shakespearescher Energie nicht allein zu zeichnen, sondern auch mit dramatischer Wirkung auszubilden und auszumalen weiß, davon zeugen alle seine Werke. Und warum sollte er es nicht tun? Es gibt eine Zeit, wo der wahre Dichter, der Seher der Gegenwart, die nur ihrer Nähe wegen beachtenswerten, eigentlich aber unbedeutenden und unpoetischen Erscheinungen des Tages fahren lassen und sich sagen muss: Lasst die Toten ihre Toten begraben! Bei diesem Scheidewege aber scheint mir Kingley jetzt angelangt zu sein.
Wenn jene Erwartung schon durch Das gerechtfertigt erscheint, was von Kingsleys Werken der Welt vorliegt, so nicht minder durch die frische, ursprüngliche Persönlichkeit des jetzt etwa vierzigjährigen Mannes selbst. Es ist ein eigentümliches, erhebendes und seltenes Schauspiel, einen solchen Genius als geliebten Pfarrer und Prediger einer einfachen Landgemeinde zu sehen: des Sonntags seiner Gemeinde lebendig das Evangelium predigend und die menschlichen und göttlichen Tiefen des Evangeliums in jener volksmäßigen Beredsamkeit enthüllend, von welcher seine Dorfpredigten ein so schönes Muster geben, an den Wochentagen aber an allen Angelegenheiten seiner Pfarrkinder, häuslichen und bäuerlichen, belehrend und ermunternd Antheil nehmend. Diejenigen, welche nicht zu ihm in die Kirche kommen, sucht er die Woche über auf, sei es auch auf dem Acker, mit dessen Bestellung er sich vertraut gemacht hat um auch hier raten und helfen zu können in Haus und Hof, oder wo er sie findet, sollte es auch im Wirtshaus sein. Ich darf wohl nicht noch ausdrücklich bemerken, dass die Kirchgänger sich dadurch nicht vermindert haben, und dass der menschenfreundliche Pfarrer ebenso verehrt als beliebt ist und sich glücklich führt in einem Beruf, wo er so vier Segen schafft. So ist unsers Dichters bürgerliches Leben ein Musterbild jener beneidenswerten Stellung eines englischen Landpredigers, die jetzt noch viel bedeutender und nicht weniger liebenswürdig ist, als sie im Pfarrer von Wakefield erscheint. Aber wenn die englische Welt sich in London versammelt, benutzt der Dichter die ihm vergönnte dreimonatliche Urlaubsfrist, während welcher er sich vertreten lassen darf und eilt in die große Weltstadt. Da wird er nicht müde, Großes und Kleines zu beachten, lässt auch wohl seine Stimme als Prediger erschallen, wenn der Geist ihn treibt. Wie Demosthenes hatte Kingsley bis auf die letzten Jahre, im gewöhnlichen Gespräch, die Gefahr des Stotterns zu bekämpfen: der Anblick der Gemeinde, auch wohl einige Minuten gemütlicher, geistverwandter Unterredung, verbannten jedoch unfehlbar alle Blödigkeit und seine Rede ward alsbald ein fließender Ausdruck seiner inneren Beredsamkeit.
So geschah es ihm denn auch einmal, dass er, mitten im Gefühl des Druckes und der Not der untern arbeitenden Klassen von der Kanzel eines Amtsbruders eine donnernde Predigt hielt, worin er das praktische, aufopfernde Christentum des Evangeliums mit dem bequemen Maulchristentum vieler frommen Reichen verglich. Der Amtsbruder, welcher ihm die Kanzel geliehen, war aber kein Geistesbruder, und machte nach der Predigt sein Hausrecht geltend, sich auf der Stelle vor der Gemeinde aufs stärkste gegen das eben Gehörte zu erklären. Die Sache kam vor die Öffentlichkeit und die Entscheidung des Bischofs von London ward von beiden Seiten angerufen. Der sonst streng kirchliche Bischof Bloomfield, der übrigens ein wahrhaft christlicher Mann war ebenso wohl als ein höchst geistreicher und gelehrter, entschied für Kingsley: und dabei hatte es sein Bewenden.
Ohne es zu wollen, hat sich unser Dichter nach einigen Seiten hin am anschaulichsten in einem der geschichtlichen Charaktere seiner „Hypatia“ gezeichnet Bischof Synesius aus Cyrene ist dort geschildert, wie er nach seinen Gedichten und Briefen war: ein klassisch gebildeter Dichter und Denker, der in Alexandrien ein gläubiger Christ wird, und später, ohne die Frau zu verlassen, und ohne die Philosophie abzuschwören, aus dringendes Verlangen seiner Mitbürger ihr Bischof. Sein Herz schlug für alles Menschliche, und er findet es mit seinem geistlichen Amte nicht unverträglich, feine Freundschaft mit der berühmten Heldin Hypatia, seiner ehemaligen Lehrerin und Genossin in Plato, fortzusetzen, und ihr freundliche Briefe zu schreiben. Es ist ganz in seinem Charakter, dass Kingsley ihn als einen rüstigen Jäger auch keinen Anstand nehmen lässt, eine wilde Jagd über Berg und Tal (wie die englische Fuchsjagd) mit rechtem Behagen zu leiten, um sich und der Gemeinde Unterhalt zu verschaffen. Aber ein doppelter Unterschied zwischen dem Bischof der Landschaft von Cyrenica (der jetzigen Regentschaft von Tripolis) und dem Domherrn und Prediger der englischen Landeskirche tritt bald sehr bedeutend hervor, wenn wir die beiden Männer uns näher besehen.
Kingsley steht nicht allein da, wie Synesius, dem Frau und Kinder bald starben, er hat in seiner Frau eine gebildete und hilfreiche Christin zur Seite, welche er mit Recht seinen besten Hilfspfarrer (curate) nennen darf, und mit welcher vereint er der Gemeinde das Musterbild eines christlichen Hausstandes vor Augen stellt. Zweitens aber fühlt man auf jeder Seite, dass Kingsley der Bürger eines freien Volks ist, dessen Sorgen wie dessen Ruhm er teilt, und an dessen weltgeschichtlich christlichen Beruf im Reich Gottes er glaubt, während Synesius, eben wie sein gelehrter und tiefsinniger Freund, Angustinus, kein Vaterland mehr hat auf dieser Erde, und an kein Reich Gottes in der Wirklichkeit in dieser Welt mehr glauben kann.
Und da befinden wir uns auf dem Standpunkte, von welchem aus ich mir die Erlaubnis erbitte, einige Worte über „Hypatia“ zu sagen. Das Werk selbst ist so fern von allem Schein der Gelehrsamkeit, und die Forschung ist in ihm so ganz verklärt in die Freiheit der schaffenden dichterischen Darstellung, dass man das ganze Buch lesen und Menschen und Zeit verstehen kann, ohne eine Ahnung zu haben, dass Allem eine, durch Forschung gefundene historische Wahrheit einwohne.
Das gilt zuvörderst von allen historischen Charakteren des Buches: von Hypatia und Theon, ihrem Vater, dem berühmten Mathematiker und von des Synesius gewaltigem Amtsbruder, Cyrill, dem Patriarchen Alexandriens. Von Orestes wissen wir gerade genug, um Kingsleys Auffassung zu rechtfertigen, obgleich dessen Betheiligung an der Empörung Heraklians, des Grafen von Afrika nur eine dichterische Begründung hat. Aber das Ganze bewegt sich treu in dem Rahmen der Weltgeschichte während der ersten dreißig Jahre des fünften Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Damals auch lebten und wirkten Angustinus, Synesius und der tugendhafte Erzieher des unwürdigen Sohnes des Theodosius, Arsenius, welcher den Hof des Arcadius verließ und sich als Büßer in die Laura zurückzog; in welcher wir ihn in „Hypatia“ finden. Alle diese sind Lebensbilder aus jener Zeit, höchst anmutig und leicht gezeichnet, und jedem gebildeten Leser verständlich ohne Gelehrsamkeit. Aber auch die tiefen Gedanken und Erwägungen, welche bei den genannten Personen und namentlich bei Hypatia und ihrem Vater vorkommen, sind aus tiefer Kenntnis, wie der hellenischen Bildung und Weltanschauung überhaupt, so insbesondere auch der neuplatonischen Philosophie und ihres wirklich wissenschaftlichen Vorbildes, Platos, geflossen. Wie vertraut Kingsley mit diesem Gegenstand sei, zeigt sein aus Vorlesungen in Edinburg entstandenes Büchlein: „Alexandrien und seine Schulen“ (1854), und nicht minder das meisterhaft platonische Gespräch: „Phaeton“ (1852), wo der attischen Grazie und der sokratischen Ironie jener angelsächsische Humor beigemischt ist, welcher den englischen und amerikanischen Sprechern gar wohl ansteht. Was die Darstellung des Patriarchen Kyrill betrifft, so hat der Dichter mit wahrem Geschmack jene hassenswürdigen Eigenschaften des herrschsüchtigen Hierarchen allerdings eher verhüllt als hervorgehoben. Dieses ist ihm, wie er es selbst in seiner rechtfertigenden Einleitung ausspricht, aus einer künstlerischen Notwendigkeit hervorgegangen.
Da man doch (sagt er) das gegenüberstehende Grundübel der Zeit, die heillose Versunkenheit und Verlogenheit der untergehenden griechisch-römischen Welt nicht in ihrer Nacktheit- und unverhüllten Scheußlichkeit darstellen kann, so muss auch die gegenüberstehende dunkle Seite etwas gemildert werden. Wie wenig Kingsley übrigens, trotz des Lobes, welches er in jener Einleitung der kirchlichen Dogmatik zu Anfang des fünften Jahrhunderts wegen der Erhabenheit des Gegenstandes ihrer Spekulationen erteilt, von ihrer unevangelischen und überein kömmlichen Sophistik hält, und wie sehr er die byzantinische Hofkirche mit ihren frömmelnden Prinzessinnen und ehrgeizigen Eunuchen verabscheut, zeigt viel besser als jenes theologische Urteil der Einleitung das geniale Kunstwerk selbst. Da erkennt man deutlich, dass ihm das Bleibende und wahrhaft Christliche in der Kirche jener Zeit das Gegenteil der ketzermachenden Dogmatik ist. Der mit dem größten Fleiß ausgearbeitete männliche Charakter des Romans, Raphael, der grauenvollen Miriam geheimnisvoller Sohn, der heidnisch gebildete, epikureische und menschenfeindliche Jude, wird nicht durch jene kirchliche Lehre bekehrt, sondern dadurch, dass er den Triumph der dienenden Liebe, in ihrer Aufopferung und ihrem unerschütterlichen Gottvertrauen, in einer christlichen Familie erkennt. Da wird ihm der Mann von Tarsus und sein göttlicher Lehrer und Meister klar: die ewige Wahrheit des Evangeliums von Gott und Mensch tritt mit himmlischer Erleuchtung vor seinen Geist; der Krampf des starren Herzens ist gelöst; er lebt und duldet und stirbt mit dem untergehenden Christenhäuslein im unwirtlichen Afrika.
Der Grundgedanke des Dichters ist in diesem Werk wie in allen seinen Hervorbringungen dieser. Das Christentum steht in keinem Amt und in keinem Buchstaben der Lehre und in keiner spekulativen Formel: es ist eine Kraft der ewigen Liebe zum göttlichen Leben, eine Kraft, welche den selbstsüchtigen Sinn des Einzelnen bricht, und notwendig auch die Selbstsucht von Klassen, Völkern, Staaten und Dynastien. Allein diese Umwandlung der Massen geht nach den Gesetzen des geistigen Kosmos nur langsam vorwärts und meistens nur durch gewaltige und zerstörende Geschicke, welche brechen was nicht biegen will; aber der Gott in der Geschichte segnet auch im Sturmwind und im Donner. Das Christentum also ist unserm Kingsley göttliche Kraft und göttliches Leben und erprobt sich nur im Leben selbst.
Dieser Grundgedanke allein dürfte uns auch wohl das Rätselhafteste des Werkes erklären, den Titel: „Neue Feinde mit altem Gesicht.“
Der Titel wäre vielleicht weniger zugespitzt, wenn das Werk nicht zuerst in einer Zeitschrift zu erscheinen gehabt hätte; doch ist er weder aus dieser Zufälligkeit entstanden, noch auch bloß deswegen gewählt, weil der Verfasser seinen weiten Leserkreis nicht durch einen gelehrten und altertümlichen Schein abschrecken wollte. Es lag ihm vielmehr daran, sogleich nicht allein das Werk als eine schöpferische Dichtung hinzustellen, sondern auch, nach guter englischer Sitte, als ein praktisches Lebensbild, als einen Spiegel für die Gegenwart.
Aber vor welchen Feinden will der Dichter warnen? Ohne Zweifel vor solchen, welche das gegenwärtige englische Leben bedrohen. Aber etwa nur dieses? Keine Ansicht kann falscher und niedriger sein. Hätte er einen so beschränkten, insularisch-egoistischen Blick, so wäre er kein Prophet, weder der Vergangenheit, noch der Gegenwart, kein wahrer Dichter; auch „Hypatia“ wäre nie geworden, was sie ist: ein ungeheuerer Weltenkampf, der uns vorgeführt wird. Aber man blicke nur tiefer in das Gemälde, und man wird sehen, dass es seinen Zweck wesentlich in sich selbst hat, dass es viel tiefere Züge enthält, als eine Zweckschrift zu geben vermag. Allerdings findet dort der englische Pharisäer sich gezeichnet, heiße er Evangelischer oder Puseyit; aber ebenso wohl der Pietist und Pfaff des Festlandes und der Welt. Bei der Schilderung der Unfähigkeit der neuplatonischen Schule etwas zu schaffen, die Wirklichkeit zu ergreifen, den Strom der Weltgeschichte zu finden, und bei der inneren Leerheit ihrer Formel, fällt allerdings der erste Seitenblick auf das Formelwesen der deutschen Spekulation, welche Kingsley nicht unbekannt ist. Aber der Wink findet nach dem Sinne des Werkes auch in einem Formelwesen ganz entgegengesetzter Art seine Anwendung, von welchem England und Frankreich voll sind. Ja gewiss ist nicht bloß der Seher und Dichter, sondern auch der reflektierende Philosoph Kingsley, der Ansicht, dass unserer Spekulation doch eine ganz andere, höhere und edlere Kraft einwohnt als den Schülern oder Verehrern von Bentham und Comte.
Suchen wir nun einen allgemeinen Ausdruck für die Antwort auf jene Frage, so werden wir alle seine Werke zu Zeugen anrufen können, eben wie die erhabensten und schlagendsten Gemälde in unserem Romane und die ganze künstlerische Anlage dieser großen Dichtung, wenn wir den rätselhaften Titel etwa folgendermaßen auszulegen uns erlauben. Es sind immer dieselben Elemente, welche sich in allen Zeitaltern großer sozialen Krisen zeigen, und eine solche Zeit ist die unsrige. Es geht in ihnen zum Leben oder zum Tod; ohne Mängel, ohne Gebrechen, ohne Sünde ist keine der in ihr kämpfenden Parteien; aber das, was innere Wahrheit hat und Kraft der Aufopferung offenbart, was der Sehnsucht der Ernsten und Guten und dem Bedürfnisse der Menschheit und ihrer ewigen Bestimmung entspricht, das gewinnt die Welt: ja wenn es scheinbar untergeht, erobert es die Zukunft im Tode durch die inneren Lebenskeime, die in ihm verborgen und geborgen sind.
In dieser Grundanschauung Kingsleys, in diesem Glauben an die Unzerstörbarkeit des Guten liegt auch der Unterschied zwischen seiner „Hypatia“ und dem „Anastasius“ von Thomas Hope. Sie sind die beiden einzigen geschichtlichen Lebensbilder des europäischen Schrifttums, welche die Nachwelt lesen wird; nicht bloß Geschichtsbilder, wie Vitets dramatisierte Geschichten, welche übrigens in ihrer Art als unübertreffliche Muster dastehen. Beide genannte große Schöpfungen sind Werke englischer Schriftsteller dieses Jahrhunderts. Von allen englischen Romanen — und Europa hat mit Recht ihnen ziemlich einstimmig den ersten Rang in diesem Jahrhundert zuerkannt — in „Anastasius“ das einzige Werk, welches sich mit Kingsleys Schöpfung an Tiefe des Genius wie an Umfang und Mächtigkeit des Talents vergleichen lässt. Wie sehr man auch Walter Scotts unsterbliches Verdienst anerkennen muss, dass er die moderne epische Dichtung an die geschichtliche Wirklichkeit angeknüpft, so haben seine Romane wie sein Talent ihre leicht erkenntliche Grenze. Hope war der Erste, welchem es gelang, ein weltgeschichtliches Lebensbild zu entweich. Sein Gegenstand ist die Menschheit im türkischen Reiche während des letzten Vierteljahrhunderts. Von Stambul und Smyrna und nach den Inseln des Ägäischen Meeres bis nach Ägypten und Arabien zaubert er uns Schöpfungen hervor, geschart um bedeutende geschichtliche Charaktere und Ereignisse, ehe die Wirkungen der französischen Umwälzung auch jene Länder mehr oder weniger in einen neuen Strom hineinzogen. Eine große und bewunderungswürdig gelöste Aufgabe. Aber welch eine schwerere Aufgabe erwählte sich Kingsley! Anderthalbtausendjähriger Schutt musste weggeräumt, es musste eine Teilnahme geschaffen werden für Zeiten und Zustände, welche den meisten seiner Leser höchstens durch nackte Namen bekannt waren. Beide Werke haben ihre eigentümlichen glänzenden Seiten und stehen ebenbürtig nebeneinander. In beiden geht eine Welt unter; aber dort ohne Lösung, weil ohne ein neu belebendes Element, ja ohne die Ahnung einer Auferstehung der Abgestorbenen oder Absterbenden: hier dagegen mit allem Gefühle lebens-schwangerer Zukunft, mit dem Bewusstsein des unzerstörbaren Ewigen in der Menschheit und mit dem Glauben an ein solches Element in unserer Zeit.
Denn gewiss, es wäre ein ungerechter Vorwurf, und, wir erlauben uns hinzuzufetzen, es würde einen Mangel an Verständnis der Weltgeschichte verraten, wenn jemand „Hypatia“ aus der Hand legen wollte mit dem Vorwurf, die Dichtung verlaufe sich in nichts, alles gehe unter; wozu die ganze Anspannung? Wozu der große Anlauf, wenn alles in Zerstörung aufgehe, in Tod und Grab endige?
Ist es nicht auch so mit der germanischen Ilias, mit der großartigen Dichtung der Nibelungen? Da liegen sie, niedergestreckt im Tod wie um des gemordeten Siegfried Grabhügel, die germanischen Helden und ihre tapferen Mitkämpfer, besiegt durch Verrat, erschlagen von tapferen Stammgenossen, die der Fremdherrschaft dienstbar geworden sind! Wer kann das großartige Todesbild, von Cornelius Meisterhand entworfen, trockenen Auges ansehen — auch wenn er nicht ein Deutscher ist! Auch wenn er nicht weiß, dass seit Hermanns Tod, in welchem Siegfrieds Ermordung geschichtlich wird, nichts Neues von Bedeutung in der politischen Geschichte der Nation vorgefallen ist! Und doch ist unser Schmerz ein gemilderter: wir geben uns ihm hin, weil das Bild so großer Taten und Geschicke uns über den Tod hinweg hebt. Noch weniger ist unser Schmerz ohne Trost bei dem Seitenstück des germanischen Epos, welches in der Weltgeschichte des Geistes spielt, in „Hypatia.“
Hypatia war dem Tode geweiht; ihr ganzes Dasein hatte seinen inneren Halt verloren, sie war zerfallen mit ihrer inneren Gedankenwelt wie mit der Weltgeschichte, ohne jedoch irre geworden zu sein an dem Ewigen, dessen abgelebte und untergegangene Sinnbilder sie als edle Priesterin verehrt, deren vereinsamtes Heiligtum sie als treue Wächterin gepflegt hatte. Eine glücklichere Lösung war dem christlichen Helden und seiner, auch in ihrer Versunkenheit stets von attischer Anmut strahlenden Schwester geworden: auch Raphael war ihrer teilhaftig geworden, und ein Strahl ewiger Liebe war im Todeskrampf auf die umnachtete Seele seiner unglücklichen Mutter gefallen. In der christlichen Gemeinschaft und in der Schule des Leidens fanden Raphael und die ihm so teuer gewordenen Christen Afrikas die untrügliche Gewähr der Wahrheit, welche sie bekannten, und während um sie herum Rom, Athen, Karthago, Byzanz fielen oder wankten, stand ihnen das Gottesreich auch auf dieser Erde fest. Wie dort über dem Grabe der Helden und ihres Stammes und ihrer Zeit der Genius der Weltgeschichte schwebt, so hier auch noch der ewige Friedensbote. Beide sprechen zu uns und rufen uns zu: Ihr, die ihr nicht unwürdig seid, solche große Geschicke vor euch vorübergeführt zu sehen, ihr sollt erkennen, was der gesunde Sinn eueres Stammes, ja, weniger klar, die ganze Menschheit ahnt und glaubt, dass wahres Leben nicht untergeht, sondern nur herrlicher sich aus dem Tod empor ringt.
Die heidnischen Hunnen dort, die grausamen Vandalen hier, scheinen die Sieger, aber nur, um sich selbst zu vernichten. Hier und dort sind es Bildung und die Religion des Geistes, welchen der Sieg beschieden ist; der germanische Geist aber, der Hellene des Nordens, erscheint als der kräftige Träger und Verwirklicher der christlichen Idee über den Erdkreis Kingsley lässt die Germanen zuerst in einem ungünstigen Licht erscheinen, nämlich, wie sie, noch trunken von der Plünderung Roms und des ganzen Westens, erfasst wurden vom Zauber des südlichen Himmels und überwältigt von dem Gefühl der Erbärmlichkeit der Alten Welt sich den Launen ungezügelten Übermuts hingaben. Das Wesen des Barbaren, auch des edelsten, ist Maßlosigkeit, und der germanisch-skandinavische Geistesbruder hat noch bis jetzt nicht die menschliche Religion des Hellenen, das Maß, sich angeeignet. So treten die Goten, frisch von der Plünderung Athens kommend, in der Weltstadt Alexandrien auf. Aber sobald die Not und ernste Geschicke sie zur Besinnung bringen, erschrecken sie in ihrer ganzen Größe: und Kingsleys Schilderung ist ebenso wahr als poetisch.
So hatten sich denn alle vier Elemente der sogenannten Alten Welt zusammengefunden im Wunderlande des Altertums, unter dem Volk, welches auf sie alle mit dem Stolz uralter Gesittung und dem Groll eines viel tausendjährigen Druckes herabsah. Da stand, heimisch geworden, das Hellenentum, als Bildung und Philosophie; das Römertum, als Nachfolget des Mazedonientums, als Herrscherkraft und Recht. Da auch hatte das Judentum seinen Platz eingenommen, der älteste Gast des Pharaonenlandes. Von allen gehasst und alle hassend, mit seiner Abgewandtheit von allem, was den Geist Japhets bewegt, aber auch gerade wegen des Druckes und Hasses der Welt die ihm eigenen Vorzüge und berechnende Verstandesüberlegenheit fühlend, hielt es fest zusammen und beutete die Not der Zustände zu seinem Vorteile nicht ohne Schadenfreude aus. Da endlich hatte auch das Christentum die dem Hellenischen gemäßigte Form gewonnen. Die hierarchische Gestaltung hatte auch hier das Gemeindeleben geschwächt und einseitig umgebildet. Das Volkselement hatte sich als Einsiedler- und Mönchtum gestaltet. Gegründet von einigen großen und tiefen Geistern, die sich von dem Leben der Hellenen und Römer zurückzogen und das weltliche Treiben der alexandrinischen Christen flohen, waren sie die heilige Miliz des Hierarchismus geworden. Die Mönche, von welchen die Libysche Wüste wie die Thebais wimmelte, flehten unablässig den Untergang der Welt herab, aus welcher sie sich geflüchtet hatten, oder von welcher sie weggedrängt und ausgestoßen waren. Sie scharten sich zusammen, wenn die gemeinsame Sache es forderte. Bei Hypatias Ermordung waren sie die Henkersknechte und diese Tat war das symbolische Todesopfer des heidnischen Geistes. Sie fällt ins Jahr 415, spätestens 417. Wenige Jahre später verschwinden die letzten Helden unserer Dichtung.
Welches Element ist nach vierzehn Jahrhunderten noch lebenskräftig wirksam und menschheitsbildend?
Die Klöster der Libyschen Wüste und die Einsiedeleien der Thebais sind untergegangen, ebenso unfähig den Sturz der alten Kirche aufzuhalten als den Sturz der Alten Welt der Griechen und Römer. Es werden nie ihre Nachfolger sein, welche das wankende Gebäude des sogenannten christlichen Europa zusammenhalten. Ebenso sind die maßlosen Goten untergegangen, nachdem sie den ersten volksmäßigen Übersetzer der Bibel und König, Theoderich den Großen, hervorgebracht. Aber die Kraft des Evangeliums hat das Christentum von der Allmacht der Herrscher und der Dumpfheit des Klosterlebens befreit, der germanische Geist hat die Barbarei und dann die Hohlheit von Lug und Trug besiegt. Durch das Christentum geläutert, durch die Bildung und Weisheit der Alten Welt gestärkt und durch große Geschicke zum Bewusstsein des Geistes, als des ordnenden und erhaltenden, gereift, steht er noch da, von keinem Verrat gebeugt, mit Jugendkraft und dem glaubenden Gemüt, womit er die Alte Welt überwunden und das Angesicht der Erde erneuert hat.
Das ist die Lehre der Nibelungen und der Dichtung Kingsleys.
Wen es reizt, mehr von den Persönlichkeiten und wirklichen Zuständen jener Zeit zu wissen, und im historischen Zusammenhange zu übersehen, der wird wenig in unserm gelehrten Schrifttum finden, den alten ehrlichen Schrökh ausgenommen; anmutiger kann er es bei den Franzosen lesen, besonders in Tillemonts Denkwürdigkeiten: am vollständigsten jedoch bei Gibbon: so über Hypatia, Kyrill, Orestes in Kapitel XLVII über Arcadius und Arsenius in Kapitel XXIX, über die Empörung des Grafen von Afrika und die Verwüstung Mauritaniens durch die Vandalen bis zur Belagerung von Hippo (Bona) und den Tod von Augustinus (430) Kapitel XXXI – XXXIII.
Gibbon hatte in Oxford, wie sein vorübergehender jugendlicher Übertritt zur römischen Kirche und sein späteres Auftreten zeigt, vollkommenen Schiffbruch am geschichtlichen Glauben gelitten. Jener tiefe Groll der Verzweiflung gegen die Theologie seiner Zeit, welcher in der französischen Schule als Hass des Christentums zum Ausbruch kam, hatte zu einer Verdunkelung seines religiösen Bewusstseins geführt.
Aber seine geschichtliche Darstellung der entsetzlichen Zeit, welche den Gegenstand seines unsterblichen Werkes bildet, ist viel freier davon geblieben, als die Romantiker und ihre Gönner wissen oder zugestehen wollen. Seine historische Genauigkeit hat, trotz einzelner ihm nachgewiesener Irrtümer, die Sichtung der Kritik triumphierend bestanden.
Aber niemand bedarf dieser Belehrungen, um sich der großen Dichtung zu erfreuen, zu deren frischem Genuss wir den gebildeten deutschen Leserkreis einluden möchten. Nur das wollen wir hier noch zum Schluss erwähnen, dass von jenen beiden unsterblichen freien Schöpfungen des Dichters, Philammon und Pelagia, in welchen die hellenischen Ideale von Apollo und Venus, wenngleich in demütigender Verkleidung, Mensch geworden sind, der Name und der allgemeine Rahmen der Geschichte des unglücklichen Mädchens rein historisch sind. Die Legende von der heiligen Pelagia ist alt und in ihrem Kern geschichtlich, und gehört ungefähr in das Jahrhundert der Hypatia.
Charlottenberg, S. Januar 1858.
Bunsen
Vorwort des Verfassers
Ein Lebensgemälde des fünften Jahrhunderts muss notwendig vieles enthalten, was jedem Leser peinlich ist, und wovon Jugend und Unschuld wohl tun das Auge gänzlich abzuwenden. Es stellt ein grauenhaftes, aber dennoch großartiges Zeitalter, eine jener kritischen, jener Hauptepochen im Leben des Menschengeschlechts dar, wo Tugend und Laster dicht beieinander — ja oft in einem und demselben Individuum vereinigt — in überraschender Offenheit und Stärke sich zeigen. Wer ein solches Zeitalter beschreibt, hat einen lästigen Missstand zu bekämpfen. Er wagt nicht zu sagen, wie schlecht die Menschen waren, und er wird keinen Glauben finden, wenn er erzählt, wie viel Gutes sie besaßen. Im gegenwärtigen Fall ist jener Missstand ein doppelt großer; denn während die Sünden der Kirche, obgleich entsetzlich, sich doch in Worten ausdrücken lassen, ist es unmöglich, die Sünden der heidnischen Welt, die sie bekämpfte, zu beschreiben; der christliche Verteidiger ist daher, des Anstands wegen, genötigt, den Zustand der Kirche weit schwächer vorzustellen, als die Tatsachen es verdienen.
Niemals möge man dessen immer eingedenk sein, ruhte der leiseste Verdacht von Immoralität weder auf der Heldin dieses Buchs noch auf den leidenden Philosophen ihrer Lehre. So niedrig und ausschweifend auch ihre Schüler oder die Manichäer gewesen sein mögen, waren doch die großen Neuplatoniker, wie Manes selbst, Personen von strenger Frömmigkeit und Tugend.
Denn es war eine Zeit gekommen, in welcher kein Lehrer Zuhörer erwarten durfte, wenn er nicht die höchsten Ansprüche auf Tugend zeigte. Jenes göttliche Wort, welches ist „das Licht, das jeden erleuchtet, der in die Welt kommt“, hatte in den Herzen der Menschen eine Sehnsucht erweckt, die in einiger Stärke bisher nur von wenigen vereinzelten Philosophen und Propheten empfunden worden war. Der Geist war über das Fleisch ausgegossen worden, und von einem Ende des Reichs bis zum anderen, vom Sklaven in der Mühle bis zum Kaiser auf seinem Thron, waren alle Herzen hungrig und durstig nach Gerechtigkeit, oder lernten jene ehren, welche sie übten. Und Er, der diese Sehnsucht erregte, gab auch, was sie zu stillen geeignet war; er lehrte die Menschen durch lange schmerzliche Erziehung die Wahrheit von ihren Trugbildern unterscheiden, und, zum ersten Mal seit Anbeginn der Welt, in einer neuen Lehre das Heil aller, nicht allein einiger wenigen Auserlesenen, sondern aller Menschen, ohne Unterschied des Ranges und Geschlechts erblicken.
Während etwas mehr als vierhundert Jahren hatten das römische Kaiserreich und die christliche Kirche, welche fast zu gleicher Zeit ins Leben traten, sich dicht nebeneinander als zwei große, rivalisierende Mächte entwickelt, die im tödlichen Kampf um den Besitz des Menschengeschlechts einander gegenüberstanden.
Die Waffen des Reichs bestanden nicht allein in überwältigend physischer Kraft, in rastlosem Streben nach ungerechter Eroberung: es war zumeist mächtig durch unvergleichliches Organisationstalent und ein gleichförmiges System äußeren Gesetzes, äußerer Ordnung. Dies System war überall eine wirkliche Wohltat für unterjochte Nationen, indem es an die Stelle des in wildem Kriege teils zufällig, teils willkürlich auferlegten Elends eine bestimmte, regelmäßige Beraubung setzte; doch zog es auf die Seite des Reichs die wohlhabenden Bürger jeder Provinz, indem es ihnen einen Antheil an der Plünderung der unter ihnen stehenden arbeitenden Klassen verstattete; diese waren in den Dorfdistrikten gänzlich unterjocht, während ihre sogenannte Freiheit von geringem Nutzen für die Menge in den Städten war, welche durch die Spenden der Regierung vor dem Hungertod bewahrt und in tierischem Behagen durch Schauspiele erhalten wurde, für die man die Reiche der Natur und Kunst geplündert hatte, um ihre Schätze von der Bewunderung, der Lust und Wildheit eines erniedrigten Pöbels verschlingen zu lassen.
Gegen dieses weitgreifende System hatte die Kirche nun seit vierhundert Jahren gekämpft, gekämpft mit den alleinigen Waffen ihrer hohen, allumfassenden Sendung und mit Bewährung eines Geistes der Reinigkeit und Tugend, der Liebe und Aufopferung, welcher sich mächtiger erwiesen hatte, die Herzen der Menschen zu erweichen und miteinander zu verbinden, als alle Gewalt, aller Schrecken, all die mechanische Organisation und die Versuchung zur Sinnlichkeit, womit das Kaiserreich gegen jene heilige Schrift gestritten hatte, in welcher es instinktartig von Anbeginn und auf den ersten Blick seinen tödlichsten Feind erkannte.
Doch nun hatte die Kirche gesiegt, die Schwachen dieser Welt hatten die Starken vernichtet. Trotz der teuflischen Grausamkeit der Verfolger, trotz der ansteckenden Atmosphäre des Lasters, welche sie umgab; trotzdem, dass sie sich nicht aus einem abgesonderten Geschlecht reiner Geschöpfe, sondern aus den buchstäblich Neugeborenen jener tief gefallenen Massen, welche sie beschimpften und verfolgten, bilden musste; trotzdem, dass sie innerhalb ihrer selbst die Ausbrüche wilder Leidenschaften erfahren musste, welchen ihre nunmehrigen Glieder und Angehörigen nicht ungestraft gefrönt hatten; trotz einer Menge Sekten, die um sie her, ja in ihrem eigenen Schoß entstanden, Teile von ihr zu sein beanspruchten, und die Menschen mittels eben jener Parteianmaßung, jenem Geist der Ausschließung anlockten, wodurch jene Ansprüche in sich selbst zerfielen; trotz dem allen hatte sie gesiegt. Selbst die Kaiser hatten sich zu ihr bekannt; Julians letzter Versuch, das Heidentum durch kaiserlichen Einfluss wieder einzuführen, liefert nur den Beweis, dass der alte Glaube jeden Halt in den Herzen der Menschen verloren hatte, und bei seinem Tode rollte die große Flutwoge der neuen Meinung ungehemmt einher. Die Herrscher der Erde waren genötigt, mit dem Strom zu schwimmen, die Gesetze der Kirche, wenigstens in Worten, als ihre eigenen anzunehmen, einen König der Könige zu bekennen, welchem selbst sie Ehrfurcht und Gehorsam schuldeten, und ihre eigenen Sklaven ihre ärmeren Brüder, ja selbst ihre geistlichen Obern zu nennen.
Doch wenn auch die Kaiser christlich geworden waren, das Reich war es nicht. Hier und dort wurde ein Missbrauch abgeschafft, oder ein Befehl erlassen, die Gefängnisse zu untersuchen und die Lage der Gefangenen zu erleichtern, oder ein Theodosius wurde durch die strengen Ermahnungen eines Ambrosius zu Menschlichkeit und Gerechtigkeit zurückgeführt. Doch das Reich war dasselbe geblieben; fortwährende Tyrannei machte die Massen zu Sklaven und unterdrückte alles nationale Leben; die Tyrannen mästeten sich selbst und ihre Beamten durch ein weltumfassendes Plünderungssystem, und solange dasselbe von Oben herab geboten und befolgt wurde, blieb den Menschen keine Hoffnung; ja es befanden sich Solche unter den Christen, die, wie später Dante, in der verhängnisvollen Gabe Konstantins und dem Waffenstillstand zwischen Kirche und Reich nur neue, noch tödlichere Gefahren erblickten. Versuchte doch das Reich über die Kirche selbst den Upasschatten, wodurch es jede andere Form menschlichen Daseins vernichtete, auszubreiten, und auch sie zu ihrem Sklaven und besoldeten Diener zu machen, damit es sie füttere, wenn gehorsam, und sie zertrete, wenn jemals sie wagen sollte, einen eigenen Willen zu haben und ein anderes Gesetz, als das ihrer Tyrannen anzuerkennen; versuchte man doch, mit der feinsten Heuchelei zu Werke gehend, der Kirche die Last und Sorge für die Massen aufzubürden, von deren Herzblut man sich nährte! So dachten damals Viele, und, wie mir scheint, nicht ohne Weisheit.
War indes der gesellschaftliche Zustand der sogenannten gesitteten Welt zu Anfang des fünften Jahrhunderts ein so regelloser, so war es ihr geistiger Zustand noch weit mehr. Die allgemeine Vermischung der Stämme, Sprachen und Sitten, welche während vierhundert Jahren unter der römischen Regierung stattfand, hatte eine damit in Verbindung stehende Verschmelzung verschiedener Religionsformen, eine allgemeine Gärung menschlichen Denkens und Glaubens zur Folge. Aller aufrichtige Glaube an die alten Götter war längst erstorben, und zwar noch vor dem handgreiflichen und materiellen Kaiser-Götzendienst; die Götter der Nationen, unfähig, diejenigen zu befreien, welche ihnen vertraut hatten, wurden nach und nach zu Vasallen des Divus Caesar, wurden von den philosophischen Reichen vernachlässigt und nur von den niederen Klassen noch verehrt, wo der alte Ritus deren grobe Sinnlichkeit reizte, oder der Reichtum und die Bedeutung einzelner Orte dadurch gewannen.
Inzwischen hatten die Gemüter der Menschen aufs Geratewohl ihren alten Anker über Bord geworfen; sie trieben wild umher auf pfadlosen Meeren spekulativen Zweifels und versuchten namentlich in dem mehr metaphysischen und kontemplativen Osten die Fragen von der Verbindung des Menschen mit dem Unsichtbaren für sich zu lösen durch jene tausend Schismen, Ketzereien und Theosophien — es hieße dem Wort Philosophie eine Schmach antun, dieselben so zu nennen —, deren Verzeichnis der Gelehrte heutigen Tags voller Staunen und ebenso unfähig ihre Fantasien zu zählen als zu erklären, betrachtet.
Aber selbst diese, wie jede Äußerung freien, menschlichen Denkens hatten ihren Nutzen und trugen Früchte. Sie brachten vor das geistige Auge der Priester tausend neue Fragen, welche gelöst werden mussten, wenn die Kirche nicht für immer ihren Anspruch auf das Amt eines Lehrers und Trösters der menschlichen Seele verlieren wollte. Zu studieren, wie diese Wasserblasen sich bildeten und jeder Woge menschlichen Lebens entsprangen; nur zu oft, gleich dem Augustinus, die Reize ihrer Lockungen zu empfinden; die Wahrheit, welche sie enthielten, von der Lüge zu trennen, welche sie an deren Stelle darboten, die allgemeine Kirche vorzustellen, als in den großen Tatsachen, welche sie verkündete, selbst den zartesten metaphysischen Wünschen eines kranken Zeitalters volle Befriedigung bietend — das war die Aufgabe jener Zeit; und Menschen wurden ausgesandt, sie zu erfüllen, und dieselben Ursachen, welche die geistige Revolution hervorgerufen hatten, förderten ihre Arbeit. Die allgemeine Vermischung der Ideen, Glaubensformen und Stämme, selbst schon die physische Leichtigkeit des Verkehrs zwischen verschiedenen Teilen des Reichs, trug dazu bei, den großen Kirchenvätern des vierten und fünften Jahrhunderts eine so bedeutende Gabe der Beobachtung, eine Tiefe der Gedanken, eine so großherzige und weit schauende Geduld und Toleranz zu verleihen, wie, kühn dürfen wir es aussprechen, die Kirche seitdem nur selten und die Welt niemals wieder erblickt hat.
Wenigstens, wenn wir berufen sind, jene großen Männer nach dem, was sie besaßen, und nicht nach dem zu beurteilen, was sie nicht besaßen, so müssen wir glauben, dass, lebten sie jetzt, sie ebenso hoch über diese Generation emporragen würden, als dies der Fall bei ihren Zeitgenossen war. Und ein solches Zeitalter, welches dem seichten Urteil eines Spötters wie Gibbon nur als ein faules, zweckloses Chaos von Sinnlichkeit und Anarchie, Fanatismus und Heuchelei erschien, brachte einen Athanasius, einen Hieronymus, einen Chrysostomus und Augustinus hervor, zog in die Sphäre der Christenheit alles, was die Philosophien von Griechenland, Ägypten, sowie die soziale Organisation von Rom an wertvollem Material besaßen und legte in fremden Ländern durch unbewusste Mittel den Grund alles europäischen Denkens, aller europäischen Sitten.
Doch die Wohlfahrt einer Kirche hängt nicht allein von dem Glauben ab, den sie den Ihrigen nennt, selbst nicht von der Weisheit und Heiligkeit einiger weniger großen Geistlichen, wohl aber von der Treue und Tugend ihrer individuellen Glieder. Diemens sana muss ein corpus sanum zur Wohnung haben. Selbst für die westliche Kirche würde die hohe Zukunft, der sie entgegen ging, eine Unmöglichkeit geworden sein, wäre nicht etwas frischeres und gesünderes Blut in die Adern einer Welt eingeströmt, die durch römischen Einfluss befleckt und ausgesogen war.
Und das frische Blut war in dem Zeitalter unserer Erzählung zur Hand. Die große Flut jener gotischen Völker, von denen die Norweger und Deutschen den reinsten Typus zeigen, obgleich jede Nation Europas von Gibraltar bis Petersburg ihnen die kostbarsten Elemente ihrer Kraft verdankt, strömte Woge über Woge vorwärts nach Südwesten durch das ganze römische Reich, und hielt erst ein und zog sich zurück, als sie das Mittelländische Meer erreicht hatte. Diese wilden Stämme führten dem Zauberkreis des Einflusses der westlichen Kirche all das Material zu, dessen sie bedurfte, um eine künftige christliche Welt zu gründen, und das sie ebenso wenig in dem westlichen wie in dem östlichen Reiche zu finden vermochte; größere Reinheit der Sitten war diesen Stämmen eigen; sie zeigten eine heilige Ehrfurcht für das weibliche Geschlecht, für Familienleben, Gesetz, gerechte Justiz und individuelle Freiheit, und besaßen vor allem die höchste Redlichkeit in Wort und Tat, starke, nicht durch angeerbte Weichlichkeit geschwächte Körper, ernste, obgleich aufgeweckte Gemüter, und waren mit einer seltenen Bereitwilligkeit, selbst von denen, welche sie verachteten, zu lernen, gesegnet; ihr Verstand war in praktischer Beziehung dem der Römer gleich, und blieb, was Einbildungskraft und spekulativer Scharfsinn betrifft, nicht weit hinter dem der östlichen Völker zurück.
Ihre Kraft wurde augenblicklich fühlbar; ihr Vortrab, während drei Jahrhunderten nur mühsam jenseits der östlichen Alpen zurückgehalten, war, wo immer möglich, in den Dienst des Kaisers aufgenommen und das innerste Herz der römischen Legionen bestand aus gotischen Anführern und Gemeinen. Nun aber war die Hauptmasse eingetroffen. Stamm auf Stamm kamen sie die Alpen herab, einander auf den Fersen folgend an den Grenzen des Reichs. Die Hunnen, im Einzelnen ihnen untergeordnet, drängten von hinten sie vorwärts durch die unwiderstehliche Gewalt großer Massen; Italien mit seinen reichen Städten, seinen fruchtbaren Tälern winkte ihnen zur Plünderung; als Hilfstruppen hatten sie ihre eigene Kraft und die Schwäche der Römer kennengelernt, und ein casus belli war bald gefunden … Wie ungerecht war das Betragen der Söhne des Theodosius, als sie die gewöhnliche Gabe versagten, durch welche die Goten bestochen worden, das Reich nicht anzugreifen! Gleich einer Sündflut stürzten die wilden Scharen sich in die Ebenen Italiens und das westliche Reich glich von dem Tage an einem sterbenden Blödsinnigen, während die neuen Eindringlinge Europa unter sich teilten. Die fünfzehn Jahre vor dem Beginn dieser Erzählung hatten das Schicksal Griechenlands entschieden; die letzten vier Jahre das von Rom selbst. Die zahllosen Schätze, welche fünf Jahrhunderte des Raubes um das Kapital gehäuft hatten, waren wilden Männern, in Schaffelle und Pferdehäute gekleidet, zur Beute geworden, und die Schwester eines Kaisers hatte ihre Schönheit und Tugend, den Stolz des Geschlechts würdig ausgeglichen gefunden durch jene des rauhändigen nordischen Helden, der sie aus Italien als seine Gefangene und Braut hinwegführte, um neue Königreiche im südlichen Frankreich und Spanien zu finden und die kürzlich eingetroffenen Vandalen durch die Meerenge von Gibraltar in das damals blühende Küstenland von Nordafrika zu treiben. Überall siebten die verstümmelten Glieder der Alten Welt im Medeakessel, um ganz, jung und stark daraus hervorzugehen. Die Langobarden, die edelsten ihres Stammes, hatten, nach langen Wanderungen südwärts von den schwedischen Bergen, einen vorübergehenden Ruhepunkt auf Österreichs Grenze gefunden, um bald von den heranziehenden Hunnen verdrängt zu werden, worauf sie, die Alpen überschreitend, für immer ihren Namen den Ebenen der Lombardei gaben. Einige wenige Jahre später sahen die Franken sich im Besitz des untern Rheinlandes und ehe noch die Haare von Hypatias Schülern grau geworden, sollten die mythischen Helden Hengist und Horsa an den Küsten von Kent landen und eine englische Nation ihr weltweites Leben beginnen.
Aber irgendeine weise Absicht der Vorsehung versagte unserm sonst überall siegreichen Stamme, jenseits des Mittelländischen Meeres Fuß zu fassen, oder selbst nur in Konstantinopel, welches bis zum heutigen Tag in Europa den Glauben und die Sitten Asiens bewahrt. Die östliche Welt schien durch ein dunkles Verhängnis dem einzigen Einfluss verschlossen zu sein, der imstande gewesen wäre, ihre Wiedergeburt zu bewirken. Jeder Versuch der gotischen Rassen jenseits des Meeres, sei es nun in der Gestalt eines organisierten Königreichs, wie das der Vandalen in Afrika oder nur als eine Räuberbande, wie die Goten in Kleinasien unter Gainas oder als Prätorianergarde, wie die Wäringer des Mittelalters, oder als religiöse Eindringlinge, wie die Kreuzfahrer sich niederzulassen, endete in der Verderbnis und im Verschwinden der Kolonisten. Jene außergewöhnliche Umgestaltung der Sitten, welche, nach Salvian und seinen Zeitgenossen, die vandalischen Eroberer in Nordafrika bewirkten, war von keinem Nutzen für sie; sie verloren mehr als sie gaben. Klima, schlechtes Beispiel und der Luxus der Macht erniedrigte sie binnen einem Jahrhundert zu einem Geschlecht hilfloser und ausschweifender Sklavenhalter, verurteilt zu gänzlicher Vernichtung durch die halbgotischen Armeen Belisars; mit ihnen verschwand die letzte Möglichkeit, dass die gotischen Stämme denselben ernsten aber gesunden Einfluss auf die östliche Welt ausüben würden, welcher der westlichen das Leben wiedergegeben hatte.
Die ägyptische und syrische Kirche waren daher bestimmt, nicht für sich selbst, sondern für uns zu arbeiten. Die Zeichen von Krankheit und Verfall waren bereits nur zu sichtbar in ihnen. Die eigentümliche Richtung des griechisch-orientalischen Geistes, woraus die größten Denker der damaligen Welt hervorgingen, hatte die Wirkung, sie vom tätigen Handeln zur Spekulation hinüberzuziehen, auch waren die Bevölkerungen von Ägypten und Syrien verweichlicht, überbildet, erschöpft durch Jahrhunderte, in welchen kein frisches Blut dem alten Stamme zufloss. Kränklich, selbstbewusst, körperlich träge, ebenso unfähig damals wie jetzt zu persönlicher oder politischer Freiheit, boten sie einen Stoff, aus dem leicht Fanatiker gemacht werden konnten, nicht aber Bürger des Reiches Gottes. Die wahren Ideen der Familie und des nationalen Lebens, diese beiden göttlichen Wurzeln der Kirche, von denen losgerissen sie sicher sein kann dahin zu schwinden in jenes gottloseste und grausamste aller Gespenster: eine religiöse Welt — waren im Osten erstorben durch den bösen Einfluss der allgemeinen Sitte, Sklaven zu halten, sowie durch die Verderbnis jener jüdischen Nation, welche seit Jahrhunderten die große Zeugin — dieser Ideen war, und alle Klassen, gleich ihrem Vorvater Adam, in der Tat dem alten Adam in jeglichem Menschen, jeglichem Zeitalter ähnlich, schoben den Vorwurf der Sünde von ihrem eigenen Gewissen hinweg auf menschliche Verhältnisse und Verpflichtungen — und hierdurch auf Gott; wie vor alters mit der Entschuldigung: „Das Weib, welches du mir gegeben hast, bei mir zu sein, gab mir von dem Baume, und ich aß.“ Der leidenschaftliche Charakter des Ostens fand, gleich allen Schwachen, gänzliche Enthaltung leichter als Mäßigkeit, religiöse Gedanken weit angenehmer als gute Handlungen; und eine Welt von Klöstern erhob sich und verbreitete sich über den ganzen Osten in solcher Ausdehnung, dass, wie man sagte, sie in Ägypten mit der Anzahl der übrigen Bevölkerung wetteiferte, und bei bedeutender Abnahme gegenwärtiger moralischer Übel, eine sehr ins Auge fallende Entnervung und eine große Abnahme in der Zahl der Bevölkerung erzeugte.
Ein solches Volk vermochte der immer wachsenden Tyrannei des östlichen Reichs keinen Widerstand zu leisten. Umsonst setzten Männer wie Chrysostomus und Basilius ihren persönlichen Einfluss den fürchterlichen Ränken und Schändlichkeiten des byzantinischen Hofs entgegen, die immer abwärts führende Laufbahn der östlichen Christenheit zog sich noch während zweier elenden Jahrhunderte ungestört fort, und zwar dicht neben der zur Höhe strebenden Entwickelung der westlichen Kirche; und während die Nachfolger des großen Heiligen Gregorius die Heiden bekehrten und das neugeborene Europa zivilisierten, verschwanden die Kirchen des Ostens vor den mohammedanischen Eindringlingen, welche stark waren durch ihren Glauben an den lebendigen Gott, den die Christen, während sie einander hassten und verfolgten wegen der Streitfragen über ihn, verleugneten und lästerten in jeder Handlung ihres Lebens.
Aber während der Periode, von welcher diese Geschichte handelt, war der griechisch-orientalische Geist noch mitten in seiner großen Arbeit. Jene wunderbare metaphysische Schärfe, welche in Phrasen und Definitionen, für unser gröberes Verständnis nur zu oft sinnlos, die Symbole der aller wichtigsten geistigen Dinge erblickte, und fühlte, dass in der Unterscheidung zwischen homousios und homoiusios die Lösung des ganzen Rätsels der Menschheit enthalten sein könne, kam in Alexandrien, jenem alten Sitz griechischer Philosophie, zum Kampf mit den hinfälligen Überresten des wahrhaft wissenschaftlichen Denkens, dem sie ihre außerordentliche Bildung verdankte. Durch klösterliche Einsamkeit und Trennung von Familie und nationalen Pflichten eigneten sich die Väter jener Zeit ganz besonders zu dieser Aufgabe, indem sie ihnen wenn nichts anderes, wenigstens Muße verlieh, großen Fragen mit einem, den mehr geselligen und praktischen Gemütern des Nordens unmöglichen, lebenslangen Ernst ins Angesicht zu schauen. Unsere Pflicht ist es, statt sie als pedantische Träumer zu verspotten, dem Himmel zu danken, dass sich Menschen fanden, gerade zu einer Zeit, wo man ihrer bedurfte, welche für uns taten, was wir niemals für uns selbst zu tun vermocht hätten; die uns als köstliches, im wahren Sinne mit dem Lebensblut ihres Geschlechts erkauftes Erbe, eine Metaphysik hinterließen, welche in gleicher Weise christlich und wissenschaftlich jeden bisherigen Versuch, sie zu verbessern, scheitern ließ; Pflicht ist es, zu danken, dass diese Menschen siegreich kämpften mit jener seltsamen Brut theoretischer Ungeheuer, erzeugt von abgelebter griechischer Philosophie mit ägyptischer Symbolik, chaldäischer Astrologie, persischem Dualismus, brahmanischem Spiritualismus — reizende und blendende Phantome, von denen etwas mehr gesagt werden soll in den nachfolgenden Kapiteln.
Ich bin in meiner Darstellung Hypatias und ihres Schicksals treu der authentischen Geschichte gefolgt, namentlich der Erzählung der Schlussszene, wie sie Sokrates im siebenten Buch, §. 15, seiner Kirchengeschichte gibt. Übrigens bin ich geneigt, und zwar aus verschiedenen historischen Gründen, ihren Tod zwei Jahre früher, als er es tut, zu setzen. Die Tradition, dass sie die Gattin Isidors, des Philosophen, war, verwerfe ich mit Gibbon als einen handgreiflichen Anachronismus von wenigstens fünfzig Jahren (Isidors Lehrer, Proklus, wurde erst ein Jahr vor Hypatias Tod geboren), dem noch überdies durch Photius widersprochen wird, welcher ausdrücklich sagt, nachdem er Hypatia und Isidor miteinander verglichen, dass Isidor eine gewisse Domna zur Gattin nahm. Auch findet sich keine Andeutung, dass sie verheiratet war, in irgendeinem zeitgenössischen Schriftsteller, und der Name Isidor erscheint nirgends unter den vielen beiderseitigen Freunden, denen Synesius Botschaften sendet in seinen Briefen an Hypatia, worin, wenn irgendwo, eines Gatten erwähnt worden wäre, falls ein solcher existiert hätte. Auf die ganz reizenden Briefe des Synesius sowohl, als auf die Briefe Isidors, des guten Abts von Pelusium, erlaube ich mir diejenigen Leser zu verweisen, welche nähere Kunde aus dem Privatleben des fünften Jahrhunderts wünschen.
Ich darf nicht hoffen, dass diese Blätter durchaus frei von Anachronismen und Irrtum sich erweisen. Ich kann nur sagen, dass ich fleißig und redlich gestrebt habe, die Wahrheit selbst in den kleinsten Details zu ermitteln, und das Jahrhundert, seine Sitten und seine Literatur zu schildern, wie ich sie fand — durch und durch gekünstelt, wüst und entnervt, weit mehr erinnernd an die Zeiten Ludwigs des Fünfzehnten, als an die des Sophokles und Plato. So sende ich denn diese kleine Skizze in die Welt hinaus und werde jedem herzlich dankbar sein, der, meine Irrtümer aufdeckend, mich und das Publikum gründlicher belehrt über den letzten Kampf zwischen der jungen Kirche und der alten Welt.
Teil 1
1. Die Laura
In dem vierhundert und dreizehnten Jahre der christlichen Ära saß, etwa dreihundert Meilen von Alexandria, der junge Mönch Philammon am Hang einer Reihe niedriger, von Triebsand umgebener Felsen. Hinter ihm lag die Wüste, leblos, unendlich, ihren trüben Schimmer am blauen, wolkenlosen Horizont abspiegelnd. Zu seinen Füßen rollte und rieselte der Sand gleich gelben Bächen von Tiefe zu Tiefe, von Schicht zu Schicht, oder er umwirbelte ihn, wenn der laue Sommerwind sich erhob, in gelben, Rauch ähnlichen Wolken. Hier und da befanden sich an der Vorderseite der Felsen, die in ein entgegenliegendes enges Tal ausliefen, eine Art von Höhlengräbern, ungeheure Quadrate mit Obelisken und nur halb behauenen Säulen, dastehend, wie die Handwerker Jahrhunderte zuvor sie verlassen; der Sand hatte sich rings umher angehäuft, während ihre Spitzen von Schnee starrten. Stille und Öde herrschte überall, es schien das Grab eines toten Volks in sterbendem Land. Hier saß er, über dies alles nachsinnend, voller Leben, Jugend, Gesundheit und Schöne — ein junger Apoll in der Wüste. Seine einzige Kleidung war ein altes, mittels eines Ledergürtels befestigtes Schaffell. Seine langen schwarzen, nie von einer Schere berührten Locken wehten und glänzten in der Sonne; ein reicher dunkler Flaum an Kinn und Wange zeigte den Frühling gesunder Mannheit; seine harten Hände und nervigen, von der Sonne gebräunten Glieder sprachen von Arbeit und Leiden, seine blitzenden Augen und die hervorragende Stirn von Kühnheit, Fantasie, Leidenschaft und Geist, die keine Sphäre der Tätigkeit an solchem Ort fanden. Was hatte seine herrliche, jugendliche Menschlichkeit allein unter Gräbern zu schaffen?
So dachte vielleicht auch er, da er mit der Hand über die Stirn fuhr, als wolle er einen aufsteigenden Traum verjagen, und seufzend erhob er sich, die Felsen entlang wandernd, indem er an jeder Ecke, an jedem Spalt hinabsah, um Brennholz für das Kloster zu erspähen, woher er kam.
So einfach auch das Material war, das er suchte — denn es bestand hauptsächlich aus den niedrigen, dür.ren Sträuchern der Wüste und dann und wann aus einem Fragment von Holz aus irgendwelcher Ruine —, wurde es doch immer seltener im Umkreis von Abt Pambos Laura zu Scetis und lange, ehe Philammon den täglichen Bedarf beisammenhatte, war er weiter entfernt von seiner Heimat, als dies je der Fall gewesen.
Plötzlich befand er sich bei einer Wendung des Tals einem ihm neuen Anblick gegenüber … es war ein in den Sandfelsen gehauener Tempel, davor eine Plattform mit Bauholz und vermoderndem Werkzeug bestreut, und hier und da ein im Sand bleichender Totenschädel, vielleicht irgendeinem Handwerker angehörend, der in einem der tausend Kriege der Vorzeit bei seiner Arbeit hingeschlachtet worden. Der Abt, sein geistlicher Vater — der einzige Vater in der Tat, welchen er kannte, denn die Laura und des alten Mannes Zelle waren seine frühesten Erinnerungen — hatte ihm streng verboten, jemals einem dieser Überbleibsel alten Götzendiensts zu nahen, geschweige es zu betreten; aber ein breiter Weg führte nieder zu der Plattform, und die große Menge Brennholz war zu verführerisch, um daran vorüberzugehen. Er wollte hinabsteigen, einige Scheite auflesen und dann zurückkehren, um dem Abt von dem Schatz, den er gefunden, zu erzählen und ihn zu fragen, ob er ihn wieder aufsuchen dürfe.
So ging er denn hinab, kaum wagend, das Auge zu den bunt gemalten Bildwerken zu erheben, welche rot und blau noch immer durch die traurige Einöde leuchteten, ohne in diesem regenlosen Himmelsstrich irgendwie beschädigt zu werden. Aber er war jung; Jugend ist neugierig, und der Teufel, wenigstens im fünften Jahrhundert, geschäftig in jungen Köpfen. Philammon nun glaubte fest an den Teufel, und betete Tag und Nacht inbrünstig, von ihm befreit zu werden; so bekreuzte er sich denn, und rief ehrlich genug aus: »Herr, wende meine Augen ab, dass sie nicht Eitelkeit sehen!« Nicht desto weniger aber blickte er hin … Wer aber würde haben widerstehen können, diese vier kolossalen Könige anzusehen, die so grimmig und bewegungslos dasaßen, die ungeheueren Hände auf die Knie gelegt in unaufhörlich selbstbewusster Ruhe, und die den Berg auf ihren mächtigen Häuptern zu tragen schienen? Ein Gefühl von Angst, Schwäche und Furcht überkam ihn. Er wagte nicht, sich zu bücken, um das Holz zu seinen Füßen aufzuheben, der Blick der großen strengen Augen der Könige lag bannend auf ihm.
Um ihre Knie und ihren Thron waren mystische Schriftzeichen eingegraben, Symbol auf Symbol, Zeile auf Zeile — die alte Weisheit der Ägypter, worin Moses, der Mann Gottes, so bewundert war — warum sollte nicht auch er sie kennenlernen? Sie barg möglicherweise fürchterliche Geheimnisse der großen Welt, der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen, wovon er nur ein so kleines Fleckchen kannte. Diese Könige, welche hier saßen, wussten um alles; ihre scharfen Lippen schienen zu ihm zu sprechen, bereit, sich zu teilen … O, dass sie es einmal täten … und doch dies grimmige, höhnische Lächeln, das ihn von der Höhe ihrer Weisheit und Macht mit kalter Verachtung zu strafen schien, ihn, den armen Jüngling, der die Überbleibsel und Trümmer ihrer einstigen Herrlichkeit sammelte. Er durfte sie nicht mehr ansehen.
So blickte er denn an ihnen vorüber in die Tempelhallen; in einen kühlen Abgrund grünen Schattens, der Säule um Säule sich immer tiefer, bis zur schwärzesten Nacht, verdunkelte. Nur schwach vermochte er in der Dämmerung an jedem Pfeiler, an jeder Wand prächtige Arabesken, lange Zeilen gemalter Geschichte zu erkennen; Siege und Mühen, Reihen von Gefangenen in fremdartigen fantastischen Gewändern, seltsame Tiere hinter sich führend, beladen mit dem Tribut unbekannter Länder, Reihen von Frauen beim Fest, die Häupter gekrönt mit Kränzen, in jeder Hand die duftende Lotosblume, während Sklaven Wein und Wohlgerüche brachten, und Kinder auf ihren Knien saßen und Gatten an ihrer Seite und tanzende Mädchen in durchsichtigem Gewand mit goldenen Gürteln ihre braunen Glieder wild durcheinander schwangen … Was sollte das alles bedeuten? Warum war das alles so gewesen? Warum war sie in dieser Weise fortgeschritten, die große Welt, Jahrhundert auf Jahrhundert, Jahrtausend auf Jahrtausend, essend und trinkend, freiend und gefreit, und nichts Besseres kennend? Ihre Voreltern hatten das Licht verloren Jahrhunderte, bevor sie geboren waren … Und Christus wurde erst Jahrhunderte nach ihrem Tod der Welt geschenkt.
Wie konnten sie Besseres wissen? Und doch sind sie alle in der Hölle. Jeder von ihnen! Jede der Frauen, welche hier saßen mit ihren buschigen Locken und Blumenkränzen, ihren Juwelen, Lotosblumen und Florgewändern, ihre schlanken Glieder zur Schau tragend, und die vielleicht, als sie lebte, so lieblich lächelte, so fröhlich daher schritt und Kinder hatte und Freunde, und niemals daran dachte, was einst ihr Loos sein müsse … sie befand sich in der Hölle, für ewig, ewig, ewig brennend zu seinen Füßen. Er starrte nieder auf den Felsenboden, ob nicht sein Auge ihn zu durchdringen vermöchte, und das Auge des Glaubens drang hindurch … er sah sie in der lodernden Flamme sich winden, geröstet, glühend, in immerwährender Todesqual und der Gedanke, dieselbe auch nur einen Augenblick lang erdulden zu müssen, machte ihn schaudern. Er hatte sich einst die Hand verbrannt als ein Palmblatt Feuer gefangen. Er bedachte, was dem ähnlich war. Sie ertrug zehntausend Mal mehr als das, für immer! Er hörte ihr gellendes Geschrei um einen Tropfen Wassers, ihre Zunge zu kühlen …
Er hatte nur einmal im Leben einen menschlichen Schrei gehört, den Schrei eines Knaben, der, im Nil badend, von einem Krokodil in die Tiefe gezogen wurde, und dieser Schrei, schwach und entfernt, wie die mächtige Flut ihn vernehmen ließ, hatte tagelang in unerträglicher Weise in seinem Ohr wiedergetönt. All die Schreie nun sich zu vergegenwärtigen, welche jene feurigen Wölbungen für immer durchhallten! War der Gedanke zu ertragen? War er möglich? Millionen und abermals Millionen für ewig brennend um Adams Fall? … Wäre das göttliche Gerechtigkeit?
Es war die Versuchung eines Dämons! Er hatte den unheiligen Raum betreten, wo noch immer Teufel ihre frühere Wohnung umkreisten; er hatte seinen Augen nicht gewehrt, die Abscheulichkeiten der Heiden zu verschlingen, und hatte dem Teufel Raum gegeben. Er wollte heimfliehen zu seinem Vater, ihm alles zu beichten. Er würde ihn strafen, wie er es verdient, für ihn beten und ihm verzeihen. Und doch — konnte er ihm alles sagen? Konnte, durfte er ihm die ganze Wahrheit beichten — die unersättliche Sehnsucht, die Geheimnisse des Wissens kennenzulernen, die schreiende Menschenwelt zu sehen, welche langsam in ihm erstanden war, Monat nach Monat, bis zu diesem Augenblick, wo sie eine so erschreckende Gestalt gewonnen? Er konnte nicht länger in der Wüste bleiben.
War diese Welt, welche alle die Seelen zur Hölle geschickt, so schlecht, wie Mönche sie darstellen? Gewiss; wie könnte sie sonst solche Frucht getragen haben? Doch es war ein zu fürchterlicher Gedanke, als dass er ihn auf Treu und Glauben festhalten sollte. Nein, er musste gehen und sehen.
Erfüllt von diesen grässlichen Fragen, halb gestammelt und undeutlich wie der Gedanke eines Kindes, wanderte der unerfahrene Jüngling weiter, bis er den Vorsprung des Felsens erreichte, zu dessen Füßen seine Heimat lag.
Sie hatte eine liebliche Lage, diese einsame Laura, diese Gasse von rohen Felsenzellen, unter dem immerwährenden Schatten der südlichen Felsenwand und ihres Wäldchens alter Dattelbäume. Eine in dem Felsen sich verzweigende Höhle diente den Zwecken einer Kapelle, einer Vorratskammer und eines Hospitals; am sonnigen Abhang des Tals lagen die allgemeinen Gärten der Brüderschaft, grün von Hirsen, türkischem Weizen und Bohnen und mitten hindurch schlängelte sich ein Bächlein, mit äußerster Sorge gepflegt und geleitet, wogegen es den kleinen Raum, den freiwillige und brüderliche Arbeit mühsam den Einfällen des alles verschlingenden Sandes entrissen hatte, mit immerwährendem Grün bestreute; denn dieser Garten war, wie alles in der Laura, außer jedes Bruders sieben Fuß langer Felsenzelle, gemeinsames Eigentum und deshalb die Sorge und Freude aller.
Für das Gemeinwohl wie für das eigene hatte jeder mittels seines Korbs von Palmblättern das Tal mit schwarzem Schlamm aus dem Nilfluss bedeckt, über dessen weites Silberkleid die Mündung des Tals hinabgähnte. Für das Gemeinwohl hatte jeder die Klippen rein von Sand gefegt, und in den künstlichen Boden die Ernte gesät, an der alle gleichen Anteil hatten. Kleider, Bücher, Kirchengerät und alle sonstige gemeinschaftliche Bedürfnisse einkaufen zu können, saß jeder Tag für Tag, den Geist mit hohen, himmlischen Gedanken erfüllt, während die Hände mit dem Flechten von Palmblättern zu Körben sich beschäftigten, die ein alter Mönch in wohlhabendern, mehr besuchten, jenseits des Nils liegenden Klöstern gegen die Bedürfnisse des eigenen Klosters eintauschte. Woche für Woche ruderte Philammon den alten Mann in einem leichten Papyruskahn hinüber, und während er seiner Rückkehr harrte, fing er Fische für das gemeinsame Mahl. Das Leben in der Laura war ein einfaches, glückliches und gemütliches, ganz den Lehren und Regeln angemessen, die kaum weniger heiliggehalten und beobachtet wurden als die der Heiligen Schrift, auf welche man sie nicht mit Unrecht basiert glaubte. Jeder hatte Nahrung, Kleidung, Schutz auf Erden; Freunde, Ratgeber, lebendigen Glauben an die fortwährende Fürsorge Gottes und Tag und Nacht die glänzende Hoffnung ewiger Herrlichkeit vor Augen, welcher alle Träume der Poeten nicht gleichkommen … Und was bedurfte der Mensch mehr in jenen Tagen? Hierher waren sie geflohen aus den Städten, mit denen verglichen Paris ernst und Gomorra keusch genannt werden können, aus einer faulen, höllischen, sterbenden Welt von Tyrannen und Sklaven, Heuchlern und schlechten Dirnen, — um ungestört über Pflicht und Gericht, Tod und Ewigkeit, Himmel und Hölle nachzudenken; um einen gemeinsamen Glauben, gemeinschaftliche Pflichten, Freuden und Trübnisse zu finden …
Wohl ist es wahr, dass Viele ihren Posten verlassen hatten, den Gott ihnen angewiesen, als sie vor den Menschen in die Wüste geflohen waren. Welcher Art der Posten und welcher Art das Jahrhundert, von denen diese alten Mönche flohen, werden wir vielleicht sehen, ehe noch diese Geschichte zu Ende ist.
»Du kommst spät, mein Sohn«, sagte der Abt, ohne von seiner Arbeit aufzusehen, als Philammon ihm nahte.
»Das Brennholz ist selten, und ich war genötigt, weit zu wandern.«
»Ein Mönch sollte niemals antworten, ehe er gefragt wird. Ich erkundigte mich nicht nach der Ursache. Aber wo fandest du dies Holz?«
»Vor dem Tempel, weit entfernt vom Tal.«
»Dem Tempel? Was sahst du dort?«
Keine Antwort erfolgte, und Pambo blickte auf mit seinen durchdringenden, schwarzen Augen.
»Du bist eingetreten, und trugst Verlangen nach seinen Abscheulichkeiten.«