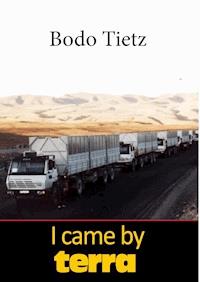
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bodo Tietz, Jahrgang 1938, erzählt vom Berlin seiner Kindheit, der Nachkriegszeit mit ihren Entbehrungen, aber auch der kraftvollen Stimmung des Aufbruchs. Mit einem Marktstand hielten seine Mutter Charlotte und der junge Bodo die Familie finanziell über Wasser. Sein Geschäftssinn entflammte wie auch seine Liebe zur Oper und Leichtathletik. Kaufmann wollte Bodo werden. Wurde ein echter Schenker- Mann, sammelte Speditionserfahrungen in zehn Firmen und gründete mit terra schließlich sein eigenes Unternehmen. Die Menschen nimmt und mag Bodo Tietz dabei, wie sie sind. Schließlich gibt es keine anderen. Eines aber konnte der Unternehmer nie akzeptieren: Es geht nicht! Bei diesem Satz schüttelt Bodo Tietz noch heute gerne den Kopf. Kreativ muss man sein und hartnäckig. Durchhalten muss man können. Dann löst man jeden Fall. Auch davon erzählt dieses besondere Buch. Mit einer Zeitleiste der Jahre 1938 bis 2016.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt es nicht.“
(Konrad Adenauer)
„Fehler aus der Vergangenheit sind nicht korrigierbar,
Schuldgefühle helfen dir nicht. Vergiss sie!
Gestalte mit Erfahrungen daraus deine Zukunft.
(Bodo Tietz)
Mein Dank gilt meiner Frau Hilke, die mich seit 46 Jahren liebevoll in unserer Familie und während meiner Arbeit in der Firma terra unterstützt hat, sowie meinen beiden Söhnen Andreas und Michael. Sie führen seit vielen Jahren das Unternehmen selbstständig und sehr erfolgreich.
(Bodo Tietz)
Mein Dank gilt Herrn Lars Röper, der mit mir aus meinen privaten und geschäftlichen Unterlagen, Beiträgen, Berichten und Ideen dieses Buch geschaffen und es streckenweise in Prosa verwandelt hat.
www.biografie-meines-lebens.de
© 2017 - Bodo Tietz
Inhaltsverzeichnis
Prolog
So ging es los mit
terra
1978
- Teil 1 -
Meine (Vor-) Kriegsjahre (1938-1945)
Meine Eltern
Deutschland während meines Geburtsjahres
Die Krankheit meines Vaters
Düstere Tage in Freyenstein
Die großen Berliner Kaufhäuser
Ein Teddy begleitet mich ein Leben lang
Meine Großeltern
Unsere Fahrten nach Sauen während des Krieges
Die Nachkriegszeit
Der Marktstand – Überleben durch Handel
Zwei Währungen / „Zonengrenzen“, 1948
Mit der S-Bahn in den Osten
Erste kaufmännische Aktivitäten
Einschulung in die zweite Klasse
Die „Oberhemden“ des Herrn Stange
Die erste Liebe zur Musik
Unser Klavier
Privatunterricht bei Prof. Einfeldt
Berliner Kulturleben nach 1945 und meine Liebe zur Oper
Die Berliner Opernhäuser nach 1945
„Berliner-Blockade“, 1948
„Berliner-Luftbrücke“, 1948
Meine sportliche Jugend
Im „Tus Lichterfelde“, 1951
„Sieg über 100 Meter“ - die Jahre als Leichtathlet
Tennisspiele
Spätere Bespannmaschine für meine Kinder
Auf Skiern
„Papa telefoniert wieder!“
Meine Schulzeit (1946-1955)
Die neue Anstellung meiner Mutter (1951)
Entscheidung für eine Lehre
Meine Lehrzeit bei „Schenker“ (1955 bis 1957)
„Von der Sackkarre bis zum Smoking“
Ein Tag als Kellner
Dr. Grundke aus der Interzonen-Verkehrsabt.
Mein Lexikon für die „Schenker-Welt“
Eklat in der Berufsschule
Unser Wirtschaftswunder
Die „Deutsche Wirtschaft“ nach 1945
„Wohlstand für alle!“
„Die Wirtschaft brummt!“
Meine 20 Jahre als Angestellter in zehn Firmen (1957-1978) und meine dreijährige erste Selbstständigkeit
Buchhalter bei „Schenker“ (1959)
Bei „von Mylke-Versicherungen“ (1959-1960)
„Diktieren kann ich natürlich!“
Bei der „Deutschen Shell AG“, (1960-1965)
Das Großtanklager in Berlin-Spandau
Die „Berliner Mauer“
Die große Sturmflut in Hamburg
Das Shell-Haus
„Jobklassen“
Bei den „Tierfeinkostwerken Verden“ (1965-1968) & „Mr. Mars“
Tiernahrung für alle!
„Chappi“ für Algerien
Meine Arbeit als Traffic-Manager
Vogelfutter oder Drogen?
Erste Gedanken an eine Selbstständigkeit
Die 68er-Bewegung
Bei der „Spedition Koch“ (1968)
Versandleiter bei „Ferrero“ (1968)
Bei „Bursped“ in Hamburg (1968-1969)
Bei „Willy-Bruhn und Söhne“ (1969-1972)
Meine Familie
Hilke, Andreas und Michael
Eine zweite Selbstständigkeit?
Unser Glücksbringer
- Teil 2 -
„I came by
terra“
Ein Slogan lässt mich nicht mehr los!
Orientalische Geschichten – die frühen Jahre von
terra
Dreimal Hilke
Kennzeichen-Wirrwarr
„Herr Tietz“
Aufwachsen mit
terra
Zwischen Arbeit und Freizeit
Unser Klavierlehrer
„17 Uhr, keine Fahrer, kein Kapital“
„Fass Dich kurz!“
„Meine Eltern sind Diebe!“
„21 Jahre Hund“
terra
macht es möglich
„Happy birthday, 1981“ In sechs Tagen nach Bagdad
Die Bedeutung des Fernschreibers
Das „Rote Telefon“
Der Zollstock
Der Zoll in Bagdad
Bastelstunde
Ein Tunnel in Rumänien
Die Baustelle
Ohne Diesel
Marketing à la
terra
Ein Fass voll Bier
Weihnachtsbäume nach Teheran
Die Messe in Bagdad
Mein Messe-Stand an der Garderobe
Niepolomice und der „Mayor“
Die Islamische Revolution
Deutsche Firmen im Iran
25 Tiefkühlfahrzeuge vor der Grenze zum Iran
Der Schah verlässt das Land, 1979
Chomeini in Teheran, 1979
Der Erste Golfkrieg
Nichts geht mehr! 83 Fahrzeuge vor der irakischen Grenze
Die Aufträge brechen weg!
Vom Orient in die Tropen
Der erste Kran
„Roll on, roll off!“-Schiffe
Überbreite, Überlänge, Überhöhe
Üble Geschäftspraktiken -Ausbilden und prüfen
International ist alles!
Sibirische Züge
terra
in der Türkei
terra
weltweit
Auf der Hoggar-Route durch die Wüste
„Die Jungs müssen gut sein!“ - Meine Fahrerliste
Neunzig PKW unterwegs nach Prag
2.700 Panzer
Meine Söhne bei
terra
„Bush is a criminal!“
Andreas erster Arbeitstag bei
terra
Michaels´ erster Arbeitstag bei
terra
Bonjour, Renault!
„25-Jahre
terra“
Mein Ausstieg bei
terra
(2003)
Zwei Brüder & ein Unternehmen, die
terra Handels- und Speditions GmbH
Die weiteren Firmen
„Tietz Immobilien GbR“ (2003)
„terra
Real Estate GmbH“ (2014)
„terra
Holding GmbH“ (2010)
39 Jahre
terra
– 78 Jahre Bodo Tietz Familie und Firma, wie klappt das?
„Amazing Grace“ und „True Love“
Unsere fünf Enkelkinder
Die Verwechslung im „Moulin Rouge“
Eine ganz besondere Reise
Anhang
Unsere „terra-Kran-Ausstellung“
Bilderstrauß einer Arbeitswoche bei
terra
Rechtliche Organisation der
terra
Holding GmbH
Vortrag von Hilke Tietz zu
terra
Das prämierte Logbuch eines
terra
-Überführungsfahrers mit Bildern
Anmerkungen und Quellen
WELTGESCHICHTE 1938-2016/78 Jahre
Fast achtzig Jahre werden in diesem Buch behandelt. Was ist nicht alles in dieser Zeit geschehen und hat unser Leben beeinflusst?
Diese ZEITLEISTE erinnert daran. Ich habe all die Jahre miterlebt.
Prolog
So ging es los mit terra 1978
In der Schule mochte ich das Fach „Latein“ nun wirklich nicht. Das lateinische Wort für Erde allerdings gefiel meiner Frau Hilke und mir sogleich. „terra“, das klang international, weltgewandt und irgendwie auch solide in seiner kompakten Schreibweise. Ob unsere Firma auf soliden Beinen stehen würde, natürlich wussten wir es nicht. Aber so sollte sie heißen: „terra Handels- und Speditions GmbH.“
Am 28. Februar des Jahres 1978 ließen wir terra in das Handelsregister eintragen. Noch am selben Tag entnahm ich der Schublade ein schwarzes Schulheft und betrachtete den Umschlag. Das Kästchen zur Bezeichnung des schmalen Büchleins war ebenso leer wie dessen sämtliche Seiten. Freudig nervös setzte ich den Kugelschreiber an und schrieb in kleinen Buchstaben die Worte „lfde. Geschäftsvorgänge terra Handels- und Speditions GmbH.“ vorne auf das schwarze Heft.
Kurz hielt ich inne, platzierte dann ein weiteres Wort darunter:
„ - Positionsbuch - “.
Unsere Aufträge, wenn sie denn kämen, wollte ich in dem schwarzen Heft festhalten. Vorerst legte ich es allerdings auf den Schreibtisch im terra-Büro, das wir in unserem Einfamilienhaus am Heidekamp in Buchholz eingerichtet hatten. Hilke würde das Büchlein beim Betreten des Büros sicher gleich auffallen.
Einen kurzen Blick auf den Kalender werfend, verließ ich das Büro. „1978“ thronte in großen Zahlen das Jahr über all den Tagen. Eine düstere Zeit in Deutschland. „Konspirative Wohnung“ war eben zum „Wort des Jahres“ gewählt worden; terroristischen oder geheimdienstlichen Aktivitäten dienende Privatwohnungen wurden so bezeichnet. Die Anschläge der RAF sowie die Entführung und Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer im Deutschen Herbst des Jahres 1977 hatten zu der Wahl des Wortes geführt.
Bis zuletzt gab der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt sich eine Mitschuld am Tode Schleyers. Theoretisch habe er diesen, wie von der RAF gefordert, gegen gefangene Terroristen austauschen können.
Für den deutschen Fußball war das Jahr 1978 ebenfalls mehr als unerfreulich. Lediglich ein Sieg in sechs Spielen und als Krönung ein 2:3 gegen Österreich ließen die Weltmeisterschaft in Argentinien mit der „Schmach von Cordoba“ enden.
Von diesen Geschehnissen konnten Hilke und ich im Februar 1978 allerdings ebenso wenig wissen, wie wir die Zukunft von terra vorhersagen konnten. Einige kleinere Aufträge gingen ein, erste Eintragungen in unserem schmalen „Positionsbuch“. Doch mein Angestelltendasein hatte ich noch nicht aufgegeben. Dafür erschien es Hilke und mir zu früh. Meine erste Firmengründung vor einigen Jahren war schließlich schiefgelaufen. Außerdem hüpften unsere beiden wundervollen Jungs, Andreas und Michael, bereits in unserem Leben herum. Ein weiteres Kind war unterwegs. Auf eine gewisse finanzielle Sicherheit konnten wir nicht verzichten.
Gleich nach unserem morgendlichen Familienfrühstück schnappte ich mir die beiden Jungs, brachte Michael in den Kindergarten, Andreas in die Schule und fuhr zur Arbeit nach Hamburg. Hilke erledigte all die endlosen Dinge im Haushalt, die bei einer Familie so anfallen, und begab sich dann ins Büro. Schließlich hatte die „terra Handels- und Speditions GmbH.“ jetzt geöffnet.
Ziemlich still war es dort. Stumm stand das Telefon vor ihr auf dem Schreibtisch. Lediglich der nagelneue, im Keller installierte Fernschreiber summte leise vor sich hin. Das Summen störte Hilke nicht, dennoch machte ihr das Gerät Bauchschmerzen. Unsere gesamten Ersparnisse waren in den Fernschreiber geflossen. Von dem Geld hätten wir beinahe eine Weltreise machen können. Und warum nicht einfach weiter als Angestellter arbeiten? Alles lief doch gut.
Erneut schaute Hilke auf das schweigende Telefon, erhob sich und warf erst einen skeptischen Blick auf den Fernschreiber, dann auf die Uhr. Keine halbe Stunde war vergangen, seitdem terra die Türen für Aufträge aus aller Welt geöffnet hatte. Bliebe es weiterhin so still, würde der Tag quälend lang werden und der Fernschreiber zunehmend bissige Blicke ernten. Auch wenn er natürlich nichts dafür konnte, dass wir beide uns in das große Abenteuer des Unternehmertums stürzten.
Eben spielte Hilke mit dem Gedanken, eine weitere Waschmaschine voll schmutziger Kinderkleidung anzuwerfen, da wischte das Klingeln des Telefons diesen sogleich beiseite. Ein Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. „Das ist doch sicher Bodo“, dachte sie, „er möchte mir einen schönen Vormittag wünschen und fragen, wie es bei terra so läuft.“ Viel würde sie noch nicht zu erzählen haben.
Professionell ließ sie es ein weiteres Mal läuten, nahm in Gedanken an mich den Hörer von der Gabel und führte ihn an Ohr und Mund.
„Guten Tag, terra Handels- und Speditions GmbH, Hilke Tietz am Telefon“, meldete sie sich und stellte sogleich fest, dass das Wort terra aus ihrem Munde noch etwas unsicher klang.
„Guten Tag“, antwortete eine ihr unbekannte Stimme. Beinahe schreckte Hilke kurz auf. Das war nicht Bodo.
„Wir brauchen jemanden“, fuhr der Mann am Telefon fort, „der Lastwagen nach Teheran überführt. Können Sie das?“ Hilke zögerte keine Sekunde. „Selbstverständlich“, sagte sie selbstsicher, obwohl ihr keineswegs klar war, wie terra einen derartigen Auftrag ausführen sollte. Von ihrer prompten Zusage erfreut und verblüfft, fragte Hilke nach: „Wie viele Fahrzeuge sind es denn?“
„15 LKW“, antwortete der Mann.
„Ja“, unterstrich Hilke unsere Kompetenz. „terra übernimmt das gerne. Wann soll es denn losgehen?“ Zufrieden nannte der Anrufer meiner Frau die Details und der tolle Fernschreiber summte alsbald fröhlich:
„Auftrag erteilt“. 15 Lastwagen für den Iran. Das war doch was! Stolz schrieb ich am 21. April des Jahres 1978 als „Position 13“ unseren ersten großen Auftrag in das schwarze Schulheft.
Manchmal ist es nur eine einzige Sekunde, die darüber entscheidet, ob einem der Auftrag erteilt wird oder nicht. Hilke war spitze gewesen! Das hatte wunderbar geklappt. Glücklich schlossen wir uns in die Arme. Dass ich den Kunden bereits vor einiger Zeit gewonnen und den Tag und Zeitpunkt des Anrufes bei terra terminiert hatte, erzählte ich meiner lieben Frau erst einige Zeit später. Außerdem war ich selbst nicht sicher gewesen, ob der Auftrag wirklich erteilt werden würde. Nun aber wurde es ernst. Dringend brauchten wir einen Konvoiführer, vierzehn weitere Fahrer und einige große Scheine zur Finanzierung der Fahrtkosten. Eine Tour von Deutschland nach Teheran, schließlich legt kein „normaler Mensch“ so eine Strecke mit einem Fahrzeug zurück.
„Herr Walter ist unser Mann“, sagte ich entschlossen zu Hilke, „er kann den Konvoi führen.“
An der bulgarisch-türkischen Grenze bei Kapikule hatte ich Herrn Walter vor einigen Monaten kennengelernt; ein erstklassiger Konvoiführer und dazu absolut vertrauenswürdig. Niemand wollte schließlich, dass die Lastwagen irgendwo auf der Strecke zwischen Deutschland und Iran spurlos verschwinden. Auch so etwas war in unserem Gewerbe schon vorgekommen. Für terra wäre es der Todesstoß, noch bevor wir richtig aufleben würden.
Also rief ich Walter in Graz an. Er willigte ein. Wir trafen uns dort. Walter hatte bereits ein erstklassiges Team aus Fahrern zusammengestellt. Glücklich reichte ich ihm die Hand und händigte ihm einige Scheine für den Diesel und die Zollbeamten aus. Walter grinste mich an.
„Wir schaukeln das schon, Boss“, sagte er, bestieg sein Führerhaus und fünfzehn LKW-Fahrer ließen die Motoren an. Mein Herzklopfen war wohl dennoch zu hören. Der Konvoi verließ den großzügigen Parkplatz beim Friedhof in Graz, der uns immer so gelegen kam. Jede Menge Lastwagen ließen sich dort unterbringen, standen eindrucksvoll nebeneinander. So auch eines Jahres an Allerseelen, als die katholischen Kirchgänger mit ihren Wagen anrollten, um der Verstorbenen zu gedenken und den Parkplatz beim Friedhof von Dutzenden Lastwagen belegt fanden. Skeptisch und fluchend durchkämmten sie alsbald die benachbarten Straßen auf der Suche nach freien Parkplätzen und mussten den mitgebrachten Grabschmuck über viele Hundert Meter bis zum Friedhof tragen. Wir bedauerten das natürlich. Aber der Parkplatz war nun einmal ein perfekter Treffpunkt für unsere Konvois. In den Folgejahren aber passten wir uns natürlich an.
Immer wieder mal summte der Fernschreiber während der folgenden Tage und Walter gab die Position unseres Konvois durch. Viele Stunden aber auch Stille.
„Wird alles laufen?“, schauten Hilke und ich uns an, lächelten und nickten uns zu. „Ja, das wird es schon!“ Am achten Tage summte es in unserem Kellerbüro. „Walter“, rief Hilke mich aufgeregt an. „Sie sind in Teheran!“
Wären die Fahrer voller Begeisterung für den Orient weitere 4.600 Kilometer nach Osten gefahren, hätten sie Reinhold Messner und Peter Habeler treffen können, die im Jahr unserer Firmengründung erstmalig den Mount Everest ohne Sauerstoffgerät bestiegen haben. Und auch bei terra gelang uns der Aufstieg, ohne dass die Luft zu dünn wurde. Für eine Weile würde die Fahrt nach Teheran unser größter Auftrag bleiben. Dennoch machte ich fortan alle paar Tage Eintragungen in unser schwarzes Schulheft: „1 LKW/Libanon“, „2 LKW/Bagdad“, „1 Kran/Brest“, „6 Busse“, „55 LKW“.
1. Teil - Die (Vor-)-Kriegsjahre 1938-1945
55 Lastwagen. Das war schon was. Dabei war ich doch eigentlich ein S-Bahn-Kind. Erinnere die zahllosen Fahrten im Berlin meiner Kindheit und Jugend. Vorbei an den Trümmern der eroberten und schrecklich zerbombten Stadt, die Steinhaufen abtragenden Trümmerfrauen bewundernd. Wie sie aus dem, was der Krieg aus den Häusern gemacht hatte, die brauchbaren Steine schleppten, diese zu Stapeln auftürmten, auf dass sie wieder verwendet werden konnten. Sehe ich heute Bilder von den zerstörten Städten Syriens, von Damaskus oder Aleppo, führen sie mir das Berlin meiner Kindheit vor Augen und ich spüre, dass auch dort im Orient die westlichen alliierten Kräfte im Friedenspakt mit den osteuropäischen Staaten diese wundervollen Städte aus ihren Trümmern aufs Neue errichten können.
Meine Eltern
Ganz wie das Berlin des Jahres 1945. Die Stadt, in der sich während der zweiten Hälfte der 1930er Jahre die beiden Bankkaufleute Bernhard Tietz (1904 bis 1961) und Charlotte Kilper (1907 bis 1971) womöglich in einem der Flure des Bankhauses Seidel das erste Mal begegneten, sich ein Lächeln schenkten, aus dem ihre Liebe erwuchs. Am 24. Oktober des Jahres 1938 wurde ihnen ein Sohn geboren. Ein gesundes Kerlchen, dem Charlotte und Bernhard den Namen Bodo gaben, ein, wie die Namenslexika wissen, altsächsisches Wort für „Gebieter“. Das stimmte schon. Denn fortan würde ich, wie alle Kinder es tun, natürlich ordentlich mitbestimmen über ihre Leben. Gleichzeitig ist mir das Gebieten, im Sinne des herrschenden und keinerlei Widerspruch zulassenden Menschen fern. Vielmehr fordere ich gerne dazu auf, Widerspruch zu leisten. Wie könnte ich sonst erfahren, was außerhalb meiner eigenen Vorstellungen und Überzeugungen noch möglich ist?
Mutter Charlotte und Vater Bernhard Tietz im Urlaub auf Usedom 1933.
Eine spätere Umdeutung der Herkunft des Namens Bodo aus dem althochdeutschen „boto“ für Bote indes, passt eigentlich besser zu mir. Dieser Bote allerdings bringt später mit terra die Lastwagen, Krane und Schwertransporter von den Werken zu den Kunden in aller Welt.
Deutschland während meines Geburtsjahres
So fröhlich ich als Kind gewesen bin, es war doch eine düstere Zeit, in der ich das Licht der Welt erblickte. Kaum ein Jahr nach meiner Geburt verkündete Adolf Hitler am Vormittag des 1. September 1939 im Berliner Reichstag: „Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen!“ Wenige Stunden zuvor hatte die Deutsche Wehrmacht ohne Kriegserklärung Polen überfallen. Hitler selbst sprach mit Blick auf einen angeblichen Angriff Polens auf den Sender Gleiwitz von einer Verteidigungsaktion. Jener allerdings war von der SS inszeniert worden. Frankreich und Großbritannien forderten den Rückzug der deutschen Soldaten aus Polen innerhalb von zwei Tagen. Hitler ließ das Ultimatum verstreichen. Der Zweite Weltkrieg begann. Er sollte sechs Jahre dauern und fast 60 Millionen Menschen in den Tod reißen.
St. Monikastift in Berlin Lankwitz 1938.
Bereits am Tage meiner Geburt im Lankwitzer St. Monikastift waren die Anzeichen für Krieg und Verfolgungen unübersehbar gewesen. Für meine Eltern gab es an diesem Montag nur eine wichtige Schlagzeile: Bodo ist geboren! Alle anderen, in den Zeitungen des 24. Oktober 1938 blätternden Deutschen, lasen die Vorschläge des Reichsaußenministers Joachim von Ribbentrop an Polen, Danzig wieder dem Deutschen Reich anzugliedern. In weiteren Nachrichten des Tages äußerte sich die „Deutsche Diplomatische Korrespondenz” zur Kolonialfrage mit den Worten, das Reich wolle die Besitzungen wiederhaben, die „ihm aufgrund verleumderischer Behauptungen“ weggenommen worden sind.
Der Deutschlandfunk berichtete am Tage meiner Geburt erstmalig über die Arbeiten am „Westwall“, dem auf einer Strecke von 630 Kilometern an der Deutschen Westgrenze errichteten Verteidigungssystem aus über 18.000 Bunkern, Stollen, zahllosen Gräben und Panzersperren. Alle Zeichen standen auf Krieg. Am 12. März meines Geburtsjahres 1938 ließ Hitler die Wehrmacht in Österreich einmarschieren, um drei Tage darauf auf dem Wiener Heldenplatz vor Zehntausenden jubelnden Menschen zu verkünden: „Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reiches melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich.“
Anfang November des Jahres 1938, zwei Wochen nach meiner Geburt, brannten in Deutschland über 1.400 Synagogen und Betstuben, mehr als 400 Juden wurden während der Gewaltmaßnahmen der Nationalsozialisten getötet oder in den Selbstmord gehetzt. Jüdische Friedhöfe wurden verwüstet. 30.000 Juden in Konzentrationslager verschleppt. Die seit Hitlers Machtergreifung im Jahre 1933 herrschende Diskriminierung der Juden wurde zur systematischen Verfolgung und riss bald Millionen Juden in den Abrgrund des Holocaust. Es war die Reichskristallnacht des 9. auf den 10. November 1938, eingebettet in die damaligen Novemberpogrome.
Ob meine Mutter mit mir als Säugling auf dem Arm am Fenster unserer Wohnung in der Havensteinstraße 31 in Berlin stand und hinausschaute? Hielt ich meine Eltern wach während dieser Nacht, wie Neugeborene es so gerne tun? Was Charlotte und Bernhard wohl sprachen über das, was dort draußen geschah? Machte es ihnen Angst?
Wie auch meine Großeltern, waren und blieben meine Eltern parteilos. Immer sind sie zuverlässige und korrekte Angestellte gewesen, der Politik jedoch näherten sie sich nicht, zeigten sich eigentlich desinteressiert, wohl um unbeschadet die politischen Geschehnisse an sich vorbeiziehen zu lassen.
Die Krankheit meines Vaters
Schlimme Nachrichten auch in unserer Familie. Das Elternglück von Charlotte und Bernhard wurde ein halbes Jahr nach meiner Geburt vom Klagen meines Vaters erschüttert. Er könne sich nicht mehr richtig bewegen. Seine Glieder fühlten sich steif an am Morgen und ließen schon bald seinen ganzen Tageslauf beschwerlich werden. Gemeinsam mit meiner Mutter suchte er mehrere Ärzte auf. Rheuma wurde diagnostiziert. Später entwickelte sich daraus Gicht.
„Ihr Mann“, nahm einer der Ärzte meine Mutter zur Seite und sprach wie ein Schlag ins Gesicht, „wird nie wieder gesund werden.“ Meine Mutter hat diesen Moment nie vergessen oder verwinden können. Später erzählte sie mir davon, wie die harten und unsensiblen Worte des Arztes ihr Leben ins Taumeln brachten. Vom Arzt fuhr Charlotte heim in unsere Wohnung in Berlin-Lankwitz. An ihrer Seite ihr kranker Mann, in ihren Armen ein gerade sechs Monate alter Junge.
Der Arzt sollte recht behalten. Mein Vater wurde nie wieder gesund. Ich selbst erlebte ihn immer nur krank. Im Rollstuhl, daheim im Bett liegend, in Spitälern, einem Hospiz in Pritzwalk und viele Jahre später, vor seinem Tod im Jahre 1961, in einer solchen Einrichtung in Berlin. Die Krankheit führte zur völligen Versteifung seiner Glieder. Bernhard war ein liebevoller Mann und Vater. Abenteuerliche Spaziergänge durch den Wald, das gemeinsame Fußballspielen mit mir oder das Toben im Park sind ihm aber natürlich nicht möglich gewesen.
Drei Jahre alt.
Untauglich für den Krieg blieb mein Vater, anders als so viele Männer aus unserer Straße, nach dem Kriegsausbruch bei uns. Während der ersten Kriegsjahre konnte er noch arbeiten und wechselte in die Buchhaltung der Firma Maggi, die damals bereits Millionen von Brühwürfeln in alle Welt verkaufte. Gut erinnere ich mich daran, wie ich nach dem Krieg jeden Monat zu Maggi fuhr und die Firmenrente meines Vaters abholte. 93,- DM lagen in einem Umschlag, den ich an mich nahm, sicher verwahrte und heimbrachte.
Die Firma Maggi allerdings stand den Nazis sehr nahe. Seit meinem Geburtsjahr durfte Maggi Berlin sich als „Nationalsozialistischer Musterbetrieb“ bezeichnen. Alle höheren Angestellten sowie natürlich die Geschäftsführung waren arischer Herkunft. Exklusiv belieferte Maggi mit seinen Produkten die Wehrmacht, für die selbst eine eigene Suppe produziert wurde.
Düstere Tage in Freyenstein
Während die Alliierten näher rückten, evakuierte die Firma ihre Mitarbeiter in den Norden der Prignitz (Brandenburg), in die heute zu Wittstock/Dosse gehörende Kleinstadt Freyenstein. Im Schloss Freyenstein waren Büroräume angemietet worden. Mein Vater ging dort seiner Tätigkeit als Buchhalter nach, bis dies im letzten Aufbäumen Deutschlands im Weltkrieg sinnlos wurde. Unsere Familie, meine Mutter Charlotte, mein Vater Bernhard und ich als sechsjähriger Junge, bezog in einem sehr einfachen Haus nahe dem Schloss ein Zimmer. Recht armselig war das. Schlimmer als alle Meldungen über die sich nähernden Alliierten und unser spärliches Zimmer waren für mich jedoch die mehrmals täglichen Gänge auf das Außenklo. Denn immerzu stolzierte im Hof ein gewaltiges Monster herum. Ein riesiger Truthahn, der, beinahe so groß wie ich, nichts Besseres zu tun hatte, als mich bei jedem Gang zur Toilette zu attackieren, sich gewaltig aufzuplustern und gemeingefährlich zu starren. Das Gehabe brachte mich vor Angst ins Zittern. Dennoch trickste ich den Vogel ein jedes Mal aus und lernte wohl damals schon, Unwegsamkeiten zu umgehen oder hinfort zu schaffen.
Heute macht der Truthahn sich dort nicht mehr wichtig. Das Haus in Freyenstein ist allerdings, wie ich vor einigen Jahren beim dortigen Besuch mit meinem Sohn Michael feststellte, heute ebenso heruntergekommen und armselig wie damals zur Jahreswende 1944/45. Kaum betraten Michael und ich das Grundstück, kam uns eine alte Frau entgegen, verängstigt und voller Sorge, wir wären die Gerichtsvollzieher. Wir konnten sie beruhigen und die Frau zeigte uns das Zimmer, in dem wir das Kriegsende verbrachten und dessen Tür eines Tages plötzlich und brutal aufgerissen wurde.
Allesamt schreckten wir damals zusammen. Ein mit den Russen paktierender polnischer Soldat stürmte ins Zimmer. In der Hand ein Gewehr. Hektisch sah er sich um, riss die Waffe hoch und zielte auf meinen Vater. Meiner Mutter entfuhr ein Schrei. Voller Angst huschten wir zusammen, hielten uns fest.
„Papa“, wollte ich rufen, da senkte der Soldat das Gewehr, schrie einige polnische Worte in unsere Richtung und verließ das Zimmer. Seine Krankheit mag meinem Vater das Leben gerettet haben. Sie hatte ihn auch vor dem Krieg bewahrt, in dem so viele Väter meiner Generation umkamen. Meine Mutter und ich sprangen auf, umarmten meinen Vater, fanden uns in einem Abgrund aus Angst, Hilflosigkeit und Tränen. Alle drei aber überlebten wir den Krieg unbeschadet.
Glocken verkündeten damals das Kriegsende. Auch die Treppe des Hauses in Freyenstein gibt es heute noch. Als Junge stand ich auf einer ihrer Stufen und spürte das Läuten der Glocken in meinem Körper. Sah die Tränen, die den Menschen über die Wangen liefen. Es war der 8. Mai des Jahres 1945. Der Krieg war vorbei.
Im Jahre 1945.
Noch Jahre später aßen wir mit dem Besteck von Maggi, das unsere Familie nach Kriegsende bei der Rückkehr nach Berlin mitnehmen durfte. Neben anderen Familien und unserem Hab und Gut hockten wir auf Lastwagen, die uns in die zerstörte Stadt und nach Hause brachten. Neben meiner Mutter sitzend, drückte ich meinen geliebten Teddybären an mich. Immer war er an meiner Seite gewesen. Mein kranker Vater saß vorne beim Fahrer.
Die großen Berliner Kaufhäuser
„Nenne“, sagte ich leise zu meinem Teddy, während der Lastwagen Bombenkrater und Häuserruinen passierte. Zu meinem ersten Geburtstag hatten meine Eltern „Nenne“ bei Wertheim am Leipziger Platz erworben. Auch dieser Ort und das einst so prachtvolle Kaufhaus, hier auf einem Foto aus dem Jahre 1929 zu sehen, waren 1944 von den Bomben zerstört worden. Während einiger Jahre war es das größte Warenhaus Europas und galt mit seinen kunstvollen Fliesen und Mosaiken, einem Sommergarten sowie einem Teeraum und wechselnden Kunstausstellungen gleichsam als dessen schönstes. Delikatessen, Musikinstrumente, Bücher oder eben auch „Nenne“ - alles gab es dort. Denn auch damals schlief die Konkurrenz nicht: Das Wertheim-Haus stand im fortwährenden Wettbewerb mit dem Kaufhaus meines Namensvetters „Tietz“ am Alexanderplatz sowie dem späteren KaDeWe (Kaufhaus des Westens) am Wittenbergplatz. Allesamt wurden die jüdischen Eigentümer der Häuser von den Nazis enteignet, 1937 die jüdischen Geschäftsführer entlassen. Aus Wertheim wurde die AWAG (Allgemeine Warenhaus Gesellschaft AG), aus den Kaufhäusern von Hermann Tietz wurde „HERTIE“ (HERmann TIEtz), aus denen seines Cousins Leonhard Tietz „Kaufhof“.
„Kaufhaus Wertheim“ in Berlin, Leipziger Platz, heute „Mall of Berlin“.
Lange jedoch war der Name der „Tietz“-Kaufhäuser vielen Berlinern noch ein Begriff und mehrmals wurde ich während der Zeit als Lehrling bei „Schenker“ auf meinen Nachnamen angesprochen.
„Ach, Sie heißen Tietz. Haben Sie etwas mit den Kaufhäusern zu tun?“ Lächelnd schüttelte ich dann immer den Kopf.
„Nein, nein, vermutlich wäre ich dann auch nicht hier bei Schenker als Lehrling“, erwiderte ich scherzhaft.
Heute steht auf dem Gelände des 1955/56 endgültig abgerissenen Wertheim-Hauses eine Mall, die im September 2014 eröffnete „LP 12 Mall of Berlin“.
„Ich kenne da einen Urberliner“, schmeichelte ein Kollege einmal nach einer Tagung der Transportunternehmer-Organisation ECG in der Hauptstadt. Die meisten der Teilnehmer hatten ihre Frauen mitgebracht und alle freuten sich auf eine Stadtrundfahrt. „Bodo Tietz“, rief er, „der kann uns die Stadt zeigen!“
Natürlich konnte ich das, stand alsbald mit dem Mikrofon vorne im Reisebus und führte die Gruppe durch „mein Berlin“. Allen war es eine große Freude. Zugleich spürte ich, wie nah mir viele Orte meiner Kindheit noch waren. Auch wenn sie ihre Gestalt so sehr verändert hatten. Die Vergangenheit leuchtet in den Erinnerungen der Menschen für lange Zeit noch durch all das Neue hindurch.
Ein Teddy begleitet mich ein Leben lang
„Nenne“; der Name meines auch heute noch bei uns „lebenden“ Teddys soll mein erstes Wort gewesen sein.
Ganz wie zum Kriegsende, während unserer Heimkehr in die Havensteinstraße 31, habe ich es auch später immer gemocht, wenn ich ein oder zwei kleine Bären an meiner Seite hatte. Das steckt wohl tatsächlich aus damaligen Zeiten noch in mir.
Zu so vielen Orten unserer Erde, auf allen meinen Reisen, saßen zwei kleine dieser netten Gesellen in meiner Aktentasche. Und kürzlich auf einer Urlaubsfahrt staunte meine heute elfjährige Enkelin Saphia nicht wenig, als die Zoll-Kontrolleure im Flughafen Zürich, nachdem sie sich über meine Tasche hergemacht hatten, zwischen den Kleidungsstücken zwei kleine Teddybären herausnahmen.
„Nenne“ und ich.
Die Kontrolleure verzogen keine Miene. Schließlich sind sie Profis und man möchte lieber gar nicht wissen, was sie sonst so alles aus den Koffern der Reisenden ans Tageslicht befördern.
Saphia allerdings kicherte gleich los.
„Was hast denn du da im Koffer, Opa?“
„Nenne“ war an meiner Seite, als wir unsere damalige Wohnung im Haus an der Havensteinstraße erreichten. Unser Haus war unbeschadet. Die Nachbarhäuser allesamt zerstört. Kaum mehr als Schutthaufen waren von ihnen übrig geblieben. Ein trauriger, zutiefst verstörender Anblick, obwohl meine Mutter und ich die Entwicklung, die unsere Straße während der letzten Kriegsjahre nahm, genau hatten verfolgen können.
Mein Spielzeug aus den Kriegsjahren.
Mit meinen Großeltern.
Meine Großeltern
Waren wir doch immer wieder von Freyenstein nach Sauen, in die Gemeinde Rietz-Neuendorf im Osten Brandenburgs, zu den Eltern meiner Mutter gefahren, Fritz Kilper (geboren 1881 in Berlin, verstorben 1944 in Sauen) und Marie Kilper (geboren 1886 in Slubice, verstorben 1956 in Berlin). Bis zum Jahre 1943 hatten meine Großeltern in unserer Nachbarschaft in Lankwitz gewohnt. Schnell mal eben hatte ich zu ihnen hinüberlaufen können. Einmal aber kamen sie heim, da gab es ihr Haus nicht mehr. Eine Bombe hatte es in Trümmer gerissen. In Sauen fanden sie schließlich ein neues Zuhause.
Quer durch Berlin führten uns nun die Fahrten zu meinen Großeltern. Und jedes Mal machten wir Halt an der Havensteinstraße, sahen in unserer Wohnung, rechts im zweiten Stock, nach dem Rechten und waren glücklich, diese und das sie umschließende Haus überhaupt noch vorzufinden. Denn zunehmend fanden wir während unserer letzten Passagen die Nachbarhäuser, eines nach dem anderen, von Bomben zerrissen vor. Gut lässt sich auf dem Foto oben erkennen, dass unser Haus mit der Hausnummer 31 noch eine alte Fassade besitzt. Das linke Gebäude hingegen riss eine Bombe in Trümmer. In den 1950er Jahren wurde es neu errichtet. Wir wohnten in dem Haus mit dem Möbelwagen davor, rechts oben im zweiten Stock, dort, wo von den drei Fenstern das linke Küchenfenster aufsteht.
Unser Umzugswagen von der Havensteinstraße 31 in Berlin nach Buchholz in der Nordheide 1968. „Unser“ Haus blieb im Krieg unbeschädigt.
Unsere Fahrten nach Sauen während des Krieges
„Steigen wir wieder an der Friedrichstraße um?“, fragte ich meine Mutter während einer unserer Fahrten nach Sauen. Sie lächelte. „Ja, Bodo“, antwortete meine Mutter. Obwohl ich den Weg zu den Großeltern natürlich ebenso kannte, wie den großen Bahnhof Friedrichstraße mit seinen zahllosen Treppen und Geländern.
Zerstörte Häuser vor dem Bahnhof Friedrichstraße, 1945.
Dessen Umgebung allerdings war ein schlimmer Anblick. Der Bahnhof selbst jedoch blieb weitestgehend unbeschädigt. Wie wenig er sich doch bis heute verändert hat. Auch gibt es immer noch diese eine Treppe, auf der ich als wohl sechsjähriger Junge mit meinem Gepäck auf dem Arm stürzte, meine Mutter mich gerade noch zu fassen bekam und mir aufhalf, während sich oben die von uns angestrebte S-Bahn in Richtung Erkner in Bewegung setzte. Wir hatten die S-Bahn verpasst. Die amerikanischen Bomber hingegen trafen die Bahn ganz genau. Es wäre unser Zug gewesen. Niemand überlebte den Angriff. Die düsteren Treppenstufen im Bahnhof Friedrichstraße haben unsere Leben gerettet. Meine Mutter und ich nahmen die folgende S-Bahn. Kurz vor Erkner hielt der Zug. Alle Fahrgäste wurden aufgefordert, diesen zu verlassen. Es sei etwas geschehen. Bis Fangschleuse müssten wir zu Fuß weitergehen. Wir Reisenden liefen los. Passierten Erkner zu Fuß. Es sind meine Anblicke der sich über die Toten beugenden Ärzte, die ich nie vergesse, sowie deren Worte: „Wir schauen, ob sich noch Lebende zwischen den Leichen befinden.“
„Charlotte! Bodo! Da seid ihr ja endlich“, werden meine Großeltern Fritz und Marie gerufen und uns in die Arme geschlossen haben, als wir spät an diesem Tage das heute aus 35 Wohnhäusern bestehende Dorf Sauen erreichten. Unser Weg dorthin führte über Friedrichstraße und Erkner nach Fürstenwalde und Pfaffendorf. Die letzten fünf Kilometer bis Sauen gingen wir immer zu Fuß. Mein Großvater Fritz war Landwirt und Gutsverwalter auf dem Anwesen des damals berühmten Professors August Bier. Als führender deutscher Chirurg mit internationalem Ruf, leitete Bier während 25 Jahren die Chirurgische Klinik der Charité. Seine Freizeit verbrachte er, so weit die Termine es zuließen, gerne mit seiner Familie in Sauen. Opa Fritz und Oma Marie wohnten im benachbarten Schulhaus. Dort kamen auch meine Mutter und ich während unserer Tage in Sauen unter. Heute ist das Gebäude ein Gemeindehaus und beherbergt die Freiwillige Feuerwehr. Mit Hilke und meinen Söhnen habe ich den Gutshof sowie den Kirchhof in Sauen vor einigen Jahren besucht. Mein Großvater starb im Juli 1944 auf dem Gut, meine Großmutter Marie im November des Jahres 1952 im Ost-Berliner St. Hedwig Krankenhaus, das wir während ihrer letzten Wochen von Westberlin noch ohne Weiteres hatten aufsuchen können.
Für mich war es immer schön bei den Großeltern und nach Großvaters Tod mit meiner Großmutter in Sauen. Ich stromerte durch die Wiesen und den Wald, fuhr mit auf die Felder und verrichtete auch kleine Arbeiten. Manchmal ging ich mit Großmutter zu den benachbarten Höfen, um für etwas Geld dort Wäsche zu bügeln.
Sicher durfte ich in Sauen auch endlich und unbeschwert meine geliebten Blaubeeren sammeln. In Freyenstein war mir dies strikt untersagt gewesen. Viele Stellen, an denen die herrlichsten Blaubeeren wuchsen, durften wir Kinder nicht besuchen. Denn dort waren auch die Gräben. Aushebungen, die mit Erschossenen gefüllt wurden. Mit den Körpern der Juden und anderer Gefangener, die eben noch wie Vieh von deutschen Soldaten durch Freyenstein getrieben worden waren.
Nicht nur ein Treck war das. Wir sahen viele.
Sahen die Gefangenen in ihrer gestreiften Kleidung, einige trugen die Judensterne daran. Wie sie allesamt heranklapperten, mit dem Blechgeschirr in ihren dünnen Fingern. Einige Anwohner füllten ihnen Suppe hinein. Die Männer der SS aber schlugen mit ihren Gewehrkolben die Suppenschüsseln zu Boden, trieben den Treck weiter.
Wir wussten, wo die Massengräber waren. Wohl heute noch sind. Dort durften wir Kinder nicht spielen. Keine Beeren sammeln oder Pilze.
Neben der Kirche in Freyenstein erinnert heute ein Gedenkstein an das, was ich als Junge sah. Die Todesmärsche aus dem nahe gelegenen Konzentrationslager Sachsenhausen. Auf dem Stein ist von einer unbekannten Zahl von Häftlingen die Rede. Viele ihrer Gesichter habe ich gesehen. Sie erscheinen mir heute noch.





























