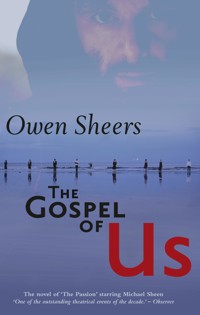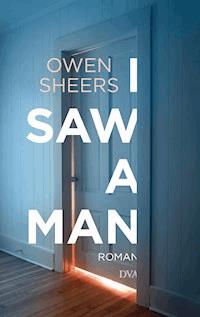
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein atemberaubendes Drama über die Last von Geheimnissen
Nach dem tragischen Tod seiner Frau Caroline, die als Journalistin bei einem Auslandsdreh in Afghanistan ums Leben gekommen ist, erträgt Michael es nicht länger im gemeinsamen Heim in Wales. In dem Versuch, ein neues Leben zu beginnen, zieht er nach London, wo er auf die Nelsons trifft: Josh, Samantha und ihre zwei Töchter wohnen im Haus nebenan, und aus einer Zufallsbekanntschaft wird schnell – allzu schnell? – eine intensive Freundschaft. Michael geht bei den Nelsons wie selbstverständlich ein und aus, bis er eines Samstagnachmittags ihre Hintertür halb offen stehend vorfindet. In dem Gefühl, dass etwas nicht stimmt, betritt er das augenscheinlich leere Haus ... und setzt damit eine Folge von Ereignissen in Gang, die ihrer aller Leben schlagartig und auf immer verändern wird.
Ein tiefgreifender, packender Roman über Verlust, Schuld und die heimtückische Natur von Geheimnissen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Der eine Schritt zu weit
Nach dem tragischen Tod seiner Frau Caroline, die als Journalistin bei einem Auslandsdreh in Pakistan ums Leben gekommen ist, erträgt Michael es nicht länger im gemeinsamen Heim in Wales. In dem Versuch, ein neues Leben zu beginnen, zieht er nach London, wo er auf die Nelsons trifft: Josh, Samantha und ihre zwei Töchter wohnen im Haus nebenan, und aus einer Zufallsbekanntschaft wird schnell – allzu schnell? – eine intensive Freundschaft. Michael geht bei den Nelsons wie selbstverständlich ein und aus, bis er eines Samstagnachmittags ihre Hintertür halb offen stehend vorfindet. In dem Gefühl, dass etwas nicht stimmt, betritt er das augenscheinlich leere Haus … und setzt damit eine Folge von Ereignissen in Gang, die ihrer aller Leben schlagartig und auf immer verändern wird.
Ein packender Roman über Verlust, Schuld und die heimtückische Natur von Geheimnissen; virtuos erzählt, dem Leser immer einen Schritt voraus.
Owen Sheers, geboren 1974 in Fidschi, lebt nach einer Zeit in London heute wieder in Wales, wo er auch aufgewachsen ist. Vielseitig talentiert, lässt er sich nur schwer auf eine Form festlegen – zu seinen publizierten Werken zählen Dramen, Libretti, Gedichte und ein Sachbuch. Der Debütroman Resistance wurde in zehn Sprachen übersetzt und mit Michael Sheen in der Hauptrolle verfilmt. Sheers wurde u. a. mit dem Somerset Maugham Award, der Hay Festival Poetry Medal und dem Amnesty International Freedom of Expression Award ausgezeichnet. I Saw a Man ist sein zweiter Roman und für den französischen Prix Femina étranger nominiert.
Owen Sheers
I SAW A MAN
Roman
Aus dem Englischen von Thomas Mohr
Deutsche Verlags-Anstalt
Für Samantha
Yesterday, upon the stair,
I saw a man who wasn’t there.
He wasn’t there again today,
I wish, I wish he’d go away.
Hughes Mearns,Antigonish (Variante)
1
Der Vorfall, der ihrer aller Leben veränderte, ereignete sich an einem Samstagnachmittag im Juni, kurz nachdem Michael Turner – in der Annahme, es sei niemand da – das Haus der Nelsons durch die Hintertür betreten hatte. London ächzte unter einer Hitzewelle. Überall im South Hill Drive standen die Fenster offen, und das Blech der Autos war so heiß, dass die Schweißnähte in der Sonne knackten. Die leichte Morgenbrise war abgeflaut, und die Platanen am Straßenrand standen reglos in der schwülen Luft, ebenso wie die Eichen und Buchen im nahe gelegenen Park. Obwohl die Hitze erst eine Woche andauerte, glichen die schattenlosen Rasenflächen schon jetzt einer Trockensteppe.
Michael hatte die Hintertür der Nelsons halb offen stehend vorgefunden. Er stützte sich mit dem Unterarm am Türrahmen ab, steckte den Kopf durch den Spalt und rief nach seinen Nachbarn.
»Josh? Samantha?«
Keine Antwort. Das Haus schluckte seine Stimme ohne Echo. Er blickte auf seine alten Segelschuhe, unter deren Sohlen dicke Klumpen nasser Erde hingen. Seit Mittag hatte er im Garten gearbeitet und war zu den Nelsons herübergekommen, ohne sich zu säubern. Selbst an den nackten Knien, die aus seinen Shorts hervorlugten, klebte Erde.
Mit dem linken Absatz streifte er sich den rechten Schuh vom Fuß und horchte, während er sich auch den anderen auszog, in das stille Haus hinein. Es war noch immer nichts zu hören. Er sah auf seine Uhr: zwanzig nach drei. Um vier begann sein Fechttraining auf der anderen Seite von Hampstead Heath. Zu Fuß brauchte man dorthin mindestens eine halbe Stunde. Er wollte die Tür eben ein Stück weiter öffnen, doch als er den Dreck an seinen Fingern bemerkte, besann er sich eines Besseren und stieß sie mit dem Ellbogen auf. Dann trat er ein.
In der Küche war es kühl und dunkel, und es dauerte einen Moment, bis sich das gleißende Licht auf seiner Netzhaut verflüchtigt hatte. Das Haus stand am Rande einer kleinen Böschung, und der Garten fiel zur Grundstücksgrenze hin sanft ab. Der Rasen zwischen dem Birnbaum und dem verkümmerten Blumenbeet war längst verdorrt. Hinter dem schilfdurchwucherten Zaun stand eine Trauerweide, die sich über einen Teich neigte. Sämtliche Teiche in Hampstead Heath hatten seit ein paar Wochen einen giftgrünen Überzug aus Entengrütze. Vor wenigen Minuten erst hatte Michael ein Blesshuhn beobachtet, das mit nickendem Nonnenkopf eine Schneise durch den Wasserteppich pflügte, die Küken im Zickzack hinterdrein.
Wieder horchte er in die Stille. Dass Josh und Samantha die Tür offen ließen, wenn sie nicht zu Hause waren, hatte er noch nie erlebt. Er wusste, das Samantha mit ihrer Schwester übers Wochenende weggefahren war, aber Josh und die Mädchen hätten eigentlich da sein müssen. Trotzdem war das Haus wie ausgestorben, die einzigen Laute kamen aus dem Park: Ein Hund bellte, Picknicker schwatzten durcheinander, und im Badeteich planschten Kinder. Irgendwo in der Nachbarschaft sprang ein Rasensprenger an. Allerdings war es im Haus so still, dass diese Geräusche bereits wie aus der Vergangenheit zu ihm drangen, als habe er nicht nur die Türschwelle, sondern eine Zeitzone überschritten.
Vielleicht hatte Josh ja eine Nachricht hinterlassen. Michael sah am Kühlschrank nach, einem amerikanischem Trumm aus gebürstetem Stahl mit integriertem Eiswürfelbereiter. An der Kühlschranktür machten sich mit Mark-Rothko-Magneten befestigte Flyer und Zettelchen die Plätze streitig. Doch unter all den Pizzaservice-Speisekarten, Einkaufslisten und Schulterminen gab es nichts, was über Joshs Verbleib Auskunft gegeben hätte. Michael drehte sich um und ließ seinen Blick durch die Küche wandern, auf der Suche nach einer Erklärung dafür, warum die Hintertür offen stand, aber anscheinend niemand da war.
Wie das ganze Haus war auch die Küche großzügig und solide ausgestattet. Die Jalousie warf ein Schattenmuster auf die moderne Kochinsel in der Raummitte: zwei Ceranfelder, Backofen und reichlich Profi-Küchenutensilien. Hinter der Frühstückstheke ging es in einen Wintergarten, wo inmitten von Topfpflanzen und beschirmt von einem ockerfarbenen Sonnensegel ein durchgesessenes Sofa und zwei alte Polstersessel ihren Lebensabend fristeten. Am anderen Ende der Küche stand ein ovaler Esstisch, und dort an der Wand hingen die Nelsons.
Es war eine Studioaufnahme in Schwarz-Weiß aus der Zeit, als Lucy noch ein Baby und Rachel höchstens drei gewesen war. Die Kinder, fein gemacht in identischen weißen Kleidchen, saßen auf dem Schoß ihrer Eltern. Samantha hielt den Kopf geneigt und lachte ihre Töchter an, Josh dagegen starrte direkt in die Kamera. Die jungenhafte Frisur trug er noch heute, nur das kantige Kinn hatte etwas von seiner Bestimmtheit eingebüßt, und auch die Haare waren nicht mehr ganz so dunkel, sondern an den Schläfen schon leicht angegraut.
Michael blickte dem jüngeren Josh einen Moment lang in die Augen und überlegte, ob er anrufen sollte. Doch sein Handy lag in seiner Wohnung, und wahrscheinlich gab es ohnehin keinen Grund zur Sorge. Nirgends waren Einbruchspuren zu entdecken. Die Küche sah genauso aus wie immer.
Er kannte die Nelsons zwar erst seit sieben Monaten, doch nachdem sie einmal Freundschaft geschlossen hatten, war ihre Beziehung rasch enger geworden. In den vergangenen Wochen hatte er bestimmt häufiger an ihrem Tisch gegessen als bei sich zu Hause, gleich nebenan. Anfangs war der alte Trampelpfad, der von ihrem Grundstück durch die Hecke in den Garten seines Wohnblocks führte, kaum mehr zu erkennen gewesen, doch inzwischen hatte der kleine Grenzverkehr zwischen ihm und den Nelsons unübersehbare Fakten geschaffen. Er selbst ging sie zumeist abends besuchen, aber am Wochenende schauten Samantha und die Mädchen gelegentlich bei ihm vorbei. Diese Familie hatte seinem Leben die erforderliche Stabilität zurückgegeben, ein Gewicht, das wenigstens teilweise ersetzte, was er verloren hatte. Deshalb wusste Michael auch so genau, dass kein Fremder die Küche durchsucht hatte, alles war an seinem angestammten Platz. Wie oft war er schon dort gewesen, wie oft hatte er bei den Nelsons gegessen und getrunken und war dadurch nach und nach wieder zu sich gekommen? Von Josh und Samantha hatte er gelernt, weniger an Carolines Abwesenheit zu denken und mehr an Caroline selbst.
Michael schaute noch einmal im Wintergarten nach. Und es konnte vermutlich nicht schaden, auch die anderen Zimmer kurz zu kontrollieren. Josh und Samantha hatten sicher nichts dagegen, überlegte er, während er die Post-it-Notizen rings um die Ladestation des Telefons durchging. Aber er musste sich beeilen. Er war ohnehin nur gekommen, um sich den Schraubenzieher zurückzuholen, den er Josh vor zwei Tagen geliehen hatte. Er brauchte ihn, um vor dem Training noch seinen Degen zu reparieren. Sobald er den Schraubenzieher gefunden hatte, wäre er wieder weg.
Michael sah noch einmal auf die Uhr. Fünf vor halb vier. Wenn irgendetwas nicht in Ordnung war, konnte er Josh immer noch von unterwegs anrufen. Weder er noch die Kinder konnten allzu weit sein. Er kehrte dem Telefon den Rücken und ging in Richtung Flur. Seine Socken hinterließen auf den Terrakotta-Fliesen feuchte Abdrücke, die hinter ihm wieder verdunsteten, als wollte ein Wind seine Spuren verwischen.
2
Josh hatte er gleich am ersten Abend kennengelernt. Michael hätte nie gedacht, dass er noch einmal in London landen würde. Aber nachdem seine Frau Caroline von einem zweiwöchigen Auslandseinsatz in Pakistan nicht zurückgekehrt war, hatte er beschlossen, das gemeinsame Cottage in Wales zu verkaufen und wieder in die Hauptstadt zu ziehen.
Coed y Bryn war ein altes walisisches Langhaus mit niedrigen Decken und angeschlossenem Stall in einsamer Hanglage außerhalb von Chepstow. Das nächstgelegene Gebäude war eine kleine Kapelle, die jedoch nur noch für Hochzeiten und Beerdigungen genutzt wurde. Wenn man in Coed y Bryn aus dem Fenster schaute, sah man nichts als Wald und Himmel. Kein Ort zum Alleinsein, meinten seine Freunde. Jetzt, wo Caroline nicht mehr da sei, sagten sie, brauche er Menschen um sich, Abwechslung. Peter, ein Arbeitskollege, hatte ihm dann die Wohnung angeboten, möbliert, in einem Mietshaus aus den Fünfzigerjahren mit Blick auf Hampstead Heath. Erst hatte er die Mail mit der Objektbeschreibung tagelang nicht geöffnet, aber eines einsamen Abends, nach einem von vielen einsamen Tagen, hatte er eine Flasche Wein aufgemacht und sich mit dem Laptop an den Kamin gesetzt. Peters Mail enthielt mehrere Anhänge.
Das erste Bild zeigte zwei breite Fenster, dahinter Bäume und die sanfte Hügellandschaft von Hampstead Heath. Und während sich der Herbstwind gegen das Cottage stemmte, scrollte Michael weiter. Eine breite Straße, gesäumt von einer geschlossenen Reihe georgianischer Stadthäuser, hier und da durchbrochen von modernen Mehrfamilienhäusern. Die Wohnung verfügte über insgesamt drei eher dürftig ausgestattete Zimmer mit vergammeltem Teppichboden sowie eine Junggesellenküche, ein altmodischer Schlauch in Beige und Grün.
Die Wohnung hatte zweifellos eine bewegte Vergangenheit. Wie viele Vormieter wohl schon an diesen Fenstern gestanden, in diesen Betten gelegen hatten? Jetzt, wo Caroline nicht mehr da war, brauchte er eigentlich dringend einen Neuanfang. Aber genau das, einen Neuanfang, wollte er nicht. Also schrieb er Peter, er werde die Wohnung nehmen. Zum einen, weil sie seinen Bedürfnissen entgegenkam: Sie war eher eine Zwischenstation. Zum anderen, weil er wusste, dass Peter nur tat, worum ihn Caroline gebeten hatte, nämlich sich um ihn zu kümmern. Wenn er sich jetzt für diese Wohnung entschied und nach London zog, betrachtete Peter seine Aufgabe womöglich als erledigt und würde ihn mit weiteren Hilfsangeboten verschonen.
Als sie damals nach Wales gezogen waren, hatten sie den größten verfügbaren Möbelwagen mieten müssen, um ihre gemeinsamen Habseligkeiten nach Coed y Bryn zu schaffen. Mit Mitte dreißig waren sie beide nicht mehr ganz jung und hatten trotz ihrer ungebundenen Lebensweise weit mehr gehortet als weggeworfen. Michaels persönlicher Besitz, hauptsächlich Bücher, war entweder eingelagert oder stapelte sich noch immer in den Gästezimmern von Freunden diesseits und jenseits des Atlantiks. Sogar der ganze alte Kram aus seiner Jugendzeit existierte noch, auf dem Dachboden seiner inzwischen verstorbenen Eltern in Cornwall. Caroline hatte ihrer Nomadenexistenz zum Trotz wie besessen Kunstgegenstände, Schuhe und Möbel angehäuft. Mit dem, was die beiden im Laufe von zehn Jahren angesammelt hatten, hätte man ein Haus vollstopfen können, das doppelt so groß war wie Coed y Bryn.
Für Caroline, Auslandskorrespondentin bei einem amerikanischen Privatsender, war das Cottage der vorläufige Endpunkt einer langen Liste von Adressen, an der sich lückenlos ablesen ließ, aus welchen Regionen sie berichtet hatte. Seit ihrem Studienabschluss hatte sie auf diversen Kontinenten gelebt, aber stets provisorisch, in kleinen Apartments, WGs oder Dienstwohnungen des Senders, in Kapstadt, Nairobi, Sydney, Beirut und Berlin. 2001, mit Ende zwanzig, hatte sie eine usbekische Einheit der Nordallianz als eingebettete Reporterin auf ihrem Vormarsch nach Kabul begleitet. Ihren Dreißigsten hatte sie mit einer Flasche Jack Daniel’s und einem US-Marine in einem Panzerfahrzeug am Stadtrand von Bagdad gefeiert. Vor Michael war ihr Leben eine erratische Kette von Erregungszuständen gewesen. Nur in Flughäfen fand sie so etwas wie Ruhe, als sei der Transitbereich ihre eigentliche Heimat. Abflug- und Ankunftshallen prägten ihre Erinnerung und markierten die einzelnen Kapitel ihres Lebens. Sich dem Rhythmus der Ereignisse zu unterwerfen, von heute auf morgen ans andere Ende der Welt beordert zu werden, ohne Einfluss auf Zeitpunkt oder Ziel, war ihre Form der Freiheit. Sie kannte es nicht anders. Geboren in Kapstadt, aufgewachsen in Melbourne, Studium in Boston. Immer war sie irgendwo die Neue gewesen, die Außenseiterin, die es vorgezogen hatte, Erworbenes zurückzulassen und mit leichtem Gepäck weiterzuziehen.
Mit den Jahren gewöhnte sie sich an die stete Unstetigkeit, prahlte mit ihrem wahrhaft grenzenlosen Anpassungsvermögen und hielt Bindungslosigkeit für eine prima Sache. Wenn sie in Schiphol umstieg, legte ihre gebräunte Haut anschaulich Zeugnis davon ab, dass sie noch tags zuvor durch Wüsten, Suqs und Basare gestiefelt war. In Clubs oder Bars wirkte das Flüchtige ihrer Existenz auf Männer wie ein Pheromon. Jetzt oder nie, das versuchte sie ihnen zu vermitteln, und in ihrem direkten Blick lag eine Präsenz, die man bei so einer zierlichen Person niemals vermutet hätte. Dabei schminkte sie sich nur selten, und auch ihre Haare waren nicht annähernd so gepflegt wie die der anderen Frauen, die an der Hotelbar hockten. Manchmal, wenn sie gerade erst gelandet war, hing sogar noch der abgestandene Schweißgeruch eines Langstreckenflugs in ihren Kleidern.
Die Männer kamen trotzdem. Bürohengste, deren Körper noch den Anzug verrieten, selbst wenn sie Freizeitkleidung trugen. Egal wo, ob in Cafés, Kneipen oder auf der Straße, sie erkannten Carolines Einmaligkeit. Sie war wie ein Komet, und sie wussten, dass sie ihre Nacht nur ein einziges Mal erhellen würde.
Caroline wurde Zeuge von Gräueltaten auf der ganzen Welt. Sie sah, was der Mensch dem Menschen antun konnte. Sie verlor Freunde, in Bosnien, Afghanistan, Sri Lanka, im Libanon und im Irak. Eines Abends in Kabul wurde ihr afghanischer Dolmetscher mit ausgestochenen Augen und herausgeschnittener Zunge tot in seiner Wohnung aufgefunden. Das alles belastete sie sehr, und ihre Familie machte sich Sorgen. Dennoch waren die vielen Toten für sie bloß unvermeidliche Begleiterscheinungen, der Preis, den sie für ihre Lebensweise zu zahlen hatte. Sie nahm dies so selbstverständlich hin wie die vielen Abschiede und zerbrochenen Freundschaften.
Natürlich war sie nicht immer glücklich. Mit Anfang dreißig stellte sie fest, dass sie zunehmend oberflächlich wurde und nichts ertrug, was längere Betrachtung oder Tiefe verlangte. Aber im Großen und Ganzen war sie mit ihrer Welt zufrieden. Sie betrachtete das Leben als ein Musikinstrument, für das man nur die richtige Melodie zu finden brauchte, und in dieser Hinsicht hatte sie Glück gehabt. Sie hatte ihre Melodie schon früh gefunden, und sie beherrschte sie virtuos.
Doch dann wachte sie eines Morgens in einem Hotelzimmer in Dubai auf, und plötzlich war alles anders. Als wäre ihr bewusst geworden, dass der Preis, den sie für ihr Leben gezahlt hatte, in keiner Relation zu seinem tatsächlichen Wert stand. Was ihr eben noch positiv erschienen war, verkehrte sich auf einen Schlag ins Negative. Eine Woche zuvor war ihre Tante gestorben, und sie, Caroline, war nicht zum Begräbnis nach Australien gereist. Das gehe schon in Ordnung, hatte ihre Mutter ihr versichert, alle könnten das verstehen. Caroline fragte sich bis zuletzt, ob dieses Telefongespräch der Auslöser gewesen war. Damals hätte sie wahrscheinlich gesagt: eher nicht. Doch wie auch immer, sie wollte einen Schlussstrich ziehen, eine andere Melodie spielen. Sie wollte morgens aufwachen und wissen, wo sie war. Sie wollte gewollt werden, vermisst und gebraucht. Alle hatten immer nur Verständnis, niemand hatte Sehnsucht.
Wieder in Beirut, ließ sie sich nach London versetzen. London lag eine halbe Weltreise von Melbourne entfernt, aber sie wollte nicht nach Hause. Und auch nicht nach Amerika. Sie wollte an einen Ort, der älter war als Australien oder die USA, und so entschied sie sich für London. London war der große Knotenpunkt, all ihre verstreuten Freunde und Bekannten – Kameraleute, Fotojournalisten, Redakteure, Reporter – fanden sich von Zeit zu Zeit dort ein. Aber London war nicht nur Knotenpunkt, sondern auch Sprungbrett nach ganz Europa. Der Kontinent würde ihr Zuflucht bieten, wenn der Drang sie überkam und sie von Neuem fortgehen und ankommen musste.
Im Gegensatz zu Caroline hatte Michael, abgesehen von seinem Elternhaus und einer Wohnung in Manhattan, lediglich Londoner Adressen vorzuweisen. Nach dem Studium war er nicht nach Cornwall zurückgekehrt, sondern in London geblieben und hatte als Volontär beim Evening Standard angefangen. In den nächsten fünf Jahren schrieb er als freier Mitarbeiter Promi-Kolumnen, Kritiken, Reportagen und Kommentare, und mit der Länge seiner Artikel wuchs auch sein Gehalt. Mit Ende zwanzig jedoch begann er beim Anblick einiger älterer Kollegen zu befürchten, dass dieser Weg über kurz oder lang in die völlige Erstarrung führen könnte, und so verließ er den Standard und zog nach New York, ausgestattet mit einem Journalistenvisum und den Zusagen diverser englischer Zeitungsmacher, die er als freier Korrespondent mit Storys aus dem Big Apple beliefern sollte. Und Michael lieferte. Doch er war nicht nach Amerika gezogen, um dort auf denselben ausgetretenen Pfaden zu wandeln wie in England. Er war hierhergekommen, um sich weiterzuentwickeln, vom Journalisten, als der er sich seit seinem Studium bezeichnete, zum Schriftsteller.
Michaels erstes Buch hieß BrotherHoods und handelte von Nico und Raoul, zwei Brüdern aus der Dominikanischen Republik in Manhattans Migrantenviertel Inwood. Das Buch gewährte einen authentischen Einblick in ihr Leben und ihre Welt, es erzählte von geplatzten Träumen und enttäuschten Hoffnungen, die Geschichte eines Scheiterns auf der ganzen Linie. Leider auch für seinen Autor, Michael. Denn eigentlich hatte er einen Roman schreiben wollen, statt seine Zeit in den USA mit Artikeln über die New Yorker Partyszene und den Super Bowl oder Reisereportagen auf den Spuren der Hudson-Valley-Maler zu verplempern. Aber die Ideen wollten einfach nicht sprudeln. Egal wie lange er am Schreibtisch saß oder wie viele Notizen er sich in Cafés und Kneipen machte, aus irgendeinem vertrackten Grund endete seine Fantasie stets an der Grenze zum Erfundenen. Weshalb die Prosa seiner Idole – Salter, Balzac, Fitzgerald, Atwood – für ihn letztlich unerreichbar blieb. Er kannte jeden Kniff, wusste genau, wie ihre Geschichten funktionierten, durchschaute ihr filigranes Räderwerk, und doch erging es ihm wie dem Mechaniker, der zwar einen Motor zerlegen kann, selbst aber niemals etwas Vergleichbares konstruieren könnte.
Dabei war er überzeugt gewesen, dass New York ihm den kreativen Schub bescheren würde, der ihm in London nicht vergönnt gewesen war. Das silberne Band des Hudson am frühen Morgen, die Ströme der Rücklichter auf der Lexington Ecke 3rd, die schiere Ausdehnung dieser Stadt, monumental und intim zugleich: Manhattan selbst war ein Roman, ein Ort, an dem die Geschichten auf der Straße lagen, dachte er. Aber da hatte er sich getäuscht, und so ging er im zweiten Jahr dazu über, seine journalistischen Texte mit literarischen Elementen zu garnieren.
Er begann vor der eigenen Haustür, mit einer Story über Ali, den armenischen Besitzer des Kiosks an der Ecke. Er folgte dem Tagesablauf dieses Mannes vom frühen Morgen, wenn er den Gehsteig vor seinem Laden schrubbte, bis tief in die Nacht, wenn er zugekokste SoHo-Models mit Kondomen und Kaugummi versorgte. Die Story erschien in der Zeitschrift The Atlantic, und der Redakteur wollte mehr. Also richtete Michael sein Augenmerk auf das Haus gegenüber und Marilia, die schwarze Mutter von sechs Kindern, die sich seit zwanzig Jahren ehrenamtlich als Schülerlotsin engagierte. Über Marilia bekam er Zugang zu der betreffenden Schule und ihrem überlasteten Direktor, der sich redlich bemühte, trotz Personalmangels einen regulären Unterricht zu garantieren, Waffen aus der Schule herauszuhalten und den Ansprüchen nerviger Helikoptereltern gerecht zu werden.
Bei seinen Recherchen stellte Michael verwundert fest, dass sein britischer Akzent ihm eine große Hilfe war. Er öffnete ihm Türen, die Journalisten sonst verschlossen blieben, nicht unbedingt bei Ämtern und Institutionen, aber bei den Leuten selbst. Auf wen er auch zuging, alle schrieben ihm automatisch dieselbe Seriosität zu, die sie mit der BBC oder Merchant-Ivory-Filmen assoziierten. Dadurch, vor allem aber durch seine geduldige Art und seine unaufgeregte Neugier kam er den Menschen schnell näher. Sie vertrauten ihm, und er, ein genauer Chronist, dem kein noch so winziges Detail entging, versuchte die Welt durch ihre Augen zu betrachten, durch ihre Haut zu spüren.
Ganz gleich, über wen er schrieb, den Millionär mit Residenz am Central Park oder den Obdachlosen in der Bronx, seine Technik war immer dieselbe: Annäherung bis zur Selbstaufgabe. Er tauchte ein in die ihm fremde Welt, bis sein Gegenüber nicht nur seinen aristokratischen englischen Akzent vergessen hatte, sondern auch, dass er, Michael, überhaupt da war. Er schnitt sich Hunderte weißer Karteikarten so zurecht, dass sie bequem in die Innentasche seines Jacketts passten. Sie wirkten nicht so offiziell wie ein Notizbuch und deshalb auch nicht so bedrohlich, eben weiter nichts als kleine Zettelchen, auf denen man rasch etwas notiert und die früher oder später im Papierkorb landen.
Wenn er nach monatelanger Recherche das Gefühl hatte, genug gesehen und gehört zu haben – und es war wirklich eher ein Gefühl als ein überprüfbares Urteil, eine undeutliche Wahrnehmung am Rande seines Blickfelds –, zog er sich ebenso schnell aus dem Leben seiner Gesprächspartner zurück, wie er gekommen war, und nahm ihre Geschichte mit in seine Wohnung in SoHo, wo er von Neuem in die Story eintauchte. Er griff dafür auf Romantechniken zurück: indem er nicht nur aus dem Leben seiner Protagonisten verschwand, sondern auch aus dem Text, den er über sie schrieb. Obwohl er natürlich dabei gewesen war, als der Lebensmittelkontrolleur die Ratte entdeckt hatte, ein Schüler dem Mathelehrer an die Gurgel gegangen war und der Hund des Millionärs hatte eingeschläfert werden müssen, tauchte Michael in dem fertigen Artikel nicht auf. Nur seine Hauptfiguren waren noch da und bewegten sich in der dritten Person durch ihr Leben und die Stadt, wie im Roman.
Sein Stil war gewissermaßen der Gegenentwurf zum Gonzo-Journalismus: die vollständige Tilgung des Autors aus dem Text. Ein Trick, der nur funktionierte, weil er über so viel Material verfügte, dass sich die Geschichte auch in den verbliebenen toten Winkeln problemlos fortschreiben ließ. Obwohl er nicht dabei gewesen war, wusste er genau, wie Ali sich beim Aufwachen fühlte. Oder Marilia, wenn sie unter der Dusche sang. Oder eben der Millionär, wenn er in einem morgendlichen Meeting in Brasilien den ersten Kaffee trank. Er extrapolierte einfach das, was er bei anderer Gelegenheit über sie erfahren hatte, und stieß so in eigentlich ungesicherte Bereiche vor, was die Story jedoch umso wahrhaftiger erscheinen ließ. Das war die verbindende Idee dieser frühen New Yorker Reportagen: die dichterische Freiheit als Werkzeug des Realismus.
Als er Nico und Raoul kennenlernte, war er bereits auf der Suche nach einem Stoff, der mehr füllte als ein paar Zeitschriftenseiten. Dass aus seinem Roman nichts geworden war, hatte an seinem Wunsch, endlich ein richtiger Schriftsteller zu werden, nichts geändert. Nun, mit einer Reihe respektabler Reportagen in der Tasche und einem Ensemble wirklichkeitsnaher Charaktere in der Hinterhand, wollte er einen zweiten Versuch wagen.
Den Kontakt zu Nico und Raoul stellte ein Polizist her. Es war Februar, verharschter Schneematsch säumte den Straßenrand, und sie standen mit ihrem Coffee to go am U-Bahn-Eingang Broadway Ecke 201st. In den Schaufenstern spiegelte sich fahles Winterlicht, und die Pendler trugen Steppjacken, Handschuhe und Wintermützen, die eigentlich für Trekkingtouren im Hochgebirge gedacht waren.
Michael war an diesem Morgen zum Inwood Hill Park hinausgefahren, weil er sich die Stelle ansehen wollte, wo holländische Kaufleute den Lenape-Indianern einst Manhattan abgekauft hatten – für einen Sack voll Plunder im Wert von vierundzwanzig Dollar. Er kannte die Gegend nördlich von Washington Heights erst seit Kurzem, aber ihre Authentizität hatte ihn auf Anhieb fasziniert. Das Straßentheater rings um Inwood Street, Dyckman Street und Broadway war deutlich migrantischer geprägt als noch hundert Straßen weiter südlich. Männer aus der DomRep spielten Domino vor ehemals irischen Pubs, deren Wände noch immer mit Kleeblatt und IRA-Flagge bemalt waren. An den Ampeln warteten Gangsta-SUVs mit dunklen Scheiben und versorgten die Umgebung mit wummernden Reggaeton-Beats. In den Salsa-Clubs schlürften puerto-ricanische Dragqueens bonbonfarbene Cocktails, und an den Ecken standen Jugendliche in knielangen Hip-Hop-Shirts und klopften coole Sprüche. Im Park hetzten langgliedrige schwarze Kids zwischen Basketballringen hin und her, italienische Großväter sahen sich ein Little-League-Baseballspiel an, und vom nahe gelegenen Fußballplatz hallten die Schreie der mexikanischen Kicker herüber.
Jenseits der 200th Street hatte Michael das Gefühl, dem ursprünglichen Geist von Manhattan näher zu sein als irgendwo sonst in der Stadt. Was auch immer die holländischen Kaufleute damals getrieben hatte, hier lag es noch in der Luft, ganz anders als in den weiter südlich gelegenen Vierteln, wo das Geld schon so viel Patina angesetzt hatte, dass die Herkunft nicht mehr durchschien. Jede Einwanderergruppe, egal ob aus der Dominikanischen Republik, Mexiko, Irland oder Afrika, kam ihm vor wie der Jahresring eines Baums, der über Wachstum und Wandel auf dieser Insel Auskunft gab.
Michael hatte den Polizisten an einem Kaffeestand am Rand des Parks angesprochen und gefragt, ob sich die Gegend in den vergangenen Jahren stark verändert habe. Der Cop konnte darüber nur lachen. »O Mann«, sagte er kopfschüttelnd, »haben Sie ne Ahnung. Hier bleibt nichts lange so, wie es ist.« Auf dem Weg zu seinem Posten an der U-Bahn unterhielten sie sich weiter. Michael fragte nach der Kriminalität im Viertel. Der Cop zuckte die Achseln. »Ach, das hält sich im Rahmen. Hauptsächlich Drogenhandel, häusliche Gewalt und so.« Fußstampfend pustete er auf seinen Kaffee. Dann erzählte er Michael von zwei Brüdern aus der Dominikanischen Republik, »Unruhestifter, wie sie im Buche stehen«. Die beiden waren um vier Uhr früh die Arden Street entlangmarschiert und hatten die Seitenfenster sämtlicher Autos eingeschlagen. Dutzende Alarmanlagen jaulten, ein heulendes, blinkendes Inferno, während ringsum die Fenster aufgerissen wurden und Männer im Unterhemd wütend nach Ruhe brüllten.
Noch während der Polizist die Szene schilderte, wusste Michael, dass er das Brüderpärchen kennenlernen wollte. Wer waren sie? Wie verzweifelt musste man sein, um mit solcher Zerstörungswut auf die eigene Lage aufmerksam zu machen? Über die Gründe brauchte er nicht lange zu spekulieren, er ahnte, was für Geschichten sich hinter diesem Vorfall verbargen. Er fragte den Cop, ob er die beiden treffen könne. Der Cop, ein breitgesichtiger Latino mit buschigem Schnauzer, zog die Augenbrauen hoch und schnalzte mit der Zunge. Michael holte einen Fünfziger aus seinem Portemonnaie und faltete ihn zweimal. Der Polizist warf einen kurzen Blick darauf, bevor er das Geld an sich nahm und es achselzuckend in seiner Tasche verschwinden ließ, ganz so als ob er sagen wollte: Wer bin ich, um mich gegen die Ordnung der Dinge zu stemmen? Und schon am nächsten Morgen trat Michael dem Problem-Duo im Büro ihres Sozialarbeiters unter die misstrauischen Augen. Die beiden hießen Nico und Raoul.
In den folgenden drei Jahren nahm Michael bis zu vier Mal die Woche den A-Train in Richtung Norden und tauchte in das Leben der beiden Brüder ein. Manchmal mietete er sich in einer Pension unweit des Parks ein Zimmer und verbrachte mehrere Tage am Stück in der Nachbarschaft. Dreimal erlebte er hier den Indian Summer mit seiner unbeschreiblichen Farbexplosion. Dort, wo sich heute der Park befand, hatten die Lenape-Indianer einst ihre Wohnhöhlen in die Kalksteinformationen geschlagen. Nach einem Jahr erhielt er vom Inhaber der Pension einen Treuebonus in Form eines alten Schreibtischs, der den vielen Kerben nach zu urteilen wohl einmal ein Küchentisch gewesen war. Und während Michael in seiner Dachkammer saß und seine Notizen ins Reine schrieb, begann draußen die schleichende Gentrifizierung des Viertels. Aus den Bücherständen auf dem sonntäglichen Markt wurden Antiquariate und Cafés. Immobilienmakler zogen ein, wo noch vor Kurzem Waschsalons und Schustereien ihre Dienste feilgeboten hatten. Junge weiße Paare strichen die Fassaden bislang vernagelter Häuser. Und selbst mitten in der Woche sah man Mütter mit farbenfrohen Buggys und Babytragen nachmittags im Park spazieren gehen.
Dass er so gut wie nichts über die Welt der Brüder wusste, kam Michael anfangs sehr zugute. Er passte einfach nicht ins Bild, dieser schlaksige Engländer mit seiner Spießerfrisur und einem Akzent wie aus einer britischen Sitcom. Aber er war ganz nützlich, wenn es darum ging, einen Sozialarbeiter zu belabern oder ein paar Scheine abzustauben. Dann wiederum war er wie ein Kind, wissbegierig und lerneifrig, er wollte verstehen, was in der Gegend vor sich ging, und das Gelernte anschließend mit nach Hause nehmen. Doch ganz allmählich, über Monate und Jahre, schmolz ihr Wissensvorsprung dahin. Wie man sich unauffällig in ein fremdes Leben einpasste, wusste er von seinen Reportagen. Dabei machte er sich nie mit seinem Gegenstand gemein, er war einfach immer nur da. So viel Zähigkeit trug ihm bei den Freunden von Nico und Raoul bald einen gewissen Respekt ein, denn er hörte ihnen wenigstens zu und versuchte, ihre Sicht der Dinge zu verstehen. In der kleinen Welt von Inwood avancierte er bald zu einem gefragten Ratgeber. So wusste er beispielsweise schon vor Nico, dass Nicos Freundin schwanger war. Und von Raoul erfuhr er unter dem Siegel der Verschwiegenheit, dass dieser die Seiten gewechselt hatte und inzwischen für einen rivalisierenden Dealer arbeitete. Natürlich hatte so viel Insiderwissen nicht nur Vorteile. Mehr als einmal wollte die Polizei Informationen von ihm, und das machte die Erfahreneren unter den Jungs nervös. Vor einem Michael mit allerhand Geschichten anzugeben, war eines. Aber ein Mikey, der wusste, was wirklich abging, war etwas völlig anderes.
Der A-Train, mit dem Michael von SoHo nach Inwood fuhr, folgte einem alten Jagdpfad der Lenape quer durch die Wälder und Hügel Manhattans. Und als habe er geahnt, dass Michael diese Strecke aus ähnlichen Gründen nahm wie einst die Indianer, fühlte Nico ihm eines Morgens auf den Zahn. Sie saßen in der Wohnung einer Tante, einem winzigen Apartment in einer Sozialsiedlung an der 10th Avenue.
»Ich schwör’s dir, el tronco hier will uns abzocken«, sagte er vom Sofa aus zu Raoul, ohne Michael aus den Augen zu lassen. »Ist doch so, Mikey, oder?«, sagte er und schnippte einen Zahnstocher in Michaels Richtung. »Die geldgeile puta will uns ficken, stimmt doch, Mikey? Du willst die ganze Scheiße hier zu Gold machen.«
Michael tat die Bemerkung mit einem Lachen ab, doch einige Sekunden lang lag eine unangenehme Spannung in der Luft. Weniger wegen des drohenden Tons, der ihm entgegenschlug, sondern weil sie alle wussten, dass es stimmte, auch wenn er es sich nicht eingestehen mochte.
Fünf Jahre nach der ersten Begegnung mit Nico und Raoul im Büro ihres Sozialarbeiters erschien BrotherHoods. Michael hatte eigentlich gehofft, das Buch würde die Lage der Brüder verbessern, aber das tat es nicht. HBO zahlte ihnen jeweils fünfundzwanzigtausend Dollar für die Rechte an ihrer Biografie und wollte eine Serie daraus machen. Mehrere Staffeln, Box-Sets, Werbung auf Bussen und Bahnen. Doch daraus wurde nichts. Eine Zeit lang sonnten sie sich in ihrem fragwürdigen Ruhm, doch am Ende verschärften das Geld und die öffentliche Aufmerksamkeit ihre Probleme noch. Während das Buch sich langsam, aber sicher zur heißesten Neuerscheinung der Saison entwickelte, trat Nico eine Haftstrafe wegen unerlaubten Waffenbesitzes an. Raoul, ohne den Schutz seines Bruders, floh nach Pennsylvania zu einem Verwandten, weil er Ärger mit einem Dealer hatte. Und während sie die Stadt verließen, machten immer mehr New Yorker ihre Bekanntschaft: in der U-Bahn, auf Parkbänken, unter der Bettdecke im Schein der Nachttischlampe. Doch nicht nur in New York, auch in Vermont, in San Francisco, ja im ganzen Land verschlangen Studenten, Pendler, Ehepaare die tragische Lebensgeschichte der beiden Brüder.
Kaum war das Buch erschienen, erhielt Michael erste Interviewanfragen und Talkshowangebote. Die New York Times, die einst seine Artikel gedruckt hatte, brachte nun ein großes Porträt über ihn. Ihm fiel auf, wie sehr er sein Privatleben vernachlässigt hatte. Zwar hatte es einige Liebschaften gegeben, doch war nie mehr daraus geworden, weil die manische Recherche und sein Doppelleben alles andere aufgefressen hatten. Erst hatten sich alle seine Gedanken um die BrotherHoods-Brüder gedreht, dann um das Buch, das daraus werden sollte. Fünf Jahre lang hatte er nicht nur mit ihnen gelebt, sondern nicht selten auch durch sie, wobei er zum bloßen Beobachter und sein Leben zu einer leeren Hülle geworden war. Doch jetzt, wo das Buch vorlag, fand er Frauen plötzlich wieder interessant – und die Frauen ihn. Er war fünfunddreißig, Single und ein erfolgreicher New Yorker Autor. Er fing etwas mit seiner Agentin an. Dann kam die schwarze Journalistin mit dominikanischen Wurzeln. Das Interview mit ihr war hart gewesen, der Ton aggressiv, doch anschließend hatte sie ihn zum Abendessen eingeladen, und bald waren sie ein Paar geworden. Die Beziehung hatte nicht lange gehalten. Unter anderem deshalb, weil er nach einer Lesung an der Columbia nicht nur eine, sondern gleich zwei Studentinnen aus dem Publikum abgeschleppt hatte.
Er war sich durchaus darüber im Klaren, wie vorhersehbar und klischeehaft das alles wirkte. Aber erstens schadete er niemandem, und zweitens hatte er sich nach fünf Jahren harter Arbeit ein kleines bisschen Abwechslung redlich verdient. Doch insgeheim hatte er von Anfang an gewusst, dass der Spaß ein Ende haben würde, nur deshalb hatte er auch so bereitwillig zugegriffen, als ihm die beiden Früchtchen von der Columbia in den Schoß gefallen waren.
Für Nico und Raoul wurden BrotherHoods und sein Autor zu einer weiteren Enttäuschung, die nur bestätigte, was sie immer schon geahnt hatten: dass die Welt sich gegen sie verschworen hatte. Michael versuchte zwar, mit ihnen in Kontakt zu bleiben, aber nach Erscheinen des Buches trennten sich ihre Wege. Während Nico im Knast saß und Raoul in Pennsylvania untergetaucht war, schickte der Verlag Michael auf Lesetour. Michael war alles andere als ein geborener Entertainer, aber er lernte schnell, wie er sich verkaufen musste: mit Zurückhaltung und einem Schuss trockenem Humor, den Journalisten und PR-Leute gern als »typisch britisch« deklarierten. Doch egal, ob in dünn besetzten Veranstaltungen wie in Ohio und Carolina oder vor vollem Haus wie in Austin oder Los Angeles, die ernste Absicht des Buches, betonte er, sei ihm wichtig, trotz des launigen Titels. Sicher, primär gehe es um zwei schwarze Einwanderer in Inwood, aber im Grund gehe es um alle Menschen, deren hervorstechendstes Merkmal es nun einmal sei, sich trotz großer räumlicher Nähe maximal voneinander abzugrenzen. »Schauen Sie sich um«, sagte er. »Diesen Leuten begegnen Sie tagtäglich auf der Straße, ihre Geschichten könnten auch die Ihren sein. Niemand, kein Mann, keine Frau, kein Kind, ist eine Insel.«
Zustimmendes Nicken im Saal, Applaus, dann wurden Bücher signiert. Bei Erscheinen der Taschenbuchausgabe spendete er einen Teil seiner Tantiemen an Bildungsprojekte in Inwood und Washington Heights. Aber jedes Mal, wenn er das mit der Abgrenzung bei größter räumlicher Nähe sagte, wurde ihm schmerzlich bewusst, dass auch er sich immer weiter von den Brüdern entfernte, die ihn so großzügig an ihrem Leben hatten teilhaben lassen. Während er sich quer durchs Land bewegt hatte, vom Hotel zum Flughafen, vom Flughafen zur Uni, hatten auch Nico und Raoul sich bewegt: Nico von der Zelle in den Speisesaal, vom Speisesaal hinaus auf den Hof, von Hofgang wieder zurück in die Zelle; Raoul von Verwandten in Pennsylvania zu Verwandten in Albany, danach weiter zu einem Mädchen, das er auf der Straße kennengelernt hatte, und schließlich auf die Couch ihrer Freundin. Innerhalb weniger Monate waren die Jahre mit den Brüdern für Michael nur noch eine ferne Erinnerung. Die Veröffentlichung ihrer gemeinsamen Geschichte hatte sie nahezu ausgelöscht.
Michael hörte Nicos Stimme das letzte Mal, als der ihn per R-Gespräch aus der Haftanstalt anrief. Michael hatte beschlossen, endgültig zurück nach London zu ziehen. Seine Mutter, seit drei Jahren verwitwet, war schwer erkrankt, außerdem kam BrotherHoods bald in England heraus. Höchste Zeit, in New York die Zelte abzubrechen. Wenn er noch länger blieb, würde die Stadt ihn nie wieder loslassen. Zwar hatte er dort seine Stimme und seine Geschichte gefunden, aber er wurde das Gefühl nicht los, dass er hier auf der Stelle trat. Für einen Tapetenwechsel war New York ideal gewesen, doch so seltsam es sich anhörte, der nächste Schritt konnte ihm nur gelingen, wenn er zurückkehrte.
Als das Telefon klingelte, krabbelte Michael gerade in seiner Wohnung in der Sullivan Street zwischen Umzugskartons und Luftpolsterfolie herum. Er nahm das R-Gespräch an, legte es jedoch sofort auf den Anrufbeantworter, noch ehe Nico etwas sagen konnte. Er hatte in dieser Woche schon zwei Mal mit ihm gesprochen und ertrug einfach keine weitere peinlich-verlegene Unterhaltung mehr, jedenfalls nicht während seines Umzugs. Und so stand er in der halb leeren Wohnung und lauschte. Auf der 6th Avenue jaulte hartnäckig eine Feuerwehrsirene, während die Stimme eines Mannes, den er als Jugendlichen kennengelernt hatte, durch sein Wohnzimmer hallte.
»Hey, Mikey?«, sagte Nico, und seine Stimme klang einsam und verloren wie in einem leeren Hangar. »Ich bin’s, Nico. Bist du da? Mann, hier ist Nico, geh endlich dran.«
Dann hörte Michael, wie eine Stahltür aufgeschlossen wurde, und anschließend das knisternde Funkgerät eines Vollzugsbeamten.
Einige Sekunden lang atmete Nico langsam und gleichmäßig in den Hörer. »Okay, das war’s dann wohl«, sagte er schließlich. »Hasta luego, Bro, mach’s gut.«
Dann wurde es still in der Leitung. Der Anrufbeantworter signalisierte blinkend den Eingang einer Nachricht. Einen Moment lang sah Michael auf das pulsierende rote Lämpchen, dann schnappte er sich den Schlüsselbund vom Küchentisch und verließ die Wohnung. Unten angekommen, stieß er die Haustür auf, überquerte die Straße und ging in der Frühlingssonne nach Norden, in Richtung Washington Square. Die Fenster in den oberen Geschossen der Häuser fingen die Sonne ein, und ihr Gleißen folgte ihm in den Augenwinkeln. Als er in die Prince Street einbog, wehte ihm eine kühlende Brise entgegen, die nach Zimt und Bagels roch. Michael beschleunigte seine Schritte, als wollte er der Erinnerung an Nicos Stimme davonlaufen oder als berge der süße Duft ein fantastisches Zukunftsversprechen.
3
Caroline war erst seit drei Wochen in London, als sie sich das erste Mal begegneten. Ein gemeinsamer Freund zeigte einen Dokumentarfilm im Frontline Club in Paddington, einem Londoner Treffpunkt für Korrespondenten, Journalisten und Filmemacher. Die Vorführung fand im obersten Stock des Clubs statt. Während der Regen gegen die Fenster prasselte, flimmerten Bilder aus Simbabwe über die Leinwand: Harare, Bulawayo und die offene Steppe. Doch eigentlich ging es um die »Operation Murambatsvina« – Müllentsorgung – von Präsident Mugabe, sprich die Vertreibung von siebenhunderttausend Slumbewohnern aus ihren »illegalen« Unterkünften im Winter 2005. Caroline sah, wie eine alte Frau mit roter Pudelmütze von mehreren Polizisten gezwungen wurde, ihre primitive Behausung aus unverputzten Hohlblocksteinen mit einem Vorschlaghammer eigenhändig zu zertrümmern.
Irgendetwas an dem Gegensatz machte sie nervös: Hier regenblinde Fenster und das Geräusch von Reifen auf nassem Asphalt, dort Jacarandas und Akazien im Abendrot. Sie hatte in Nairobi und Kapstadt gelebt und kannte jedes Land in Afrika. Was sie dort auf der Leinwand sah, war schrecklich und wunderschön zugleich. Sie war seit noch nicht einmal drei Wochen in England, und schon zerrten diese Bilder an ihr, denen sie sich verbunden fühlte wie durch eine Nabelschnur. Trotzdem wehrte sie sich dagegen, denn das morgendliche Erwachen in Dubai wirkte noch immer in ihr nach. Und obwohl sie diese neue Stimme in ihrem Innern nicht verstand, musste sie auf sie hören.
Es war Caroline, die Michael zuerst entdeckte. Er saß ein paar Reihen vor ihr, und der Widerschein der Leinwand erhellte sein Profil. Sie begann, ihn zu beobachten. Die blonden Haare waren nach hinten gekämmt, und sein Hemdkragen saß schief, sodass das Etikett zu sehen war. Wenn er sich seinem Nebenmann zuwandte, glaubte sie zu erahnen, dass er sich irgendwann einmal das Nasenbein gebrochen hatte – was ihn nur noch interessanter machte. Er kam ihr irgendwie bekannt vor, doch erst später, an der Bar, fiel ihr ein, wo sie ihn schon einmal gesehen hatte: auf der Rückseite eines der Bücher, die sie vor drei Wochen in ihrem Handgepäck verstaut hatte.
Die einzigen Leute, die Caroline im Frontline kannte, hatten sich bereits verabschiedet. Sie nahm einen letzten Schluck aus ihrer Bierflasche, dann ging sie auf Michael zu. Er unterhielt sich gerade mit einem älteren Mann, einem in Unehren ergrauten Reporter, der sich seinerzeit als Kriegsberichterstatter in Vietnam einen Namen gemacht hatte. Statt eine Gesprächspause abzuwarten, meldete Caroline sich ungefragt zu Wort.
»Die Fakten allein reichen nicht«, sagte sie vorlaut und stellte die leere Flasche auf die Theke. Sie sah zu Michael hoch. »Auf die Hintergründe kommt es an. Guter Spruch«, fuhr sie fort und fixierte ihn mit ihrem Blick. »Und so wahr!«
Michael sah zu der Frau hinunter, die ihn unterbrochen hatte. Zunächst wusste er nicht, wovon sie sprach. Und als der Groschen schließlich gefallen war, fragte er sich, ob sie es ernst meinte oder ihn auf den Arm nehmen wollte. Aber sie lächelte nur, und ihre Miene verriet nichts.
»Danke«, sagte Michael. »Aber der ist nicht von mir. Ich habe ihn nur aufgeschrieben.«
Sie sah sich um. »Willkommen im Club«, sagte sie. »Oder glaubst du, irgendjemand hier hätte je seine eigene Geschichte aufgeschrieben? Und wenn, wen interessiert das schon?«
Michael sah seinen Bekannten an. »Wie siehst du das, Bill?« Aber Bill unterhielt sich bereits mit jemand anderem.
»Caroline«, sagte sie und streckte ihm die Hand hin.
»Michael«, antwortete er. Ihr Händedruck war sanft, aber fest. Als sie sich auf den frei gewordenen Barhocker zog, fiel Michaels Blick auf ihre schlanken Schenkel. Sie trug Jeans, Biker-Boots und einen Oversized-Pulli, der eine Schulter freiließ. Michael spürte die Wärme, die von der gebräunten Haut abstrahlte. Was ihm ebenfalls sofort auffiel: die goldenen Einschlüsse in ihren braunen Augen. Ein paar Wochen später, im Bett, sollte er dieses Glitzern als »Katzengold« bezeichnen – Lockmittel für Männer wie ihn. Doch fürs Erste erwiderte er nur ihren offenen Blick.
»Also, mir hat er gefallen«, sagte Caroline. »Der Spruch. Aber der Rest war auch nicht schlecht.«
»Schreibst du auch?«, fragte er.
»Nein«, sagte sie. Wieder ließ die den Blick durch den Schankraum wandern, als musterte sie die Gäste. Michael hätte gern mehr über sie gewusst. Aber sie hielt sich bedeckt.
»Hast du schon was gegessen?«, fragte sie stattdessen und wandte sich wieder ihm zu. »Zu viele Schwanzträger im Saal, da versteht man ja sein eigenes Wort nicht.«
Er konnte ihren Akzent nicht recht einordnen. Er startete irgendwo in Europa, migrierte mitten im Satz jedoch nach Afrika.
Als Michael lachte, wusste Caroline, dass sie früher oder später mit ihm schlafen würde, mit diesem Mann, dessen Buch sie, wenn auch nur zur Hälfte, im Flugzeug gelesen hatte und dem sie jetzt in einer Londoner Bar über den Weg gelaufen war.
Die Frau hinter ihr wurde laut und schrie einen Mann mit Halbglatze an, der unentwegt den Kopf schüttelte.
»Aber das ist doch gar nichts«, rief sie und gestikulierte gefährlich mit ihrem halb vollen Weinglas. »Warst du mal in Somalia?«
»Himmel«, sagte Caroline und verzog schmerzhaft das Gesicht. Dann hörte sie Michael an ihrem Ohr.
»Siehst du, man braucht gar keinen Schwanz, um sich hier wichtigzumachen.« Wie sie ihm eines Morgens etwa vier Wochen nach ihrer Hochzeit am Frühstückstisch verriet, war dies der Moment, in dem ihre Entscheidung feststand.
Sie flohen vor dem Regen in ein libanesisches Restaurant in U-Bahn-Nähe und bestellten sich etwas zu essen, rührten es jedoch kaum an. Stattdessen betranken sie sich mit zwei Flaschen Rosé aus der Bekaa-Ebene, und Caroline erzählte Michael, dass sie während des Bürgerkriegs versucht hatte, dort einen Film über die Haschischbauern zu drehen.
Als sie das Restaurant endlich verließen, wurde in der Küche bereits geputzt und die Kellner stellten die Stühle hoch. Der Regen hatte aufgehört, und die Neonlichter spiegelten sich auf dem nassen Gehsteig. Caroline legte den Arm um Michaels Hüfte und schob die Fingerspitzen in die Gesäßtasche seiner Jeans. Michael legte den Arm um ihre Schulter, und sie schmiegte dafür den Kopf an seine Brust. So gingen sie schweigend ein paar Schritte. Da plötzlich spürte Caroline, wie Michael tief Luft holte, und sie wusste, was nun kommen würde. Er habe eine Freundin, sagte er. Sie sei zwar – jobbedingt – noch in New York, aber es sei ihnen ernst, und sie wollten, trotz der Entfernung, unbedingt zusammenbleiben.
Doch das klang selbst in Michaels Ohren wenig überzeugend. Und auch Caroline hörte die vertraute Melodie einer sterbenden Beziehung sofort heraus. Trotzdem ließ sie ihn reden und erklären und machte sich erst von ihm los, als sie am Eingang zur U-Bahn standen und er endlich den Mund hielt. Sie trat einen Schritt zurück und hob kapitulierend die Arme.
»Na wenn das so ist, Mr Edelfeder, nehme ich mir wohl besser ein Taxi«, sagte sie, machte auf dem Absatz kehrt, trat an die Bordsteinkante und winkte eins heran. »Trotzdem danke für den schönen Abend«, rief sie über die Schulter. »War nett mit dir.«
»Fand ich auch«, gab Michael zurück. »Was hältst du davon, wenn …?« Doch sie war schon außer Hörweite und trippelte auf Zehenspitzen zu dem wartenden Taxi.
Michael sah zu, wie sie einstieg. Bevor sie die Tür zuzog, rief sie ihm über den Gehsteig noch etwas zu.
»Sag mir Bescheid, wenn es vorbei ist.« Dann fiel die Tür ins Schloss, und sie beugte sich vor, um dem Fahrer ihre Adresse zu nennen.
Obwohl keiner von beiden winkte, als das Taxi losfuhr und sich in den Verkehr einfädelte, konnten sie die Augen nicht voneinander lassen. Sie sahen sich so lange nach – Caroline durch die Heckscheibe des Taxis, Michael vom Straßenrand –, bis das Taxi in der Masse der Autos verschwunden und Michael zu einem Strich vor der erleuchteten U-Bahn-Treppe geworden war.
Später meinten ihre Freunde, Caroline und Michael seien schlicht durch die Gunst der Stunde zusammengekommen. Kein Mensch glaubte, dass sie wirklich zueinander passten, und niemand sprach von Liebe. Aber was auch immer an jenem Abend geschehen war, von einer überstürzten, rauschhaften Beziehung konnte nicht die Rede sein, im Gegenteil, ihr Verhältnis war von Anfang an von bemerkenswerter Entspanntheit, glich eher einer Rückbesinnung als einem Neuanfang.
Beim nächsten Mal trafen sie sich zum Abendessen in Covent Garden. Caroline, die Michael bisher nur in Jeans und Pullover gesehen hatte, erschien in High Heels und einem knöchellangen grauen Mantel, darunter ein kleines Schwarzes. Sie hatte sich die Haare geglättet und Make-up aufgelegt. Nachdem sie den Mantel an der Garderobe abgegeben hatte und auf seinen Tisch zukam, bemerkte Michael, dass sie sämtliche Blicke auf sich zog. Ihm wurde klar, dass sie jederzeit in der Lage war, eine solche Reaktion zu provozieren. Dass sie normalerweise darauf verzichtete, machte sie in seinen Augen nur noch attraktiver. Als er aufstand und ihr einen Stuhl anbot, kam er sich vor wie der Gewinner einer Kuppelshow.
Was Caroline anging, so hatte sie sich bereits für Michael entschieden. Nicht etwa, weil sie das Gefühl hatte, dass in ihrem Leben etwas fehlte, und auch nicht, weil sie sich von seinem feinsinnigen Humor und seinem Aussehen angezogen fühlte, beides Qualitäten, deren Wert sich ihr erst allmählich offenbart hatte, wie ein gut gehütetes Geheimnis. All diese Eigenschaften kannte sie auch schon aus früheren Beziehungen und hatte sie für letztlich nicht ausreichend befunden. Neu hingegen war die Ruhe dieses Mannes, seine Fähigkeit, das Leben leicht zu nehmen, ohne arrogant oder oberflächlich zu wirken. Bei jenem ersten Abendessen war es ihr noch nicht bewusst, und vielleicht kam sie auch während ihrer kurzen Ehe gar nicht in den Genuss dieser Erkenntnis, aber es handelte sich hierbei weniger um eine persönliche als vielmehr um eine regionale Eigenart. Wäre Caroline je nach Cornwall gefahren, vielleicht in eines der Dörfer und Städtchen entlang der Küste, in denen Michael aufgewachsen war – Gorran Haven, St Mawes, Mevagissey –, sie hätte viele Männer kennenlernen können, die ähnliche Charakterzüge besaßen. Fischer, Farmer, Lageristen. Bei ihnen allen hätte sie diese vorsichtig-optimistische Perspektive auf die Welt vorgefunden, Erbe der Vergangenheit an einem Ort, an dem das Meer vieles geben, aber auch alles nehmen kann. Statt dieser Landschaft treu zu bleiben, die ihn geprägt hatte, war Michael mit diesem Erbe in die große Stadt gezogen und fragte sich später tatsächlich, ob Caroline sich nicht vielleicht doch eher in das Meer verliebt hatte als in ihn. Als ob nicht er selbst ihr Leben komplettierte, sondern vielmehr der Ort, aus dem er stammte und den sie durch ihn zu erspüren glaubte.
An jenem Abend schliefen sie zum ersten Mal miteinander, in ihrer neuen Wohnung in Farrington. Während ihre kleinen Hände unter sein Hemd glitten, öffnete er ihren Reißverschluss und streifte ihr das Kleid von den Schultern. Ihr Körper war fest und schlank, ihre Unterwäsche erstaunlich schlicht. Ganz anders als sie selbst. Er war über Nacht geblieben, und sie hatte ihn am nächsten Morgen – wiederum mit ihren Händen – geweckt und ihn im Halbschlaf von hinten in sich eindringen lassen, während die Sonne schon durch das Laken schien, mit dem sie das Fenster verhängt hatte.