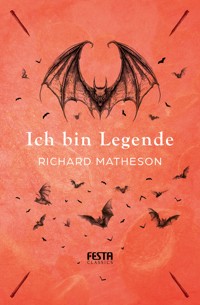
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Roman, so unsterblich wie ein Vampir. Robert Neville ist der letzte lebende Mensch ... Alle anderen wurden durch eine Seuche zu Vampiren. Und diese Kreaturen gieren nach seinem Blut. Tagsüber ist er der Jäger, der in den verlassenen Ruinen der Zivilisation nach den schlafenden Untoten sucht und sie vernichtet. Nachts verbarrikadiert er sich in seinem Haus und betet darum, dass der neue Tag endlich anbricht. Wie lange kann ein einzelner Mann in einer Welt voller Vampire überleben? Dean Koontz: »Der intelligenteste und fesselndste Vampirroman seit Dracula.« Stephen King: »Richard Matheson ist der Autor, der mich am meisten beeinflusst hat.« Washington Post: »Man kann Richard Matheson mit Fug und Recht als den einflussreichsten amerikanischen Fantastik-Autor zwischen H. P. Lovecraft und Stephen King bezeichnen.« Der berühmte Klassiker I AM LEGEND in neuer Übersetzung. Er wurde bereits viermal verfilmt und 2012 zum »besten Vampirroman der letzten hundert Jahre« gekürt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Manfred Sanders
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe I am Legend
Copyright © 1971, renewed 1999 by Richard Matheson
1. Auflage 2025
Copyright © dieser Ausgabe 2025 by
Festa Verlag GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 10
04451 Borsdorf
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Titelbild: Festa Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
eBook 978-3-98676-250-6
www.festa-verlag.de
Für HENRY KUTTNER
mit tief empfundenem Dank für seine Hilfe und Ermutigung bei diesem Buch
TEIL EINS
JANUAR 1976
1
An trüben Tagen war sich Robert Neville nie ganz sicher, wann die Sonne untergehen würde, und dann waren sie manchmal schon auf den Straßen, bevor er es nach Hause schaffte.
Mit etwas Nachdenken hätte er die ungefähre Zeit ihres Auftauchens vielleicht berechnen können, aber er war es schon sein ganzes Leben lang gewohnt, den Anbruch der Nacht anhand des Himmels abzuschätzen – und an bewölkten Tagen funktionierte diese Methode nicht besonders gut. Deshalb blieb er an solchen Tagen lieber in der Nähe des Hauses.
Mit einer Zigarette im Mundwinkel, von der ein dünner Rauchfaden über seine Schulter wehte, ging er im tristen Grau des Nachmittags um das Haus herum. Er überprüfte an allen Fenstern, ob die angenagelten Bretter gelockert waren. Nach besonders heftigen Angriffen waren sie oft gespalten oder halb abgerissen, dann musste er sie ersetzen – eine Arbeit, die er hasste. Heute war nur ein Brett lose. Ist das nicht erstaunlich?, dachte er.
Im Hinterhof sah er nach dem Gewächshaus und dem Wassertank. Manchmal war das Gestell des Tanks beschädigt oder die Regenfänger waren verbogen oder abgebrochen. Manchmal warfen sie Steine über den hohen Zaun des Gewächshauses, und dabei zerriss dann auch schon mal das darüber gespannte Netz und er musste Glasscheiben auswechseln.
Aber heute waren sowohl Tank als auch Gewächshaus unversehrt.
Er ging zum Haus zurück, um Hammer und Nägel zu holen. Aus dem gesprungenen Spiegel, den er vor einem Monat an der Haustür angebracht hatte, blickte ihm sein verzerrtes Abbild entgegen. Bald würden die ersten Scherben des silberbedampften Glases herunterfallen. Egal, dachte er. Das war der letzte verdammte Spiegel, den er hier aufgehängt hatte – es war die Mühe nicht wert. Er würde stattdessen Knoblauch nehmen. Knoblauch funktionierte immer.
Er ging langsam durch die halbdunkle Stille des Wohnzimmers, bog nach links in den kurzen Flur und dann wieder nach links in sein Schlafzimmer.
Früher war das Zimmer gemütlich und wohnlich eingerichtet gewesen – aber das war in einer anderen Zeit. Jetzt diente der Raum rein funktionellen Zwecken, und da Nevilles Bett und Kommode nur wenig Platz beanspruchten, hatte er die andere Hälfte des Zimmers zu einer Werkstatt umgebaut.
Eine lange Werkbank nahm fast die ganze Wand ein. Auf der schweren Holzplatte waren eine Bandsäge, eine Drechselmaschine, eine Schleifscheibe und ein Schraubstock angebracht. Darüber an der Wand hing ohne erkennbare Ordnung das Werkzeug, das Robert Neville benutzte.
Er nahm einen Hammer von der Werkbank und ein paar Nägel aus einer der unsortierten Blechdosen. Dann ging er wieder nach draußen und nagelte das Brett vor dem Fenster fest. Die übrigen Nägel warf er zwischen die Trümmer auf dem Nachbargrundstück.
Eine Weile stand er auf dem Rasen vor dem Haus und blickte die stille Cimarron Street entlang. Robert Neville war ein großer Mann, 36 Jahre alt, von englisch-deutscher Abstammung. Sein Gesicht war eher unauffällig, abgesehen vielleicht von dem schmalen, entschlossenen Mund und dem leuchtenden Blau seiner Augen, deren Blick jetzt über die verkohlten Ruinen der Häuser links und rechts neben seinem schweifte. Er hatte sie niedergebrannt, um zu verhindern, dass sie von den benachbarten Häusern aus auf sein Dach sprangen.
Nach einigen Minuten atmete er langsam und tief durch und ging zurück ins Haus. Er warf den Hammer auf das Sofa im Wohnzimmer, dann steckte er sich eine neue Zigarette an und goss sich seinen Vormittagsdrink ein.
Etwas später zwang er sich, in die Küche zu gehen, um den Müll, der sich in den letzten fünf Tagen angesammelt hatte, durch den Abfallzerkleinerer zu jagen. Er wusste, dass er eigentlich auch die Pappteller und -becher verbrennen, die Möbel abstauben, die Spüle, die Badewanne und die Toilette putzen und die Bettwäsche hätte wechseln müssen; aber ihm war nicht danach.
Denn er war ein Mann und er war allein und solche Sachen waren ihm nicht so wichtig.
Kurz vor Mittag. Robert Neville sammelte in seinem Gewächshaus einen Korbvoll Knoblauch ein.
Anfangs hatte ihm der Geruch von Knoblauch in so großen Mengen Übelkeit bereitet; sein Magen war in ständigem Aufruhr gewesen. Jetzt hing der Geruch überall in seinem Haus und in seiner Kleidung, und manchmal hatte er das Gefühl, selbst schon danach zu riechen. Er nahm ihn kaum noch wahr.
Als er genug Knollen hatte, ging er zurück ins Haus und kippte sie auf das Abtropfbrett der Spüle. Aber als er auf den Lichtschalter drückte, flackerte das Licht erst, bevor es mit voller Stärke aufleuchtete. Robert Neville schnaubte missmutig – der Generator machte wieder Ärger. Da musste er wohl wieder das verdammte Handbuch herauskramen und die Leitungen überprüfen. Und wenn sich eine Reparatur nicht mehr lohnte, musste er einen neuen Generator einbauen.
Verärgert zog er einen hochbeinigen Hocker an die Spüle, schnappte sich ein Messer und setzte sich mit einem müden Knurren hin.
Zuerst holte er die kleinen sichelförmigen Zehen aus den Knollen. Dann halbierte er jede der rosafarbenen ledrigen Zehen, um ihr Inneres freizulegen. Der kräftige, beißende Geruch breitete sich rasch in der Küche aus. Als es kaum noch zu ertragen war, schaltete er die Klimaanlage ein, die den größten Teil des Gestanks absaugte.
Als Nächstes nahm er einen Eispickel von der Wand und bohrte Löcher in die halben Knoblauchzehen, dann fädelte er sie alle auf ein Stück Draht, bis er ungefähr 25 Girlanden hatte.
Anfangs hatte er diese Girlanden vor die Fenster gehängt. Aber sie hatten aus der Ferne mit Steinen geworfen, bis er gezwungen gewesen war, die zerbrochenen Fensterscheiben durch Sperrholzplatten zu ersetzen. Irgendwann hatte er das Sperrholz wieder abgerissen und stattdessen Bretter über die Fenster genagelt. Das hatte das Haus zwar in eine düstere Gruft verwandelt, aber das war immer noch besser, als ständig mit Steinen und Glassplittern bombardiert zu werden. Und nachdem er die drei Klimageräte installiert hatte, war es gar nicht mehr so schlimm. Man konnte sich an alles gewöhnen, wenn man musste.
Er ging nach draußen und nagelte die aufgefädelten Knoblauchzehen über die verrammelten Fenster. Die alten Knoblauchgirlanden, die ihren kräftigen Geruch größtenteils verloren hatten, warf er weg.
Zweimal pro Woche war diese Prozedur notwendig. Bis er etwas Besseres finden würde, war das seine vorderste Verteidigungslinie.
Verteidigung?, dachte er. Wozu?
Den ganzen Nachmittag lang fertigte er Holzpflöcke an.
Er drechselte sie aus runden Holzpfählen, die er mit der Bandsäge in 25-Zentimeter-Stücke zerteilt hatte. Mit der Schleifscheibe bearbeitete er sie, bis sie so spitz wie Dolche waren.
Es war eine mühsame, monotone Arbeit, die die Luft mit heiß riechendem Holzstaub erfüllte – Staub, der seine Hautporen verklebte, ihm in die Lunge drang und ihn zum Husten brachte.
Und trotzdem schien er nie voranzukommen. Egal wie viele Pflöcke er anfertigte, sie waren in null Komma nichts verbraucht. Und es wurde auch immer schwieriger, runde Pfähle zu finden. Bald würde er Kanthölzer zu Pflöcken drechseln müssen. Das macht bestimmt Spaß, dachte er gereizt.
Es war alles sehr deprimierend und bestärkte ihn in seinem Entschluss, nach einer besseren Methode der Beseitigung zu suchen. Aber wie sollte er die finden, wenn sie ihm nie die Chance gaben, in Ruhe darüber nachzudenken?
Während er drechselte, hörte er Schallplatten über den Lautsprecher, den er im Schlafzimmer aufgestellt hatte – Beethovens Dritte, Siebte und Neunte. Er war froh, dass er schon früh im Leben von seiner Mutter gelernt hatte, diese Art von Musik zu schätzen. Es half, die schreckliche Leere der Stunden zu füllen.
Ab 16 Uhr wanderte sein Blick immer öfter zur Uhr an der Wand. Er arbeitete schweigend, die Lippen zu einer schmalen Linie zusammengepresst, mit einer Zigarette im Mundwinkel, die Augen fest auf die Drehbank gerichtet, von der der mehlige Holzstaub zu Boden rieselte.
16:15 Uhr. 16:30 Uhr. 16:45 Uhr.
Noch eine Stunde, dann würden sie wieder das Haus belagern, diese dreckigen Bastarde. Sobald das Tageslicht verschwunden war.
Er stand vor dem riesigen Gefrierschrank, um sein Abendessen auszusuchen. Sein müder Blick wanderte von oben nach unten, vom Fleisch zum gefrorenen Gemüse, dann zu Brot und Gebäck, zu Obst und Eiscreme.
Er entschied sich für zwei Lammkoteletts, grüne Bohnen und eine kleine Packung Orangensorbet. Er nahm die Packungen aus dem Gefrierschrank und schob die Tür mit dem Ellbogen zu.
Dann ging er zu den Konservendosen, die unsortiert bis zur Zimmerdecke gestapelt waren. Er nahm eine Dose Tomatensaft und verließ das Zimmer, das einst Kathy gehört hatte und jetzt nur noch für seinen Magen da war.
Langsam ging er durch das Wohnzimmer und ließ dabei seinen Blick über die Fototapete an der hinteren Wand schweifen. Sie zeigte eine Klippe, die schroff zu einem grünblauen Meer abfiel, dessen Wellen sich an schwarzen Felsen brachen. Weit oben im klaren blauen Himmel segelten weiße Möwen im Wind, und auf der rechten Seite ragte ein knorriger Baum über den Abgrund. Seine dunklen Äste zeichneten sich vor dem Himmel ab.
Neville ging in die Küche und ließ die Vorräte auf den Tisch fallen. Sein Blick wanderte zur Uhr. 17:40 Uhr. Nicht mehr lange.
Er füllte etwas Wasser in einen kleinen Topf und stellte ihn auf eine Herdplatte. Dann taute er die Lammkoteletts auf und schob sie in den Grill. Inzwischen kochte das Wasser; er schüttete die gefrorenen Bohnen hinein und legte einen Deckel auf den Topf, während er müßig überlegte, dass es wahrscheinlich der Elektroherd war, der den Generator auslaugte.
Am Tisch schnitt er zwei Scheiben Brot ab und goss sich ein Glas Tomatensaft ein. Er setzte sich hin und beobachtete den Minutenzeiger bei seiner Wanderung über das Zifferblatt. Die Bastarde mussten bald hier sein.
Als er seinen Tomatensaft getrunken hatte, ging er zur Haustür und hinaus auf die Veranda. Er ging die Stufen zum Rasen hinab und zum Bürgersteig.
Der Himmel verdunkelte sich und es wurde kühl. Er blickte die Cimarron Street auf und ab und ließ sich vom kühlen Wind die blonden Haare zerzausen. Das war das Problem mit diesen bewölkten Tagen – man wusste nie, wann sie kamen.
Aber immer noch besser als diese verdammten Staubstürme. Mit einem Achselzucken kehrte er über den Rasen ins Haus zurück, verschloss und verriegelte die Tür hinter sich und legte den schweren Balken vor. Dann ging er wieder in die Küche, drehte die Lammkoteletts um und schaltete die Herdplatte unter den Bohnen aus.
Er lud gerade sein Essen auf den Teller, als er innehielt und schnell zur Uhr schaute. 18:25 Uhr war es heute. Er hörte Ben Cortman rufen.
»Komm raus, Neville!«
Seufzend setzte sich Robert Neville hin und begann zu essen.
Er saß im Wohnzimmer und versuchte zu lesen. An seiner kleinen Bar hatte er sich einen Whisky Soda gemixt, und jetzt hielt er das kalte Glas in der Hand, während er in einem Physiologiebuch las. Aus dem Lautsprecher über der Tür zum Flur erklang laut die Musik von Schönberg.
Aber nicht laut genug. Er konnte sie immer noch draußen hören, wie sie murmelten und umhergingen und riefen, wie sie knurrten und miteinander kämpften. Gelegentlich prallte ein Stein von der Hauswand ab. Manchmal bellte ein Hund.
Und alle wollten sie das Gleiche.
Robert Neville schloss für einen Moment die Augen und presste die Lippen zu einer schmalen Linie zusammen. Dann öffnete er die Augen wieder, zündete sich eine Zigarette an und zog den Rauch tief in seine Lunge.
Er wünschte, er hätte genug Zeit gehabt, um das Haus schalldicht zu machen. Es wäre alles gar nicht so schlimm gewesen, wenn er sie nicht hätte hören müssen. Selbst nach fünf Monaten ging es ihm noch an die Nieren.
Er hatte sich abgewöhnt, nach draußen zu schauen. Am Anfang hatte er ein kleines Guckloch in das vordere Fenster gebohrt und sie beobachtet. Aber dann hatten die Frauen ihn entdeckt und angefangen, obszöne Posen einzunehmen, um ihn aus dem Haus zu locken. Er hatte keine Lust, sich das anzusehen.
Er legte das Buch beiseite und starrte düster auf den Teppich, während aus den Lautsprechern die Verklärte Nacht erklang. Ihm war klar, dass er sich nur etwas in die Ohren stopfen musste, um die Geräusche von draußen auszublenden, aber dann hätte er auch keine Musik mehr hören können – und er wollte nicht das Gefühl haben, sich in ein Schneckenhaus zu verkriechen.
Wieder schloss er die Augen. Die Frauen waren es, die es so schwer machten, dachte er. Die Frauen, die lasziv in der Nacht posierten, in der vagen Hoffnung, dass er sie sah und herauskam.
Ein Schauder durchfuhr ihn. Es war jeden Abend das Gleiche. Er las und hörte Musik. Dann dachte er darüber nach, das Haus schalldicht zu machen, und dann wanderten seine Gedanken zu den Frauen.
Tief in seinem Körper entstand wieder diese krampfartige Hitze, und er presste die Lippen aufeinander, bis sie weiß anliefen. Dieses Gefühl kannte er nur zu gut, und es machte ihn wütend, dass er nicht dagegen ankämpfen konnte. Es wurde stärker und stärker, bis er nicht mehr still sitzen konnte. Irgendwann würde er aufstehen und mit geballten Fäusten auf und ab gehen. Vielleicht stellte er den Filmprojektor auf oder er aß etwas oder trank zu viel oder drehte die Musik so laut auf, dass ihm die Ohren wehtaten. Wenn es wirklich schlimm wurde, musste er irgendetwas tun.
Er spürte, wie sich seine Bauchmuskeln immer mehr verkrampften. Er nahm das Buch und versuchte zu lesen, formte mit den Lippen langsam und schmerzhaft jedes einzelne Wort.
Aber im nächsten Moment lag das Buch wieder auf seinem Schoß und er starrte auf das Bücherregal an der gegenüberliegenden Wand. All das Wissen in diesen Büchern konnte das Feuer in ihm nicht löschen; all die Worte von Jahrhunderten konnten nicht das stumme, primitive Verlangen seines Fleisches stillen.
Die Erkenntnis machte ihn krank. Er fühlte sich davon beleidigt. Es war ein vollkommen natürlicher Trieb – aber es gab keine Möglichkeit mehr, ihn zu befriedigen. Sie hatten ihm das Zölibat aufgezwungen; damit musste er leben. Du hast doch einen Verstand, oder?, fragte er sich. Dann benutze ihn auch!
Er drehte die Musik noch lauter, dann zwang er sich, eine ganze Seite ohne Pause zu lesen. Er las von Blutzellen, die durch Membranen gepresst wurden, von Lymphflüssigkeit, die Abfallprodukte durch Röhren transportierte, welche durch Lymphknoten blockiert wurden, er las von Lymphozyten und phagozytischen Zellen.
»… und fließt in der linken Schulterregion, in der Nähe des Thorax, in eine große Vene des Blutkreislaufs.«
Das Buch klappte mit einem dumpfen Schlag zu.
Warum ließen sie ihn nicht in Ruhe? Dachten sie, sie könnten ihn alle haben? Waren sie so dumm, das zu glauben? Warum kamen sie jede Nacht? Nach fünf Monaten sollte man doch meinen, dass sie aufgeben und es woanders versuchen würden.
Er ging zur Bar und mixte sich noch einen Drink. Als er zu seinem Sessel zurückging, hörte er, wie Steine auf das Dach prasselten und mit dumpfen Geräuschen in den Büschen neben dem Haus landeten. Und über dem Lärm hörte er Ben Cortman rufen, wie er immer rief.
»Komm raus, Neville!«
Eines Tages kriege ich den Bastard, dachte er, während er einen großen Schluck von dem bitteren Getränk nahm. Eines Tages werde ich ihm einen Pflock mitten durch seine gottverdammte Brust rammen. Ich werde einen extralangen für ihn anfertigen, mit bunten Bändern dran. Dieser Dreckskerl!
Morgen. Morgen würde er das Haus schalldicht machen. Seine Finger verkrampften sich zu Fäusten. Er ertrug es nicht, an diese Frauen zu denken. Wenn er sie nicht hörte, würde er vielleicht auch nicht an sie denken. Morgen. Morgen.
Die Musik endete. Er nahm die Schallplatte vom Plattenspieler und schob sie zurück in ihre Hülle. Jetzt konnte er sie draußen ganz deutlich hören. Er griff nach der erstbesten Platte, legte sie auf und drehte die Lautstärke auf Maximum.
Das Jahr der Pest von Roger Leie dröhnte ihm in die Ohren. Violinen kreischten und jammerten, Pauken donnerten wie die Schläge eines sterbenden Herzens, Flöten pfiffen seltsam atonale Melodien.
Wut packte ihn, er riss die Platte vom Teller und zerbrach sie über seinem Knie. Das hatte er schon lange vorgehabt. Mit steifen Beinen ging er in die Küche und warf die Bruchstücke in den Mülleimer. Und dann stand er in der dunklen Küche, die Augen fest geschlossen, die Zähne zusammengebissen, die Hände auf die Ohren gepresst. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe, LASST MICH IN RUHE!
Aber es war sinnlos, nachts waren sie nicht zu schlagen. Man brauchte es gar nicht erst zu versuchen; die Nacht war ihre Zeit. Dumm von ihm, auch nur daran zu denken. Sollte er sich einen Film ansehen? Nein, er hatte keine Lust, den Projektor aufzubauen. Er würde ins Bett gehen und sich Watte in die Ohren stopfen. Darauf lief es ohnehin jede Nacht hinaus.
Schnell, um nicht zu viel nachzudenken, ging er ins Schlafzimmer und entkleidete sich. Er zog seine Pyjamahose an und ging ins Bad. Ein Pyjamaoberteil trug er nie – das hatte er sich in Panama während des Krieges abgewöhnt.
Als er sich wusch, musterte er im Spiegel seine breite Brust und die dunklen Haare, die um seine Brustwarzen und von der Mitte seines Brustkorbs ausgehend nach unten wuchsen. Er betrachtete das verzierte Kreuz, das er sich eines Nachts, als er betrunken gewesen war, in Panama hatte tätowieren lassen. Was war ich damals doch für ein Dummkopf!, dachte er. Aber gut, vielleicht hatte das Kreuz ihm das Leben gerettet.
Er putzte sich gründlich die Zähne und benutzte Zahnseide. Er bemühte sich, seine Zähne gut zu pflegen, denn er war jetzt sein eigener Zahnarzt. Eine Menge Sachen konnten gern zum Teufel gehen, aber nicht seine Gesundheit. Warum hörst du dann nicht auf, Alkohol in dich reinzuschütten?, dachte er. Warum hältst du nicht einfach die Klappe?, dachte ein anderer Teil seines Kopfes.
Er machte einen Rundgang durchs Haus und schaltete alle Lichter aus. Ein paar Minuten lang betrachtete er die Fototapete und versuchte sich vorzustellen, dass es wirklich das Meer war. Aber wie konnte er das, bei all dem Rumpeln und Kratzen, dem Jaulen und Fauchen und Schreien in der Nacht?
Er schaltete die Wohnzimmerlampe aus und ging ins Schlafzimmer.
Mit einem verärgerten Knurren registrierte er, dass das Bett voller Sägemehl war. Er wischte es mit schnellen Handbewegungen ab und überlegte, dass er wohl besser eine Abtrennung zwischen der Werkstatt und dem Schlafbereich errichten sollte. Besser dies und besser das, dachte er verdrießlich. Es gab so verdammt viel zu tun, dass er sich nie um das eigentliche Problem kümmern konnte.
Er steckte sich die Wattestöpsel in die Ohren, und eine große Stille umfing ihn. Dann schaltete er das Licht aus und kroch unter die Bettdecke. Ein Blick auf die Leuchtziffern der Uhr verriet ihm, dass es erst ein paar Minuten nach zehn war. Auch gut, dachte er. Dann kann ich morgen umso früher loslegen.
Er lag in der Dunkelheit im Bett, atmete tief ein und aus und hoffte auf Schlaf. Aber die Stille half nicht wirklich. Er sah sie immer noch vor sich, die bleichen Gestalten, die um sein Haus strichen und unablässig nach einem Weg suchten, um zu ihm zu gelangen. Einige von ihnen kauerten jetzt wahrscheinlich auf ihren Fersen wie Hunde und beobachteten mit glitzernden Augen das Haus, während sie langsam mit den Zähnen knirschten, vor und zurück, vor und zurück.
Und die Frauen …
Musste er denn wieder damit anfangen? Mit einem Fluch wälzte er sich auf den Bauch und presste sein Gesicht in das heiße Kissen. Schwer atmend lag er da, während sein Körper sich rastlos bewegte. Lass es Morgen werden. Sein Kopf sprach die Worte, die er jede Nacht sprach. Lieber Gott, lass es Morgen werden.
Er träumte von Virginia und schrie im Schlaf, und seine Finger krallten sich in die Bettdecke wie blutrünstige Klauen.
2
Der Wecker klingelte um halb sechs. Benommen streckte Robert Neville im Halbdunkel den Arm aus und drückte den Knopf.
Er tastete nach seinen Zigaretten und zündete sich eine an, dann setzte er sich auf. Nach einigen Minuten verließ er das Bett, ging ins dunkle Wohnzimmer und öffnete die Klappe des Gucklochs.
Draußen auf dem Rasen standen die dunklen Gestalten wie stumme Soldaten auf Wache. Während er sie beobachtete, gingen die ersten bereits fort und er hörte sie unzufrieden vor sich hin murmeln. Eine weitere Nacht war zu Ende.
Er ging zurück ins Schlafzimmer, schaltete das Licht ein und kleidete sich an. Als er sein Hemd überzog, hörte er Ben Cortman rufen: »Komm raus, Neville!«
Und das war alles. Danach zogen sie sich alle zurück – schwächer, als sie gekommen waren. Sofern sie nicht über einen aus ihren eigenen Reihen hergefallen waren. Das taten sie oft. Es herrschte keine Einigkeit unter ihnen. Ihr Verlangen war ihr einziger Antrieb.
Als er fertig angezogen war, setzte sich Neville mit einem leisen Grunzen aufs Bett und notierte mit einem Bleistift seine Liste für den Tag:
Drehbank bei Sears
Wasser
Generator überprüfen
Holzpfähle (?)
Das Übliche
Das Frühstück nahm er hastig ein: ein Glas Orangensaft, eine Scheibe Toast und zwei Tassen Kaffee. Er schlang es herunter und wünschte sich, er hätte die Geduld, langsamer zu essen.
Nach dem Frühstück warf er den Pappteller und den Pappbecher in den Müll und putzte sich die Zähne. Wenigstens eine gute Angewohnheit, tröstete er sich.
Als er nach draußen kam, galt sein erster Blick dem Himmel, der klar und praktisch wolkenlos war. Heute konnte er sich vom Haus entfernen. Gut.
Als er über die Veranda ging, trat er auf ein paar Scherben des Spiegels. Tja, hat nicht lange gehalten, wie erwartet, dachte er. Er würde später aufräumen.
Eine der Leichen lag auf dem Bürgersteig, die andere halb im Gebüsch versteckt. Beide waren Frauen. Es waren fast immer Frauen.
Er schloss die Garagentür auf und fuhr seinen Willys Station Wagon rückwärts in die Kühle des frühen Morgens. Dann stieg er aus, öffnete die Heckklappe, zog Arbeitshandschuhe an und ging zu der Frau auf dem Bürgersteig.
Bei Tageslicht ist wirklich nichts an ihnen attraktiv, dachte er, während er die beiden nacheinander über den Rasen schleifte und auf die Segeltuchplane warf. Kein Tropfen Blut war mehr in ihnen; beide Frauen hatten die Farbe von Fischen, die schon zu lange aus dem Wasser waren. Er klappte die Heckklappe wieder hoch und verriegelte sie.
Anschließend nahm er einen Sack und sammelte auf dem Rasen Steine und Schutt ein. Den Sack räumte er in den Jeep, dann zog er die Handschuhe aus. Er ging ins Haus, wusch sich die Hände und bereitete sein Mittagessen vor: zwei Sandwiches, ein paar Kekse und eine Thermoskanne mit heißem Kaffee.
Als er damit fertig war, ging er ins Schlafzimmer und holte die Tasche mit den Holzpflöcken. Er hängte sie sich über den Rücken und schnallte sich den Werkzeuggürtel mit dem Hammer um. Dann verließ er das Haus und schloss die Haustür sorgfältig hinter sich ab.
Heute Morgen würde er nicht nach Ben Cortman suchen; es gab zu viel anderes zu tun. Einen Moment dachte er daran, dass er sich vorgenommen hatte, das Haus schalldicht zu machen. Ach, zum Teufel damit, dachte er. Das mache ich morgen oder an irgendeinem bewölkten Tag.
Er stieg in den Wagen und warf einen Blick auf seine Liste. ›Drehbank bei Sears‹ war der erste Punkt. Natürlich erst, nachdem er die Leichen entsorgt hatte.
Er ließ den Wagen an, fuhr rückwärts auf die Straße und dann zügig zum Compton Boulevard. Dort bog er rechts ab und fuhr nach Osten. Auf beiden Seiten der Straße zogen schweigend die Häuser vorbei. Am Straßenrand parkten Autos, leer und tot.
Robert Nevilles Blick wanderte zur Tankanzeige. Der Tank war noch halb voll, aber es schadete sicher nicht, an der Western Avenue zu halten und ihn aufzufüllen. Es wäre Unsinn, das Benzin, das er in seiner Garage lagerte, anzubrechen, solange er nicht musste.
Er hielt an der verlassenen Tankstelle, holte sich ein Fass Benzin und befüllte den Wagentank mit einem Schlauch, bis die blass bernsteinfarbene Flüssigkeit aus dem Einfüllstutzen spritzte und auf den Betonboden lief.
Danach überprüfte er Ölstand, Kühlwasser, Batteriesäure und Reifendruck. Alles war in gutem Zustand – so wie eigentlich immer, denn er kümmerte sich sorgfältig um den Wagen. Sollte er jemals unterwegs eine Panne erleiden und nicht bis Sonnenuntergang zum Haus zurückkehren können …
Aber es hatte keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Wenn das geschah, wäre es sein Ende.
Er fuhr weiter den Compton Boulevard entlang, vorbei an den hohen Ölbohrtürmen, durch Compton, durch all die stillen Straßen. Nirgendwo war jemand zu sehen.
Aber Robert Neville wusste, wo sie waren.
Das Feuer brannte immer. Als er fast dort war, zog er seine Handschuhe und die Gasmaske über und betrachtete durch die Augengläser die dicke rußige Rauchwolke, die über der Erde hing. Das ganze Feld war zu einer riesigen Feuergrube ausgehoben worden. Im Juni 1975 war das gewesen.
Neville parkte den Wagen und sprang heraus, um es schnell hinter sich zu bringen. Er entriegelte und öffnete die Heckklappe, zerrte eine der Leichen heraus und schleifte sie zum Rand der Grube. Dann richtete er sie auf und stieß sie hinunter.
Der Leichnam hüpfte und rollte das steile Gefälle hinab, bis er auf dem großen Haufen schwelender Asche am Boden der Grube landete.
Robert Neville atmete keuchend, als er zum Wagen zurückeilte. Wenn er hier war, hatte er immer das Gefühl, ersticken zu müssen, obwohl er die Gasmaske trug.
Er schleifte die zweite Leiche zur Grube und stieß sie hinein. Dann, nachdem er auch den Sack mit den Steinen hinuntergeworfen hatte, lief er zum Wagen zurück und raste davon.
Nachdem er eine halbe Meile gefahren war, zog er sich die Gasmaske ab und die Handschuhe aus und warf sie auf den Rücksitz. Mit weit aufgerissenem Mund atmete er tief die frische Luft ein. Aus dem Handschuhfach holte er seinen Flachmann und trank einen großen Schluck Whisky. Dann zündete er sich eine Zigarette an und inhalierte tief. Manchmal musste er wochenlang jeden Tag zur brennenden Grube fahren, und immer wurde ihm schlecht davon.
Irgendwo dort unten war Kathy.
Auf dem Weg nach Inglewood hielt er an einem Lebensmittelladen, um ein paar Flaschen Wasser mitzunehmen.
Als er den verlassenen Laden betrat, drang ihm der Gestank verdorbener Lebensmittel in die Nase. Schnell schob er einen Einkaufswagen durch die stillen, verstaubten Gänge. Der schwere Verwesungsgeruch war so aufdringlich, dass er nur durch den Mund atmete.
Er fand die Wasserflaschen im hinteren Bereich des Ladens, aber auch eine Tür, die zu einer Treppe führte. Nachdem er alle Flaschen in den Einkaufswagen geräumt hatte, ging er die Treppe hinauf. Möglicherweise war der Ladenbesitzer irgendwo dort oben; er konnte genauso gut mit ihm anfangen.
Es waren zwei. Auf dem Sofa im Wohnzimmer lag eine Frau, etwa 30 Jahre alt, in einem roten Hausmantel. Ihre Brust hob und senkte sich langsam, ihre Augen waren geschlossen, die Hände über dem Bauch gefaltet.
Nervös hantierte Robert Neville mit dem Pflock und dem Hammer. Es war immer hart, wenn sie noch am Leben waren – vor allem bei Frauen. Er spürte, wie seine Muskeln sich verkrampften, als das primitive Verlangen wieder erwachte. Er kämpfte dagegen an. Es war vollkommen irrational, Vernunft hatte nichts damit zu tun.
Sie gab keinen Laut von sich, bis auf ein abruptes, heiseres Keuchen. Als er ins Schlafzimmer ging, hörte er es hinter sich plätschern. Was soll ich denn sonst machen?, dachte er, denn noch immer musste er sich jedes Mal selbst überzeugen, dass er das Richtige tat.
In der Tür des Schlafzimmers blieb er stehen und starrte das Kinderbett beim Fenster an. Er schluckte schwer und bekam kaum Luft. Dann gab er sich einen Ruck, ging zum Bett und sah hinein.
Warum sehen sie für mich alle wie Kathy aus?, dachte er und holte mit zitternden Händen den zweiten Pflock aus der Tasche.
Während er langsam zu Sears fuhr, versuchte er sich damit abzulenken, dass er darüber nachdachte, warum nur Pflöcke aus Holz funktionierten.
Grübelnd rollte er den leeren Boulevard entlang. Der einzige Laut war das gedämpfte Brummen des Motors. Er wunderte sich, dass er fünf Monate gebraucht hatte, bis er sich darüber Gedanken machte.
Was ihn auf eine andere Frage brachte: Warum schaffte er es immer, das Herz zu treffen? Es musste das Herz sein, das hatte Dr. Busch gesagt. Aber Robert Neville hatte so gut wie keine anatomischen Kenntnisse.
Er runzelte die Stirn. Es ärgerte ihn, dass er diese abscheuliche Arbeit schon so lange erledigte, ohne auch nur ein einziges Mal darüber nachgedacht zu haben.
Er schüttelte den Kopf. Nein, ich muss es sorgfältig durchdenken, dachte er. Ich muss alle Fragen sammeln, bevor ich versuche, sie zu beantworten. Man musste es auf die richtige Weise angehen, auf die wissenschaftliche Weise.
Ja, ja, ja, dachte er, der Schatten des alten Fritz. Das war der Name seines Vaters gewesen. Neville hatte seinen Vater gehasst und sich lange dagegen gewehrt, die Logik und die handwerklichen Fähigkeiten des alten Mannes zu benutzen. Sein Vater hatte die Existenz von Vampiren bis zu seinem Tod geleugnet.
Bei Sears holte er sich eine Drehbank, verlud sie in den Station Wagon, dann durchsuchte er den Laden.
Fünf von ihnen versteckten sich im Keller in verschiedenen dunklen Ecken. Einen fand Neville in einer Kühltruhe mit Glasdeckel. Er musste lachen, als er den Mann in seinem Emaillesarg liegen sah; was für ein lächerliches Versteck.
Später überlegte er, wie humorlos die Welt doch geworden war, dass ihn so etwas erheitern konnte.
Gegen 14 Uhr parkte er irgendwo und aß sein Mittagessen. Alles schien nach Knoblauch zu schmecken.
Und das brachte ihn dazu, über die Wirkung nachzudenken, die Knoblauch auf sie hatte.
Es musste der Geruch sein, der sie abschreckte, aber warum?
Was über sie bekannt war, war schon seltsam: dass sie sich tagsüber versteckten, dass sie Knoblauch mieden, dass Holzpflöcke sie töten konnten, ihre angebliche Angst vor Kreuzen und Spiegeln.





























