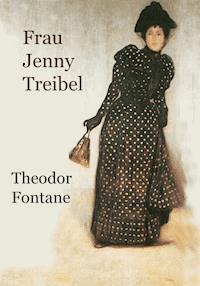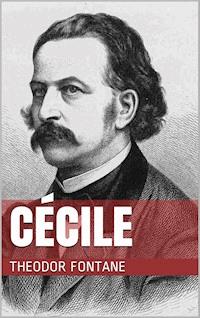3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Über ein gutes Frühstück in angenehmer Gesellschaft ging ihm nichts, Hausmannskost wußte er ebenso zu schätzen wie märkische Spezialitäten oder exotische Delikatessen. Auf seine geliebte Schinkenesserei konnte er ganz verzichten, wenn die reine Luft auf Norderney oder im Thüringer Wald die Fütterung seiner Nerven übernahm. Bier galt dem gelernten Apotheker als Stärkungsmittel, Rotwein als reine Medizin. Und der Schlummerpunsch gab ihm und seiner Frau Emilie oft eine angenehme Bettschwere. „Wenn die Diät-Hysterie grassiert, wird man einen Autor gerne lesen, der noch von Herzen sagen konnte: 'Ich bin nicht für halbe Portionen.'“ Tagesanzeiger
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über Theodor Fontane
Theodor Fontane wurde am 30. Dezember 1819 im märkischen Neuruppin geboren. Er erlernte den Apothekerberuf, den er 1849 aufgab, um sich als Journalist und freier Schriftsteller zu etablieren. Ein Jahr später heiratete er Emilie Rouanet-Kummer. Nach seiner Rückkehr von einem mehrjährigen England-Aufenthalt galt sein Hauptinteresse den »Wanderungen durch die Mark Brandenburg«. Neben der umfangreichen Tätigkeit als Kriegsberichterstatter, Reiseschriftsteller und Theaterkritiker schuf er seine berühmt gewordenen Romane und Erzählungen sowie die beiden Erinnerungsbücher »Meine Kinderjahre« und »Von Zwanzig bis Dreißig«. Fontane starb am 20. September 1898 in Berlin.
Gotthard Erler, geb. 1933 in Meerane/Sachsen, seit 1964 eng mit dem Aufbau-Verlag verbunden, dessen Geschäftsführer er von 1990 bis 1998 war. Seine jahrzehntelangen Forschungen und vielseitigen Editionen haben an der Verbreitung des Fontane’schen Werks einen hervorragenden Anteil.
2014 erhielt Gotthard Erler das Bundesverdienstkreuz.
Informationen zum Buch
»Kleine feine Ausgabe mit der nötigen Würze.« FAZ
Über ein gutes Frühstück in angenehmer Gesellschaft ging ihm nichts, Hausmannskost wußte er ebenso zu schätzen wie märkische Spezialitäten oder exotische Delikatessen. Auf seine geliebte Schinkenesserei konnte er ganz verzichten, wenn die reine Luft auf Norderney oder im Thüringer Wald die Fütterung seiner Nerven übernahm. Bier galt dem gelernten Apotheker als Stärkungsmittel, Rotwein als reine Medizin. Und der Schlummerpunsch gab ihm und seiner Frau Emilie oft eine angenehme Bettschwere.
»Wenn die Diät-Hysterie grassiert, wird man einen Autor gerne lesen, der noch von Herzen sagen konnte: 'Ich bin nicht für halbe Portionen.'« Tagesanzeiger
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Ich bin nicht für halbe Portionen
Essen und Trinken mit Theodor Fontane
Herausgegeben von Luise Berg-Ehlers und Gotthard Erler
Inhaltsübersicht
Über Theodor Fontane
Informationen zum Buch
Newsletter
Aperitif
»Seine Verpflegung wird Ihnen allerhand Schwierigkeiten machen« Statt einer Vorspeise
Ein gutes Frühstück dauert bis zum AbendEchte und unechte Dejeuners
»Ein Nachmittag in Halensee« klingt fast so poetisch wie »vier Wochen auf Capri«Sommerfrische und Landpartie
Nichts entlehnt und nichts geborgt, Für Großes und Kleines ringsum gesorgtMittägliches in Berlin, der Mark und andernorts
Man paßt mehr zum »Gasthof zum alten Zieten« in Wildberg als zum Clarendon-Hôtel in LondonSpeisen auf Reisen
Kaffe, wenn’s sein kann menschliches ProduktKaffe und Kuchen
Champagner ist nun mal nicht mein WeinBier und Cognac, Mosel und Gilka sowie ein Fünfzeiler über das Rauchen
Der knurrende Magen ist ein gefährlicher RebellAbendbrot und Souper
Hilfe bei »verlatschtem Magen«Gute Verdauung ist besser als eine Million – Fontane als Hausarzt
Quellennachweis
Anmerkung
Impressum
Aperitif
In jedem Fontane-Roman wird mindestens einmal ausgiebig getafelt oder wenigstens ein Imbiß auf der Landpartie genommen. Manchmal erfährt man ganz genau, was auf den Tisch kommt, zum Beispiel ein »echtes Berliner Essen« in »Vor dem Sturm«: »… erster Gang eine große Schüssel mit Mohnpielen, daneben links ein Heringssalat und rechts eine Sülze. Alles reich gewürzt; auf dem Mohn eine dichte Lage von gestoßenem Zimt, auf dem Salat kleine Zwiebeln, die mit Pfeffergurken und sauren Kirschen abwechselten.« Im »Stechlin« ist verheißungsvoll von »losgelösten Krammetsvögelbrüsten« in einer »höheren Form von Schwarzsauer« die Rede, die aber Küchengeheimnis bleibt. Leo von Poggenpuhl dagegen begnügt sich mit den schäbigen Resten eines Edamers und nimmt zum Tee einen Gilka. Zum richtigen Diner gehören diverse Weine, und von Montefiascone und Lacrimae Christi in »L’Adultera« bis zum Trarbacher bei Professor Schmidt in »Frau Jenny Treibel« läßt Fontane die zeitgenössischen Edelsorten Revue passieren. Nicht zu vergessen das ABC der renommierten Liköre und das genüßliche Anzünden von Zigarren oder Meerschaumpfeifen, nachdem die älteste Dame von ihrem »Tafelaufhebungsrecht« Gebrauch gemacht hat.
Was wären freilich all diese Diner- und Abendbrot-Szenen ohne die Gespräche und Dispute, die dabei geführt werden; ja Essen und Trinken sind, genau besehen, nur der angenehm-willkommene Anlaß, Figuren vorzuführen, Meinungen zu vertreten, die Fabel weiterzuspinnen und nicht zuletzt: die Kultur der Gastlichkeit, der Geselligkeit darzustellen, wo sich Lukullisches und Kulinarisches wie selbstverständlich mit espritvoller Unterhaltung bei Tisch und Nachtisch verbinden.
In der erfreulichen Kombination von Gaumen- und Gesprächsfreuden ist unschwer der Autor Theodor Fontane zu identifizieren, der sich aus gutem Grund etwas auf sein »Causeurtum«, seine Kunst des geistvollen Plauderns, zugute hielt und der, das mindeste zu sagen, ein überaus konstruktives Verhältnis zur Befriedigung seiner Leib- und Magenbedürfnisse hatte: »Ich habe eine hohe Vorstellung von der Heiligkeit der Mahlzeiten; gleich nach dem schlafenden kommt der essende Mensch.«
Fontane war ein Gourmet und ein Gourmand, beides, scheint es, aus Passion. »Ich bin nicht für halbe Portionen«, bekennt er und gedenkt mit sichtlichem Behagen der »Vernichtungsfeldzüge« gegen Frau von Merckels »Schwemmklöße« (was immer das war). Er muß, bei strikter Aversion gegen die sächsische »Mehlpampe«, ein Suppenfanatiker gewesen sein, was nicht zuletzt an den hier erstmals veröffentlichten eigenhändigen Wochenspeiseplänen ablesbar ist. Vorzüglich zubereitete Hammelkoteletts mit Bohnen, aber auch Quetsch- und Bratkartoffeln zählten zu seinen Lieblingsgerichten, wobei der Hammel (»unendlich süßes Wort«) englischen und italienischen Qualitätsmaßstäben zu genügen hatte. Ein Schrecken war ihm, dem Vielgereisten, das kollektive Mittagessen in Hotels und Gasthäusern (Table d’hôte genannt), bei dem er zwischen Hungrigbleiben und Langerweile umzukommen fürchtete und oft genug Unappetitliches hinzunehmen hatte. Er begann gern »mit Austern und Chablis«, aber er konnte (unausbleiblich bei seiner labilen Gesundheit) auch »Hungerkuren« mit Tee, Rotwein und Selters absolvieren, und der entlaufene Apotheker verordnete die bewährten Hausrezepte auch seiner Familie.
Bier hat er sehr geschätzt; ob Kulmbacher oder Werdersches – beides galt ihm als »Roborans«, als kräftigendes Getränk. Die Bemerkungen über Champagner sind höchst widersprüchlich, die Bekenntnisse zu Mosel- und Ungar-Weinen bleiben sich gleich – wie die zum Cognac, den er gern, wohldosiert, zum »Kaffe« trank. Er hat »Kaffe« bis zu seinem Tode mit einem »e« geschrieben, und er scheint ihn zeitweise ungeheuer stark und in großen Mengen getrunken zu haben. Wie lange er, beiläufig, geraucht hat, läßt sich schwer sagen. Auf Reisen bevorzugte er die Nichtraucher-Coupés; Zigarren (im »Stechlin« sogar Zigaretten) läßt er gleichwohl allenthalben glimmen. Ob er, wie der kleine Fünfzeiler suggeriert, nach einer schlechten uckermärkischen Zigarre aus Vierraden tatsächlich das Rauchen aufgegeben hat, bleibt fraglich und ist auch kaum wichtig.
Er war »kein Fresser von Fach«, wohl aber ein Genießer mit einem gewissen Hang zur Quantität. Gutes Essen und schmackhafte Getränke – in seiner bescheidenen Mansardenwohnung in der Potsdamer Straße 134c oder draußen im Jagdschloß Dreilinden beim Prinzen Friedrich Karl – schätzte er hoch, und auf ein entsprechendes Ambiente legte er Wert. Daß diese Kultur des 19. Jahrhunderts, in seinen Romanen und in zahlreichen autobiographischen Zeugnissen vielfältig reflektiert, bedroht war, spürte er wohl. In seinem späten Gedichtentwurf »Retrorsum«, das unsere kleine Sammlung beschließt, beschwor er die Horrorvision der technifizierten Nahrungsaufnahme aus dem Automaten. Und das moderne Massen-Essensangebot des neuen Jahrhunderts wäre ihm tatsächlich ein Greuel gewesen; er wollte essen wie an seinem Hochzeitstag anno 1850: gut, ausgiebig, unbehelligt.
Luise Berg-Ehlers/Gotthard Erler
»Seine Verpflegung wird Ihnen allerhand Schwierigkeiten machen«Statt einer Vorspeise
Am 15. Oktober war Polterabend gewesen, am 16. war Hochzeit. Ich habe viele hübsche Hochzeiten mitgemacht, aber keine hübschere als meine eigne. Da wir nur wenig Personen waren, etwa zwanzig, so hatten wir uns auch ein ganz kleines Hochzeitslokal ausgesucht, und zwar ein Lokal in der Bellevuestraße – schräg gegenüber dem jetzigen Wilhelmsgymnasium –, das »Bei Georges« hieß und sich wegen seiner »Spargel und Kalbkoteletts« bei dem vormärzlichen Berliner eines großen Ansehns erfreute. Dem Gastmahl voraus ging natürlich die Trauung, die zu zwei Uhr in der Fournierschen Kirche, Klosterstraße, festgesetzt worden war. Alles hatte sich rechtzeitig in der Sakristei versammelt, nur mein Vater fehlte noch und kam auch wirklich um eine halbe Stunde zu spät. Wir waren, um Fourniers willen, in einer tödlichen Verlegenheit. Er aber, ganz feiner Mann, blieb durchaus ruhig und heiter und sagte nur zu meiner Braut: »Es ist vielleicht von Vorbedeutung – Sie sollen warten lernen.«
Und nun waren wir getraut und fuhren in unsrer Kutsche zu »Georges«, wo in einem kleinen Hintersaal, der den Blick auf einen Garten hatte, gedeckt war. Eine Balkontür stand auf, denn es war ein wunderschöner Tag. Draußen flogen noch die Vögel hin und her, aber es waren wohl bloß Sperlinge.
Das Arrangement hatten wir Wilhelm Spreetz überlassen. Wilhelm Spreetz, ein behäbiger Herr von Mitte Dreißig, war Oberkellner im Café National hinter der Katholischen Kirche, dem Lokal also, drin wir seit einer ganzen Reihe von Jahren unsre Tunnelsitzungen hatten. Bei diesen Sitzungen uns zu bedienen war der Stolz unsres literarisch etwas angekränkelten Wilhelm Spreetz, und als er davon hörte, daß ich Hochzeit machen wollte, bat er darum, dabeisein und, soweit das in einem fremden Lokale möglich, alles leiten zu dürfen. Eine Bitte, die ich, schon weil ich an die Macht freundlicher Hände glaube, mit tausend Freuden erfüllte.
Bei Tische, zu meinem Leidwesen, fehlte Fournier, was wohl damit zusammenhing, daß er von der mutmaßlichen Anwesenheit meines bethanischen Freundes Pastor Schultz gehört hatte. Beide paßten eigentlich vorzüglich zusammen, waren aber, der eine wie der andere, sehr harte Steine: Fournier ganz Genferischer, Schultz ganz Wittenbergischer Papst. Und so räumte denn Genf, klug und vornehm wie immer, das Feld.
Auf dem Tisch hin standen natürlich auch Blumen; aber was mir noch lieber war, auch schon bloß um des Anblicks willen, das waren die Menschen, die die Tafel entlang saßen. Ich bin sehr für hübsche Gesichter, und fast alle waren hübsch, darunter viele südfranzösische Rasseköpfe. Doch verblieb der schließliche Sieg, wie das zum 16. Oktober auch paßte, dem Deutschtum. Unter den Gästen waren nämlich auch Eggers und Heyse, deren Profile für Ideale galten und dafür auch gelten durften.
Schultz brachte sehr reizend den Toast auf das Brautpaar aus, und was das Reizendste für mich war, war, daß ein Bräutigam nicht zu antworten braucht. Ich beschränkte mich auf Kuß und Händedruck und aß ruhig und ausgiebig weiter, was, wie ich gern glaube, einen ziemlich prosaischen Eindruck gemacht haben soll. Als mir Schultz eine Weile schmunzelnd zugesehen hatte, sagte er zu meiner Frau: »Liebe Emilie, wenn der so fortfährt, so wird seine Verpflegung Ihnen allerhand Schwierigkeiten machen.«
Diese Schwierigkeiten waren denn auch bald da: schon nach anderthalb Monaten flog meine ganze wirtschaftliche Grundlage, das »Literarische Bureau«, in die Luft.
Ich hatte, wie schon angedeutet, geglaubt, im Hafen zu sein, und war nun wieder auf stürmischer See.
Von Zwanzig bis Dreißig
Ein gutes Frühstück dauert bis zum AbendEchte und unechte Dejeuners
Mitunter, wenn ich beim Frühstück sitze,
Kommen mir alle die alten Witze …
1885
Ich begann mit Austern und Chablis
Der Marsch aus dem »Tannhäuser« klang noch, als ich in mein »Hôtel royal« wieder zurücktrat. Es war Dejeunerzeit. Ich begann wie billig mit Austern und Chablis. Diesen Luxus, wenn es an dieser Stelle überhaupt einer war, empfand ich wie eine Pflicht. Ich hatte mich in Epernay und Reims (wer tränke einsam Champagner?) mit einem »bock« begnügt, aber nun auch – nach Analogie jenes vormärzlichen Landsmanns, der, zweimal an dem Eckladen vorübergehend, das dritte Mal um so sicherer überzeugt war, sich für seine Enthaltsamkeit belohnen zu müssen – glaubte auch ich mir ein Anrecht auf das natürliche Gewächs des Meeres, die Auster, erworben zu haben. Sie kam in jener nicht genug zu bewundernden Gestalt, die zwischen der großen holsteinschen und den kleinen Whitstables die richtige Mitte hält, und ich darf sagen, seit jenem schönen Maitage 1864, wo ich mit Dr. H. (den ich hiermit schönstens grüße) in »Wilkens Keller« die ohnehin frischen Düppelreminiszenzen mit Château d’Yquem noch frischer machte, hatt’ ich so nicht wieder gefrühstückt. Denn ein echtes Frühstück, man täusche sich darüber nicht, ist rar wie alles Schöne und Große. Es muß im Vordergrunde Stimmung und im Hintergrunde Erinnerungen haben. Hier in Dieppe hatt ich beides, und so erschien mir denn wieder einmal einer jener
rätselhaft gebornen
Und, kaum begrüßt, verlornen
Augenblicke (wie Lenau das Glück definiert), ein Glückesaugenblick, sag ich, dessen ich um so dankbarer gedenke, als er es mit seiner Zeitbegrenzung nicht allzu peinlich nahm. Im Gegenteil. Es hing Gewicht sich an Gewicht, und die dritte Stunde war vorüber, als ich mich geländerfest auf mein Zimmer hinauffühlte.
Aus den Tagen der Okkupation
Englisches Frühstück
Lassen Sie mich in möglichster Kürze schildern, wie ein Tag verläuft. Nach abgehaltener Morgenandacht versammelt sich alles beim Frühstück: Kaffee und Tee, Hammelbraten und Eier, Speckschnitte und geröstetes Weißbrot machen die Runde am Tisch, und unter Essen und Trinken, Sprechen und Lachen vergeht eine volle Frühstücksstunde.
Ein Sommer in London
Eine Blechkanne mit mäßig starker Lurke
Durch Herrn du Rieux – an den ich durch Herrn Lange (dies ist eine Notiz für Mutter Kummer u. Frau Lieutenant Maul) empfohlen war – ward ich veranlaßt, hier, in unmittelbarer Nähe der Noblesse, meine Wohnung zu nehmen. Ich bezahle wöchentlich 12 Shilling für Wohnung, 5 Shilling für Heizung (es ist hundekalt) und 16 Shilling für Kaffe (Morgens) und Thee (Abends). Macht 33 Shilling (gerade 11 Rthr) pro Woche, pro Monat also 44 Thaler. Dies ist einmal überhaupt (für einen norddeutschen Geldbeutel) kolossal, und ist in specie unverschämt für das, was geboten wird. Wenn sich die Engländer für ihre Frühstücke (d. h. Kaffe mit Imbiß) 1 Shilling bezahlen lassen, so ist das unter Umständen durchaus nicht zuviel, sondern gegentheils noch billig. Man erhält alsdann auf silbernem Kaffebrett 2 silberne Kannen, mit Kaffe und Thee gefüllt, dazu Butter, Milch, 2 Arten Weißbrot, Zucker (soviel man will) und Eier. Wer in solch Frühstück einzuhauen versteht (und es lernt sich) der sorgt gewissenhaft dafür, daß sein Wirth nicht zum reichen Manne wird. Aber von solchem Frühstück ist hier gar nicht die Rede: man kriegt eine Blechkanne mit trüber, mäßig-starker Lurke gefüllt, – fabelhaftes Zeug das den Namen ›Milch‹ usurpirt, Zucker und Weißbrot, und würde den ganzen Kram mit einem halben Shilling (5 Sgr) über den Kopf bezahlen.
An die Mutter, London, 28./29. April 1852
Frühstück mit Blindgänger
In solcher Stimmung erreichten wir die Villa des Herrn Maistle. Ein angenehmer Duft, der unverkennbar aus dem Souterrain kam, zog über den Flur. Mit der ganzen Begehrlichkeit eines ungefrühstückten Menschen traten wir in das Eßzimmer, ohne Ahnung davon, in wie eigentümlicher Weise uns der Genuß dieser Stunde getrübt werden sollte.
Eh wir uns noch setzen konnten, trat nämlich der Hausmeier an uns heran, um, wie er sich ausdrückte, in einer delikaten Angelegenheit unseren Rat zu erbitten. Wir folgten unverzüglich. Es ging einen Gartensteg entlang, dann einen zweiten, bis wir an einem Teil der Einfassungsmauer standen, der gerade hier einen prächtigen, am Spalier gezogenen Aprikosenbaum zeigte. Zu Füßen ebendieses Aprikosenbaums lag eine umgestülpte Kiste, auf die der Hausmeier hinwies. Die Situation schien weiter nichts Bedrohliches zu haben. Nach meiner Meinung konnte sich unter dieser Kiste nur zweierlei befinden, entweder ein Igel oder eine Schildkröte. Ich entsann mich deutlich, in Zeiten, die nicht mehr sind, diesen vielbenachteiligten Kreaturen (weil nur auf die Defensive eingerichtet) eine ähnlich kummervolle Wohnung angewiesen zu haben. Es kam aber anders. Was da drunter lag, war so offensiv wie möglich; – der Hausmeier nahm die Kiste weg, und eine vierundzwanzigpfündige unkrepierte Granate sprach zu unseren Blikken. Gleichzeitig erging die Frage an uns, was er damit machen solle. Wie aus einem Munde riefen wir: »Zunächst zudecken, liegenlassen; das andere wird sich finden.« Wir schritten nun wieder auf das Haus zu und proponierten unterwegs, unmittelbar nach unserem Aufbruch (dies nach wurde sehr betont) ein unglaublich tiefes Loch zu graben und in diesem Loch die Granate zu bestatten. Dies schien auch angenommen zu werden. So setzten wir uns denn zu Tisch. Das Rührei kam, auch der Taraxacum-Salat, aber wir kauten etwas hoch, – die Seele aller Fröhlichkeit, die Unbefangenheit, war hin. Draußen am Aprikosenbaum, keine fünfzig Schritt von uns entfernt, lag die unkrepierte Riesengranate. Riesenschlange wäre nicht unbehaglicher gewesen.