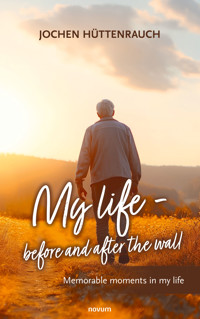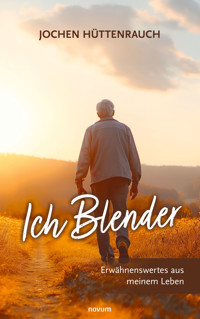
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Emilie bei einem Skiurlaub plötzlich ein Hirn-Aneurysma erleidet, wird ihr Ehemann Johan brutal aus seinem bis dahin komfortablen Leben gerissen. Dies veranlasst ihn, sein bisheriges Leben Revue passieren zu lassen, angefangen von seiner Kindheit auf einem "Bio"-Bauernhof über seinen Werdegang als Ingenieur in der DDR bis hin zum Mauerfall und was danach geschah … Dabei ist Johan alias "Blender", unter welchem Namen der Protagonist bei der Stasi auch geführt wird, über all die Jahre kein Kostverächter, die Verlockungen winken vielerorts … Außerdem entdeckt der todesmutige Abenteurer seine Leidenschaft für das Höhenbergsteigen; die höchsten Gipfel der Erde will er meistern, koste es, was es wolle. Aber wird er es auch schaffen, der Grenzerfahrung des Todes zu trotzen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-99146-975-9
ISBN e-book: 978-3-99146-976-6
Lektorat: Alexandra Eryiğit-Klos
Umschlagfoto: Gearstd | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: Jochen Hüttenrauch/Stasi-Unterlagen-Archiv
www.novumverlag.com
Widmung
Für meine Ameli
Warum?
Dieses Werk ist in Teilen inspiriert von realen Ereignissen, es ist jedoch eine hiervon unabhängige Geschichte. Daher erhebt der Erzählung keinen Anspruch, Geschehnisse und Personen und ihre (beruflichen und privaten) Handlungen authentisch wiederzugeben, vielmehr hat der Autor ein eigenständiges, neues Werk geschaffen.
Lange nach dem Tod seiner Eltern wurde Johan bewusst, dass er doch sehr wenig über ihr Leben und ihre Gedanken zum Leben wusste. Vielleicht hätte er als junger Mensch mehr Fragen stellen müssen. Doch jetzt ist es dafür viel zu spät. Johan weiß nicht, ob es seinen Töchtern und Enkeln mal genauso gehen wird. Er hat sich deshalb nach dem Tod seiner lieben Frau Emilie entschlossen, Erwähnenswertes aus seinem außergewöhnlichen und abenteuerlichen Leben aufzuschreiben. Natürlich für seine Nachfahren, aber auch für sich selbst, um das Erlebte noch mal Revue passieren zu lassen. Vielleicht werden auch seine zwei Töchter und die Enkel irgendwann mal Interesse daran haben zu erfahren, was ihr Vater und Großvater so alles erlebt hat.
Einige Passagen dieser Lebensbeichte sind weder moralisch noch jugendfrei. Das Aufgeschriebene wird sicher nicht unbedingt dazu beitragen, dass Johan als Vater und Großvater beliebter wird, aber das war sein Leben und er hat es gerne gelebt.
Der Schock in Ischgl
Emilie kam durch den Schnee stapfend hinter einem tief verschneiten Holzstapel hervor. Ihr schmerzverzerrtes Gesicht signalisierte, da ist was nicht in Ordnung. Nur wenige Minuten vorher hatten wir auf unserer Wanderung durch das Paznauntal von Ischgl nach Galtür mit unserem Collie „Kaschmir“ noch herumgealbert und bei bester Laune den letzten Urlaubstag genossen. Emilie sah mich mit plötzlich erweiterten Pupillen an und sagte: „Ich habe furchtbare Kopfschmerzen, mir ist schwindelig, halt mich fest.“ Buchstäblich fiel sie in meine Arme und verlor kurz darauf das Bewusstsein.
Einen Moment lang war ich wie versteinert. Mir war unerklärlich, was da passiert war. In ihr schmerzverzerrtes Gesicht schauend, schüttelte ich sie panisch. Als das nichts half, legte ich sie in den in der Nacht frisch gefallenen Pulverschnee und versuchte sie durch leichte Schläge ins Gesicht wach zu bekommen. Kaschmir sprang indes um uns herum, er glaubte, das Albern im Schnee ginge weiter.
Wir waren wenige Minuten vorher an einer Müllsortieranlage vorbeigekommen, die zwischen beiden Orten in freier Landschaft stand. Ich hatte im Vorbeigehen gesehen, dass dort gearbeitet wurde. Ratlos, wie ich war, befahl ich Kaschmir, neben Emilie Platz zu nehmen, und rannte zurück zu diesem Betrieb. Zwei Frauen, die mir entgegenkamen, berichtete ich kurz, was passiert war, und bat sie, doch bei Emilie zu warten, bis ich zurückkommen würde. Auf dem Betriebsgelände angekommen, erklärte ich dem ersten Arbeiter, der mir über den Weg lief, dass meine Frau einige Hundert Meter weiter oben bewusstlos im Schnee liege. Ich bat den Mann, doch mit dem vor dem Gebäude stehenden Kleintransporter zur Unglücksstelle zu kommen. Was dann passieren sollte, war mir in diesen Moment allerdings auch nicht klar. Ohne zu zögern, setzte er sich in das Auto und versuchte den verschneiten, steilen Weg hinaufzufahren. Kaschmir hatte leider nicht bei seinem Frauchen gewartet, sondern war bellend hinter mir hergelaufen. Nach einigen schwierigen Rutschpartien hatte der Transporter es geschafft, bis an die Unglücksstelle ranzufahren. Die beiden Frauen knieten neben meiner Frau und versuchten sie zu beruhigen. Sie war zwischenzeitlich wieder aufgewacht. Nachdem der Fahrer gesehen hatte, in welchem Zustand Emilie war, rief er sofort geistesgegenwärtig die Bergrettung an.
Beim Versuch, sie aufzurichten und sie in das Auto zu heben, hat sie sich erbrochen und gejammert, dass sie immer noch furchtbare Kopfschmerzen habe. Noch bevor wir sie einladen konnten, hörten wir die Sirene des Rettungswagens. Kurze Zeit später ging es mit Martinshorn in Richtung Arztpraxis nach Ischgl. Der sehr freundliche Fahrer des Kleintransporters ist mit mir und dem Hund dem Rettungswagen gefolgt.
Mitten in der Skisaison war die Arztstation in Ischgl durch die täglichen Skiunfälle gut besucht. Zahlreich Patienten saßen im Warteraum. Die Untersuchung von Emilie hatte aber Vorrang und ging sehr zügig. Meine Emilie war gut ansprechbar und sie konnte Hände und Füße bewegen. Dem Arzt berichtete sie über ihre starken Kopfschmerzen und dass sie jetzt am liebsten ins Hotel gehen würde, um zu schlafen. Ich hatte ihm vorher den Hergang des Unglücks kurz geschildert und war froh, von Emilie zu hören, dass es ihr jetzt schon wieder besser gehe. Umso mehr habe ich mich gewundert, dass der behandelnde Arzt den Rettungshubschrauber bestellte, um sie in das nächste Krankenhaus nach Imst zu fliegen.
Der Helikopter landete schon nach wenigen Minuten auf dem dafür vorgesehenen Platz hinter der Arztpraxis. Die zur Besatzung gehörende junge Notärztin entschied nach Erläuterung der Sachlage, ohne zu zögern, dass Emilie nicht in das nahe gelegene Kreiskrankenhaus, sondern sofort in die Uniklinik Innsbruck geflogen werden sollte. Vor dem Abflug sollte sie noch intubiert werden, das scheiterte aber, da ihre Venen trotz intensiver Bemühungen nicht gefunden wurden. Ein Problem, das ich schon lange bei ihr kannte.
Es war mittlerweile später Vormittag geworden. Die Notärztin gab mir zu verstehen, dass es wenig Sinn mache, vor dem späten Nachmittag in der Klinik in Innsbruck aufzutauchen. Ich verabschiedete mich von meiner Emilie doch etwas erleichtert mit einem Kuss, ohne zu diesem Zeitpunkt auch nur zu ahnen, was uns beiden in den nächsten Tagen und Monaten bevorstand.
Nachdem der Hubschrauber gestartet war und ich die Arztrechnung beglichen hatte, ging ich erst mal mit Kaschmir zurück ins Hotel.
Gemeinsam mit Heike und Mike Wolff, unseren besten Freunden, hatten wir eine Woche Skiurlaub in einem der schönsten Hotels von Ischgl, dem „Ischgler Hof“, gebucht. Emilie hatte das Skifahren schon vor einigen Jahren aufgegeben. Für diesen Sport war sie einfach zu ängstlich. Deshalb hatten wir unseren Kaschmir als ständigen Begleiter für sie mitgenommen. Mit ihm streifte sie jeden Tag allein durch die Gegend, während wir uns auf den blauen und roten Pisten des wunderschönen Skigebietes vergnügten.
An diesem letzten Urlaubstag hatte ich mir trotzdem vorgenommen, gemeinsam mit Frau und Hund im verschneiten Paznauntal zu wandern. Ich habe mich mittlerweile tausendmal gefragt, was gewesen wäre, wenn so etwas bei ihren einsamen Spaziergängen an einem der Vortage passiert wäre.
Im Hotel angekommen, habe ich erst mal Heike angerufen, um ihr mitzuteilen, was vorgefallen war. Sie wollte nicht glauben, dass Emilie mit dem Helikopter unterwegs nach Innsbruck war.
Unser feuchtfröhlicher Urlaubsausklang hatte schon am Abend vorher in der Hotelbar stattgefunden. Alle vier haben wir von dem großartigen gemeinsamen Urlaub geschwärmt und uns vorgenommen, das auf jeden Fall im nächsten Jahr zu wiederholen. Es gab bei Emilie am Vorabend keinerlei Anzeichen von Unwohlsein oder Krankheit.
An diesem Nachmittag hatte sie uns mit dem Lift noch auf der Idalp in 2.300 Meter Höhe besucht, um dort mit uns einmal Après-Ski an der Piste zu erleben. Vielleicht war diese Höhe der Auslöser für ihre Erkrankung.
Am frühen Nachmittag machte ich mich auf den Weg in das etwa 100 Kilometer entfernte Innsbruck, vielleicht um Emilie abzuholen? Ich hatte vorsorglich ein paar Sachen eingepackt, für den Fall, dass sie über Nacht in der Klinik bleiben musste. Aufgrund ihres Zustandes beim Abschied war ich aber sehr optimistisch, dass ich am nächsten Tag mit ihr gemeinsam die Heimreise nach Berlin würde antreten können. Meine Überraschung war deshalb groß, als man mir in der zentralen Aufnahme mitteilte, dass sie auf der Intensivstation der Neurochirurgie liege. Auf einmal schlug mir das Herz bis zum Hals. Ich konnte nicht deuten, was das zu bedeuten hatte. Mit weichen Knien versuchte ich in der großen Klinik die Intensivstation zu finden. An der Einlassschleuse musste ich einige Zeit warten. Zu diesem Zeitpunkt waren meine Hoffnungen auf eine gemeinsame Heimfahrt bereits verflogen. Ich versuchte mir vorzustellen, was eigentlich mit Emilie passiert war. Natürlich ohne Ergebnis.
Nach einer kurzen Einweisung und nachdem ich mir die Hände desinfiziert hatte und eine Plastikschürze angelegt hatte, durfte ich nach etwa einer halben Stunde Wartezeit in die Intensivstation eintreten. Ich wurde dort vom Oberarzt in Empfang genommen, der mir als Erstes mitteilte, dass meine Frau sich immer noch im OP befinde. Für mich der nächste Schock. Anhand von MRT-Aufnahmen erläuterte er mir dann, dass Emilie ein Aneurysma (Erweiterungen des Querschnittes von arteriellen Blutgefäßen) im Hirn hatte. Dieses Aneurysma war geplatzt und hatte zu einer Hirnblutung geführt. Durch diese Blutung wurde ein großer Teil des Hirns irreparabel zerstört. Der genaue Umfang der Zerstörung sei aber noch nicht feststellbar.
Tausend Dinge schossen mir in diesem Moment durch den Kopf: unsere nun fast 40-jährige Beziehung, unsere Kinder und Enkelkinder, Emilies Modeladen am Alex und – naheliegend – auch unsere gemeinsame Patientenverfügung. Wir hatten beide vor einigen Jahren eine Patientenverfügung verfasst, um uns gegenseitig einen menschenwürdigen Abgang aus dieser Welt zu ermöglichen. Nach der dramatischen Schilderung des Arztes war eine meiner ersten Fragen deshalb auch, ob es nach derzeitigem Kenntnisstand wahrscheinlich sei, dass Emilie zukünftig wieder ein lebenswertes Leben führen könne. Bei dieser Frage habe ich mich vor mir selbst erschrocken, da es möglicherweise für mich um eine Entscheidung über Leben oder Tod meiner Frau ging. Der Arzt erläuterte mir, dass wahrscheinlich der Schädel geöffnet werden müsse, um Raum für die zu erwartende Schwellung des Hirns zu schaffen. Für diesen Eingriff brauchte er meine Zustimmung.
Mir wurde erklärt, dass größere, gesunde Teile des Hirns bei entsprechender Therapie durchaus in der Lage seien, Funktionen der zerstörten Hirnbereiche zu übernehmen. Ein anderes, aber dadurch lebenswertes Leben sei dadurch möglich. Ich habe etwas erleichtert dieser OP zugestimmt. Ich frage mich heute noch, ob das richtig war.
Die positive Nachricht des Arztes war dann, dass die Blutung im Hirn durch die sogenannte „Coiling-Methode“ gestoppt wurde. Dabei werden Platinspiralen (Coils) an einem Stahldraht fixiert und über einen Katheter von der Leiste bis zum Aneurysma im Kopf geschoben. Dort wird das Coil aus dem Katheter gelöst und rollt sich sofort zu einer Spirale auf. Dadurch wird die weiche Absackung im Gefäß dauerhaft ausfüllt. Diese OP war während meines Gespräches mit dem Arzt noch nicht abgeschlossen.
Zur Besuchszeit spätabends saß ich dann zwei Stunden an Emilies Bett und habe Händchen gehalten. Sie war in ein künstliches Koma versetzt worden, das noch drei Wochen anhalten sollte. Zweiundzwanzig Leitungen Kanülen und Sonden habe ich gezählt, mit denen sie durch unterschiedliche Instrumente und Infusionsapparate versorgt und überwacht wurde.
Es war für mich sehr schockierend und irgendwie nicht fassbar, den Menschen, den ich sehr liebte und mit dem ich so lange Zeit mein Leben geteilt habe, in diesem Zustand und in dieser Umgebung liegen zu sehen. Eine unendliche Ohnmacht habe ich verspürt, die ich in den nächsten Monaten noch intensiver zu spüren bekam.
Während der Rückfahrt nach Ischgl war ich wie in Trance. Mein Leben begann wie ein Film an mir vorüberzuziehen.
Wormstedt – Johan Hüttigs Heimat
Am ersten Sonntag im Dezember 1946 erblickte ich, als echtes Sonntagskind, bei einer Hausgeburt das Licht der Welt. Mein Elternhaus stand in Wormstedt, einem 1000 Jahre alten Dorf im schönen Thüringer Land.
Quälen musste ich mich sicher nicht mehr, denn als sechster Spross der Familie Hüttig war meine Geburt für meine Mama Helene schon fast Routine. Die Geburten meiner zwei Brüder Rudolf und Reiner und der drei Schwestern Johanna, Margret und Gertraut hatten schon Jahre vorher Voraussetzungen für meine stressarme Geburt geschaffen.
Margret hat mir mal erzählt, dass sie von unserem Vater geweckt wurde, weil was neues Aufregendes angekommen sei. Die Enttäuschung war bei ihr groß, als sie im Gebär- und Sterbezimmer unseres Hauses mich als zehn Pfund schweres Baby bestaunen sollte. Die zehn Pfund wurden mit hinlänglicher Genauigkeit auf einer zum Hof gehörenden Viehwaage gemessen. Meine Schwester hatte mit etwas Süßem oder großartigen Spielsachen zum ersten Advent gerechnet und nicht mit einem weiteren plärrenden Etwas, mit dem sie nun auch noch teilen musste.
An dieser Stelle möchte ich meine Verwunderung zum Ausdruck bringen, wie unsere Eltern es geschafft haben, fünf von sechs Geschwistern im Dezember zur Welt zu bringen. Damit noch nicht genug, vier von uns erblickten an zwei aufeinander folgenden Tagen, fast im Jahresrhythmus, das Licht der Welt. Da gab es sicher einen besonderen ehelichen Familienfeiertag im März!
Ich habe meine Existenz wahrscheinlich der Heimkehrerfreude meines Vaters aus der Kriegsgefangenschaft zu verdanken. Diese Freude und Fröhlichkeit haben sich sicher auf meinen Charakter übertragen, wofür ich auch heute noch sehr dankbar bin.
Mein Vater Wilhelm, der deutsche Kaiser lässt grüßen, hatte den Zweiten Weltkrieg und einige Monate Gefangenschaft unbeschadet überstanden. Über seine Kriegserlebnisse hat sich Papa nie groß ausgelassen. Er war da Kraftfahrer und durch sein Talent, alles zu reparieren, was technisch war, hat er die Frontlinie nie gesehen.
Wenn ich den Aussagen meiner ältesten Schwester Johanna und meiner Cousine Annelise, die damals auch in unserem Haus gewohnt hat, Glauben schenken darf, gab es nach mir noch weitere zwei Schwangerschaften unserer Mutter.
Die Föten sind aber nach den heimlichen, sicher schmerzhaften Abtreibungen im Feuer gelandet. Johanna war mal, unter dem Küchentisch spielend, Zeugin eines Gespräches unserer Mutter mit der Nachbarin Hella. Sie sprachen über die Vorbereitung dieser gefährlichen Aktion. Trotz Abtreibungsverbot war offensichtlich Nachbarschaftshilfe dabei üblich. Ich habe also großes Glück gehabt, dass ich gerade noch geduldet war. Vielleicht hatte Hella auch gerade keine Zeit. Danke, Hella!
Es muss meiner Familie nach dem Krieg dreckig gegangen sein, dass zu solchen Mitteln der Familienplanung gegriffen wurde. Ich selbst habe das aber als Kind zu keinem Zeitpunkt so empfunden. Rudolf hat mir in den letzten Jahren einiges über den desolaten Zustand unseres Bauernhofes erzählt, was in mir den Eindruck erweckte, ich hätte meine frühe Kindheit auf einem anderen Hof verbracht.
Da meine Geschwister viel älter waren als ich, sind wir nie Spielgefährten gewesen. Vielmehr hatten sie einen Horror, wenn sie mit mir spielen mussten, da ich oft geheult habe, wenn etwas nicht nach meinem Kopf ging. Besonders schlimm muss das wohl bei Kartenspielen oder „Mensch ärgere dich nicht!“ gewesen sein.
Meine Geschwister waren froh, wenn sie mich nicht betreuen mussten, und meine Eltern mit dem großen Bauernhof hatten Wichtigeres zu tun, als mich zu hüten. So hatte ich schon als kleines Kind sehr viele Freiheiten, die ich auch redlich nutzte.
Ich erinnere mich, als 1951 in Wormstedt der erste Kindergarten eröffnet wurde. Ich war neugierig mit meinen fünf Jahren, was in so einem Kindergarten passierte. Ich bin also am ersten Tag dahin gegangen. Spielzeug musste man mitbringen. Ich hatte einige sehr schöne Holzhäuser, die ich erwartungsvoll eingebracht habe. Nach circa einem Jahr habe ich die wieder abgeholt, weil mein erster auch mein letzter Kindergartentag war. Spielen unter Aufsicht, das war nicht mein Ding. Ich habe mich schon als kleiner Junge am liebsten im kleinen Wäldchen unseres Dorfes und auf weiter Flur herumgetrieben.
Meine erste Spielgefährtin, an die ich mich erinnere, war Gunda, die Tochter meiner Cousine Anneliese. Sie wohnte mit ihrem Mann Romann in zwei Zimmern unseres Hauses. Romann war ein stattlicher Mann und, wenn man von seinem schwarzen Haar absah, das Musterbild eines von den Nazis postulierten Ariers. Er wurde deshalb auch als sehr junger Bursche von der Waffen-SS rekrutiert. Nach dem Krieg hat Anneliese ihm die SS-Tätowierung unter dem Arm mit einem Rasiermesser herausgeschnitten, um ihn vor den Nazi-Jägern zu schützen. Es hat geholfen, er ist vor nicht allzu langer Zeit, im greisen Alter von 94 Jahren, gestorben. Ende der Fünfzigerjahre, als die erste große Flüchtlingswelle aus der DDR war, ist er mit seiner Familie nach Schwaben verschwunden.
In dieser Zeit sind mehrere Familien, auch alteingesessene Bauern, aus unserem Dorf in Richtung Westen ausgewandert. Für uns Kinder war das immer beeindruckend, wenn eines Morgens wieder ein Hof verlassen aufgefunden wurde. Durch das Brüllen des hungrigen Viehs wurde das sehr schnell öffentlich. Ich erinnere mich noch dunkel an eine nächtliche Familienratssitzung kurz vor Errichtung der Mauer, als auch meine Eltern ernsthaft darüber nachgedacht haben, dem allgemeinen Drang nach dem Westen zu folgen. Sie waren aber dann doch nicht mutig genug, oder die Mauer hat es vereitelt.
Mein Vater war alles andere als ein guter Bauer. Seine Talente, die ich auch geerbt habe, lagen mehr bei allen technischen Dingen. Im Dorf sagte man ihm nach, Wilhelm könne alles reparieren, von der Taschenuhr bis zum Mähdrescher. Er war deshalb auch oft unterwegs, um bei anderen Leuten Gerätschaften in Ordnung zu bringen. Die Arbeit auf dem Hof blieb deshalb fast allein an unserer Mutter hängen.
Eines seiner Hobbys war, einen alten Lanz-Traktor, der aus den Zwanzigerjahren stammte, wieder zum Laufen zu bringen. Trotz monatelanger Bemühungen leider ohne Erfolg. Diesem Traktor hat er auch seinen Spitznamen zu verdanken. Das Teil machte immer nur kurz wub, wub und aus war er wieder. Neben „Diftel“ blieb dann auch „Wub-Wub“ als Spitzname an ihm hängen. Heute kann ich gut nachvollziehen, dass es auch wegen dieser Reparaturorgie oft zu Streit zwischen meinen Eltern kam. Das ging so weit, dass Helene mal mit der Mistgabel auf Wilhelm losgegangen ist. Wir Kinder haben uns bei solchen Streitigkeiten wie die sieben Geißlein alle in irgendein Versteck verzogen, um nicht auch noch etwas abzubekommen. Die Streitigkeiten waren meist so laut, dass das ganze Dorf wusste, bei Hüttigs ist wieder mal dicke Luft.
Zum Glück war Wilhelm ein sehr friedlicher Mann, sonst hätte einer von beiden die andauernden Streitigkeiten nicht lange überlebt.
Prügelstrafe zu Recht, aber auch oft zu Unrecht war mir und meinen Geschwistern nicht fremd, allerdings ausschließlich von Helene. Sie schlug oft zu, egal, was sie gerade in der Hand hatte.
Alle Geschwister waren und sind sich auch heute noch einig, wir hatten trotzdem eine gute Mutter. Sie war durch die viele Arbeit und die alleinige Verantwortung für den Hof einfach überfordert. Solange ich sie kannte, war sie nicht ein einziges Mal im Urlaub. Jedes Jahr fuhr sie einmal für ein Wochenende zu ihrer Mutter, also meiner Großmutter nach Kleina auf den elterlichen Bauernhof. Meine Oma Linda war die Einzige meiner vier Großeltern, die ich noch kennengelernt oder, besser, mal gesehen habe. Die anderen waren alle schon tot, als ich geboren wurde. Die Erfahrungen, die ich durch meine Großeltern weitergeben könnte, sind also rudimentär.
Wenn Mama mal verreiste, war unser Papa in solch seltenen Fällen zuständig für das leibliche Wohl der Kinder. Das einzige Gericht, das er beherrschte, war Erbswurstsuppe. Diese komische Suppe mussten wir dann wohl oder übel essen.
Gekocht wurde auf einem mit Holz und Kohle befeuerten Küchenherd, der auch das warme Wasser zum Waschen bereitete und im Winter die Küche heizte.
In der Küche spielte sich das ganze Leben der Familie ab. Die gute Stube wurde nur zu hohen Fest- und Feiertagen geheizt. Der Weihnachtsbaum stand dort meist bis Ostern. Wenn man den dann entsorgen musste, verlor der bei der ersten Berührung alle seine Nadeln.
Außer den Sonntagsbraten mit Thüringer Klößen ist zu den Mittagessen nur wenig in meiner Erinnerung geblieben. An eines erinnere ich mich allerdings noch sehr gut: „heiße Birnen mit Hefeklößen“. Als große Familie hatten wir auch große Töpfe zum Kochen. Die heißen Birnen waren fertig, meine Mutter hatte den Topf deshalb zum Abkühlen ohne Deckel auf den Steinfußboden in der Küche abgestellt. Als Dreijähriger habe ich zu ihren Füßen gespielt und bin dabei rückwärts in den Topf mit den heißen Birnen gefallen. Mein Geschrei war daraufhin groß. Mein verbrühter Hintern und mein bestes Stück wurden schnell von meiner Mutter kräftig gepustet und, wie damals bei Verbrennungen üblich, mit Mehl bestreut. Die Birnen haben mit der besonderen Würze meines Kinderpopos trotzdem allen geschmeckt, schließlich war das eines unserer Lieblingsessen.
In einem Haushalt mit sechs Kindern gab es natürlich über die Jahre mehrere solche Geschichten. Reiner hat mal abends sein Nachthemd gesucht. Da er nicht erfolgreich war, haben dann alle bei der Suche geholfen. Nachdem auch das erfolglos war, hat er sich am Abend ausgezogen und festgestellt, dass er das Nachthemd den ganzen Tag anhatte. Das Gelächter war daraufhin groß.
Margret wurde eines Nachts munter und schrie ganz laut: „Mama, Mama, Hilfe, in meinem Bett sind Zwerge.“ Die finsteren Zwerge entpuppten sich bei genauerem Hinsehen als mit Federn prall gefüllte Zipfel ihres Kopfkissens.
Die kurioseste Nummer, über die meine Geschwister heute noch lachen, habe ich mir geleistet. Als Kleinster musste ich abends stets als Erster ins Bett. Meine Aufgabe war es deshalb auch, den Nachttopf mit ins Schlafzimmer zu nehmen, den ich meist auch gleich benutzte, nachdem ich ihn auf seinen Platz abgestellt hatte. Eines Abends, ich war auf dem Sofa eingeschlafen, hat mich Mama geweckt und aufgefordert, doch im Bett weiterzuschlafen. Noch im Halbschlaf nahm ich meine Hausschuhe, es waren hohe Stoffhausschuhe mit Schnallen, in die eine Hand und den Nachttopf in die andere Hand. So bewaffnet ging ich fast schlafwandelnd die Treppe hoch Richtung Schlafzimmer. Den Nachttopf platzierte ich unter meinem Bett und die Hausschuhe auf dem angestammten Platz des Topfes. Zielsicher habe ich dann meine Hausschuhe angepeilt und vollgepinkelt. Gertraut war mir gefolgt und hat sich bei dem Anblick dieser Aktion vor Lachen fast in die Hosen gemacht.
Meine älteste Schwester Johanna hatte es wohl am schwersten von uns allen. Sie war nach der Meinung unserer Mutter für vieles verantwortlich, was wir, und vor allem ich, ausgefressen hatten. Sie hat zwar nie gepetzt, aber ich habe als Ausgleich danach immer mal eine Tracht Prügel von ihr erhalten. Johanna konnte stur und bockig sein wie ein Esel. Ich erinnere mich, dass sie, nachdem sie gemaßregelt wurde, stundenlang draußen stehen konnte, egal ob es geregnet oder geschneit hat.
Ein historischer Rückblick zeugt von der großen Musikalität der Familie Hüttig. Mein Großvater Otto, den ich leider nicht mehr kennenlernen durfte, war Chorleiter des Wormstedter Kirchenchores, aber vor allem Vorstand des Thüringer Sängerbundes. In dieser Eigenschaft nahm er auch an dem legendären 10. Deutschen Sängerbundfest 1928 in Wien teil.
Die musikalische Tradition geht aber noch weiter zurück. Ludwig Christoph Hüttig, mein Ururgroßvater, der von 1818 bis 1871 lebte, war Choradjutant, also Musikoffizier beim Militär. Ich erwähne das, weil wir auf unserem Dachboden noch die Symbole von Ludwigs Status aufbewahrt hatten, nämlich den sehr schönen Tambourmajorstab und seine Pickelhaube. Leider haben diese Relikte aus der Vergangenheit meinen Spieltrieb – unwissend, wie ich war – nicht überlebt. Der einzige Dachbodenfund, den ich heute noch besitze, ist die 1939er-Auflage des verbotenen Buches „Mein Kampf“ eines gewissen Adolf Hitler.
Das Musizieren und Klavierspielen waren also eine Familientradition. Besonders die Weihnachtszeremonien sind mir in Erinnerung geblieben. Unser Papa saß am Klavier und wir haben zu seinem Spiel Weihnachtslieder gesungen. Unsere Eltern legten Wert darauf, dass alle Kinder eine Klavierausbildung erhielten. Meine Geschwister mussten es über sich ergehen lassen. Kurz bevor ich an der Reihe war, starb allerdings unser Klavierlehrer. Damals war ich froh darüber, dass der bittere Kelch an mir vorübergegangen ist. Als Erwachsener habe ich es dann allerdings öfter bereut, nie ein Musikinstrument gelernt zu haben. Bezahlt wurde der Musiklehrer, Herr Mehring aus Apolda, übrigens in Naturalien, wie Eier, Wurst und sonstiges Essbares vom Bauernhof.
Reiner hatte von uns Kindern das traurigste Schicksal. Er war sicher der Kreativste von uns. Das Malen und Klavierspielen gehörten zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Beginnend mit zwölf Jahren konnte Reiner schlecht laufen. Als Dreijähriger konnte ich schon schneller rennen als er. Ich erinnere mich, dass er bei der Abreise zu einem Kuraufenthalt zu mir sagte: „Wenn ich wieder nach Hause komme, werde ich viel schneller sein als du.“ Leider blieb das sein Wunschtraum.
Nach wenigen Jahren konnte er trotz längerer Krankenhaus- und Kuraufenthalte nicht mehr gehen. Er lag die letzte Zeit seines Lebens, um ihm die Teilnahme am Familienleben zu ermöglichen, in unserer Küche, in einem Gipsbett. Zu den wenigen Aufgaben, die ich zu leisten hatte, gehörte die Betreuung von Reiner. Das hieß ihm Gesellschaft leisten, die Urinflasche halten, wenn er pullern musste, und ihm beim Essen helfen, da er langsam blind wurde und auch die Arme schrittweise den Dienst versagten. Wenn ich seinen Penis anfasste, um ihn in die Flasche zu stecken, bekam er manchmal eine Erektion. Damals habe ich mir nichts dabei gedacht. Später wurde mir bewusst, dass er als Achtzehnjähriger durch seine Krankheit nie Gelegenheit hatte, mit einer Frau zusammenzukommen. Meine Berührungen haben ihn sexuell erregt. Man könnte nach der Lesart des 21. Jahrhunderts feststellen, das wäre Kindesmissbrauch. Mir hat dieser „Missbrauch“ aber sicher nicht geschadet. Im Gegenteil, ich bin im Nachhinein froh, dass ich Reiner so zu ein wenig sexueller Erregung verhelfen durfte.
Reiner starb drei Tage vor meinem zehnten Geburtstag. Ich war am Nachmittag nach der Schule allein mit ihm in der Küche. Reiner schlief, plötzlich hustete er ganz fürchterlich, verdrehte die Augen und hörte nach kurzer Zeit auf zu atmen. Ich rannte schreiend auf den Hof und rief um Hilfe. Meine Schwester Johanna kam sofort. Helfen konnte aber keiner mehr. Reiner hatte sein fünfjähriges Martyrium überstanden.
Die Beerdigung fand an meinem zehnten Geburtstag statt. Ich erinnere mich, dass ich an diesem Geburtstag ein kleines Persipanschwein, also ein Schwein aus dem damals üblichen Marzipanersatz, geschenkt bekommen habe.
Vor der Beerdigung wurde Reiners Leichnam in dem Zimmer, in dem er und wir alle zur Welt kamen, aufgebahrt. Die Aufbahrung war im offenen Sarg und jeder aus dem Dorf, der einen Kondolenzbesuch machte, hatte auch Gelegenheit, sich von unserem verstorbenen Bruder zu verabschieden.
In unserem Familienalbum gibt es Fotos von dieser Aufbahrung. Für mich als zehnjährigen Jungen war es schon komisch, mit meinem toten Bruder unter einem Dach zu schlafen. Deshalb durfte ich in diesen Nächten auch zu meinen Eltern ins Bett. Morgens, als ich wach wurde, lag ich dann aber wieder in meinem eigenen eisernen Gitterbett, was für mich in diesem Alter langsam zu klein wurde.
Reiner wurde von sechs kräftigen Männern unseres Ortes unter Glockengeläut zum Friedhof getragen. Der Kinderchor der Schule hat an seinem Grab gesungen, während mein Bruder der Erde übergeben wurde. Meine Schwester Johanna hat, für mich unverständlich, nicht an der Trauerfeier teilgenommen. Später habe ich dann erfahren, dass sie schwanger war. Eine Trauerfeier war damals in diesem Zustand tabu.
Nach Reiners Tod hatte ich außer dem lästigen Schulbesuch fast unbegrenzten Freiraum. Meine Geschwister waren aus schon erwähnten Gründen froh, wenn sie sich nicht um mich kümmern mussten. Auch meine Eltern konnten durch die vielfältigen Aufgaben des Hofes nicht auch noch auf mich kleinen Hosenscheißer aufpassen.
Der Platz in der Küche, an dem Reiners Sterbebett stand, wurde mir und meinem Elternhaus fast zum Verhängnis. Abends allein zu Hause, hätte ich es fast geschafft, unser Haus abzufackeln. Auf dem Sofa sitzend habe ich Lagerfeuer gespielt. Ein Haufen zerknülltes Zeitungspapier, den ich angezündet hatte, drohte sehr schnell außer Kontrolle zu geraden. Mit großer Mühe und einem Eimer Wasser hatte ich es gerade noch geschafft, ein Übergreifen der Flammen auf das Sofa zu verhindern. Die mit Bohnerwachs getränkten Dielen hatten danach einen nicht zu übersehenden Brandfleck. Dem Schock meiner Eltern folgte eine Tracht Prügel. Sogar verdient. Ich hätte es besser wissen müssen.
Wenige Jahre vorher gab es einen Großbrand in Wormstedt. Die größte Feldscheune unseres Dorfes stand eines Abends in Flammen und brannte bis auf die Grundmauer nieder. In respektvoller Entfernung beobachteten viele Dorfbewohner das gruselige Schauspiel. Auch ich konnte die meterhoch schlagenden Flammen beobachten und die Hitze spüren. Die Feuerwehr war nur noch in der Lage, die Ausbreitung des Brandes zu verhindern. An ein Löschen war nicht zu denken. Am darauffolgenden Morgen war die Scheune verschwunden. Tote Schafe, die da eingesperrt waren, lagen nackt mit aufgedunsenen Körpern herum und stanken fürchterlich. Für mich stellt sich die Frage: Habe ich, inspiriert durch diesen Brand, das Lagerfeuer gemacht, oder habe ich wegen dieses Erlebnisses geistesgegenwärtig richtig gehandelt und das Feuer gelöscht? Egal wie, mein Elternhaus steht noch.
Das aus insgesamt zehn mehr oder weniger großen Stuben bestehende Wohnhaus unseres Hofes wurde im Jahr 1777 als Lehm- und Fachwerkbau von der Familie Hanß errichtet. Der aus Flurstedt stammende Bauer Robert Lepold Hüttig heiratete am 13. April 1875 in die Familie ein und übernahm den Hof.
Die dazugehörigen Stallungen stammen aus dem Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Etwa 17 Hektar Acker und Wiesenland gehörten auch dazu. Viel Nutzvieh wollte täglich versorgt werden. Das waren sechs Kühe, drei Pferde, diverse Schweine und jede Menge Kleinvieh wie Schafe, Ziegen Gänse, Enten, Hühner und Kaninchen.
Neben dem Nutzvieh hatten wir auch immer ein bis zwei Hunde und viele Katzen. Ich erinnere mich an maximal zwölf Katzen. Mit Gertraut gemeinsam habe ich öfter mal Katzenversammlung in der Küche veranstaltet. Unser größter und ältester Kater war sehr starrsinnig und wollte immer eigenmächtig die Versammlung verlassen. Ich habe ihn deshalb mal am Hinterbein festgebunden, um seine Flucht zu verhindern. Das hätte ich lieber nicht tun sollen. Er riss wieder aus und hing am Strick fest; als ich ihn daraufhin losbinden wollte, hat er mich fürchterlich in die Hand gebissen, ich habe geblutet wie ein Schwein und heute noch eine Narbe als Andenken an unseren Chefkater.
Viele Katzen bedeuteten aber auch viele junge Katzen. Auf einem großen Bauernhof findet man die putzigen Kätzchen meist erst, wenn sie schon etwas größer und ausgesprochen niedlich sind. Ich war dann derjenige, der dafür sorgen musste, dass die Population nicht überhandnahm. Die kleinen Kätzchen habe ich ohne Skrupel mit viel Schwung an eine Wand geworfen. Wenn sie dann nach ein, manchmal auch zwei Würfen betäubt waren, wanderten sie in die Jauchengrube. Dieses Prozedere klingt ziemlich brutal, auf einem Bauernhof war es aber Normalität, Tiere zu töten, entweder um die Vermehrung im Zaum zu halten oder sie später genüsslich zu essen.
Kurios war, dass wir als Kinder nicht zusehen durften, wenn Kühe, Stuten oder Sauen gedeckt wurden. Wir hatten einige Jahre einen prächtigen Zuchtbullen auf unserem Hof. Immer wenn von anderen Höfen die Kühe zum Decken gebracht wurden, wurde ich als Kind im Haus eingesperrt, bis die Prozedur erfolgreich beendet war. Trotzdem haben meine Spielkameraden und ich Mittel und Wege gefunden, das Liebesspiel der Tiere zu beobachten. Der Austausch der dabei gewonnenen Erkenntnisse mit meinen Altersgenossen nach dem brutal anmutenden Geschlechtsakt, der manchmal menschliche Unterstützung brauchte, um den richtigen Eingang der Kuh zu finden, hat immer besonders großen Spaß gemacht.
Sexualität spielte für uns als Dorfkinder verbotenerweise immer eine wichtige und aufregende Rolle. Erfahrungen wurden gesammelt und ausgetauscht, noch bevor wir in die Schule kamen.
Ich erinnere mich an so ein frühsexuelles Erlebnis mit schmerzhaften Folgen. Zusammen mit einem meiner besten Spielkameraden Georg haben wir Gunda an einem schönen Sommertag in ein Tabakfeld gelockt. Für Außenstehende waren wir zwischen den zwei Meter hohen Tabakpflanzen unsichtbar. Gemeinsam haben wir Gunda überredet, uns ihre Muschi zu zeigen. Im Gegenzug haben wir dann unsere kleinen Schnipse, wie wir damals unseren Penis nannten, entblößt. Gunda mit ihren vielleicht sechs Jahren hat abends ihrer Mutter gebeichtet, dass Johan und Georg ihr den falschen Popo gezeigt haben. Daraufhin setzte es von meiner Mutter am nächsten Tag wieder mal eine schmerzhafte Tracht Prügel.
Auf unserem Hof wohnte in den Fünfzigern auch die Schwester meiner Großmutter, Clara von der Gönne. In mir fließt also auch ein wenig blaues Blut!
Sie wurde nach dem Krieg enteignet. Ihrer Familie gehörte früher das Rittergut, die Brauerei und das Wirtshaus in unserem Dorf.
Sie konnte von dem großen Besitz nur wenig retten, dazu gehörte auch ein Buch über die „Anatomie der Frau“. Dieses Nachschlagewerk wurde gut vor dem Zugriff von uns Kindern versteckt. Da ich wusste, wo sie den Schlüssel ihrer jetzt winzig kleinen Wohnung über dem Pferdestall versteckte, habe ich mich heimlich in ihr Kämmerlein geschlichen, um bei der alten Tante zu stöbern, dabei habe ich dieses interessante Buch gefunden. Darin gab es die ganzseitige Abbildung einer nackten Frau, dieses Bild war für mich damals das Größte. Nur meine besten Freunde durften es nach dem Schwur, niemandem etwas zu verraten, ansehen. Diese nackte Frau war das Aufregendste, was man zeigen konnte in diesen augenscheinlich bürden und verklemmten Zeiten.
Die jährlichen Schlachtfeste waren immer Höhepunkte im täglichen Einerlei auf dem Bauernhof. Um ein eigenes Schwein zu schlachten, musste man sich einen Schlachtschein besorgen. Den bekamen Bauern aber nur, wenn der vom sozialistischen Staat auferlegte Lieferplan für Schweine erfüllt war. Allerdings hatte die achtköpfige Familie auch Hunger trotz fehlender Planerfüllung. Da kam es schon mal vor, dass eines Nachts ein Schwein aus dem Stall verschwunden war.
Um das verschwundene Tier möglichst geräuschlos zu zerlegen, wurden in der Erntezeit im Sommer (geschlachtet wurde natürlich nur im Winter) beim Stapeln der Strohballen in der Scheune Hohlräume geschaffen, die als Mordhöhle für das Töten des Schweins geeignet waren. Zumindest ich als Kleinster in der Familie war selbstverständlich bei solchen Aktionen aus Gründen der Geheimhaltung nicht eingeweiht. Trotz aller Vorsicht sind meine Eltern mal beim Schwarzschlachten erwischt worden. Da auch meine adlige Tante beteiligt war, wurde das Verbrechen mit einer saftigen Geldstrafe geahndet. Außerdem war das auch noch einen kurzen Artikel über die Machenschaften der ehemaligen Großgrundbesitzer im „Bauernecho“, der Tageszeitung der Thüringer Bauern, wert.
Meist waren Hüttigs Hausschlachtungen aber legal und manchmal auch wirklich festlich. Das Größte, woran ich mich erinnere, kostete zwei Schweinen und einem Jungbullen das Leben. Da hat uns am dritten und letzten Tag des Schlachtfestes sogar die Feuerwehrkapelle einen Marsch geblasen. Die fleißigen Bläser und die anderen fleißigen Helfer wurden dann natürlich bestens verköstigt.
Das Schweineschlachten hatte immer einen ähnlichen Ablauf. Bevor es losging, wurde die Waschküche, in der auch jeden Sonnabend gebadet wurde, gründlich gereinigt. Unter den gemauerten Kessel wurde nachts Feuer gemacht, damit morgens, wenn der Fleischer kam, das Wasser schon kochte. Wenn Hugo, unser Fleischer, dann da war, hörte alles nur noch auf sein Kommando. Die erste Festlegung war, Frauen, die ihre Tage haben, haben im Schlachthaus nichts zu suchen. Jegliche Berührung mit dem Fleisch war verboten. Inwieweit fundiert war, dass ansonsten die Gefahr bestand, die Wurst könnte verderben, lasse ich hier offen.
Meist wurde das Schwein laut quiekend vom Schweinestall in die direkt danebenliegende Waschküche geführt. Die Tiere haben wohl gespürt, dass ihr letztes Stündlein geschlagen hatte. Manchmal war das der Kampf, zwei bis drei Männer gegen ein Schwein, bis das Tier richtig platziert war. Mit dem Bolzenschussgerät wurde das Schwein durch einen aufgesetzten Schuss in den Schädel getötet. Auf dem Boden liegend, machte der Fleischer dann mit einem Schnitt durch die Kehle und die Halsschlagader dem Tier den Garaus. Das Blut musste mit einer untergehaltenen Schüssel aufgefangen werden. Die Schüssel zu halten, war später meine Aufgabe als Kleinster, während ein kräftiger Mann die Vorderbeine festhalten musste, damit das Tier nicht zu sehr ausschlug. Als ich das erste Mal beim Töten dabei sein durfte, hat mich der Fleischer beauftragt, das Hinterbein des liegenden Schweins zu halten. Das habe ich nur einmal gemacht. Beim Versuch, das Bein festzuhalten, bin ich im hohen Bogen in der nächsten Ecke gelandet. Den kräftigen Hinterlauf, das spätere Eisbein, konnte man einfach nicht halten, das war auch nicht nötig, denn die Tritte gingen, wenn keiner sich dumm anstellte, ins Leere. Eine weitere Bösartigkeit von Hugo war das Anmessen meiner persönlichen Leberwurst. Als Leberwurstfan soll ich mal gesagt haben: „Ech asse nar Lawerworscht.“ Dazu hat er mir den Darm des Schweins um den Kopf und Hals gewickelt. Diese Prozedur hatten alle meine Geschwister vorher durchgemacht und über mich deshalb hämisch gelacht.
Das Reinigen der Därme war ein Job, für den man einen guten Magen haben musste. Die Därme mussten gewendet und mit einem Holzschaber gereinigt werden, dabei kam der ganz und halb verdaute Darminhalt zum Vorschein. Oft mit Massen von Spulwürmern. Wegen des Gestankes konnte das nur auf dem Hof gemacht werden. Auch dafür hat sich Hugo immer den ausgesucht, der ihn vorher mal geärgert hatte.
Trotz dieser unappetitlichen Prozedur hat uns die Wurst, die später in die Därme gefüllt wurde, immer sehr gut geschmeckt. Zum Zerlegen wurde das Schwein auf eine liegende Leiter gebunden und je nach Gewicht des Tieres von zwei bis drei Männern an die Wand gestellt. Das Zerlegen mit der Axt und einem scharfen Messer war dann allein dem Fleischer vorbehalten. Zum Schneiden des Fleisches unter Hugos Kommando mussten dann wieder alle ran.
Wie bereits erwähnt, war mein Vater ein Technikfreak. Beim Schlachtfest mit den zwei Schweinen und dem Ochsen musste viel Fleisch mit dem Fleischwolf zur Wurstherstellung zerkleinert werden. Üblicherweise war damals das Drehen des Fleischwolfs Handarbeit. Mein Vater hatte aber eine geniale Idee. Unser großer Küchentisch aus stabilem Eichenholz wurde auf den Hof transportiert und dort verkeilt. Statt Kurbel wurde am Fleischwolf, der auf dem Tisch verschraubt war, eine Riemenscheibe montiert. Wir hatten einen 3-PS-Elektromotor, der damals so groß war wie heute ein 30-KW-Elektroantrieb. Der wurde ebenfalls auf dem gepflasterten Hof verkeilt. Ein Flachriemen von der Dreschmaschine sollte die Kraftübertragung zwischen Motor und Fleischwolf übernehmen. Vor dem Einschalten hat mein Vater alles noch mal überprüft und Romann, der ihm geholfen hatte, die Technik zu montieren, hat sich zur Sicherheit noch auf den Tisch gesetzt. Der Fleischer und seine neugierigen Helfer postierten sich in großer Erwartung, aber in respektvollem Abstand um das technische Monstrum. Es konnte also losgehen. Mein Vater hat den Motor angelassen und siehe da, der Wolf drehte sich. Als der Motor dann aber auf volle Leistung geschaltet wurde, gab es einen kräftigen Ruck, der Tisch fiel um und Romann stürzte im hohen Bogen auf das Pflaster. Zum Glück hat der Fleischwolf die Aktion heil überstanden, sodass die Bastler das Fleisch dann doch mit ihrer Muskelkraft statt Geisteskraft durchdrehen konnten.
Ein besonders spannender Akt war das Kochen der Blut-, Leber- und Schwartenwurst im Kessel. Der auch zu kochende, mit Blutwurst und der Zunge gefüllte Magen des Schweins war das sensibelste Objekt im Kessel. Wenn der Magen beim Kochen platzte, schmeckte die Wurstsuppe zwar noch herzhafter, aber acht bis zehn Pfund guter Zungenwurst waren verloren. Hugo passierte das leider öfter mal, sodass unsere Mutter sogar mal den Fleischer gewechselt hat.
Im Dorf war es üblich, die Wurstsuppe zusammen mit einer kleinen Kochwurst an verwandte und befreundete Familien zu verteilen. Der Rücklauf erfolgte dann, wenn auf den anderen Höfen geschlachtet wurde. Das bedeutete für mich, heiße Wurstsuppe in einem Blechkrug zu den befreundeten Bauernhöfen und Familien zu tragen. Oft kam ich dann mit kleinen Leckerlies zurück.
Nach dem Schlachten war das Räuchern des Schinkens sowie der Koch- und Knackwurst angesagt, dafür war eine Räucherkammer im Haus eingemauert. In dieser Zeit roch das ganze Haus nach schwelendem Buchenholz und Räucherwurst. Nach dem Räuchern wurden 30 bis 40 geräucherte Würste und der Schinken in der Speisekammer aufgehängt. In den ersten Wochen tropften sie dort vor sich hin. Eine alte Bauerntruhe, die sich heute noch in meinem Besitz befindet, stand unter der Wurst. Die Spuren der tropfenden Würste sind heute nach 60 Jahren noch zu sehen und sogar zu riechen. In dieser Truhe wurde damals das aus eigenem Getreide gemahlene Mehl gelagert. Auch die Spuren der Mäuse, die sich m Verzehr des Mehls beteiligten, sind heute noch zu erkennen.
Neben der Truhe stand ein großes Holzfass, in dem sich der Zucker befand. Es handelte sich um Zucker aus eigener Zuckerrübenernte, der uns durch die Lieferung von Rüben zustand. Das Ernten der Rüben war eine schweißtreibende Angelegenheit. Es gab dafür eine spezielle Rübengabel. Einstechen, lockern, rausziehen und auf den Leiterwagen werfen, so war der Ablauf. Bis der Wagen voll wurde, war es ein hartes Stück Arbeit, die nur noch vom Kartoffellesen übertroffen wurde. Der Transport der Rüben mit Pferd und Leiterwagen zur nächsten Bahnstation war dann noch mal ein schwieriges Unterfangen.
Heute wird viel für den Umweltschutz getan und noch mehr darüber geredet. Es ist deshalb interessant, unseren Bauernhof der Fünfziger- und Sechzigerjahre mal mit den Augen des Umweltschützers anzusehen. Abgesehen von der stark schwefelhaltigen Rohbraunkohle, die wir damals zum Heizen und Kochen verbrannt haben, war unser Hof ein fast geschlossenes Ökosystem. Fast alles, was auf dem Hof anfiel, wurde verwertet. Beginnen wir beim Schlachten eines Schweins. Alles Fleisch und die Innereien wurden als Braten, Schinken oder Wurst von uns verzehrt. Der stinkende Darminhalt wurde den überlebenden Schweinen noch mal zum Fressen vorgeworfen, die der Gestank offensichtlich nicht gestört hat. Die Knochen und die Rückenhaut mussten abgeliefert werden und wurden zu Seife und Schweinsleder verarbeitet. Der Bauchnabel und der Penis wurden im Winter als salzfreies Vogelfutter auf dem Hof aufgehängt und von den Singvögeln auch geliebt. Alle anfallenden organischen Stoffe wie Kot, Mist und Urin wanderten auf den Mist und in die Jauchengrube und wurden später zur Düngung der Felder verwendet. Selbst die Asche kam irgendwann aufs Feld. Direkt über der Jauchengrube befand sich das Freiluftklo, es hieß bei uns allerdings „Scheißhaus“. Für rückwärtige Dienste wurde das „Bauernecho“ verwendet, wenn nach dem Lesen oder vom Eiereinpacken zum Verkauf was übrig blieb. Durch intensives Knittern musste das für die rückwärtigen Dienste erst verwendbar gemacht werden.
Zum Mistaufladen musste der Leiterwagen mit seinen eisenbereiften Holzrädern rückwärts an den Mist herangeschoben werden. Eines Tages ging dabei unser Scheißhaus zu Bruch. Die Mauern fielen so weit ein, dass man beim Draufsitzen den ganzen Hof gut überblicken konnte. In meiner Erinnerung ist haften geblieben, wie meine Mutter darauf thronte. Wenn, wie üblich, kein Papier auf dem Klo war, rief sie dann laut: „Papier!“ Das war für den, der am nächsten stand, das Zeichen, loszusprinten und eine Zeitung zu holen.
Zurück zum Umweltschutz. Abgewaschen wurde nur mit heißem Wasser, das Abwaschwasser bekamen dann die Schweine. Abgase durch Motoren gab es nicht, da alles mit unseren zwei bis drei Zugpferden bewegt wurde. Wenn mal was kaputtging und nicht wieder repariert oder anderweitig verwendet werden konnte, wanderte das in die Scherbengasse, ein etwa 60 Zentimeter breiter Zwischenraum zwischen unserem Haus und dem Nachbarhaus. Diese Gasse wurde während meiner gesamten Kindheit nicht ein einziges Mal geleert. Für uns Kinder war es ab und zu eine richtige Fundgrube für exotische Relikte aus der Vergangenheit.
Im Frühjahr, nach meinem elften Geburtstag, bekam ich meinen ersten eigenen Hund. Mira, eine altdeutsche Jagdhündin, war die Tochter der Hündin vom Elternhof meiner Mutter in Kleina. Von da an verbrachte ich einen großen Teil meiner reichlich bemessenen Freizeit zusammen mit meiner Hündin. Mira war nicht der erste Hund auf unserem Hof. Der Vorgänger Molli war ein Kettenhund, der leider aufgrund seiner restriktiven Haltung sehr bissig war. Ich hatte Angst vor ihm und habe deshalb zu diesem Schäferhund-Mischling keine Beziehung aufbauen können. An sein bitteres Ende erinnere ich mich aber sehr gut.
Ins Dorf kam regelmäßig, vielleicht einmal im Monat, der Fellmann mit einem Pferdefuhrwerk. Er sammelte Knochen, Felle von Kaninchen, aber auch gehäutete Schweinerücken. Er hat gemeinsam mit meinem Vater unserem alten Hund Molli den Garaus gemacht. Leider auf eine bestialische Art und Weise. Mein Vater hatte Mollis Kette durch den Türspalt des Scheunentores gesteckt und den Hund so an das Tor rangezogen, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Der Fellmann schlug dem Hund dann mit der Axt den Schädel ein. Obwohl ich Molli nicht mochte, habe ich beim Zusehen dieses Massakers geweint. Töten war aber nun mal Alltag auf einem Bauernhof.
Oft war ich mit Mira in dem leider sehr klein geratenen Dorfwäldchen oder in der Flur unterwegs. Ich frage mich heute, was ich dort wohl die ganze Zeit gemacht habe.
Wir bildeten Kinderbanden, bauten Laubhütten im Wald und kämpften gegeneinander. Schon damals musste ich als Bandenchef einer Kinderbande meine Führungsqualitäten unter Beweis stellen. Zum Chef wurde ich in nicht geheimer Abstimmung von den Mitgliedern gewählt.
Der Wahl gingen oft auch handgreifliche Machtkämpfe voraus. Einmal bin ich bei einer solchen Schlägerei fast ohnmächtig geprügelt worden, als mein Klassenkamerad und ewiger Rivale Rolli die Macht in unserer Bande übernahm. Schon hier wurde mir bewusst, der Weg zur Macht ist steinig und nicht immer gleich erfolgreich. Es war eine gute Schule für mein späteres Leben. Mein Freund und Rivale Rolli musste nach kurzer Zeit die Macht nicht ganz freiwillig, nach einem kurzen Nasenbluten, wieder an mich abgeben.
Unsere Bande verfügte selbstverständlich auch über Waffen. In der Regel waren das aus Stöcken selbst geschnitzte Schwerter. Pfeil und Bogen hatten wir selbst durch Plünderung von Haselnussbüschen hergestellt. Auch Gummikatapulte, selbst aus Astgabeln und Reifengummi gebastelt, waren Teil des Arsenals. Heimlich hatten wir sogar als Überreste aus dem Krieg richtige Waffen. Ich war stolzer Besitzer eines verrosteten Säbels, der wohl aus dem Ersten Weltkrieg stammte und früher mal sehr schön gewesen sein muss. Für kurze Zeit besaß ich auch einen Revolver. Nachdem ich den mal ausgeborgt hatte, sah ich ihn leider nie wieder. Meine wertvollste Waffe war allerdings ein gut erhaltener Karabiner aus dem Zweiten Weltkrieg. In Ermangelung von Patronen habe ich versucht, das Teil mit Kugeln zu laden und zu schießen, was zum Glück nicht funktionierte. So ein besonderer Schatz musste natürlich gut versteckt werden. Die wenig genutzte kleine Leichenhalle auf unserem Friedhof war ein gutes Versteck. Irgendwann war die gefährliche Waffe von da aber verschwunden. Der Gemeindediener unseres Dorfes hat den Karabiner wahrscheinlich gefunden und konfisziert.
Zu den vielfältigen Aufgaben unseres Gemeindedieners, genannt „Bimmel-Arno“, gehörte neben der Friedhofspflege auch das Ausrufen von Bekanntmachungen im Dorf. Da ich schon als Jugendlicher mit meiner Aussprache kaum zu überhören war, durfte ich diese Aufgabe manchmal übernehmen. Das funktionierte so: An mehreren zentralen Plätzen unseres Dorfes wurden, durch andauerndes Läuten mit einer großen Handglocke, die Einwohner auf die Straße gelockt, um dann mit nicht zu überhörender Stimme Neuigkeiten und Informationen im allgemeinen Interesse, wie Gemeindeversammlung, Stromsperre oder Beerdigungstermine, auszurufen.
Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen in Wald und Flur war, auf Bäume zu klettern. Dabei war es für mich wichtig, Bäume zu besteigen, die für meine Spielkameraden meist nicht zu bezwingen waren. Ich erinnere mich an eine alte Kopfweide am Rande des Utenbachs. Der durch das jahrzehntelange Schneiden von Flechtzweigen schon recht geräumige Kopf der Weide befand sich in vier bis fünf Metern Höhe. Der Stamm bot aber wenige Möglichkeiten, da hochzukommen. Ich hatte ihn trotzdem mit teils waghalsigen Klettereinlagen schon mehrmals bestiegen. Klaus, einer meiner Spielkameraden, wollte unbedingt auch den Kopf der Weide erreichen. Durch meine Hilfestellung und Hinweise ist er nach mehreren Versuchen auch oben angekommen. Sein Gipfelglück war aber nur kurz. Vor dem Abstieg hatte er dann so viel Angst, dass ich nach mehreren seiner untauglichen Versuche Hilfe von der freiwilligen Feuerwehr anfordern musste. Die haben ihn unter hämischem Gelächter mit einer Leiter aus luftigen Höhen befreit. Klaus wurde danach von den anderen Kindern noch lange verspottet. So richtige Freunde waren wir seitdem nicht mehr.
Im September 1953 wurde ich zusammen mit fünf weiteren Kindern aus unserem Dorf eingeschult. Wie die Schuleinführung und was in der Zuckertüte war, daran kann ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Diese Schultüte war für mich auch kein Trost für die Freiheit, die ich damit aufgeben musste. Wenn ich mich recht besinne, war ich von Anfang an nicht besonders motiviert, den halben Tag die Schulbank zu drücken, während draußen Wald und Flur auf mich warteten.
Der Unterricht war so organisiert, dass die erste und dritte Klasse gemeinsam in einem Klassenraum von einem Lehrer unterrichtet wurden. Unsere Klassenlehrerin Fräulein Gärtner kam jeden Tag gemeinsam mit der einzigen Erstklässlerin aus dem Nachbardorf gelaufen. In diesen zwei Kilometer entfernten Ort gab es damals keine Busverbindung. Die Klassenstärke betrug beide Klassen zusammen 14 Schüler.
Unsere ersten Schreib- und Rechenversuche haben wir auf Schiefertafeln gemacht. Wichtig war neben dem Pausenbrot, jeden Tag einen frisch gespitzten Schieferstift und einen feuchten Schwamm, der außen mit einer Schnur am Schulranzen befestigt war, mitzubringen. Mein Pausenbrot habe ich nie vergessen.
Aus früheren Zeiten der Einklassenschule, die mein Vater und auch meine älteren Geschwister während des Krieges noch genossen hatten, gab es ein Schulgebäude im Dorf, das bestand aus einem Klassenraum. Heute ist dieses Gebäude ein gut besuchtes Restaurant mit dem Namen „Zur alten Dorfschule“.
Da wir nun eine Mehrklassenschule waren, waren die Unterrichtsräume im Dorf verteilt. Wir hatten unter anderem Unterricht im umgebauten Wohnzimmer des Hauses vom Dorflehrer. Der hatte leider eine unangenehme Eigenschaft. Jeden Abend bei Anbrechen der Dunkelheit machte er einen Kontrollgang durch das Dorf. Für uns Kinder war es das Zeichen, dass wir auf kürzestem Weg nach Hause zu verschwinden hatten. Die Prügelstrafe von Lehrern gab es zwar offiziell nicht mehr, trotzdem setzte es bei Nichteinhalten seiner Anordnungen schon mal eine Ohrfeige, entweder vom Lehrer oder von unseren Eltern.
Zwei Unterrichtsräume befanden sich in dem alten Brauereigebäude meiner adligen Verwandtschaft. Das Gebäude wurde im Jahre 1946 enteignet. Im Rahmen der Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone wurden Großgrundbesitzer, Kriegsverbrecher und aktive NSDAP-Mitglieder entschädigungslos enteignet.
1954 wurde das Brauhaus abgerissen, um im Nationalen Aufbauwerk (NAW) an gleicher Stelle eine neue Schule zu bauen. Das hieß: Aufbau unter Verwendung des Abrissmaterials durch freiwillige Arbeitsstunden der Dorfbewohner und von Studenten der Ingenieurschule für Bauwesen Apolda. An dieser Stelle sei erwähnt, dass meine Schwester Johanna auf diese Weise ihren Mann Horst kennengelernt hat. Er war Student an der Bauschule in Apolda und konnte als Aufbauhelfer beim Schulneubau seine Fähigkeiten als Maurer unter Beweis stellen.
Ich selbst habe als kleiner Steppke Ziegelsteine geputzt. Pro Stein gab es einen Pfennig für das Sparschwein. Ich hatte allerdings kein Sparschwein, deshalb hat sich mein Geld immer wieder schnell verflüchtigt. Für 20 Pfennig konnte man damals zur Kirmes eine Runde Kettenkarussell fahren oder mit einer Luftschaukel in die Höhe gehen. Es war gute Tradition, dass ein wandernder Schausteller mit seinem Karussell und der Schaukel von einer Kirmes zur anderen durch die Dörfer zog.
Nach vierjähriger Bauzeit wurde die Schule 1958 eingeweiht. Vor der Einweihung gab es Gerüchte, dass der damalige Präsident der DDR Wilhelm Pieck kommen würde. Das war wohl mehr der Wunschtraum unseres Bürgermeisters. Tatsächlich wurde die Schule dann aber im Beisein des Vorsitzenden des Rates des Kreises und des Bezirksschulrates übergeben. Die Dorfältesten hatten die Bedeutung unseres Ortes wohl überschätzt.
Eigentlich sollte die Schule schon 1957 eingeweiht werden, denn da hatte Wormstedt Tausendjahrfeier. Wir hatten sicher zu langsam und zu wenig Steine geputzt.
Anlässlich des tausendjährigen Bestehens wurden mehrere Linden an verschiedenen Stellen unseres Dorfes gepflanzt. Ich war eines der sechs Kinder, welche die Ehre hatten, Pate von einem der neu gepflanzten Bäume zu sein. Eine Herausforderung dabei war, dass ich in aller Öffentlichkeit dazu ein Gedicht rezitieren musste. Der Text wurde dann in einer Flasche unter den Wurzeln mit eingebuddelt. Nur dank der guten Pflege meines Bruders Rudolf ist meine Linde die einzige, die die ersten Jahre überstanden hat und heute zu einem kräftigen alten Lindenbaum herangewachsen ist. Bekanntlich können Linden sehr alt werden. Vielleicht wird man in einigen Hundert Jahren mein Gedicht und meinen Namen lesen können.
Durch den für damalige Verhältnisse großzügigen Schulneubau hatte ich ab der sechsten Klasse zusammen mit Kindern aus den Nachbardörfern Utenbach, Kösnitz und Pfuhlsborn Unterricht.
Die alte Schule wurde Sporthalle. Sportunterricht hatten wir mit unseren Mädchen gemeinsam. Es begann die Zeit, in der ich mich für die Reize des anderen Geschlechts immer mehr interessierte. Als Junge von zwölf Jahren war die Anzugsordnung sommers wie winters grundsätzlich kurze Hosen. Im Winter trugen wir dazu lange Strickstrümpfe. Also auch ein Leibchen mit Strumpfhaltern war angesagt. Beim Sport in der Halle wurden zwar die Strickstrümpfe ausgezogen, aber das Mieder blieb unter der schwarzen Turnhose. Es gab nur schwarze Turnhosen! Die Strumpfhalter baumelten dann gut sichtbar und verführerisch aus den Hosenbeinen heraus. Ich habe mich dafür immer furchtbar geschämt, wenn die Mädchen wegen dieser Anzugsordnung kicherten.
Gott sei Dank war meine Favoritin Angelika – für mich das schönste Mädchen der Schule – nicht in meiner Klasse, sondern eine Klasse über mir. Mir war schon bewusst, dass ich keine Chance hatte, bei ihr zu landen, und so habe ich sie immer heimlich bewundert und mir vorgestellt, wie neidisch doch alle anderen wären, wenn sie meine Freundin wäre.