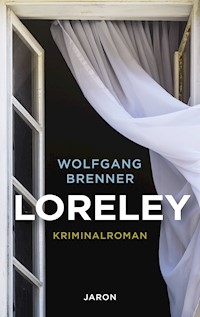8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
»Liebevoll-bissige Satiren, nach deren Lektüre man nur einen Wunsch hat: mehr davon!« Brigitte »Liebevoll-bissige Satiren, nach deren Lektüre man nur einen Wunsch hat: mehr davon!« Brigitte Ach, das Leben ist wahrlich ein ständiger Kampf – vor allem zwischen den Geschlechtern. Dabei tragen die Frauen gar keine Schuld, denn die (Schuld) tragen für gewöhnlich ihre Hormone. Männer hingegen funktionieren durch Vitamine, durch Hopfen und Malz und finanzielle Anreize. Seit Schmalenbach das weiß, hat er mehr Verständnis für die Nöte der Frauen im allgemeinen und seiner Lebensgefährtin Elke im besonderen. Wenn etwa der Müll des türkischen Nachbarn ihr ästhetisches Wohlbefinden stört. Oder sie schwankt, ob sie dem Besuch aus Cottbus Hummer oder Nudeln auftischen soll. Schmalenbach versucht sich in alles einzufühlen. Natürlich nur, solange sie ihn nicht mit Kommentaren über seinen Bauchansatz oder mit Fragen wie »Kanntest du die?« in die Enge treibt. Zum Glück kann unser Mann ohne Vornamen in solchen Zwangslagen auf den bewährten Rat seiner Freunde Pfeifenberger und Germersheimer zählen, mit denen er sich allabendlich in seiner Stammkneipe »Promi« trifft. Dort werden die wahrhaft wichtigen Themen des Lebens besprochen, der therapeutisch bedingte Seitensprung etwa, die Don Juan-Künste jedes einzelnen oder auch die Reize der Bodybuilderin aus Darmstadt. Das alles klingt Ihnen vertraut? Nun, Schmalenbach & Co. sind eben Menschen wie du und ich. Doch so herrlich amüsant haben Sie den wahnwitzigen Alltag sicher noch nicht beschrieben gesehen. Und gerade deshalb sind Wolfgang Brenners neue Großstadtgeschichten wieder etwas ganz Besonderes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 257
Ähnliche
Wolfgang Brenner
Ich dachte schon, es ist was Schlimmes
Neue Geschichten mit Schmalenbach
Deutscher Taschenbuch Verlag
Originalausgabe 2006© Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, MünchenDas Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.eBook ISBN 978-3-423-40005-3 (epub)ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-20952-6Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de
Inhaltsübersicht
Wo ich doch immer so eklig zu dir bin
Das Briefgeheimnis
Poesie
Unglaublicher Urlaub
Die Urlaubskasse
Der Bauch
Hormone
Die Trennung
Keine Lust
Stimmen
Elkes Essen
Ponzo
Freundinnen
Toskana
Himmlische Gerechtigkeit
Die amerikanische Diät
Glück im Geschäft
Gott
Das Begehren
Kanntest du die?
Kinder
Psychologie
Die Vergötterung
Die Triade
Müll
Aspirin
Kommt ’ne Frau zum Arzt
Ich betrüge dich
Elkes Wagen
Die Korrektur
Die Aufgabe
Die Poesie der Gewohnheit
Der neue Freund
Im Zustand der Gnade
200 Frauen
Urlaubsplanung
Streng vertraulich
Das Osterlamm
Trennung – die Zweite
Besuch aus Cottbus
Wenn Sloterdijk kommt
Der Unfall
Getrennte Betten
Der Tod des Kartoffelmanns
Wo ich doch immer so eklig zu dir bin
Elke war so anders. So still. Etwas lag in der Luft.
»Hör mal«, begann sie eines Abends. »Ich muss dir etwas sagen.«
Es gab jetzt zwei Möglichkeiten: Entweder man ließ das, was kam, demütig und still über sich ergehen – oder man versuchte, sich zum Herrn über die Dinge zu machen und sich seinem Schicksal zu stellen. Schmalenbach tendierte zur zweiten Variante:
»Gut, wenn du darüber reden willst, so lass uns das jetzt tun. Es wird dir nachher besser gehen.«
»Meinst du wirklich?«
»Natürlich wird nichts mehr so sein wie früher. Aber das Leben geht weiter. Ich möchte, dass du sofort jeden Kontakt zu dem Schwein abbrichst. Nein, ich will gar nicht wissen, wer es ist. Du gibst alle Geschenke zurück, die er dir gemacht hat. Und ich möchte, dass der Betrüger auch dir alle Geschenke zurückgibt, falls du so dreist warst, ihm welche zu machen. Weiter wirst du in Zukunft nie, nie wieder . . .«
»Schmalenbach!«
»Bitte unterbrich mich nicht! Die Sache ist einfach zu ernst, um noch zu diskutieren. Hattet ihr ungeschützten Sexualverkehr?«
»Schmalenbach!«, flehte sie ihn an. »Ich habe keinen anderen Mann!«
Ja, aber was war es dann? Elke befand sich in einem erbärmlichen Zustand. Sie lief ziellos durchs Zimmer. Schmalenbach war ganz bang. Was kam da auf ihn zu? Wollte sie vielleicht alles hinschmeißen? Ein neues Leben anfangen? Zu ihrer Mutter zurückgehen? Doch noch Kinder haben? Oder endgültig auf Kinder verzichten? Wollte sie umschulen oder gar umziehen?
»Ich wollte es dir schon die ganze Zeit sagen, aber ich hatte nicht den Mut dazu«, stammelte sie. Elke nahm seine Hände. Sie wurde sehr feierlich, fast pathetisch: »Schmalenbach, ich möchte mich bei dir entschuldigen.«
Das hätte sie sich früher überlegen sollen. Als noch was zu retten war.
»Verzeihst du mir?«, hauchte sie.
»Ich muss darüber nachdenken.«
Vor allem musste er wissen, worum es eigentlich ging. Eine Generalabsolution konnte sie von ihm nicht erwarten. Nicht nach dem, was vorgefallen war.
»Es tut mir so leid. Ich schwöre auch, es nie wieder zu tun. Bitte, bitte, vergib mir! Ich finde sonst keine Ruhe.«
Schmalenbach kämpfte mit sich. Irgendetwas in ihm sagte: Nutze die Gelegenheit und zeige dich großzügig, du wirst es nicht bereuen! Eine andere, tiefere, lautere Stimme, die sehr nach Pfeifenberger klang, aber drängte: Sei kein Frosch, lass das Mädchen noch ein wenig zappeln! Wann hast du schon mal eine solche Gelegenheit? Du kannst jetzt Dinge aushandeln, von denen du bisher nicht einmal zu träumen gewagt hast, also los!
Elke wurde immer nervöser. »Was soll ich denn noch tun? Vor dir auf die Knie fallen?«
Schmalenbach hätte es ja schon genügt, wenn sie ihm einfach gesagt hätte, worum es ging. Dann hätte er sich vielleicht erweichen lassen. Nun kamen ihr die Tränen. Schmalenbach verspürte einen Anflug von Mitleid, aber er schwor sich, diesmal nicht so einfach nachzugeben. Diesmal nicht. Sie sollte spüren, dass er der Stärkere war.
Elke nahm erneut einen Anlauf – und dann klappte es:
»Also: Ich weiß, dass ich manchmal richtig eklig zu dir bin. Nachher tut es mir immer leid.«
Sie schmiegte sich an ihn. Sie bebte. Die Arme.
Selber schuld, sagte der Pfeifenberger in Schmalenbach, warum ist sie auch immer so eklig zu dir.
»Ich mag mich dann selbst nicht«, jammerte sie. »Du weißt, was ich meine . . .«
Schmalenbach nickte vorsichtshalber.
». . . dass ich manchmal ins Zimmer komme und die Nase rümpfe, so als hättest du Körpergeruch. Dabei riechst du ganz normal. Ich tue das nur . . .« Ein Tränenschwall erstickte ihre Stimme. ». . . um dich zu ärgern. Ich weiß, es ist Unrecht. Aber ich kann nichts dagegen machen. Es ist in mir drin. Ich hasse mich deswegen.«
Dass sie manchmal die Nase rümpfte, hatte Schmalenbach bisher nicht bemerkt, aber er beschloss, in Zukunft darauf zu achten.
»Oder wenn ich an deiner Garderobe herummäkele.«
Tat sie das? Wenn ja, hatte Schmalenbach sich bis jetzt wenig daraus gemacht.
»Ich nestele an deinem Kragen oder an deinen Hemdknöpfen und mache ein schrecklich angeödetes Gesicht. Als ob du dich geschmacklos kleiden würdest.«
»Das ist allerdings nicht nett von dir«, sagte Schmalenbach streng, obwohl er Kritik an seiner Kleidung grundsätzlich überhörte, egal von wem sie kam.
»Zumal ich dir deine Klamotten ja auch selbst kaufe.«
Das kam noch dazu. Jetzt, wo sie die Sache ansprach, wurde Schmalenbach erst klar, wie ungerecht er bisweilen behandelt wurde.
»Am schlimmsten finde ich, dass ich manchmal so tue, als könntest du mich nicht mehr befriedigen. Das ist richtig widerlich von mir. Dabei gibst du dir alle Mühe, und manchmal komme ich ja auch – aber ich lasse es mir extra nicht anmerken.«
Schmalenbach war nicht einmal aufgefallen, dass sie nicht kam, geschweige denn, dass sie kam und es sich nicht anmerken ließ. »Das kränkt mich allerdings schon lange.« Elke heulte jetzt Rotz und Wasser. »Oder wenn ich dir durch die Blume zu verstehen gebe, dass du zu wenig Geld nach Hause bringst, dass du erfolglos im Beruf bist, dass du zu dick bist – das tue ich, indem ich immer demonstrativ wegschaue, wenn du dich ausziehst. Dann könnte ich mich selbst an die Wand klatschen.«
Schmalenbach seufzte. Das war wirklich ein tiefes, dunkles Loch, in das er da hineinblicken musste. Am schlimmsten aber war, dass sie ihm leidtat. Ja, er konnte es nicht ertragen, dass sie so sehr darunter litt, dass sie so eklig zu ihm war. Das war sein guter Kern. Der ließ sich nicht verleugnen, egal was dieser Pfeifenberger in ihm vorbrachte.
Er nahm also ihren Kopf zwischen seine Hände und küsste sie auf die Stirn.
»Mein Schatz, das ist doch alles halb so schlimm. Ich weiß ja, warum du so eklig zu mir bist.«
»Wirklich?! Das weißt du? Sag’s mir!«
»Das Ganze ist eine unbewusste Reaktion auf Zurücksetzungen.«
Sie lächelte fast schon wieder. »Auf welche Zurücksetzungen denn?«
»Du bist eine herzensgute, liebenswerte Frau . . .«
Elke errötete. »Bitte, mach mich nicht verlegen. Wo ich doch immer so eklig zu dir bin . . .«
»Ich bin ja selbst nicht ganz unschuldig«, erklärte Schmalenbach hochherzig. »Meine Überlegenheit provoziert doch dein Verhalten.«
»Deine was, bitteschön?«
»Meine intellektuelle und moralische Überlegenheit. Du kommst dir ganz klein neben mir vor. Da ist es doch nur natürlich, dass du aus Selbstschutz um dich schlägst. Niemand lebt gerne neben einem Menschen, der ihn um so vieles überragt: an Geist, Geschmack, Lebenserfahrung, Witz und dem allem. Aber ich verzeihe dir.«
Elke machte sich los. »Spinnst du? Wie kommst du auf diesen Quatsch?«
»Warum sonst solltest du mich so schlecht behandeln?«, fragte er.
Elke zündete sich eine Zigarette an. Dann rümpfte sie die Nase.
»Was riecht denn hier so verschwitzt? Und wie siehst du heute wieder aus? Wie eine Vogelscheuche.«
Schmalenbach verstand sie nicht. Er hatte sie doch nur trösten wollen.
»Beruflich seit Jahren auf dem Abstellgleis, chronisch unterbezahlt – aber große Töne spucken«, höhnte sie.
»Vielleicht sollten wir einfach mal über andere reden und nicht immer über uns«, schlug er vor. »Pfeifenberger zum Beispiel sagt . . .«
»Der hat wenigstens Mumm in den Knochen und kann seine Frau noch befriedigen.«
»Elke, das ist jetzt aber eklig von dir, richtig eklig!«
»Selbst schuld«, sagte Elke und verzog sich in die Küche, wo sie wild zu rumoren begann. Schmalenbach fühlte sich danach wieder mal richtig überlegen: Immerhin hatte Elke jetzt kein schlechtes Gewissen mehr.
Das Briefgeheimnis
Natürlich ist Elke eifersüchtig. Alle Frauen sind eifersüchtig. Männer übrigens auch, aber bei denen wirkt die Eifersucht sich nicht so schlimm aus.
Schmalenbach hat mal geäußert, er kenne Elke besser als sie sich selbst. Dass Elke in ihrer grenzenlosen Eifersucht allerdings so weit gehen würde, das hochheilige Briefgeheimnis, das allerletzte Tabu einer sich langsam auflösenden Zivilisation, zu verletzen – das hat selbst Schmalenbach nicht ahnen können.
Elke bestreitet auf das Heftigste, eifersüchtig zu sein. Aber sie ist krankhaft eifersüchtig. Sie würde sich jedoch lieber eine Hand abhacken, als das zuzugeben. Dabei wäre es ganz einfach. Sie müsste nur zu Schmalenbach sagen: »Hör mal, Schatz: Ich bin krankhaft eifersüchtig. Ich terrorisiere meine Umwelt mit haltlosen Verdächtigungen, ich schnüffele hinter dir her, ich vermute hinter jedem noch so belanglosen Kontakt mit einer anderen Frau eine ekstatische Sexgeschichte. Was können wir nur dagegen tun?«
Dafür hätte Schmalenbach doch Verständnis. »Ich verzeihe dir«, würde er sagen. Und: »Du kannst beruhigt sein. Es gibt keinen Grund, eifersüchtig zu sein, weil ich dir treu bin und andere Frauen keine ernstzunehmende Konkurrenz für dich sind.« Damit wäre das Problem gelöst. Aber Elke ist zu dieser Größe nicht fähig. Sie behauptet sogar dreist, sie sei schon deshalb nicht eifersüchtig, weil Schmalenbach viel zu bequem für einen Seitensprung sei und weil sich eine vernünftige und attraktive Frau niemals auf einen wie ihn einlassen würde. Mal abgesehen davon, dass solche Fehlurteile in einem selbstbewussten Mann nur den unwiderstehlichen Drang wecken, sie durch eine saftige Affäre zu widerlegen – es ist auch nicht besonders sensibel, so etwas zu äußern, vor allem nicht in Gesellschaft von stadtbekannten Multiplikatoren wie Pfeifenberger und seiner schwatzhaften Gattin Carola.
Kürzlich fiel Schmalenbach auf, dass ein Brief an ihn geöffnet und ungeschickt wieder verschlossen worden war. Es handelte sich um die Nachricht einer polnischen Gewinnspielagentur, in der Schmalenbach vertraulich seine Geheimzahl und günstige Angebote an Gewinnspielen mitgeteilt wurden.
Für Schmalenbach stürzte eine Welt zusammen. Seine Elke, dieser unschuldige und offenherzige Mensch, dem er fast zwanzig Jahre lang vertraut hatte, verletzte das Briefgeheimnis. Nach dieser bitteren Erfahrung würde zwischen ihnen nichts mehr so sein wie vorher. Schmalenbach musste doch annehmen, dass sie schon lange seine Post öffnete. Vielleicht hatte sie sogar den einen oder anderen Brief verschwinden lassen, um so eine etwaige Affäre zu verhindern.
So wie Schmalenbach mussten sich Menschen in totalitären Staaten fühlen: aller Rechte beraubt, von einer unsichtbaren Macht bespitzelt und manipuliert.
Schmalenbach konnte es Elke nicht einfach ins Gesicht sagen. Sie würde alles abstreiten. So wie das miese Stück ja auch abstritt, eifersüchtig zu sein. Aber er konnte diese Sache nicht einfach hinnehmen. Er musste sich wehren.
Es hatte keinen Sinn, mit Pfeifenberger darüber zu reden. Der brüstete sich, nicht nur das Tagebuch seiner Frau Carola zu lesen, sondern auch alle Post an sie, die ihm entfernt anrüchig zu sein schien, zu öffnen und im Zweifelsfall verschwinden zu lassen. Und Pfeifenberger erschienen sogar Stromrechnungen und Rundbriefe der örtlichen Kirchengemeinde anrüchig.
Nein, Pfeifenberger war der falsche Ratgeber. Also beriet sich Schmalenbach mit Germersheimer. Der Literat hatte zwar keine Frau, deren Post er öffnen konnte, war aber ein grundehrlicher und tugendhafter Mensch – so wie alle, die keine Gelegenheit zur Sünde hatten.
Germersheimer hörte sich alles geduldig an.
»Wenn sie sich ändern soll, musst du sie mit ihrer Schlechtigkeit konfrontieren. Ich habe diesen Weg bei meiner Frau auch oft gewählt . . .«
»Bis sie dich mit dem Abiturienten verlassen hat«, sagte Schmalenbach bitter.
»Lieber allein als mit einer Frau zusammen, die die Post zensiert«, sagte Germersheimer – und damit war Schmalenbach überzeugt.
Germersheimer hatte eine grandiose Idee, wie man Elke dazu bringen konnte, ihre Handlungsweise zu überdenken:
»Du fingierst einen Brief an dich. Mit der Handschrift einer Frau auf dem Umschlag. Als Inhalt ein Blatt, auf dem nur ein Satz steht: Du bist ein abgrundtief schlechter Mensch.«
Die tugendhaften Menschen waren oft die Raffiniertesten.
»Sie reißt den Brief auf und liest diesen Satz und weiß im gleichen Moment, dass ich weiß, was sie da tut«, begeisterte sich Schmalenbach.
»Entweder sie bringt sich um oder sie ändert sich«, prophezeite Germersheimer lakonisch.
»Oder sie verlässt mich.«
»Das ist meiner Erfahrung nach die unwahrscheinlichste Variante«, behauptete Germersheimer.
Schon am nächsten Morgen lag der Köder in der Post. Am Vortag aufgegeben, adressiert in einer besonders lasziven Frauenschrift. Aber ohne Absender.
Als Schmalenbach von der Arbeit kam, saß Elke mit dem aufgerissenen Brief am Küchentisch und weinte. Auf frischer Tat ertappt. Der Literat Germersheimer war eben ein Kenner der menschlichen Seele.
Schmalenbach ließ Elke schmoren. Schließlich schnäuzte sie sich die Nase und sagte:
»Ich habe mit dir zu reden.«
Jetzt kamen sicher ellenlange Entschuldigungen und tiefenpsychologische Erklärungen, die Schmalenbach steinern über sich ergehen lassen würde, bevor er ihr großherzig verzieh.
»Was ist das für ein Brief!?«
Aha, sie wollte kämpfen – das konnte sie haben.
»Was glaubst du denn?«
»Ich stelle hier die Fragen, Schmalenbach. Wer hat diesen Brief geschrieben?«
»Viel wichtiger ist die Frage: Wer hat diesen Brief geöffnet?«
»Na, wer wohl? Ich natürlich.«
Eines musste man ihr lassen: Sie hatte Nerven wie Drahtseile.
»Und warum öffnest du meine Post?«
»Weil die Adresse von einer Frauenhand stammt. Ist doch klar, oder? Offensichtlich verbindet dich mit dieser Person etwas, was ich nicht wissen darf. Sonst hätte die dumme Kuh doch ihren Absender auf den Brief geschrieben.«
Darauf konnte Schmalenbach nichts entgegnen. Überhaupt fühlte er sich nicht so, wie er sich hätte fühlen müssen. Nach Germersheimer. Wo war denn der Klugscheißer jetzt, wo man ihn brauchte?
»Wie ich sehe, hält dich diese Frau für ein ausgemachtes Schwein.«
»Du verstehst das falsch, Elke: Diesen Brief habe ich selbst geschrieben, um . . .«
»Du schreibst dir also selbst Briefe, in denen du dich beschimpfst, ja?«
»Nein, er war für dich bestimmt. Weil du meine Post öffnest. Das ist nicht schön von dir, wirklich nicht.«
»Lenk nicht ab, Schmalenbach! Was hast du dieser Frau angetan?«
»Welcher Frau?«
»Möchtest du weiter den Trottel spielen oder möchtest du, dass wir die Sache klären? Also: Als Erstes gehst du zu diesem armen Mädel hin und entschuldigst dich für dein unmögliches Verhalten.«
»Aber . . .«
»Kein Aber! Und dann möchte ich, dass du in Zukunft alles tust, um mich davon zu überzeugen, dass ich wieder Vertrauen zu dir haben kann.«
»Aber du hast doch meine Post geöffnet und nicht ich . . .«
»Haben wir uns verstanden?! Oder möchtest du, dass ich zu meiner Mutter zurückkehre, weil ich mit einem schlechten Menschen an meiner Seite nicht leben kann?«
»Weißt du, Elke, Germersheimer ist an allem schuld.«
»Bitte, Schmalenbach, nicht solche Ausflüchte! Ich will nur hören, dass es dir leidtut. Dieser Frau gegenüber – und mir gegenüber. Also?!«
Schmalenbach schlug die Augen nieder.
»Es war ein Fehler. Soll nicht wieder vorkommen.«
Poesie
Germersheimer litt immer noch unter der Trennung.
»An Arbeit ist überhaupt nicht zu denken«, stöhnte er.
Das war nicht unbedingt ein Beinbruch – wenn er wieder schrieb, hatten es die Freunde auszubaden, denn er bestand darauf, ihnen jede Zeile vorzulesen.
Dennoch hatten sie Mitleid mit ihm. Besonders Pfeifenberger: »Du solltest zu deiner Geschiedenen gehen und sagen: Hör mal zu, was ich dir jetzt sage . . .«
»Dazu ist Germersheimer nicht der Typ«, fand Schmalenbach.
»Bei mir würde es funktionieren.«
»Du würdest dich ebenso lächerlich machen wie Germersheimer.«
»Wollen wir wetten?«, tönte Pfeifenberger.
Natürlich wettete Schmalenbach nicht. Er hatte einen ganz anderen Rat für den gebeutelten Germersheimer:
»Du solltest versuchen, deine Frau mit dem zurückzuerobern, was du am besten kannst.«
»Du meinst, ich sollte ihr einen meiner dickleibigen Romane widmen?«
Die Romane von Germersheimer waren ungenießbar wie Fliegenpilze: Sie sahen auf den ersten Blick ganz nett aus, aber kein Mensch druckte sie, und demzufolge las sie auch niemand. Selbst wenn er seiner Geschiedenen einen dieser Romane gewidmet hätte, so wäre sie, wenn sie denn die Kraft aufgebracht hätte, ihn zu lesen, über der Lektüre verzweifelt, und keine zehn Pferde hätten sie dazu gebracht, zum Autor dieser Konvolute zurückzukehren.
»Ich glaube, dass deine starke Seite die Poesie ist«, versuchte Schmalenbach, Germersheimer auf den richtigen Weg zu bringen. Er fügte vorsichtshalber aber gleich hinzu: »Man muss keine Gedichte schreiben, um poetisch zu sein. Heutzutage schreibt niemand mehr Gedichte, aber die Welt ist voller poetischer Menschen. Poesie ist eine Lebenshaltung. Es kommt dabei darauf an, eine andere Sichtweise zu entwickeln. Man muss die Welt zum Strahlen bringen. Das ist die Kunst. Es gibt nichts, was Frauen stärker fasziniert als ein poetischer Mann.«
Darüber aber wurde Germersheimer noch trübsinniger. Er wies darauf hin, dass seine Geschiedene Jahre mit ihm verbracht hatte, ohne den Poeten in ihm zu erkennen, trotz der vielen Bücher, die er in dieser Zeit geschrieben hatte. Germersheimer vermutete, dass seine Geschiedene zu der Sorte Frauen gehörte, die weniger an Poesie als an anderen Attraktionen interessiert war – wie an Bausparverträgen, Verbeamtungen, multiplen Orgasmen und am Shoppen auf der Zeil.
Schmalenbach widersprach heftig:
»Es gibt keine Frau, die nicht auf Poesie abfährt. Du hast es halt falsch angefangen. Die Poesie lebt von der Tat. Um eine Frau davon zu überzeugen, dass du der bist, auf den sie gewartet hat, musst du etwas Poetisches tun.«
»Wohl wahr«, bestätigte Pfeifenberger. »In dieser Hinsicht bin auch ich ein poetischer Mensch. Ich gehe einfach zu einer Frau hin und sage: Hör mal zu, was ich dir jetzt sage . . .«
»Meistens bekommst du dafür eine Ohrfeige«, sagte Schmalenbach.
»Na und?«, entgegnete Pfeifenberger. »Das ist immer noch poetischer als gar nichts. Zehn Ohrfeigen zählen so viel wie eine Verabredung. Und die elfte gibt mir nach der Ohrfeige ihre E-Mail-Adresse.«
»Und was willst du damit?«, fragte Schmalenbach.
»Zum Beispiel könnte er ihr seine Gedichte schicken«, fiel Germersheimer ein.
Wenige Tage später kam er ganz aufgeregt angerannt und erklärte, er wüsste jetzt, wie er seine Geschiedene wieder für sich gewinnen könnte.
»Ich habe mir etwas Poetisches einfallen lassen. Es gibt doch jetzt so viele Leute, die nachts Botschaften für ihre Liebsten auf Autobahnbrücken schreiben. Bärchen, ich liebe dich. Oder: Mausilein, bleib doch bei mir.«
»Deine Geschiedene hat kein Auto. Wie soll sie sehen, was du auf Autobahnbrücken pinselst?«, fragte der Praktiker Pfeifenberger.
»Diese Graffiti sind doch was für Legastheniker. Nein, ich habe mir etwas Eindrucksvolleres ausgedacht. Etwas Bleibendes. In zwei Nächten Arbeit habe ich einen Vierzeiler in eine Steinplatte im Palmengarten gemeißelt. Streng klassisch und anonym. Muss ja nicht jeder gleich wissen, wer gemeint ist. Ihr glaubt nicht, was das für eine Mühe gekostet hat. Meine Finger sind ruiniert. In den nächsten Tagen ist an Schreiben nicht zu denken.«
Nun, das war nicht das Schlimmste. Viel wichtiger war: Wie bekam Germersheimer seine Geschiedene in den Palmengarten? Seit einer unangenehmen gerichtlichen Auseinandersetzung wegen des Unterhalts hielt sie nur noch über ihre Anwältin Kontakt zu ihm.
»Ich könnte der Anwältin Bescheid geben«, überlegte Germersheimer.
Doch die Freunde fanden, die Einladung zum Spaziergang im Palmengarten sollte etwas persönlicher an sie herangetragen werden.
»Vielleicht per E-Mail?«, überlegte Germersheimer. »Ich schreibe, ich will mich mit ihr auf einem Spaziergang aussöhnen – und plötzlich ist da diese in Stein gemeißelte Inschrift. Ich sage: Das ist von mir, du bist gemeint. Sie wird in Tränen ausbrechen und mich um Verzeihung bitten.«
Schmalenbach blieb skeptisch. Pfeifenberger jedoch war begeistert.
»Schmalenbach, du bist zu akademisch. Es geht um die poetische Tat. Eine Liebeserklärung. In Stein gemeißelt. Im Palmengarten. Das hat Stil. Könnte von mir sein.«
Die Sache ging Schmalenbach nicht aus dem Kopf. Einen Vierzeiler in Stein zu meißeln, das war wirklich eine Leistung. Aber was tat Germersheimer, wenn seine Geschiedene sich weigerte, mit ihm in den Palmengarten zu gehen? Dann war die ganze Arbeit umsonst.
Am Sonntagnachmittag schlug Schmalenbach Elke aus einer Laune heraus vor, einen Spaziergang durch den Palmengarten zu machen.
»Ich möchte dir etwas zeigen«, sagte er und küsste sie. »Eine Überraschung.«
Lange mussten sie nicht suchen. Es war sehr eindrucksvoll. Zehn Zentimeter hohe Lettern.
Elke war außer sich vor Glück: »Ein Liebesgedicht? Ist das wirklich von dir für mich?« Schmalenbach lächelte nur vielsagend.
Dumm war nur, dass zur gleichen Zeit ein zweites Paar erschien: Pfeifenberger und seine Carola.
»Ihr glaubt ja nicht, was Pfeifenberger sich für mich ausgedacht hat«, zirpte Carola.
Elke wurde sofort griesgrämig und fragte immer wieder: »Für wen ist das denn jetzt? Für Carola oder für mich?«
Pfeifenberger hatte die rettende Idee.
»Für euch beide – wir haben es zusammen gemacht.«
Das dämpfte die Begeisterung der beiden Damen. Und irgendwann schrie Elke auch noch:
»Das ist ja ein falscher Genitiv.«
»Was mutest du mir zu, Pfeifenberger?«, schimpfte Carola.
Wirklich, Germersheimer war ein Genitivfehler unterlaufen, ausgerechnet in der wichtigen dritten Zeile des Vierzeilers.
Elke wollte gehen, sie hatte genug. Und Carola Pfeifenberger lamentierte:
»Da sind sie schon zu zweit – und machen auch noch Genitiv-Fehler.«
Schmalenbach verbiss sich den Hinweis darauf, dass jemand, der nicht wusste, was ein Genitiv ist, doch besser vorsichtig sein sollte mit Vorwürfen wegen Genitiv-Fehlern.
Die Stimmung an diesem Abend war entsprechend düster, als Germersheimer hereinschneite.
»Sie hat gesagt, sie überlegt es sich«, jubelte er. »Vielleicht kommt sie ja zu mir zurück.«
»Und den Genitiv-Fehler – den hat sie wohl gar nicht bemerkt«, maulte Pfeifenberger.
Doch Germersheimer störte das nicht: »Sie ist ein Gefühlsmensch. Die Geste ist ihr wichtiger als die Grammatik.«
»Und so etwas nennt sich Lehrerin«, schimpfte Pfeifenberger.
Dann sprach Schmalenbach das aus, was sonst niemand zu sagen wagte:
»Eine Beziehung mit einer Frau, die so oberflächlich ist, kann niemals gut gehen.«
»Meinst du wirklich?«, fragte Germersheimer – und fiel auf der Stelle wieder in Trübsinn.
Unglaublicher Urlaub
Pfeifenberger war immer verändert, wenn er aus dem Urlaub kam. Weil ihm der ruinöse Aufenthalt auf den Malediven oder in einem VIP-Ressort der hintersten Karibik zu Kopf gestiegen war, führte er sich noch großspuriger, noch lauter auf. Er war auch jedes Mal tiefbraun. So tiefbraun, dass bis in den Oktober hinein Hautärzte ihre Visitenkarten hinter seine Scheibenwischer steckten. Aber diesmal war alles schlimmer als üblich. Und Schmalenbach machte sich Sorgen.
»Mein Urlaub war unglaublich«, tönte Pfeifenberger.
Für die Pfeifenbergers war jeder Urlaub unglaublich. Das Nordend hatte den gesamten Spätsommer unter ihren unglaublichen Urlauben zu leiden. Selbst als Pfeifenberger und Carola samt sechs Kindern vier Wochen in einem Sturmtief in Key West festsaßen und ihren Wohnwagen nur zum Gassigehen mit dem Kampfhund verlassen konnten, erzählten sie monatelang von dem unglaublichen Urlaub in Florida.
»Was war denn diesmal so unglaublich?«, seufzte Schmalenbach.
Pfeifenberger überlegte lange und machte dabei ein Gesicht wie ein Geistheiler.
»Ich glaube, es war die menschliche Nähe.«
»Im Urlaub?«, fragte Schmalenbach ungläubig.
»Wann sonst habe ich die Möglichkeit, mich so innig mit Carola zu beschäftigen?«
Spätestens in diesem Augenblick war Schmalenbach klar, dass die Sache kein gutes Ende nehmen würde. Er versuchte noch schnell, ein anderes, weniger brisantes Thema anzuschneiden, aber Pfeifenberger war nicht mehr zu halten:
»Du weißt ja: Diese Frau hat einen Blick, der geht durch Stahl. Sie sieht tief in die Herzen der Menschen, auch wenn sie sich das nicht anmerken lässt. Sie hat jeden durchschaut. Jeden! Auch dich!«
»Was habe ich damit zu tun?«
Pfeifenberger schloss die Augen und atmete durch.
»Du bist der Schlüssel zu allem. Sagt Carola. Wir haben im Urlaub viel über dich gesprochen.«
»Ich glaube, sie überschätzt mich da ein wenig«, erklärte Schmalenbach unendlich weise und unendlich selbstkritisch.
»Glaube ich auch«, sagte Pfeifenberger.
Damit war der Burgfrieden wieder hergestellt. Sie tranken ihre Biere und schwiegen wie zwei, die wussten, dass nichts, aber auch gar nichts ihrer Freundschaft etwas anhaben konnte.
»Carola sagt, du hast Einfluss auf mich«, sagte Pfeifenberger dann.
Damit mochte sie recht haben, aber Schmalenbach fragte sich, ob es ein Segen war, Einfluss auf einen Pfeifenberger auszuüben und demzufolge für jeden Schwachsinn, den sich dieser Mensch ausdachte, verantwortlich gemacht werden zu können.
»Sie sagt auch, du hältst mich vom Arbeiten ab. Und du verbaust mir die Sicht auf die Dinge.«
»Auf welche Dinge?«
»Na ja, auf die Dinge des Lebens. Zum Beispiel, sagt Carola, könnte ich ganz anderen Umgang haben, wenn ich nicht jeden Abend mit dir rumhängen würde.«
Schmalenbach wollte seinem Freund nicht ins Gesicht sagen, dass der sich glücklich schätzen konnte, ihn als Umgang zu haben. Wer sollte sich sonst mit Pfeifenberger abgeben?
»Natürlich ist das Quatsch«, sagte Pfeifenberger. »Typisches Frauengeschwätz.«
Schmalenbach atmete auf. Sein Freund mochte labil sein, aber wenn es um die Dinge ging, die ihnen beiden wichtig waren, wusste er genau, was er wollte.
»Carola sagt auch, das Beste ist, wenn ich endlich den Kontakt mit dir abbreche.«
Das hätte Schmalenbach nicht einmal Carola Pfeifenberger zugetraut. Aber die Frauen wurden sonderlich, wenn sie in die Jahre kamen und den ganzen Urlaub über nichts zu tun hatten. Sie begannen mit Neid auf ihre Männer zu blicken, die sich nicht nur äußerlich ihre Jugend bewahrt hatten, sondern auch in ihren Freundschaften immer noch so unbeirrbar blieben wie Jünglinge.
»Du darfst ihr das nicht übelnehmen«, sagte Schmalenbach dem Freund. »Weißt du, Frauen in ihrem Alter werden leicht bitter. Die Kinder gehen aus dem Haus, die Karriere liegt hinter ihnen. Da kommen sie auf dumme Gedanken.«
»Da bin ich ganz deiner Meinung«, gestand Pfeifenberger.
»Man muss seiner Frau auch so etwas verzeihen können«, sagte Schmalenbach gütig.
»Eben. Sie ist ja doch meine Frau. Deshalb denke ich, du und ich . . .«
»Was?!«
». . . wir beide sollten unseren Kontakt besser abbrechen. Schau mal: Mit Carola muss ich leben, wir haben sechs Kinder zusammen und einen gemeinsamen Sparvertrag. Mit dir trinke ich nur mein Bier. Das verstehst du doch, oder?«
Schmalenbach nickte, es war ihm ganz komisch dabei.
»Auch wenn Frauen oft Unsinn reden – so ganz daneben liegen sie damit nie, wie du ja von deiner Elke weißt«, erklärte Pfeifenberger noch.
Sie tranken einträchtig ihr letztes gemeinsames Bier – dann gingen sie in Würde auseinander.
Schmalenbach brauchte ein paar Tage, um zu realisieren, was geschehen war. Dann aber geriet er in unbändige Wut.
»Mit einem Kerl, der sich von seiner Frau diktieren lässt, wen er zum Freund haben darf, möchte ich sowieso nichts mehr zu tun haben«, schimpfte er.
»Richtig«, lobte Elke ihn, was auch nicht oft vorkam. »Im Übrigen hat dieser Pfeifenberger noch nie zu dir gepasst. Er ist einfach nicht dein Niveau gewesen.«
»Findest du?«
»Nicht nur ich. Alle meine Freundinnen sagen das auch.«
»Woher wissen sie das? Sie kennen doch Pfeifenberger gar nicht.«
»Ganz einfach: Ich hab’s ihnen gesagt.«
Gegen diese Logik war Schmalenbach machtlos. Und Elke machte ihm auch klar: Wenn Pfeifenberger diesen Schritt nicht getan hätte, hätte er ihn selbst tun müssen. Die Verbindung zwischen ihnen war längst fruchtlos geworden. Sie gaben sich nichts mehr, sie hatten sich nichts mehr zu sagen, er war durch Pfeifenberger in den letzten Jahren davon abgehalten worden, sich selbst zu verwirklichen, neue kulturelle Erfahrungen zu machen, sich in andere, interessantere Menschen hineinzudenken, andere berufliche Perspektiven zu entwickeln...
Irgendwann läutete das Telefon und Pfeifenberger war dran.
»Geht’s dir auch so? Mir fehlt irgendwie etwas. Der Austausch. Die intellektuelle Herausforderung.«
»Du hast doch Carola!«, sagte Schmalenbach bitter.
Pfeifenberger war gekränkt. »Du nimmst mir übel, dass ich auf sie gehört habe, stimmt’s?«
»Ein Armutszeugnis: ein Mann, der sich von seiner Frau seinen Freund ausreden lässt.«
Pfeifenberger seufzte. »Das war ein Fehler, das sehe ich jetzt ein. Frauen verstehen eben nichts von Freundschaft.«
»Wie wahr!«
»Und? Was tun wir jetzt? Sehen wir uns heute Abend?«
Es wurde eine lange, eine feuchtfröhliche, ausgelassene Versöhnungsfeier. Und alle feierten mit, denn die Trennung der beiden Freunde hatte eine tiefe Wunde ins soziale Leben des Nordends gerissen.
Spät in der Nacht torkelten sie Arm in Arm nach Hause.
»Wirst du Carola sagen, dass wir wieder Freunde sind?«, fragte Schmalenbach.
»So etwas lässt sich doch nicht verschweigen. Morgen pfeifen es die Spatzen von den Dächern der ganzen Stadt.«
Das stimmte allerdings. »Nicht, dass du meinetwegen zu Hause monatelang Ärger hast . . .«
»Das stehe ich durch. Wir sollten weniger auf unsere Frauen geben. Im Übrigen hat Carola keinen Grund zu schmollen. Es war ja ihre Idee.«
»Was war ihre Idee?«
»Du weißt schon: dass wir beide uns wieder vertragen. Sie sagte, es ist nicht gut, wenn ich zu Hause rumhänge und mich in alles einmische. Dann hat sie auch noch mit Elke telefoniert, und die beiden Frauen haben sich lange über uns unterhalten . . .«
Das war zu viel. Schmalenbach ließ ihn einfach stehen.
Mit Elke sprach er kein Wort darüber. Nicht dass sie auch auf die Idee kam, Männer ließen sich in ihrem Verhalten Freunden gegenüber steuern. Das wäre fatal.
Die Urlaubskasse
Elke hatte die Idee. Frauen sind eben die praktischeren Menschen – auch wenn Pfeifenberger das nicht gefällt, aber wer ist schon Pfeifenberger? Soll der doch ganze oberitalienische Altstädte mit seinem Gezeter in Angst und Schrecken versetzen, wenn Carola vor ihm den schnellsten Weg zu McDonald’s gefunden hat.
Schmalenbach hingegen lässt es gerne zu, dass Elke die taktische Planung in die Hand nimmt – weiß er doch, dass Frauen sich für gewisse biologische Benachteiligungen damit trösten, Kleinigkeiten besser managen zu können. Deshalb widersprach er nicht, als Elke am ersten Urlaubstag im Speisesaal ihres Hotels lauthals verkündete:
»Frauen können besser mit Geld umgehen. Deshalb schlage ich vor, ich übernehme die Urlaubskasse.«
Sofort erstarben alle Gespräche, und sogar am Buffet reckte man die Köpfe, um zu sehen, wer da so unverblümt ewige Wahrheiten aussprach.
»Wie du meinst«, sagte Schmalenbach. Die dralle Blondine warf ihm einen mitleidigen Blick zu, und der schmalbrüstige Kettenraucher, der schon an der Hotelbar gesessen hatte, während seine Frau noch die schweren Koffer aus dem Wagen räumte, stellte seinen überquellenden Aschenbecher auf Schmalenbachs Tisch ab.
Die Verachtung solcher Leute ertrug Schmalenbach mit Leichtigkeit. Hauptsache, seine Elke genoss den Urlaub und kam nicht auf die Idee, grundsätzliche Fragen des körperlichen Miteinanders während der Hauptessenszeiten zu diskutieren.
»Ich schlage vor, jeder zahlt hundertfünfzig Euro ein. Das müsste für eine Woche reichen«, erklärte Elke.
»Aber wir sind doch bisher immer ganz gut ohne Urlaubskasse ausgekommen.«
Elke schmetterte ihr Eislöffelchen auf den Tisch.
»Und nach dem Urlaub war dein Konto überzogen. Du kannst eben nicht mit Geld umgehen. Das hat mir deine Mutter vor zwanzig Jahren schon anvertraut.«