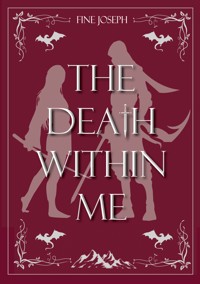Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Seit ihrer Geburt wächst Debby in dem großen Haus im Wald am Rande von Chipperham auf, zusammen mit ihren Eltern, zwei Brüdern und ihren Großeltern. Als sie sechzehn ist, verschwindet ihr kleiner Bruder Luis von einem Tag auf den anderen spurlos. Erst am Abend taucht das erste Lebenszeichen von ihm wieder auf - seine Jacke, die auf dem Bett ihres großen Bruders liegt, blutverschmiert. Trotz verzweifelter Suche wird Luis nie gefunden und die Familie geht zerstritten getrennte Wege. Nun, nach mehr als zwölf Jahren, kehrt Debby zurück, da ihr das Haus nach dem Tod ihrer Mutter vererbt wurde. Der Wald liegt noch immer so still und verlassen da, wie Debby ihn in Erinnerung hat - doch ist sie wirklich alleine? Sie könnte schwören, nachts Schritte auf den knarzenden Dielen zu hören. Schritte von jemandem, den sie jahrelang tot geglaubt hat...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Helge
Wenn du voller Begeisterung von Absatzformaten und
Musterseiten geredet hast, haben wir gelacht.
Heute sitze ich hier, schreibe Bücher und
formatiere sie mit Absatzformaten und Musterseiten.
Diese Geschichte ist zwar weniger zum Lachen, doch ich widme
sie dem einzigen Lehrer, der es geschafft hat, dass ich
gerne in den Unterricht gegangen bin.
Fine Joseph wurde am 18.01.2001 in Langenhagen unter dem Namen Josefine geboren und ist in der Nähe von Hannover aufgewachsen. Schon als kleines Mädchen lag ihre größte Leidenschaft im Lesen und Schreiben.
Von 2017 bis 2019 absolvierte sie eine Ausbildung zur Gestaltungsstechnischen Assistentin, bevor sie ein eineinhalbjähriges Studium im Schwerpunkt „Kreatives Schreiben“ abschloss.
2022 veröffentlichte sie ihr Thriller-Debüt „Die letzte Suche des Nicolas Corbyn“.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 1
„In den nächsten Tagen erwartet uns ein Wetterspektakel, wie England es selten erlebt hat. Diesmal heißt es nicht, holt die Gummistiefel und Regenschirme raus. Nein, diesmal raten wir allen Bürgerinnen und Bürgern, das Haus besonders in der Nacht nicht zu verlassen.
Nicht nur London wird das Unwetter schwer treffen, sondern auch die umliegenden Gemeinschaften, deswegen halten Sie sich an die Ratschläge und bleiben Sie drinnen.“
Die Stimme des Moderators erinnerte mich an meinen alten Lehrer. Auch er hatte sie nach jedem Satz geradezu warnend erhoben und dann spielerisch mit dem Finger gedroht. Auch, wenn er seine Strenge meistens nur vortäuschte und doch ein gutmütiges Herz besaß, so habee ich als kleines Mädchen Angst vor ihm gehabt.
Seufzend drehte ich an den Knöpfen meines Autoradios, um nach einem Sender zu suchen, der nicht pausenlos vor dem schweren Gewitter warnte, das anscheinend auf England zurollte. Noch sah es für mich ganz und gar nicht nach einem Unwetter aus.
Der Himmel war zwar mit einigen grauen Wolken überzogen und ab und zu bogen sich die Bäume links und rechts neben der Fahrbahn im Wind, doch von einem Sturm konnte nicht die Rede sein. Geschweige denn von einem Unwetter.
Endlich fand ich einen Sender nach meinem Geschmack und drehte die Musik lauter auf. Schon erfüllten die Klänge von Jennifer Rush meinen kleinen Opel Corsa und ich trommelte im Takt der Musik auf dem Lenkrad herum. Für einen Außenstehenden musste ich das perfekte Abbild der Entspannung abgeben. Ich war doch bloß eine junge Frau, die einen Ausflug in die abgeschiedenen Wälder machte, um einfach ein bisschen frische Luft zu schnappen.
Oder nicht?
Mein Gesicht verzog sich zu einer grimmigen Grimasse und ich geriet aus dem Takt. Leise fluchend drehte ich die Musik wieder leiser und umklammerte das Lenkrad umso fester. Die Lust nach Trommeln war mir vergangen, ebenso wie die Lust nach Musik.
Wenn ich ehrlich war, dann wusste ich selbst nicht so ganz, was ich mir hiervon erhoffte. Wie lange war es nun schon her, dass ich diesen Weg gefahren war?
Ich schüttelte den Kopf. Zu Lange. Viel zu lange.
Eine leise Stimme in mir flüsterte mir zu, dass es nun schon fast zwölf Jahre waren, doch ich verdrängte sie. Wollte es nicht hören. Am liebsten hätte ich auf dem nächsten Rastplatz gewendet und wäre zurück nach London in meine kleine, aber gemütliche Wohnung gefahren.
Unwillkürlich verzogen sich meine Lippen zu einem Lächeln, als ich an meine kuschelige Leseecke dachte, die zu Hause nun völlig unberührt dalag und nur auf mich wartete. Seufzend schüttelte ich dieses Bild von mir ab und richtete meine Aufmerksamkeit wieder auf die Straße vor mir.
Je weiter ich mich von Chippenham entfernte, desto holpriger wurde der Weg. Im Asphalt taten sich immer mehr Löcher auf und ich wusste sofort, dass ich auf dem richtigen Weg war. Diese Straße würde mich geradewegs nach Neverton führen.
Gegen meinen Willen lief mir ein kalter Schauer über den Rücken, als ich an das Dorf dachte, das vor vielen Jahren mein Zuhause gewesen war. Ich wusste nicht, was schlimmer wäre. Wenn es noch genauso aussah wie damals oder ich es nicht mehr wiedererkennen würde.
Die Straße wurde schmaler und ich musste aufpassen, auf meiner Spur zu bleiben. Doch hier draußen würde ich sowieso nur irgendwelchen entlaufenen Hunden oder Füchsen begegnen, dachte ich. Die letzten Sonnenstrahlen wurden nach und nach von den Wolken verdeckt. Hohe Bäume, dessen Baumkronen voller roter, brauner und gelber Blätter waren, taten sich neben der Straße auf. Ich hatte den Wald von Neverton bereits erreicht.
Jetzt war es nicht mehr weit, bis ich auf die ersten Häuser des Dorfes stoßen würde.
Ich warf einen Blick in den Rückspiegel, doch außer der Straße und ein paar Bäumen war weit und breit nichts zu sehen. Die meisten Menschen nahmen die Warnung aus den Medien wohl ernst, dachte ich.
Warum war ich also noch hier draußen auf dem Weg zu einem Haus, das ich mir geschworen hatte, nie wieder zu betreten? Ich entließ einen weiteren Seufzer und wollte gerade das Radio wieder anschalten, als vor mir die ersten Häuserdächer auftauchten.
Ohne es zu realisieren, beschleunigte sich mein Herzschlag und ich setzte mich aufrecht hin. Meine Hände klammerten sich an das Lenkrad wie ein Ertrinkender an den Rettungsring.
Das Ortsschild von Neverton stand immer noch so windschief neben der Straße, wie ich es kannte. Ich wusste nicht, ob mich das beruhigen sollte oder nicht, doch meine Schultern entspannten sich allmählich wieder. Es waren doch nur ein kleines Dorf und ein paar Häuser, weiter nichts. Doch leider wollte mein Kopf davon nicht viel wissen. Bilder entstanden vor meinem inneren Auge. Bilder, die ich längst hatte vergessen wollen.
Doch konnte man das überhaupt? Vergessen? Wollte ich das überhaupt? Es wäre ihm gegenüber nicht gerecht.
Die Straße führte mich an der Einfahrt zu Averoth‘s Cars & Co vorbei, der Autowerkstatt, in der mein Dad früher gearbeitet hatte. Ich hatte seinen Chef, Alexander Averoth, nie ausstehen können, auch wenn ich nie einen Grund dafür gehabt hatte. Im Stillen fragte ich mich, ob ich ihn auch heute noch unsympathisch finden würde.
Ein Stück weiter nördlich die Straße hinauf befand sich der Lebensmittelladen, direkt neben der kleinen Dorfapotheke und der Kneipe, in der sich die halbe Dorfgemeinschaft an den Feierabenden traf, um zu trinken und Karten zu spielen.
Manchmal hatte Opa mich und James Taylor, meinen älteren Bruder, mitgenommen, wenn er sich dort zum Kartenspielentraf, doch wirklich begeistert war ich nie gewesen. Die Luft war zu stickig, die Männer zu laut und die Limonade, die ich dortbekam, hatte jedes Mal nach verdünntem Spülmittel geschmeckt. Dennoch hatte ich meinen Opa gerne ins Dorf begleitet. Es bedeutete, eine Weile dem Haus entfliehen zu können. Ihm entfliehen zu können. Ich hatte James nie danach gefragt und doch wusste ich, dass es ihm genauso ging. Für ihn waren die Besuche in der Kneipe wie ein Stück Freiheit.
Ein Stück Frieden.
Ich ließ den Pub hinter mir und für eine Weile war die Straße nur von Büschen, Bäumen und vereinzelten Wohnhäusern gesäumt. Hinter manchen Fenstern brannte Licht, andere waren mit heruntergezogenen Rollläden ausgestattet und wieder andere waren einfach nur dunkel.
Dann baute sich der hohe Turm der Dorfkirche vor mir auf und mein Herz machte einen Hüpfer. Es war unüblich, dass sich Kinder auf die Kirche und den Gottesdienst freuten, doch ich war gerne dort gewesen. Ich hatte meine Freunde aus der Schule gesehen, mit den anderen Einwohnern Lieder singen können und ich hatte mich auf John Morgan gefreut, den Pfarrer des Dorfes.
Er war nicht so steif und ernst wie ich es eigentlich von einem Pfarrer erwartet hätte. Mit ihm konnte man lachen und irgendwie hatte er es geschafft, mir jedes Mal ein gutes, gar beschwingtes Gefühl zu geben, wenn ich mit ihm redete.
Die Kirche zog an mir vorbei und ich dachte darüber nach, ob ich John Morgan einen Besuch abstatten sollte. Dann fiel mir ein, dass ich gar nicht wusste, ob er überhaupt noch in Neverton lebte und schüttelte über mich selbst den Kopf.
Die Häuser wurden hinter mir immer kleiner, bis sie schließlich ganz aus meinem Sichtfeld verschwanden.
Nun lohnte es sich nicht mehr, nach einem schönen Radiosender zu suchen. Fünf Minuten später erschien zu meiner Rechten ein Waldweg, der zu dieser Jahreszeit wie üblich mit buntem Laub und heruntergefallenen Eicheln überseht war. Ich warf einen Blick in den Rückspiegel und setzte den Blinker, auch wenn außer mir kein Auto weit und breit zu sehen war.
Rumpelnd bog ich in den schmalen Waldweg ein. Durch das Licht, das durch die vielen Bäume in kurzen Abständen in meinen Wagen fiel, erschien es mir als würde ein Riese mit seiner Taschenlampe in meinen Opel leuchten und das Licht aus – und einknipsen.
„Komm schon, gib jetzt ja nicht den Geist auf“, murmelte ich, als das Auto ein besonders dröhnendes Geräusch von sich gab.
Tiefhängende Zweige klatschten gegen die Windschutzscheibe und ich wurde kräftig durchgeschüttelt, als sich das Hinterrad über eine hervorstehende Wurzel quälte. Ich wollte bereits in einen höheren Gang schalten, als ich abrupt auf die Bremse trat.
„Das gibt’s doch nicht“, entfuhr es mir.
Der komplette Weg vor mir war versperrt von dichtem Gestrüpp, Dornenranken und Efeu. Meine Schultern fielen erschöpft in sich zusammen und mit einem Seufzen sank ich im Sitz zurück. Hier würde ich mit dem Wagen auf jeden Fall nicht weiterkommen, so viel stand fest. Ich massierte mir für einen kurzen Moment die Schläfen und besann mich zur Ruhe, bevor ich den Motor ausschaltete und sowohl die Zündschlüssel, als auch mein Handy in meiner Jackentasche verstaute. Dann stieß ich die Tür auf und trat auf den Waldweg.
Mit in die Hüften gestemmten Händen betrachtete ich fachmännisch den Weg vor mir.
Meine gesamte Kindheit und auch meine Jugend hatte ich hier in diesem Wald verbracht und doch hatte ich den Weg nie so überwuchert, fast schon verwildert erlebt. Seit Jahren war hier niemand mehr hochgekommen, jedenfalls nicht mit dem Wagen.
Es behagte mir nicht, mein Auto hier zurückzulassen, besonders bei den schlechten Wetterankündigungen, doch hatte ich denn eine Wahl?
Ja. Du könntest dich in dein Auto setzen, zurück nach London fahren und dir unterwegs noch einen heißen Zimtkakao beim Bäcker mitnehmen.
Ich seufzte, schloss den Wagen ab und stieg über die erste Dornenranke, darauf bedacht, meine neue, schwarze Jeans nicht aufzureißen. Sei vernünftig, Debby. Das Haus liegt jetzt in deinen Händen und du musst dich darum kümmern, es auch wieder loszuwerden. Denn das war der einzige Grund, weshalb ich hier war. Dieses verdammte Haus.
Früher hatte ich es geliebt. Nun, auf eine Art und Weise, wie man ein Gebäude eben lieb haben konnte. Heute fiel mir jeder Schritt schwer, mit dem ich mich besagtem Haus näherte. Ich wusste nicht, was mich erwarten würde. Ich hatte Angst davor, es zu sehen, das erste Mal seit zwölf Jahren und nichts zu fühlen.
Das war nicht gerecht. Ich hatte so viel erlebt in diesem Haus, hier in diesem Wald, dass es nicht fair wäre, nichts mehr zu spüren. Obwohl das vielleicht sogar das Beste wäre.
Ich verhedderte mich in einem niedrigen Gestrüpp und schüttelte es in Gedanken versunken ab. Eigentlich durfte ich es mir nicht erlauben, mich hier auf diesem verwachsenen Weg so in Erinnerungen zu verlieren. Auch, wenn ich jeden Baum wiedererkannt hatte und mich nicht verlaufen würde, so gab es dennoch Gefahren in diesem Teil von Neverton, die man nicht einfach so unterschätzen sollte.
Ich erinnerte mich noch allzu gut daran, wie ich die erste Bärenfalle gesehen hatte.
Damals war ich vielleicht sieben oder acht Jahre alt gewesen und mein Großvater hatte mich gerade noch so an den Armen gepackt und mich weggezogen.
„Debby, pass auf!“
Keuchend starrte er auf die spitzen Eisenzähne, die nach oben in die Luft ragten. Zwischen all dem Laub hatte ich sie zuerst gar nicht erkannt. Verwirrt sah ich zwischen Opa und der Falle hin und her. Eine tiefe Falte zeichnete sich auf seiner Stirn ab, während er mich immer noch festhielt.
„Opa? Was ist das?“, fragte ich.
Es gefiel mir nicht, meinen Opa so zu sehen. Thomas Caterton war kein Mann, der sich schnell aus der Ruhe bringen ließ.
Schon gar nicht von irgendetwas, das er im Wald fand. Er liebte den Wald und kannte ihn ebenso gut wie seine Westentasche.
„Das ist eine Bärenfalle, Spätzchen. Verfluchter Glatzkopf hat sie hier aufgestellt“, brummte er missmutig.
Ich runzelte die Stirn.
„Eine Bärenfalle? Gibt es hier denn Bären?“
Opa sah mich an und ein flüchtiges Grinsen huschte über sein Gesicht.
„Nein. Aber laut dem vermaledeiten Mayer schon. Einmal hat er etwas zu viel...naja, einmal war er nicht ganz bei Sinnen und da hat er sich doch tatsächlich eingebildet, einen waschechten Bären an seinem Fenster vorbeispazieren zu sehen.“
Meine Augen wurden ganz groß.
„Und? Hat er das wirklich?“, hauchte ich.
Opa lachte, schüttelte den Kopf und strich mir sanft übers Haar.
„Natürlich nicht. Hier gibt es keine Bären, Spätzchen, du musst also keine Angst haben.“
„Ich habe keine Angst, vor keinem Bären der Welt“, gab ich empört zurück und verschränkte die Arme vor der Brust.
Opa lächelte erneut, doch schnell wurde er wieder ernst. Mit einem nachdenklichen Ausdruck im Gesicht musterte er die Bärenfalle, als würde sie jeden Moment aufspringen und ihn anfallen.
„Ich sollte trotzdem ein Wörtchen mit dem Glatzkopf wechseln. Bärenfallen in einem Wald aufzustellen, in dem Kinder spielen. Ganz großartige Idee.“
Zurück in der Gegenwart konnte ich darüber nur lächelnd den Kopf schütteln. Mit Glatzkopf war kein anderer als Carter Mayer gemeint. In diesem Wald gab es genau zwei Häuser. Unseres und das der Mayers.
Carter Mayer wohnte mit seinem Sohn Henry in einer einsamen Jägerhütte, abgeschieden von dem Rest der Welt. Ähnlich wie wir. Seine Frau hatte ihn verlassen, als Henry ungefähr dreizehn war. Von einem Tag auf den anderen ließ sie ihren Mann und Sohn zurück, um sich ein aussichtsreiches Leben voller Ruhm und Karriere in Tokio aufzubauen. Angeblich soll sie sich dort als Schauspielerin versucht haben und wenn man den Gerüchten trauen konnte, die in Neverton in der Kneipe erzählt wurden, dann hatte sie es geschafft. Demnach war es keine große Überraschung, dass man sie seitdem nie mehr in unserer bescheidenen Gemeinde angetroffen hat.
Neverton war sicher längst aus ihrem Gedächtnis gestrichen.
Seitdem hatte sich Carter Mayer mit Henry in die Hütte im Wald zurückgezogen. Gelegentlich ging er hinunter zum See zum Angeln oder schoss ein paar Vögel im Wald, doch nach einer neuen Liebe in seinem Leben hatte er sich nie umgesehen.
Ich fragte mich, ob Carter noch immer in der kleinen Hütte westlich von unserem Anwesen wohnte. Mittlerweile müsste er schon Ende fünfzig sein, wenn ich mich nicht verrechnet hatte.
Die Bäume lichteten sich allmählich und ein feiner Windzug strich über den Waldboden. Ich warf einen prüfenden Blick gen Himmel und stellte fest, dass sich der Horizont nach und nach verfinsterte. Das Unwetter war also bereits im Kommen. Ich fragte mich, ob es London schon erwischt hatte.
Mist. Ich hatte nicht geplant lange zu bleiben. Ich wollte mir nur einen kurzen Überblick über das Haus verschaffen, vielleicht ein oder zwei Notizen für Dinge, die repariert werden mussten und dann wieder verschwinden.
Vielleicht hatte ich ja auch Glück und ich würde das Haus in einem durchaus passablen Zustand antreffen.
Immerhin war ich nicht die Einzige, die hier groß geworden ist. Ich dachte an meinen Bruder. James. James Taylor war drei Jahre älter als ich und ich wusste, dass er derjenige war, der am meisten an diesem Haus hing.
Manchmal, Jahre, nachdem ich diesen Ort verlassen hatte, fragte ich mich, wieso ausgerechnet er diesem Haus so nahestand.
Für den Bruchteil einer Sekunde schoss mir durch den Kopf, dass er womöglich immer noch hier lebte, doch hastig verwarf ich diesen Gedanken wieder. Hier lebte ganz sicher niemand mehr. Außerdem hatte ich gehört, dass er ebenfalls weggezogen sei, kurz nachdem der Rest der Familie Neverton verließ.
Der Wind nahm zu, blies mir ein paar Strähnen ins Gesicht, die ich achtlos hinters Ohr strich. Ein paar Äste ächzten und das Holz knarrte, als eine besonders starke Windböe durch den Wald huschte.
Ich kannte die Geräusche des Waldes in und auswendig. Ich wusste, wie es klang, wenn die Bäume im Sturm zu knarzen begannen.
Das Knacken eines Zweiges hinter mir gehörte ganz sicher nicht zu den natürlichen Geräuschen des Waldes.
Ich blieb stehen, nicht sicher, ob ich mich nicht doch einfach nur verhört hatte. Da war nur das Rauschen des Windes und das Knarren des Holzes.
Es kribbelte in meinem Nacken, als ich mir gegen meinen Willen vorstellte, beobachtet zu werden.
Es war kindisch, das gab ich selbst zu und doch war ich nervös mich umzudrehen. Fast erwartete ich einem Menschen gegenüberzustehen, der mir die ganze Zeit über gefolgt war.
Oder bereits vor mir in diesem Wald war.
Bring es hinter dich, Debby .
Manchmal war es besser, eine Sache nicht zu zerdenken. Trotzdem spannte ich meine Muskeln an, als ich mich umdrehte. Der Weg, den ich schon zurückgelegt hatte, lag einsam und verlassen da.
Mit klopfendem Herzen ließ ich meinen Blick durch den Wald wandern. Plötzlich fiel es mir schwer, normale Schatten einer Birke von dem Schatten eines großen Mannes zu unterscheiden.
Stand dort jemand hinter dem Baum oder spielten mir meine Augen einen gemeinen Streich?
Hastig wischte ich mir übers Gesicht und als ich das zweite Mal hinsah, war der Schatten doch nur ein einfaches Lichtspiel, verursacht durch die schnell vorüber ziehenden Wolken.
Erleichtert atmete ich aus und setzte meinen Weg fort, dieses Mal jedoch deutlich zügiger. War es Einbildung oder hatte sich der Wald innerhalb einer Minute auf mindestens fünf Grad abgekühlt? Fröstelnd schlang ich meinen Schal fester um den Hals, stieg über ein paar Wurzeln und schnippte unwirsch einen Käfer von meiner Schulter. Ich wollte es mir nicht eingestehen, doch seitdem ich mich umgedreht hatte, ließ mich das Gefühl, verfolgt zu werden nicht mehr los.
Entspann dich. Deine Fantasie geht schon wieder mit dir durch, redete ich mir selbst zu.
Ich überlegte gerade, dass es nicht mehr weit sein konnte, als ich die dicke Birke zu meiner Rechten entdeckte.
Abrupt blieb ich stehen. Sie war genauso morsch, wie ich sie in Erinnerung hatte und thronte auf einem steilen, nicht allzu hohen Hang, der sich neben mir auftat. Ich hätte diese Birke immer und überall erkannt. Früher war sie mein Orientierungspunkt gewesen, wenn ich im Wald gespielt hatte. Ein nostalgisches Gefühl überkam mich.
James, Luis und ich hatten sie immer „der alte Pirat“ genannt, da ihre Zweige wie die Hakenhände eines mürrischen Piraten aussahen.
Ein wehleidiges Lächeln kroch über meine Lippen. Ich riss mich von ihrem Anblick los und lief die letzten Schritte den Waldweg entlang. In der Ferne, weit entfernt, dröhnte das erste Donnergrollen. Rasch beschleunigte ich meine Schritte. Ich bog um den Hang und der Weg neigte sich leicht nach rechts, stieg noch einmal kurz an und plötzlich ragte vor mir ein mächtiges Haus in die Höhe. Mir stockte der Atem.
Ich wusste, wieso ich hergekommen war.
Ich war darauf vorbereitet gewesen, das Haus zu sehen.
Und doch blieb ich wie angewurzelt stehen und ein beklemmendes Gefühl machte sich in meiner Brust breit, als ich so plötzlich vor meinem alten Zuhause stand.
Mein Zuhause, das gleichzeitig auch das meines kleinen Bruders Luis gewesen war.
Ich hatte es freiwillig verlassen.
Er nicht.
Kapitel 2
Als ich das Haus jetzt sah, hatte ich das Gefühl, wieder das kleine Mädchen zu sein, das nichts im Sinn hatte außer im Wald zu spielen und ihre Bücher zu lesen. Ich stand da, starrte auf das Anwesen vor mir, als wären keine zwölf Jahre vergangen.
Als wäre ich nie weg gewesen.
Als wäre Luis nie verschwunden.
Ich schluckte und riss mich aus meinen Gedanken. Ich war nicht wegen Luis hier. Ich würde mir einfach nur das Haus ansehen, mir einen Überblick verschaffen und dann wieder verschwinden. Mir selber Mut zusprechend ließ ich den Waldweg hinter mir und näherte mich dem Gebäude. Mein Dad hatte immer einen Zaun errichten lassen wollen, doch wir anderen waren dagegen. Wozu auch? Hier draußen war niemand außer uns und den Mayers.
In dem Brief, den ich von meinem Dad erhalten hatte, stand ausdrücklich geschrieben, dass ich mich von nun an um das Haus kümmern sollte. Es stand mir frei es zu verkaufen, zu renovieren oder sonst was damit zu machen. Meinem Dad war dies egal und irgendwie hatte ich das schon kommen sehen.
Nachdem Mum gestorben war, hatte er nicht lange gezögert, seine Sachen gepackt und England verlassen.
Wohin genau er ging, wusste ich nicht. Es kümmerte mich auch nicht. Um ehrlich zu sein war ich ganz froh ihn nicht mehr in meiner Nähe zu wissen.
Er war ein schlechter Vater gewesen und ein noch schlechterer Ehemann.
Welcher Mann nahm den Herzinfarkt seiner Frau schließlich auch mit ausdrucksloser Miene entgegen und sorgte sich zuerst um die hinterbliebenen Anlagen als um seine Frau zu trauern?
Ich schüttelte mich, wollte nicht weiter darüber nachdenken. Für mich stand fest, dieses Haus würde nicht mehr lange in meinem Besitz sein. Früher hatte ich es geliebt, dann hatte ich es zwischenzeitlich gehasst und jetzt stand ich hier und wusste nicht mehr, was ich fühlen sollte. Wenn es nach mir ginge würde ich es sofort verkaufen und irgendeinem Makler überlassen, der sicher ein Händchen für so etwas hatte. Nur leider war ich nicht die Einzige, die darüber bestimmen konnte.
Mein Dad hatte nicht nur mir diesen Brief geschickt. Auch mein älterer Bruder James hatte einen Brief bekommen. Ihm gehörte das Haus ebenso wie mir. Und irgendetwas in mir sagte, dass er es nicht einfach so in fremde Hände geben würde. Seufzend schüttelte ich den Kopf.
Das war jetzt sowieso egal.
James war nicht hier und ich bezweifelte, dass er noch auftauchen würde.
Vor zwölf Jahren brach er den Kontakt zum Rest der Familie ab. Selbst ich hatte seit dem Vorfall nichts mehr von ihm gehört.
Im Nachhinein war ich mir nicht so sicher, ob es damals die richtige Entscheidung gewesen war, mich nicht bei ihm zu melden. Spätestens als ich volljährig geworden war hätte ich es versuchen sollen. Immerhin war er mein Bruder.
Ja, dein Bruder, der deinen kleinen Bruder getötet hat.
Ich schnaubte, um die lästige Stimme in meinem Kopf loszuwerden.
„Es gab nie irgendwelche Beweise dafür“, sagte ich bestimmt in den Wald hinein, als wolle ich meine Gedanken unterstreichen, indem ich sie laut aussprach.
Ich rieb meine kalten Hände aneinander und näherte mich dem Haus. Selbst jetzt, mit meinen achtundzwanzig Jahren, empfand ich es noch genauso groß, genauso mächtig wie damals.
Erschrocken wurde mir bewusst, dass ich es zuletzt gesehen hatte, als ich sechzehn Jahre alt gewesen war. Ich schluckte und spähte zu den braunen Dachziegeln empor. Ein paar fehlten und andere waren rissig. Ranken an Efeu und dunkles Moos zierten den Großteil des Daches. Würde Dad das sehen, würde er einen Anfall bekommen.
Er hatte immer alles penibel ordentlich im Haus haben wollen.
Opa meinte, es war doch schön, der Natur seinen Lauf zu lassen und auch mal etwas Unkraut zuzulassen. Erst als ich älter wurde hatte ich verstanden, dass er mir dadurch die wichtige Lektion beibringen wollte, dass nicht alles im Leben perfekt verlaufen musste.
Eine Lektion, die Dad wohl nie beigebracht worden war.
Laub raschelte unter meinen Füßen, als ich das Gelände betrat und zu den obersten Fenstern empor spähte. Die Scheiben waren verstaubt, doch immerhin noch ganz. Unser Haus hatte vier Stockwerke; den Keller, das Erdgeschoss, das Obergeschoss und schließlich den Dachboden.
Als Kind spielte ich gerne Verstecken.
Als ich älter wurde, war es kein Spiel mehr.
Ich spürte den Stich in meiner Brust, als ich daran zurückdachte, wie ich mich auf den Dachboden verkroch, um meine Ruhe zu haben. Dennoch hatte ich die lauten Stimmen, die meistens aus der Küche drangen, nie ganz ausblenden können.
Seufzend stieg ich über eine umgekippte, rostige Schubkarre.
Ich konnte mich nicht mehr erinnern, wieso sie hier lag und wer sie zuletzt benutzt hatte. Nach dem Streit waren wir so schnell aufgebrochen, als wären wir auf der Flucht gewesen.
Der Garten, den ich einst mit gepflegtem Rasen und wunderschönen Blumenbeeten in Erinnerung hatte, glich nun einem einzigen Urwald. Efeu und Unkraut lieferten sich einen erbitterten Kampf und die Steinplatten, die zur Haustür führten, waren längst von Moos und Laub verschluckt worden. Mein Herz war schwer, als ich durch das Gras streifte. Die Blumen waren verdorrt, was zu dieser kühlen Jahreszeit kein Wunder war. Der hölzerne Rahmen der Blumenbeete, war morsch, teilweise fehlten ganze Stücke, als wären sie nach und nach abgebrochen und auch hier wucherten dichte Dornensträucher und Diesteln. Die Zeit, in der dieser Garten perfekt gepflegt war, lag weit zurück.
Ich fragte mich, was mein Opa wohl sagen würde, könnte er das Haus jetzt sehen. Er hatte sich immer ein bisschen mehr natürliche Unordnung gewünscht, doch ob er das damit gemeint hatte, war fraglich.
Ich wollte mich abwenden und zur Tür gehen, da blieb ich wie erstarrt stehen.
Eine Faust schloss sich um mein Herz und ein trauriger Laut kroch über meine Lippen. Zwischen all dem Efeu hätte ich sie beinahe nicht gesehen. Doch da stand sie, genau so, wie sie es immer getan hatte.
In Gedanken versunken befreite ich mich von der Ranke, in der sich mein Fuß verheddert hatte und ging auf die Bank zu. Ein schmales Lächeln zeichnete sich auf meinen Lippen ab, als meine Finger sanft über das Holz glitten. Es war kühl und feucht durch die Witterung und gab unter meinem Druck sogar leicht nach. Hier hatte schon lange keiner mehr gesessen und irgendwie beruhigte mich dieser Gedanke. Vielleicht war es Oma selbst gewesen, die zuletzt hier gesessen hatte.
Mein Lachen hallte durch den ganzen Wald. Ich war mir sehr wohl bewusst, dass meine Beine niemals mit den langen meines Bruders James mithalten konnten und doch rannte ich ihm hinterher, als würde mein Leben davon abhängen.
„James! James, ich hab dich gleich!“, rief ich kreischend.
James, der mir mühelos entkam, warf einen Blick über seine Schulter und grinste. In der warmen Frühlingssonne funkelten seine braunen Augen bernsteinfarben. Opa sagte immer, James und ich hatten dieselben Augen, die wir von unserer Mum geerbt hatten. Luis‘ Augen hingegen waren dunkelgrün und jedes Mal, wenn ich ihn ansah, beschlich mich das Gefühl, er könnte bis auf meine Seele schauen.
Abgelenkt von meinen Gedanken stolperte ich, verlor das Gleichgewicht und fiel zu Boden. Erschrocken hielt ich den Atem an. Meine Hände schrammten über die Steinplatte, die zwischen dem Gras lag und ein flüchtiges Brennen schoss durch meine Finger.
Es tat weh, aber ich biss mir auf die Lippe, um nicht zu weinen.
James sagte immer, nur Kleinkinder weinten.
Und ich war kein Kleinkind mehr. Vielleicht hätte ich mit fünf Jahren geweint. Aber ich war jetzt schon acht, da würde ich bestimmt nicht wegen so etwas Blödem anfangen zu weinen.
„Hast du dir wehgetan?“
Ich hob den Kopf und sah James über mir stehen.
Er sah mich mit gerunzelter Stirn an und streckte seine Hand nach mir aus. Hastig schüttelte ich den Kopf und rappelte mich auf, ohne nach seiner Hand zu greifen. In diesem Moment erreichte uns Luis. Lachend und kreischend schlang er seine winzigen Ärmchen um mein Bein und strahlte zu mir herauf.
Sofort verschwand der Schmerz und ich schenkte ihm ein Lächeln. Kurzerhand hob ich meinen kleinen Bruder auf den Arm und wippte ihn auf und ab. Obwohl Luis jetzt schon zwei Jahre alt war, fühlte es sich immer noch so an, als würde man eine Feder auf dem Arm halten.
„Ja! Ja, hab dich!“, rief er mit leicht stockender Stimme.
Diese Worte hatte er schnell gelernt. Für sein Alter verstand er überraschend viel und war mir und James auch schon sehr früh im Garten hinterher gekrabbelt, bis er auf einmal aufstand und einfach mitlief.
„Ja, du hast mich. Du warst aber auch super schnell“, sagte ich und strich ihm über die Wange.
Ich war fasziniert, wie weich sie sich anfühlte. Mein Blick schweifte an ihm vorbei zu der Bank, die Opa und James letztes Jahr im Garten aufgestellt und mit türkisfarbenem Anstrich bemalt hatten. Oma saß auf dieser, vor sich eine Staffelei mit einer neuen Leinwand, in den Händen ihre Farbpalette mitsamt Pinsel und starrte konzentriert auf ihr Gemälde. Ich lächelte, als ich sah, wie sich eine graue Haarsträhne aus ihrem Dutt löste und sie ihn sich mit einem Finger hinters Ohr strich.
Dabei verteilte sie ganz viel rote Farbe auf ihrer Wange.
Luis war meinem Blick wohl gefolgt, denn nun begann er auf meinem Arm zu quengeln und zeigte auf Oma.
„Wollen wir mal nachschauen, was Oma so malt?“, schlug ich vor und sofort leuchteten Luis‘ Augen auf.
Seit seiner Geburt war er auf sie fixiert gewesen, ebenso wie James. Ich hingegen verbrachte meine Zeit lieber mit Opa.
Langsam schlenderte ich durch das frisch gemähte Gras zu ihr hinüber und ließ mich mit Luis auf dem Arm neben ihr auf die Bank sinken.
„Pume, Pume!“, rief Luis und klatschte dabei so wild in die Hände, dass er Oma beinahe die Palette aus der Hand schlug.
Sie lächelte ihn umsichtig an, legte Pinsel und Palette beiseite und nahm mir Luis ab.
„Ja, richtig, mein Schatz. Das ist eine Blume“, sagte sie ruhig.
Es war nicht irgendeine Blume, die Oma malte.
Es war eine wunderschöne rote Orchidee. Sie wirkte so echt, dass ich am liebsten meine Hand ausgestreckt und sie berührt hätte. Oma war eine begabte Malerin. Manchmal wunderte ich mich, wieso sie ihre Bilder nicht verkaufte oder wenigstens irgendwo ausstellte. Die Leute unten aus dem Dorf würden sie lieben. Doch Oma lächelte jedes Mal und meinte, dass ihre Bilder eben nicht für jeden bestimmt wären. Als ich meinen Kopf hob, sah ich, dass James uns nicht gefolgt war, uns aber dennoch beobachtete.
Ein nachdenklicher Ausdruck lag in seinen Augen, mit denen er Oma anstarrte.
Als er bemerkte, dass ich ihn ansah, wandte er sich ab und lief mit großen Schritten in den Wald.