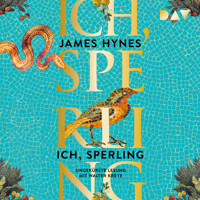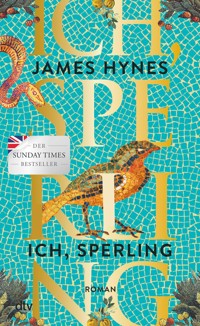
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Niemand weiß, wer ich bin, am allerwenigsten ich selbst.« Ein alter Mann blickt zurück auf seine oft unmenschliche Kindheit: Als namenloser Waise wächst er in einem Bordell inmitten der sogenannten "Wölfinnen" im spanischen Carthago Nova im 4. Jahrhundert n. Chr. auf. Eine von ihnen, Euterpe, wird seine Ziehmutter: "Sperling" nennt sie ihn liebevoll. Sperling weiß nicht viel von der Welt: Anfangs hilft er Euterpes geheimer Geliebten in der Küche, später schuftet er in der Taverne, bis er schließlich in das ominöse Obergeschoss geführt wird, wo die Prostituierten ihre Betten haben. Ein furchtbares Schicksal erwartet ihn dort. Doch wie ein kleiner Sperling entfliegt er in seiner Vorstellung der brutalen Realität immer wieder und vermag es, mit seinem Lied auch anderen Hoffnung zu geben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 770
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Irgendwo im Römischen Imperium des 4. Jahrhunderts nach Christus blickt ein alter Mann zurück auf seine Kindheit, die alles andere als unbeschwert war. Als namenlose Waise ist er in einem Bordell in Carthago Nova, einer Hafenstadt der spanischen Mittelmeerküste aufgewachsen und eine der Prostituierten, Euterpe, ist zu seiner Ziehmutter geworden:
»Sperling« nennt sie ihn liebevoll. Viel von der Welt weiß und kennt Sperling nicht: Anfangs hilft er Euterpes geheimer Geliebten in der Küche, später schuftet er in der Taverne, bis er schließlich in das ominöse Obergeschoss geführt wird, wo die Prostituierten arbeiten. Ein furchtbares Schicksal erwartet ihn dort. Doch er entflieht der Realität, befreit sich, erst nur in der Vorstellung, dann wirklich. Mit großer Vorstellungskraft und Einfühlungsvermögen lässt James Hynes in ›Ich, Sperling‹ das spätrömische Reich in den Geschichten der Deklassierten und Ausgenutzten auferstehen, dort, wo Gewalt und aufrichtige Liebe in einer dem Untergang geweihten Welt direkt nebeneinander existieren.
James Hynes
Ich, Sperling
Roman
Aus dem Englischen von Ute Leibmann
Für Mimi
Qui invitus servit, fit miser, servit tamen.
Wer unwillig dient, wird elend, dient aber dennoch.
– Publilius Syrus, Sententiae
Ich, Jakob, Sohn von niemandem, Vater von niemandem, geliebt von niemandem, Sklave, Hure, ein Cinaedus, Eunuch, Mörder, Zuhälter, vielleicht Jude, vielleicht Syrer, vielleicht Nilschlamm, Arbeiter, Aufseher, Krüppel, Schwindsüchtiger, herrenloses Gut, verwittertes, von der Flut angespültes Treibholz, letzter Bewohner einer menschenleeren Stadt in einer aufgegebenen Provinz am äußersten Rande eines sterbenden Imperiums, schreibe diese Geschichte meines Lebens nieder. Sie wird niemals fertiggestellt, denn wer sollte mein Ende schildern? Doch es wird sie wohl auch niemand lesen, denn zweifellos wird sie mit mir sterben, und ich sterbe bald. Sie wird den raschen Zerfall meines Körpers nicht lange überdauern, wird mich nur so lange überleben, wie dieser Papyrus Bestand hat, wenn er in einem verfallenen Haus unbewacht vor sich hin modert, angenagt von Ratten, ein Festmahl für Käfer und Kakerlaken, durchnässt vom Regen, der das rottende Dach durchdringt, und schließlich von der raren Sonne Britanniens zu ewigem Schweigen gebleicht. Vielleicht wird der Papyrus auch einfach zu Staub zerfallen wie alle Schriften in dieser Bibliothek, in der ich gerade sitze. Wenn dieses Schicksal Tacitus und Cicero, Juvenal und Seneca und selbst die Kaiser Julian und Marcus Aurelius ereilt – warum sollte es dann ausgerechnet mich verschonen? Ich bin bloß ein weiterer Autor, an den sich niemand erinnern wird, und dies ist bloß eine Geschichte mehr, die nichts ändert.
Aber eines verspreche ich dir, dem unbekannten Leser, der diese Worte wohl niemals lesen wird: Ich werde dich niemals belügen. Mein Leben mag voller Laster gewesen sein, doch meine Darstellung ist rechtschaffen.
I
Eine zornige Frau entgrätet einen Fisch. Sie zerlegt ihn mit kontrollierter Wut, ihre Finger sind geschickt, ihre Bewegungen sparsam. Mit einer langen, scharfen Klinge schneidet sie den Fisch hinter den Kiemen auf, löst die Wirbelsäule und hebt das rosa Filet heraus. Sie entfernt die blauen Eingeweide und wirft sie beiseite. Dann hebt sie den Kopf mit zwei Fingern unter den Kiemen empor und schleudert ihn samt freiliegender Wirbelsäule in meine Richtung.
Ich bin ein namenloses Kind, ich sitze mit gespreizten Beinen auf einer rissigen Steinplatte im Halbdunkel einer Küchenecke. Der Fischkopf mit seinem dornigen Rückgrat kommt über die Fliesen geschlittert und bleibt zwischen meinen Beinen liegen. Das Maul des Fisches ist aufgerissen, als wäre er überrascht, sich plötzlich nackt auf dem Boden wiederzufinden. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ist das ein Spiel? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Die trüben Augen des Fisches richten sich auf mein erschrockenes Gesicht, als wolle er mich warnen.
»Sie ist wütend auf dich«, sagt sein Blick.
In der Küche ist es dunkel und drückend heiß. Es riecht nach Rauch, Zwiebeln und Knoblauch, nach ranzigem Öl, und ja – nach Fisch natürlich. Der jahrelange Gebrauch scharfer südländischer Gewürze hat sich in die rußigen Mauern gebrannt, ein Geruch, den ich heute noch in meinen Nebenhöhlen spüren kann. Auf einer Arbeitsplatte aus Zement reihen sich Flaschen mit Gewürzen, verbeulte Töpfe und Pfannen, Behälter mit Kichererbsen und getrockneten Feigen sowie fleckige Krüge mit Olivenöl, Essig, Honig und Garum. An Haken über der Arbeitsplatte hängen Messer, Zangen, ein Küchenspatel, noch mehr Messer, zwei Schöpfkellen und verschiedene Löffel. Auf einem gemauerten Herd an der angrenzenden Wand kocht bereits Wasser in einem Eisentopf. In der Brennkammer darunter schwelt das morgendliche Feuer, rote Glut durchzieht die Asche. Das einzige Licht fällt durch eine niedrige quadratische Türöffnung herein, und draußen scheint die Sonne senkrecht in den Gemüsegarten, ein kniehohes Dickicht, wo Hühner ihre Köpfe zwischen den herabhängenden Blättern hitzemüder Pflanzen hin und her recken. Am Ende des Gartens befindet sich eine weiß getünchte Mauer, zu hell beinahe, um sie direkt anzuschauen, und über der Mauer strahlt ein Himmel in makellosem Blau. Selbst heute, nachdem ich den Großteil meines Lebens unter dem milchigen, unbeständigen Himmel Britanniens verbracht habe, entspricht das diamantharte, unnachgiebige Blau dieses spanischen Himmels immer noch meinem platonischen Idealbild des Firmaments – wolkenlos, grenzenlos, unendlich weit, perfekt. Es ist ein Himmel, wie ich ihn im Jenseits erwarten würde, wenn es denn ein Jenseits gäbe und ich die Hoffnung hätte, dorthin zu gelangen.
Inmitten der schmalen Küche steht ein schwerer, aber wackeliger Holztisch, unlackiert und von zahllosen Messerschnitten durchzogen. Über den Tisch beugt sich die Frau, die wütend einen weiteren Fisch entgrätet. Unter dem Tisch kann ich den zerrissenen Saum ihres Rocks sehen. Ihre schmutzigen Zehen beugen sich auf den Steinplatten und strecken sich wieder, während sie den Fisch ausnimmt. Ich habe zwar noch frühere Erinnerungen als diese, doch es sind nur Bruchstücke – die glitzernde Sonne auf dem Meer, Katzendreck auf einem Holzboden, der Duft von Mandelblüten. Jener Moment in der Küche ist meine erste zusammenhängende Erinnerung. Es ist der Anfang meiner Geschichte, und wie alle guten Geschichten beginnt sie in medias res, so wie Horaz es fordert. Als ein weiteres schlangenartiges Gebilde aus Fischkopf und Rückgrat neben mir landet, erschrecke ich, aber ich schreie nicht. Offenbar weiß ich schon, dass ich nicht aufbegehren darf. Offenbar weiß ich, was passieren wird, sollte ich es doch tun.
»Immer noch wütend«, sagt der zweite Fischkopf. »Und immer noch auf dich!«
Im schwülen Dämmerlicht der Küche glänzt der Schweiß auf dem blassen Gesicht der Frau. Ihr üppiges Haar ist zu einem Dutt gebunden, und das Licht, das durch die Türöffnung hereinfällt, lässt die widerspenstigen roten Strähnen um ihr Gesicht aufleuchten. Sie trägt ein schwarz angelaufenes, eisernes Halsband. Sie blickt kein einziges Mal zu mir hinüber, deshalb weiß ich, dass sie wütend auf mich ist. Doch irgendwie landen die Fischköpfe weiterhin zielsicher zwischen meinen Beinen, ein kleiner Hügel aus glotzenden Augen und verdrehten Grätengerüsten. Sie weiß genau, wo ich bin. Sie will mich bloß nicht ansehen.
Ein Schatten huscht an der Türöffnung vorbei. Ich drehe mich um. Da ist nichts, nur das Sonnenlicht auf der Gartenmauer, ein Huhn mit wippendem Kopf und Blätter, die sich in der Hitze zusammenrollen. Ich blicke wieder zu der Frau hinüber, die ihre Klinge in den nächsten glücklosen Fisch stößt. Dann verdunkelt sich der Raum. In der Türöffnung schwankt eine scharf umrissene Silhouette, ein Mann mit nackten Beinen und einer kurzen Tunika. Während ich aus meiner dunklen Ecke zu ihm hinüberblinzle, stützt er sich mit den Händen an beiden Seiten des Eingangs ab.
»Is hier das Pisshaus?« Er atmet schwer durch den Mund, als hätte er sich gerade einen Berg hinaufgequält.
Die Frau richtet sich auf, eine Hand auf die Tischplatte gestützt. »Hier ist die Küche.« Sie deutet mit dem Messer nach draußen. »Die Latrine ist nebenan.«
Der Mann blickt in die Richtung, bleibt aber stehen. Er ist nicht groß, doch der Eingang ist so niedrig, dass er mit seinem Kopf beinahe den Sturz streift. Im blendenden Gegenlicht kann ich weder sein Gesicht erkennen noch, welche Farbe seine Tunika hat, aber ich höre seinen mühsamen Atem. Ich sehe, wie seine Beine unter ihm zittern, als hätte er gerade ein schweres Gewicht abgesetzt. Ich höre das Klack-Klack-Klack der Klinge gegen die Tischplatte, während die Frau gekonnt einen weiteren Fisch zerlegt und den Mann hartnäckig ignoriert. Dann holt er tief Luft und schiebt sich in die Küche. Hinter ihm dringt das Licht herein. Nun kann ich erkennen, dass er verfilztes schwarzes Haar und einen struppigen Bart hat. Unter dem Tisch hindurch kann ich seine Schuhe sehen. Einer der Riemen ist gerissen, und er hat ihn selbst repariert, indem er die beiden Enden fest verknotet hat. Auf wackligen Beinen taumelt er über die Steinplatten auf die Frau zu. Sie atmet tief ein, dreht sich zu ihm um und baut sich selbstbewusst vor ihm auf. Sie stemmt die Füße in den Boden und spreizt die schmutzigen Zehen. Von meinem Platz aus sehe ich, wie die Hand, die das Messer hält, in eine Falte ihres Rocks gleitet.
»Wie heißt du?« Der Mann steht so dicht bei ihr, dass er sie anhauchen kann, und sie wendet das Gesicht ab. Er ist nur ein wenig größer als sie. Unsicher hebt er die Hand und wickelt sich eine ihrer widerspenstigen Haarsträhnen um den Finger. Sie reißt den Kopf weg und weicht zurück. Doch trotz seiner Trunkenheit ist er schnell, und bevor sie das Messer heben kann, hat er ihre Taille umfasst und ihre beiden Handgelenke gepackt. Er drückt sie gegen die Tischkante und presst ihr Handgelenk so lange gegen die Tischplatte, bis sie vor Schmerz stöhnt und das Messer loslässt. Sie wehrt sich und stemmt sich gegen ihn, worauf er sie wieder gegen den Tisch schleudert, sodass ihr der Atem stockt.
»Du suchst eine von den Wölfinnen oben«, keucht sie. »Ich bin Focaria.«
»Ich hab Geld dabei«, nuschelt er. »Ich kann zahlen«, und dabei hält er mit einer Hand ihre Taille umfasst, während er mit der anderen Stück für Stück ihren Rock hochschiebt. Focarias Zehen stemmen sich unter dem Tisch auf den Boden, während ihre Fersen emporgezogen werden. Der Mann spannt die Waden an. Er drückt die Schuhsohlen knirschend in die Steinplatten. Focaria sagt nichts, ihre Nasenflügel sind gebläht, die Lippen blutleer zusammengepresst. Mit einer Hand versucht sie auf der Tischplatte zwischen den glitschigen Fischgedärmen Halt zu finden, mit der anderen will sie nach dem Messer greifen, doch der Mann lässt kurz von ihrem Rock ab und schnippt es vom Tisch. Das Messer fällt scheppernd auf den Boden, und Focaria bleibt nur ein stummes Schreien, während er die Hand wieder unter ihren Rock schiebt.
Wenn dies ein weiteres Spiel ist, macht es mir Angst. Ihr Raufen und Grunzen treibt mir die Tränen in die Augen, doch ich bin zu angespannt, um zu weinen. Dann plötzlich schlingert der Tisch mit einem dumpfen Poltern auf mich zu. Um nicht zu stürzen, lässt der Mann Focaria los und richtet sich auf. Sie fällt auf die Knie, und während der Mann auf seinen Füßen hin und her wackelt wie ein Topf mit rundem Boden, krabbelt sie rasch unter den Tisch.
Nun fange ich tatsächlich an zu weinen, und zum ersten Mal bemerkt mich der Mann. »Was is das denn?« Er schwankt auf mich zu, eine Hand auf dem Tisch, die andere an der Wand. Er ragt vor mir auf, eine gesichtslose Silhouette im grellen Licht der Türöffnung. Ich heule noch lauter. Er bückt sich, packt mich mit harten, schwieligen Händen und hebt mich hoch. Er stinkt nach Wein und Schweiß.
»Wer bis du?«, fragt er.
Na, das ist doch mal eine Frage! Während ich jetzt, am Ende meines Lebens, diese Erinnerung niederschreibe, bin ich im Nachhinein noch beeindruckt von der trunkenen Scharfsicht des Mannes. In vino veritas, du längst verstorbener Mistkerl!
»Was bis du?« Er hebt mich über den Kopf und späht unter meine Tunika, dann blickt er in die Richtung, wo Focaria eben noch war. »Der is zu dunkel, um deiner zu sein!«
Ich wehre mich schreiend, und er hält mich auf Armeslänge Abstand, damit meine Hände und Füße sein Gesicht nicht treffen. Von dort oben, einem mir bisher unbekannten Aussichtspunkt in der Nähe der rußgeschwärzten Dachsparren, sehe ich die äußersten Begrenzungen meiner Welt und alles, was dazugehört: die gleißend helle Türöffnung, die schmierigen Wände, den verschrammten, schleimbedeckten Tisch. Die Zementplatte, das gemauerte Kochfeld, die mit Fischköpfen übersäten Steinplatten. Den Schürhaken, die kleine Eisenschaufel und den ledernen Blasebalg neben dem Herd. Die Frauengestalt, die in der hintersten Ecke kauert.
»Vielleicht will er zusehen«, ruft der Mann lachend. »Vielleicht kann er noch was lernen!«
Er wendet sich zu Focaria um und sieht gerade noch, wie sie mit bleichem Gesicht und fliegendem Haar auf ihn zugestürmt kommt, das Fischmesser umklammert, mit welchem sie aus der Hüfte heraus nach ihm sticht. Der Mann schreit auf und dreht sich schnell von ihr weg. Er rutscht mit der Ferse auf einem Fischkopf aus, verliert das Gleichgewicht und lässt mich fallen, während er auf dem Hintern landet. Ich schreie auf, als Focaria mich am Arm packt und wegzieht. Der Mann stemmt sich empor und sucht auf dem Boden nach Halt, greift aber nur in Fischköpfe. Mit der Geschicklichkeit eines Berufskämpfers wendet Focaria das Messer in ihrer Hand mit der Klinge nach unten und hebt den Arm über die Schulter. Ihre Augen glitzern furchterregend. Mein einziger Trost ist, dass ihre Wut sich gegen den Mann und nicht gegen mich richtet.
Dann plötzlich packt eine andere Hand – groß und haarig – Focaria an ihrem eisernen Halsband und wirft sie zu Boden. Sie windet sich nach Luft schnappend, während das Messer über die Steinplatten davonschliddert. Ein neuer Schatten ragt über mir auf, größer als der erste Mann, und befördert mich mit einem Fußtritt zur Seite. Er bückt sich, greift mit beiden Händen den ersten Mann am Vorderteil seiner Tunika und zerrt ihn auf die Beine.
»Die Schlampe hat versucht …«, beginnt der erste Mann, aber der neue Schatten, der ihn um einen Kopf überragt, stößt ihn gegen die Wand. Er umklammert mit einer Hand die Handgelenke des ersten Mannes und hält sie über dessen Kopf gegen die Wand gepresst. Mit der anderen Hand verpasst der neue Mann dem ersten mit einem kurzen, scharfen Messer einen Schnitt direkt unter dem Auge.
Der verletzte Mann heult auf. Der hünenhafte Schatten schleift ihn durch die Küche und befördert ihn mit einem kräftigen Stoß zur Tür hinaus. Der erste Mann stolpert nach draußen ins Sonnenlicht, landet zwischen den Pflanzen und versucht mit fuchtelnden Armen, sein Gleichgewicht zu halten. Plötzlich flattert das Huhn empört gackernd aus dem Gestrüpp hervor, der Mann weicht zurück und stürzt in den Dreck.
Der neue Schatten füllt die Türöffnung aus und verdunkelt die Küche wieder. Nur wenig Licht dringt an seinem breiten Rücken, dem ausladenden Bauch und den dicken Waden vorbei.
»Komm bloß nicht wieder«, ruft er. »Beim nächsten Mal fick ich dich ins Gesicht und schneid dir die Kehle durch.« Er wischt die Klinge seines Messers mit den Fingern ab und lässt es wieder verschwinden.
»Mein Geld …« Der erste Mann kniet zwischen den zitternden Blättern am Boden, eine Hand an die Wange gepresst. »Mein Geld ist so gut wie das von jedem andern.« Helles Blut rinnt ihm zwischen den Fingern hindurch.
»Scheiß auf dein Geld, du Fotzenlecker.« Die Stimme des Mannes in der Tür klingt grollend und feucht zugleich. »Ich brauch dein verfluchtes Geld nicht.«
Zwischen seinen Beinen hindurch kann ich sehen, wie der erste Mann mühsam aufsteht und dabei die Pflanzen platt trampelt. Irgendwo außer Sichtweite protestiert das Huhn heftig. Der Schatten in der Tür droht noch einmal mit der Faust, und der Mann im Garten taumelt davon, wobei sein Blut auf die welken Blätter tropft. Der Schatten dreht sich wieder um.
»Audo …« Focaria hat sich an der Kante des Tisches emporgezogen. In meiner Ecke jaule ich noch immer wie ein Hund.
Der Mann, den Focaria mit Audo angesprochen hat, betritt die Küche und das Licht aus der Türöffnung fällt auf ihn. Er hat ein fleischiges, plattes Gesicht, einen Bauch, der sich wie ein aufgeblähter Weinschlauch über den Gürtel seiner Tunika spannt, und stämmige Knöchel, rosa und weiß marmoriert wie ein Schinken. Mein verzweifeltes Schluchzen lässt ihn finster blicken.
»Sieh zu, dass es still ist!«, sagt er mit seiner feuchten Rasselstimme und deutet mit einem Fingerstumpf in meine Richtung, »oder ich schick’s dahin zurück, wo’s herkommt!«
»Schön wär’s.« Focaria reibt sich den Hals, wo das eiserne Band sie gewürgt hat. »Was soll ich denn mit ihm anfangen?«
Nun sieht Audo mich an. Ich höre sein lautes Atmen durch die ganze Küche. Seine Augen sind dunkel wie Rosinen in einem Brötchen, und unter dem schwarzen Blick schlucke ich instinktiv Schluchzen und Rotz hinunter. Gerade lerne ich eine meiner ersten Lektionen: Ein Sklave weint nicht.
»Lass ihn arbeiten«, sagt er. »Wo ist das Problem?«
Focaria seufzt. Sie ist selbst eine Sklavin, allerdings nützlicher, als ich es zu diesem Zeitpunkt meines Lebens bin, sodass sie sich ein paar Widerworte erlauben kann.
»Was soll er denn machen?« Ihre Stimme klingt jetzt ruhiger. »Er ist zu jung.«
Audo fixiert mich mit böser Miene, und ich werde mucksmäuschenstill. Ich lerne schnell dazu.
»Schlag ihn.« Das, so werde ich ebenfalls lernen, ist Audos Antwort auf alles. Audo ist ein Hammer und jedes Problem ein Nagel. »Ein Sklave hat die Ohren auf dem Rücken …«, beginnt er, aber Focaria, die ihre Grenzen austestet, beendet den Satz für ihn.
»… er hört nur zu, wenn du ihn schlägst«, sagt sie. »Das weiß ich, Audo.« Sie zeigt auf mich. »Aber den hier könnte ich den ganzen Tag lang schlagen und es würde keinen Unterschied machen. Er ist ein Kind. Er braucht jemanden, der ihm was beibringt, und wann soll ich das tun? Ich muss kochen, putzen und einkaufen. Ich muss jeden Abend Essen in die Taverne bringen. Ich muss den Wölfinnen Wasser und Wein raufschleppen und ihre verdammten Nachttöpfe ausleeren. Wie soll ich das alles schaffen und mich dann auch noch …«, sie macht eine Kopfbewegung in meine Richtung, sieht mich aber immer noch nicht an, »… um ihn kümmern?«
Sie will noch mehr sagen, bremst sich dann aber. Audo hat den Kopf gesenkt. Als notwendiges Inventar ist Focaria zwar weniger gefährdet als ich, doch auch sie ist nicht vor Schlägen gefeit.
»Was soll ich deiner Meinung nach tun?« Audo hebt den Kopf. »Ich bin schließlich nicht aus Geld gemacht!« Das ist noch einer seiner Lieblingssprüche. Das sagt er immer, wenn er meint, besonders vernünftig zu handeln. Focaria wiederholt den Satz manchmal heimlich hinter seinem Rücken, ahmt seinen derben Akzent nach und nennt ihn »Pecunia«. Und dann fügt sie hinzu: »Ist schließlich nicht sein verdammtes Geld, oder?«, aber natürlich nur, wenn er sie nicht hören kann.
Doch jetzt sagt sie: »Schick eine der Wölfinnen runter, um auf ihn aufzupassen.«
»Eine der Wölfinnen?«
»Wieso denn nicht?«, meint Focaria. »Wenn sie nicht arbeiten.« Ihre Stimme klingt angespannt. Sie weiß, dass sie seine Geduld gerade bis zum Äußersten reizt. »Die schlafen doch sowieso den ganzen Vormittag nur!«
Audo trommelt mit seinen fleischigen Fingern auf die Tischplatte.
»Muss ja auch nicht jeden Tag die Gleiche sein!«
Audo schnaubt lautstark wie ein kampflustiger Bulle.
»Sie können sich abwechseln. Sie könnten …«
Audo knallt beide Handflächen auf den Tisch, sodass er wackelt. Focaria bricht ab und senkt den Blick. Er hat sie zwar nicht geschlagen, aber Gewalt hat die wunderbare Wirkung, dass man bei einem geprügelten Hund irgendwann nur noch die Hand heben muss, und er zuckt zusammen.
Trotzdem scheint Focaria zu glauben, dass ihr noch ein wenig Spielraum bleibt. Rasch sagt sie: »Ich kann nicht dauernd auf ihn aufpassen. Wenn er sich verletzt, schlägst du mich. Wenn er stirbt, schlägst du mich. Wenn ich um Hilfe bitte, schlägst du mich. Was soll ich denn tun?«
Audo starrt sie wütend über den Tisch hinweg an – oder, besser gesagt, starrt er wütend ihren gesenkten Kopf an. Dann schweift sein Blick kurz in die Ecke, wo ich blinzelnd, stumm und atemlos am Boden kauere. Er blickt in Richtung Garten, und etwas Sonne fällt auf sein Gesicht. Ich kann das Grau in seinem struppigen schwarzen Haar sehen. Und ich sehe die roten Flecken auf seiner platten Nase.
»Ich schick Euterpe runter«, sagt er. »Vormittags.«
Focaria murmelt etwas vor sich hin, ohne ihn anzusehen.
»Was?«, sagt Audo.
Focaria zieht die Schultern hoch, als erwarte sie, auf den Rücken geschlagen zu werden.
»Schick Urania«, sagt sie dann, während sie immer noch die Tischplatte fixiert. »Euterpe ist zu schusselig.«
»Das war die alte Euterpe«, sagt Audo. »Die neue ist nicht so blöd.«
»Urania«, beharrt Focaria. »Woher weiß ich, dass die neue Euterpe ihn nicht umbringt?«
»Ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie’s nicht tut.«
»Was nützt es mir dann«, sagt Focaria in viel zu scharfem Tonfall, »wenn ich auf beide aufpassen muss?«
»Es reicht!«, brüllt Audo.
Focaria zuckt zusammen und umklammert ihre Ellbogen.
»Oder willst du zurück unters Aquädukt, Schwänze lutschen?«, fragt er.
»Nein, Audo«, flüstert Focaria.
»Und was sagst du dann?«, sagt Audo.
Es ist beschlossene Sache. Etwas Besseres als Euterpe bekommt sie nicht. Mühevoll formt Focaria mit den Lippen ein »Ich danke dir, Audo«.
»Dann ist das also geklärt.« Er duckt sich unter dem niedrigen Türsturz hindurch. Anschließend sticht er noch einmal einen warnenden Zeigefinger durch den Eingang »Und sorg dafür, dass er was arbeitet!«
Dann ist er weg. Focaria seufzt und lässt die Schultern sinken. Mit säuerlichem Blick betrachtet sie die Pflanzen, die der erste Mann platt getrampelt hat. Das Huhn trippelt gackernd vorbei, ruckt mit dem Kopf und lässt seine großen gelben Augen wandern. In meiner Ecke fange ich wieder an zu wimmern, verstört und zerschunden von den Tritten, den harten Griffen und dem Sturz auf den Boden. Seufzend schiebt Focaria den Tisch an seine ursprüngliche Position zurück. Sie bückt sich, hebt das Messer auf und stößt es mit zitternder Hand in die Holzplatte. Dann beugt sie sich hinab, hebt mich hoch und setzt mich auf die Tischkante. Sie blickt mich streng an, bis ich aufhöre zu wimmern und meine Tränen versiegen. Sie wischt mir den Rotz von Nase und Kinn und schnippt ihn weg. Dann nimmt sie meinen Kiefer in ihre fischigen Hände, nicht grob, aber auch nicht zärtlich, und mustert mein Gesicht, als hätte sie so etwas wie mich noch nie gesehen. Im Licht der Türöffnung kann ich ihr rotes Haar sehen. Ich sehe die Sommersprossen auf ihrer Nase und ihren Wangen. Ich sehe den Bluterguss an ihrer Kehle, dort, wo Audo sie an ihrem eisernen Halsband gepackt hat. Ich sehe ihre blauen Augen, so unnachgiebig streng und weit wie der Himmel über der Gartenmauer.
»Die glücklichen Tage sind vorbei«, sagt sie.
Über Nacht wurde der Horizont meiner Welt doppelt so weit wie zuvor und erstreckte sich nun von der düsteren, heißen, verräucherten Küche ins blendende Sonnenlicht des Gartens mit seinen würzigen Düften. Der Garten der Taverne war nicht viel mehr als ein schmaler Streifen Erde, auf dem Focaria Zwiebeln, Knoblauch, Karotten und Rüben sowie Basilikum, Thymian, Rosmarin, Minze und andere Kräuter anbaute. Auf einer langen Seite wurde er von der Küche mit dem schräg abfallenden Dach und dem rauchenden Schornstein sowie der Latrine mit ihrer klapprigen Brettertür begrenzt. Auf der anderen erhob sich die weiße Mauer mit dem abblätternden Putz, in der eine stabile Holztür zur unsichtbaren Straße hinausführte. An dem einen Ende des Gartens ragte die Mauer der Taverne empor. Ein niedriger Torbogen führte in den Schankraum im Erdgeschoss, darüber im ersten Stock, unter dem Dachvorsprung, waren drei vergitterte Fenster in die Wand eingelassen. Am anderen Ende des Gartens sah man die kahle Mauer des benachbarten Ladens und davor den gemauerten Wassertank sowie einen unkrautbewachsenen Holzstapel. Hier lebten auch die Hühner und ein launischer Hahn, hinterließen mit ihren Krallen Abdrücke in dem staubigen Boden und düngten ihn mit ihren Hinterlassenschaften.
Vor allem aber erweiterte sich meine Welt um Euterpe, jene Wölfin, die Audo mir als Lehrerin zugewiesen hatte. Jeden Morgen nach dem ersten Hahnenschrei, wenn das frühe Sonnenlicht an der Gartenmauer entlangkroch, hockte ich vor dem Kücheneingang, während Focaria sich drinnen zu schaffen machte. Ich trank einen Becher Wasser und knabberte an einem harten Stück Brot vom Vortag, während ich darauf wartete, dass Euterpe in ihrem roten Gewand gähnend und sich reckend im Torbogen der Taverne auftauchte, die verschmierte Schminke vom Vorabend noch im Gesicht. Ihre Maske, wie sie immer sagte. Manchmal hatte sie blaue Flecken im Gesicht, an den Oberarmen oder am Hals. Dann zuckte sie zusammen, wenn ich sie berührte, aber sie verlor nie die Fassung oder stieß mich weg. Ich war ihr Pusus, ihr Kleiner, und sie war nach Focaria die zweite Frau in meinem Leben. Man könnte durchaus sagen, dass ich von einer Wölfin aufgezogen wurde, genau wie Romulus und Remus. Dabei war Euterpe eine Wölfin und war es zugleich nicht. Sie war Christin und war es nicht. Sie trug zwar den Namen einer Muse, aber sie war keine Muse. Sie hieß Euterpe und hieß doch anders. Sie war meine Mutter und doch nicht meine Mutter.
In meiner frühesten Erinnerung an sie sind wir bereits miteinander vertraut und hocken aneinandergeschmiegt an der kühlen Ziegelmauer des Wassertanks. Ich weiß schon, wie sie heißt, kenne den tiefen Klang ihrer Stimme und die wohlige Wärme ihrer Brüste. Ich kenne ihren Geruch nach Moschus und Schweiß, nach dem Parfüm der letzten Nacht und etwas anderem, von dem ich erst später erfahren werde, dass es der Geruch von Sex ist. Sie lehnt mit dem Rücken am Wassertank, ich sitze auf ihrem Schoß oder zwischen ihren Knien, und sie bringt mir die Namen der Dinge bei, die es in der Welt jenseits des Gartens gibt. Das ist der Himmel, das ist eine Wolke, das da ist die Sonne. Sie hebt meine Hand und wir zeigen nacheinander auf jedes dieser Dinge. Das ist die Mauer, und hinter der Mauer ist ein Haus, und oben auf dem Haus ist ein Dach, und das Dach ist rot. Sie benennt für mich die Geräusche, die von der anderen Seite der Mauer herüberdringen, aber sie sind für mich schwerer zu begreifen, weil es nichts gibt, worauf sie dabei zeigen kann. Jetzt hört man jemanden gehen, sagt sie und marschiert dabei mit zwei Fingern meinen Arm hinauf. Und jetzt hört man jemanden laufen, und dabei bewegt sie die Finger schneller. Und das ist das Geräusch von Frauen, die reden, so wie wir jetzt reden. Da bellt ein Hund, und sie lässt ihre Finger kläffen. Da brüllt ein Maultier Iah, und sie reißt ihren Mund weit auf. Das da ist das Lachen eines Mannes, und sie kitzelt mich, bis ich mich vor Lachen krümme.
Ab und zu tritt Focaria aus der Küche, wirft den Hühnern Abfälle hin oder zupft ein paar Blätter von den Kräutern im Garten. Manchmal steht sie aber auch nur in der Türöffnung und beobachtet uns. Wenn Euterpe oder ich dann zu ihr hinüberblicken, zieht sie sich sofort in die Küche zurück wie eine Ratte in ihr Loch.
Meist bringt Euterpe mir etwas bei, indem sie Geschichten erzählt – hier ist die erste, an die ich mich erinnern kann. Es ist eine Geschichte über die Vögel.
»Am Anfang«, sagt sie und ich spüre ihren warmen Atem an meinem Ohr, »gab Gott jedem Vogel die Wahl. Er konnte sich aussuchen, ob er eine einzige Sache sehr gut machen oder aber die Fähigkeit bekommen wollte, vieles zu tun, aber nichts davon sehr gut. Siehst du den Vogel dort?«
Sie nimmt meine Hand und deutet damit auf das dürre, schmutzig weiße Federvieh, das auf gelben Füßen zwischen den Kräuterreihen stolziert und seine zornigen gelben Augen mal hierhin und mal dorthin wendet.
»Huhn«, sage ich.
»Sehr gut.« Sie drückt mich liebevoll an sich. »Als Gott das Huhn gefragt hat, was es gern können würde, sagte das Huhn: ›Ich möchte auf dem Boden laufen können, denn dort ist das Essen.‹ Gott hat ihm seinen Wunsch erfüllt. Und so läuft das Huhn jetzt auf dem Boden rum und frisst alle Würmer und Käfer, die es haben will. Seine Wahl war gut, denn es hat bekommen, was es sich gewünscht hat. Aber seine Wahl war auch schlecht, denn es kann nicht fliegen. Und so wird das Huhn von den Menschen als Sklave gehalten, und sie nehmen ihm jeden Tag die Eier weg und essen sie. Und es kann dem Fuchs nicht entfliehen, wenn er in den Garten kommt.«
Ich rutsche unruhig auf ihrem Schoß herum. Ich weiß nicht, was ein Fuchs ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht von einem gefangen werden möchte.
»Mach dir keine Sorgen«, sagt Euterpe. »Du bist zu groß, um von einem Fuchs gefressen zu werden. Siehst du den Vogel da oben?«
Gemeinsam zeigen wir auf einen anderen Vogel, mit sichelförmigen Flügeln und einem gegabelten Schwanz, der hoch über dem roten Dach vor dem harten Blau des Himmels in raschen Kehren hin und her schießt. »Das ist ein Mauersegler«, sagt sie. »Kannst du ›Mauersegler‹ sagen?«
»Mauersegler.« Ich folge ihm mit den Augen, wie er hin und her, auf und nieder flitzt.
»Sehr gut.« Wieder drückt sie mich. »Als Gott den Mauersegler fragte, was er besser als alle anderen können wollte, sagte er: ›Ich will so gut fliegen können, dass weder Mensch noch Fuchs mich jemals fangen.‹ Also hat Gott den Mauersegler zu einem besseren Flieger gemacht als alle anderen Vögel.« Sie hebt wieder meine Hand und wir wiegen gemeinsam hin und her, während wir den rasanten Flug des Mauerseglers nachzeichnen. »Der Mauersegler kann nie zum Sklaven werden und der Fuchs kann ihn niemals fangen.«
»Das ist gut!«, sage ich.
»Aber es ist auch schlecht!«, erwidert Euterpe. »Weil der Mauersegler so gut fliegt, braucht er keine Füße und kann deshalb nicht gut auf dem Boden laufen. Und weil er nicht auf dem Boden laufen kann wie das Huhn, kann der Mauersegler nur fressen, was er aus der Luft fängt. Er muss immerzu auf der Jagd sein. Der Mauersegler kann also fliegen, aber er kann sich niemals ausruhen.«
Ich blicke von dem herumstolzierenden Huhn im Garten, Sklave der Menschen und leichte Beute für den Fuchs, zu dem Mauersegler in der Luft, der niemals verschnaufen, niemals schlafen kann. Das scheinen mir keine besonders tollen Wahlmöglichkeiten zu sein, und meine Unterlippe zittert. Euterpe drückt mich noch einmal an sich.
»Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, Pusus, es gibt noch einen Vogel.« Sie hebt wieder meine Hand empor. »Schau mal, da.«
Wir zeigen auf einen dicken kleinen Vogel, der auf der Gartenmauer sitzt. Er ist weder so imposant wie das Huhn noch so flink wie der Mauersegler. Eigentlich ist er bloß eine kastanienbraune Kugel mit einer kleineren Kugel obendrauf, einem kurzen Schnabel und einer rostroten Mütze.
»Das ist der Sperling«, sagt sie. »Kannst du seinen Namen sagen?«
»Sperling.«
»Gut. Erinnerst du dich noch, wie die Geschichte bis jetzt ging, Pusus?«
»Das Huhn kann laufen, aber nicht fliegen. Der Mauersegler kann fliegen, aber nicht laufen.«
»Sehr gut!« Sie gibt mir einen aufmunternden Stups. »Also was, denkst du, hat der Sperling gewählt?«
Ich überlege. Anders als das stolzierende Huhn oder der herabschießende Mauersegler sitzt der Sperling einfach oben auf der Mauer und dreht seinen Kopf. Er streckt sich leicht auf seinen kurzen Beinen in die Höhe, bläht die Brust und reckt den stumpfen, kleinen Schnabel. Dann sinkt er in sich zusammen und wird wieder zu einem Federknäuel mit einer kleineren Federkugel obendrauf. Ich schaue Euterpe an. Sie betrachtet den Sperling mit ihren glänzenden braunen Augen.
»Erinnere dich«, sagt sie, »Gott hat jedem Vogel die Wahl gelassen, ob er eine Sache besonders gut können wollte oder lieber die Fähigkeit hätte, viele Dinge zu tun, aber nichts davon besonders gut. Nun hatte der Sperling das Glück, dass er seine Wahl nach dem Huhn und dem Mauersegler treffen durfte, und er hat aus ihren Fehlern gelernt. Er hat gelernt, dass es am besten ist, wenn man fliegen und laufen kann.«
Wie zum Beweis streckt sich der Sperling wieder auf seinen Beinen in die Höhe und hüpft erst in die eine, dann in die andere Richtung auf der Mauer entlang. Dann ist er plötzlich in der Luft. Er ist nicht so anmutig wie der Mauersegler, aber mit ein paar flinken Flügelschlägen hat er die Straße überquert und ist auf dem roten Dach gelandet.
»Und was ist die Lehre aus dieser Geschichte?«, fragt Euterpe. »Überleg mal.«
»Der Sperling kann laufen«, sage ich, »und fliegen.«
»Sehr gut!« Wieder drückt sie mich fest. Dieses Gefühl ist das schönste, das ich bis jetzt erlebt habe.
»Vielleicht kann der Sperling nicht so weit laufen wie das Huhn«, sagt Euterpe, »aber er kann weit genug laufen, um sich den Bauch vollzuschlagen. Und vielleicht kann er nicht so schnell fliegen wie der Mauersegler, aber er kann schnell genug fliegen, um dem Fuchs zu entkommen und nicht zum Sklaven der Menschen zu werden.«
Das Huhn stolziert wieder an uns vorbei. Der Mauersegler fliegt über uns hinweg. Vom roten Dach jenseits der Mauer blickt der Sperling auf die beiden Vögel und auf uns herab.
»Vergiss nie den Sperling, mein Kleiner«, flüstert Euterpe mir ins Ohr. »Er ist in nichts herausragend gut, aber in allem gerade gut genug. Das bezeichnen die Philosophen als goldene Mitte.«
»Was ist ein Phil… Phil…?«
»Phii-loh-sooph.«
»Ist das auch ein Vogel?«
Euterpe lacht. »Ein Philosoph ist kein Vogel, mein Kleiner. Ein Philosoph ist ein Mensch, der anderen Menschen hilft zu lernen, indem er ihnen Fragen stellt.«
»Bist du ein Philosoph?«
Euterpe lächelt. »Ja und nein.« Sie küsst mich auf den Scheitel. »Denk immer an die Geschichte der Vögel.« Sie berührt mein Ohr mit den Lippen. »Wenn du wählen darfst«, flüstert sie, »sei wie der Sperling.«
So wurde der Sperling zu meinem heimlichen Namensvetter. Gedrungen, autark und genügsam hockte er auf der Mauer, plusterte sein Gefieder auf, drehte den Kopf hin und her, riss den kurzen Schnabel auf und zwitscherte. In den Tagen, nachdem Euterpe mir die Geschichte erzählt hatte, beobachtete ich ihn manchmal vom Garten aus und war überzeugt, dass er mich ebenfalls betrachtete. Ich drehte das Gesicht hin und her, so wie er, ich blickte ihn erst mit einem Auge an, dann mit dem anderen und tschilpte ihm in seiner Sprache zu, ein Sperling zum anderen. Manchmal sah er mich nur an, manchmal zwitscherte er, doch manchmal antwortete er auch, indem er sich in die Luft erhob, dann schwirrten seine kleinen Flügel, während er höher und höher stieg und flog und flog – immer weiter von mir weg, bis er nur noch ein winziger Umriss war und sich im Blau des Himmels auflöste.
Ich bin auch ein Sperling, dachte ich. Eines Tages werde ich davonfliegen.
Focaria, Euterpe und die Vögel waren nicht die Einzigen, die man im Garten antreffen konnte. Da gab es natürlich Audo, und da waren meine Tanten, die anderen vier Wölfinnen, die über der Taverne wohnten und arbeiteten. Ihre Namen verdankten sie einer überheblichen Idee von Granatus, der unser Dominus und Besitzer der Taverne war. Granatus, Enkel eines freigelassenen Sklaven und Sohn eines Gerbers, besaß überall in der Stadt Grundstücke und ging zahllosen Geschäften nach, um den Gestank der Gerberei zu vertreiben, der noch immer an ihm haftete. Er hatte sich in die Kurie der Stadt eingekauft, und obwohl er selbst nie höher aufsteigen würde, hoffte er, dass einer seiner Söhne oder beide zum Ädilen oder Duovir gewählt oder in den Stab des Provinzgouverneurs eintreten würden oder – wer weiß – eines Tages sogar Senator werden könnten. Sein älterer Bruder war der Bischof von Carthago Nova und damit, zumindest inoffiziell, der mächtigste Mann der Stadt.
Granatus konnte etwas Griechisch, deshalb benannte er seine Wölfinnen nach den Musen und die Taverne trug den Namen Helikon, nach dem ursprünglichen Sitz der Musen. Er engagierte einen Schildermaler, der den Namen der Taverne in großen roten Buchstaben an die Außenmauer schrieb, aber falls er erwartet hatte, dass dieser Hauch griechischer Raffinesse eine elitäre Kundschaft anziehen würde, wurde er enttäuscht. Die Kundschaft bestand immer noch größtenteils aus Seeleuten und Fischern vom nahe gelegenen Hafen, aus Freigelassenen und Sklaven, Gelegenheitsarbeitern von der Straße sowie einigen ortsansässigen Ladenbesitzern und Händlern, die etwas suchten, was sie daheim nicht vorgesetzt bekamen. Die Taverne zog auch Saisonarbeiter an, die zur Getreide- und Olivenernte kamen und ihren gesamten Lohn in einer Nacht ausgaben, ebenso wie Bauern, die nur ein- oder zweimal im Jahr ihre Waren auf dem Markt verkauften und einen Teil ihres Gewinns in der Stadt verjubelten, bevor sie den Rest zu ihren Frauen nach Hause brachten. Lange vor meiner Zeit hatte sich in der Nachbarschaft jedoch statt Helikon, dem Musenberg, ein anderer Name durchgesetzt und man bezeichnete das Haus schon so lange als »den Mösenberg«, dass diese Bezeichnung nicht einmal mehr als witzig empfunden wurde. Natürlich wusste ich das alles damals noch nicht. Es dauerte einige Zeit, bis ich erfuhr, dass der Helikon eigentlich ein Gebirge in Griechenland ist, Wölfinnen auch Tiere sind und Clio, Thalia, Urania, Melpomene und Euterpe Göttinnen waren, lange bevor sie Huren in Carthago Nova wurden.
Gähnend, blinzelnd und verkatert kamen die Wölfinnen jeden Morgen in den Garten, um ihr Frühstück aus Resten vom Vorabend zu essen. Der Vormittag war die Zeit, in der sie ihren engen Zellen entfliehen konnten, um ein wenig frische Luft und Sonne zu tanken und sich über die Freier auszutauschen. Manchmal sangen sie gemeinsam – diese Lieder waren die erste Musik, die ich zu hören bekam –, aber manchmal trennten sie sich auch und jede ging für sich durch den Garten, um eine Weile allein zu sein. Zunächst hatte jede der Frauen einen anderen Namen für mich. Clio, eine Gallierin, nannte mich Maus, wahrscheinlich, weil ich so klein, braun und flink war. Clio selbst war füllig und gespenstisch blass, hatte schlaffes, farbloses Haar, ein schwermütiges Lächeln und wachsame Augen. Hinter ihrer Schüchternheit verbarg sich eine Spur Missgunst, die immer dann zum Vorschein trat, wenn eine der anderen Wölfinnen etwas bekam, und sie es nicht bekam. Von allen Wölfinnen roch sie morgens am stärksten nach Wein. Sie wusste nie recht, was sie mit mir reden sollte, sondern tätschelte mir nur den Kopf und sagte: »Was weißt du schon, Maus?« Dann hüllte sie sich in ihren fleckigen blauen Umhang und ließ sich im dichten Farn hinter dem Brennholzstapel nieder. Dort summte oder sang sie vor sich hin oder holte ihren Schlaf nach und schnarchte leise mit offenem Mund.
Die beiden jüngsten Wölfinnen, Thalia und Urania, waren unzertrennlich wie Schwestern. Sie saßen immer zusammen und putzten einander wie die Katzen – sie zupften sich gegenseitig die Augenbrauen, rasierten einander die Beine, frisierten einander und suchten sich wechselseitig nach Flöhen ab. Thalia war klein, kräftig und hatte einen wohlgerundeten Körper unter ihrem gelben Gewand. Sie lachte schnell, war schnell beleidigt, aber verzieh auch gleich wieder. Sie war Ägypterin und Christin und konnte mehr Sprachen als die anderen Wölfinnen zusammen – Ägyptisch, Griechisch, Aramäisch, Syrisch und Latein –, was sie bei den heimwehkranken Seeleuten und anderen Reisenden, die in Carthago Nova Station machten, besonders begehrt machte. Auch kannte sie Lieder in jeder Sprache, und wenn die Wölfinnen morgens im Garten zusammen sangen, übernahm ihre klare, hohe Stimme die Führung, bis die anderen nach und nach verstummten, die Augen schlossen und einfach nur zuhörten. Sie war so dunkel wie ich und ihr Haar ebenso dick und glänzend wie meines, deshalb nannte sie mich »Kleiner Bruder«. Manchmal scheuchte sie mich durch die Beete und rief: »Ich fang dich, Kleiner Bruder! Ich fang dich und dann fress ich dich!«
Ihre Freundin Urania war die einzige Wölfin, die aus Hispanien stammte, aus einem Dorf ganz in der Nähe. Ihr Vater, ein Schweinezüchter, hatte sie in die Prostitution verkauft, um seine kaiserlichen Steuern bezahlen zu können. Sie erfreute sich bei den bäuerlichen Freiern großer Beliebtheit, denn ihre Muttersprache war die ursprüngliche Volkssprache und ihr Latein klang genauso derb wie das ihrer hispanischen Landsleute. Sie war groß und hager, hatte eine Hakennase, scharfe Wangenknochen und schwarzes, gewelltes Haar, und ihr grünes Gewand hing an ihr herab wie an einer Vogelscheuche, betonte die herausragenden Schulterblätter, ihr Schlüsselbein und die spitzen Hüftknochen. Sie schien die Welt aus großer Höhe zu betrachten und lächelte häufig leicht amüsiert über Dinge, die niemand sonst lustig fand. Sie hatte keinen besonderen Namen für mich, sondern nannte mich einfach Pusus, genau wie Audo und Focaria. Meistens schaute sie nur zu, wenn Thalia mich im Garten auf und ab jagte, aber manchmal fing sie mich auch und dann drehte sie mich zwischen ihren langen Fingern hin und her wie ein Bauer ein neugeborenes Ferkel, als überlegte sie, ob ich wohl überleben würde oder nicht.
»Warum singst du nicht mit Thalia?«, fragte ich sie einmal, worauf Urania mich ernst ansah und erwiderte: »Weil ich quake wie ein Frosch.«
»Was ist ein Frosch?«, fragte ich, doch sie lächelte nur und ließ mich los.
Noch mehr als wir anderen war Urania ständig hungrig. Wenn Thalia und ich im Garten spielten, lungerte sie oft vor dem Kücheneingang herum und starrte mit ihren tiefliegenden Augen ins Halbdunkel. »Du kriegst was, wenn’s Essen gibt!«, brummelte Focaria, während sie eine Zwiebel aufschnitt, als würde sie jemandem die Kehle durchschneiden. Doch dann blickte Urania verstohlen über die Schulter, und wenn Audo nirgendwo zu sehen war, streckte sie ihren langen Arm in die Küche und klopfte mit einer Münze auf den Tisch. Ohne den Blick von ihrer Arbeit abzuwenden, griff Focaria nach dem Geld, ließ es in ihrer Faust verschwinden und reichte dann ein Stück Brot oder eine Handvoll Oliven nach hinten. Urania bückte sich durch die Türöffnung, stopfte sich das Brot oder die Oliven in den Mund, schluckte alles auf einmal hinunter und schlüpfte wieder hinaus.
Melpomene, die fünfte Wölfin, nannte mich Antiochus, weil ich vielleicht, vielleicht auch nicht, aus Syrien kam und etwa sieben der alten syrischen Könige Antiochus geheißen hatten. Hinter ihrem Rücken bezeichneten die anderen Melpomene als »Königin der Wölfe«, zum einen, weil sie erschreckend alt, zum anderen, weil sie eine freigelassene Sklavin war – und vermutlich auch wegen ihres überlegenen Auftretens. Einige Jahre zuvor, als sie dreißig wurde und damit das gesetzliche Mindestalter für die Freilassung erreicht hatte, gestattete Dominus ihr, sich freizukaufen. Eigentlich hatte er sie verkaufen wollen, um damit die Kosten für eine jüngere Melpomene zu decken, doch sie bot ihm mehr Geld, als er wohl auf dem Sklavenmarkt hätte erzielen können. Im Laufe der Jahre hatte sie genug angespart, indem sie jedem Freier eine Kleinigkeit extra bot und ihm dann ein oder zwei Geldstücke mehr abschwatzte, als er Audo bereits gezahlt hatte. Auf diese Weise hatte sie Münze für Münze, Fellatio für Fellatio, Fick für Fick genügend gesammelt, um sich freikaufen zu können. Sie hatte sogar ausreichend Geld zusammengebracht, um die Freilassungssteuer zu bezahlen, die der Kaiser erhob. Am überraschendsten war, dass sie sich mit Dominus darauf einigte, in Helikon zu bleiben und dort weiterhin als Wölfin zu arbeiten. Sie hatte sich ausgerechnet, dass es billiger wäre, ihre alte Zelle zu mieten und für ihre Mahlzeiten zu bezahlen, als sich in einer eigenen Hütte auf der Straße einzurichten. In Helikon hatte sie genügend Stammkunden. Auf sich allein gestellt, hätte sie wieder bei null anfangen müssen.
Für die anderen Wölfinnen bezahlten die Freier im Voraus bei Audo, während Melpomene ihren Lohn in ihrer Zelle im Obergeschoss kassierte. Im Gegensatz zu den anderen Wölfinnen, die Sklavinnen waren, konnte sie die Taverne jederzeit verlassen – gebührend verhüllt in ihrem Überwurf – und Sachen für sich selbst kaufen. Sie stattete ihre Zelle mit billigen Vorhängen und duftenden Kerzen aus und rieb sich mit teuren Ölen und Parfüms ein. Während sich die anderen Wölfinnen einen einzigen, angelaufenen Handspiegel und ein paar alte, zusammengewürfelte Kosmetikutensilien aus Blech und Blei teilten, besaß Melpomene ihren eigenen Spiegel, Kämme und ein Rasiermesser sowie ein silbernes Toilettbesteck mit Pinzetten, Bürsten und einem Ohrlöffel, verpackt in einer Tasche aus weichem Leder. Sie trug als Einzige der Wölfinnen ein Gewand aus weißer Baumwolle und war auch die Einzige, die Schmuck trug – bronzene Ringe und Armbänder, Halsketten aus Glasperlen und Bernstein sowie Ohrringe, die aussahen, als seien sie aus Gold, aber es mit Sicherheit nicht waren. Manchmal erzählte sie den Freiern, sie sei die Tochter eines römischen Senators, und einmal in der Woche kam sie vom Friseur, ihr unnatürlich gelbes Haar hochgesteckt wie das einer Dame. Sie war zierlich und nervös und hatte große Augen, eine spitze Nase und ein spitzes Kinn. Wenn sie angesprochen wurde, reagierte sie oft mit Absicht ein wenig verzögert, wie eine Schauspielerin, die ihren Moment auf der Bühne auskosten möchte. Jetzt, da sie keine Sklavin mehr war, sondern Miete zahlte, schlug Audo sie nicht mehr, und obwohl der Dominus die Regel aufgestellt hatte, dass Audo für Sex zahlen sollte wie jeder andere Freier, war Melpomene tatsächlich die einzige Wölfin, der er widerwillig einige Münzen gab.
Hinter vorgehaltener Hand meinten die anderen Wölfinnen, dass Melpomene mit ihrer geschickten Zurschaustellung und ihrem Enthusiasmus wettmachte, was ihr an Schönheit und Jugend fehlte.
»Sie färbt sie sich«, sagte Clio über ihre Haare. »Jedes Mal, wenn sie zum Friseur geht, haben sie hinterher eine andere Farbe.«
»Das Kleid ist gebraucht«, meinte Urania. »Sie hat es einem Grabräuber abgekauft.«
»Also wirklich«, lästerte Thalia. »Da bin ich ja noch eher Römerin als sie.«
»Lacht nicht«, sagte Euterpe, die niemals ein schlechtes Wort über jemanden verlor, auch nicht hinter dessen Rücken. »Wir würden genauso handeln, wenn wir’s uns leisten könnten. Wenn ein Freier sich Melpomene nimmt, kann er so tun, als würde er’s seiner Domina besorgen.«
Einmal in der Woche versammelten sich alle fünf Wölfinnen im Garten, um ihren wöchentlichen Becher Atocium zu trinken, einen Kräutersud, der eine Schwangerschaft verhindern und die Menstruation auslösen sollte. Focaria braute ihn mit Weinraute und Dill aus dem Garten, manchmal fügte sie im letzten Moment noch ein rohes Ei hinzu, damit er weniger bitter schmeckte. Audo überwachte die Prozedur – und sei es nur, um zu verhindern, dass die Zusammenkunft in eine fröhliche Feier ausartete. Heute versammeln sich die Wölfinnen gleich vor der Küche, recken und strecken sich und genießen die letzten kühlen Minuten vor der Hitze des Tages. Sie unterhalten sich leise, wobei sie Audo immer wieder verstohlene Blicke zuwerfen. Doch der lehnt bloß an der Mauer der Taverne und kaut abwesend an seinen Nägeln. Wie üblich stinkt er nach Wein und ungewaschenen Achselhöhlen.
Ich bin aufgeregt, weil alle Menschen, die meine Welt ausmachen, an einem Ort sind, und ich flitze von einer Person zur nächsten und versuche, Aufmerksamkeit zu bekommen. Einzig Thalia beachtet mich. Sie streckt die Hand aus und lässt mich an ihrem Arm hin und her schaukeln.
»Wer hatte denn letzte Nacht den Stöhner?«
»Einen Stöhner?« Clio reißt die Augen auf. »Wen meinst du damit?«
Thalia wirft einen raschen Blick zu Audo hinüber, der gerade den Nagel seines kleinen Fingers abkaut. Leise beginnt sie zu stöhnen: »Ohhhhhh.« Sie senkt das Kinn. »Ohhhhhhhhhhh«, keucht sie dann etwas dramatischer. Alle Wölfinnen lachen in sich hinein.
»Hat sich’s so angehört?«, flüstert Clio.
»Als ob er gleich sterben würde?«, fragt Euterpe.
»Eher als ob er schon tot wäre«, erwidert Thalia und schwingt mich an ihrem Arm weiter hin und her.
»Der war bei mir.« Urania grinst vor sich hin. »Er war noch nicht ganz tot.« Noch mehr verstohlenes Lachen.
»Er hat sich angehört, als ob er schon tot wäre?«, wiederholt Clio fragend. »Wie hört sich das denn an?«
Urania und Thalia tauschen einen Blick, dann stöhnen sie gemeinsam los: »Ohhhhhhhhhh!« Sie senken die Köpfe und kichern.
Melpomene beobachtet Audo. »Nicht so laut!«, murmelt sie.
»Was hast du mit ihm angestellt?«, flüstert Euterpe.
»Nichts Besonderes.« Urania zuckt die Achseln. »Ich dachte, er würde gleich anfangen zu heulen!«
»Ich hab ihn gar nicht gehört.« Das ist Clio, die immer befürchtete, etwas zu verpassen. »Hast du ihn gehört?«, fragt sie Euterpe, die jedoch den Kopf schüttelt.
Melpomene, ein bisschen abseits stehend, wirft ein: »Er klang wie ein bezahltes Klageweib.«
»Und genauso überzeugend«, murmelt Thalia, und wieder lachen alle, sogar Melpomene.
»Ruhe«, grollt Audo, bewegt sich aber keinen Schritt von der Mauer fort. Es ist schlecht für das Geschäft, wenn die Wölfinnen sich offen über die Freier lustig machen, doch wenn sie im Garten unter sich sind, findet selbst Audo es nicht wert, sich darüber aufzuregen. So brutal er mit jeder einzelnen Wölfin umgeht, wenn er mit ihr allein ist, hat er doch für gewöhnlich Skrupel, sie zu schlagen, wenn sie alle beieinander sind. Währenddessen zerre ich an Thalias Arm, aber sie ignoriert mich.
»War er jung?«, fragt Euterpe.
»Nein«, entgegnet Urania, »er war alt.«
»Bloß älter als wir?«, fragt Thalia. »Oder richtig alt?«
»Alt genug, dass er mein beschissener Vater hätte sein können«, sagt Urania. »Ich musste ihm helfen, damit er überhaupt loslegen konnte.« Sie steckt ihren kleinen Finger in den Mund und schiebt ihn rein und raus.
»Vielleicht hatte er Angst, du wolltest ihm was abbeißen?«, fragt Thalia.
Ich zerre fester an ihrem Arm und rufe: »Thalia! Thalia!«
»Das hätte ich mal besser getan«, meint Urania. »Ich dachte schon, er würde gar nicht kommen!«
Ich reiße an Thalias Arm – »Thalia!« –, aber sie fährt mich an, »Hör jetzt auf damit!«, und zieht ihre Hand weg. Ich lande auf dem Hintern im Dreck, doch noch ehe ich losheulen kann, hat Euterpe mich schon hochgehoben und auf ihre Hüfte gesetzt. Meine Beine umschlingen ihre Taille und sie schaukelt mich hin und her. »Ich hab ihn nicht gehört«, sagt sie.
»Ich auch nicht«, sagt Clio.
»Wundert mich nicht«, meint Melpomene. »Du machst doch selbst so viel Lärm mit deinem Keuchen und Grunzen!«
Thalia und Urania tauschen einen vielsagenden Blick aus. Euterpe sagt vorwurfsvoll: »Also wirklich, Mel …«
Clio läuft knallrot an. »So kannst du mit mir nicht sprechen!«
Audo blickt von seinen Fingernägeln auf, sagt aber kein Wort.
»Du schnaufst wie ein altes Maultier, das einen Sack Weizen den Berg raufschleppen muss«, verkündet Melpomene. »Das will ein Mann aber nicht hören, wenn er im Sattel sitzt!«
Clio schnaubt, und Euterpe sagt: »Das ist unfair, Mel.« Ich ziehe an Euterpes gelocktem Haar, und sie schnippt meine Hand sanft weg. »Du kannst dir die Rosinen rauspicken!«
Audo grunzt und drückt sich von der Mauer ab. Er bewegt die rechte Hand. Auf seinem Handrücken, unter der schwarzen Behaarung, sieht man die verblasste blaue Tätowierung eines Adlers mit ausgebreiteten Flügeln. Eines Tages wird Focaria mir erklären, dass dies ein Zeichen dafür ist, dass Audo früher Soldat war. »Nimm dich bloß vor dem Adler in Acht«, warnen die Wölfinnen einander manchmal, oder: »Der Adler ist auf der Jagd«, wenn Audo schlechter gelaunt ist als sonst. Jetzt ballt er die Faust und spannt die Flügel des Adlers an, woraufhin die Wölfinnen schlagartig verstummen und auf den Boden starren. Ich verstehe zwar nicht, was das Schweigen zu bedeuten hat, nutze aber die Gelegenheit.
»Ohhhhh«, rufe ich mit meiner dünnen, piepsigen Stimme.
Thalia und Urania kichern hinter vorgehaltener Hand los. Clio schnappt nach Luft. Melpomene reißt die Augen auf. Euterpe wirft mir einen Blick zu.
»Ohhhhhhhhhh.« Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich weiß nur, dass es die Wölfinnen zum Lachen bringt.
Ich hole tief Luft, um erneut zu stöhnen, aber jetzt starren mich alle an, selbst Audo, und ich versuche mich in Euterpes Armen zu verbergen. Alle Wölfinnen brechen in Gelächter aus.
»Maus!«
»Mein Kleiner!«
»Hör dir den Antiochus an!«
»Kleine Krüge haben große Ohren!«
»Er ist jedenfalls überzeugender!«, sagt Thalia, und alle lachen wieder. Sogar Audo unterdrückt ein Grinsen, und ich vergrabe mein Gesicht an Euterpes würzig duftendem Hals.
»Was ist denn hier so lustig?« Plötzlich steht Focaria im Eingang zur Küche, in der einen Hand einen kleinen schwarzen Kessel, in der anderen einen Blechbecher. Sie lacht nicht. Die Wölfinnen tauschen Blicke. Wie lange steht sie schon da? »Es ist so weit!« Sie hebt den Kessel und wackelt mit dem Becher.
Immer noch grinsend versammeln sich die Wölfinnen an der Türöffnung.
»Eine nach der anderen«, sagt Focaria.
Melpomene drängt sich an erste Stelle. Clio ist darüber verärgert, aber niemand beschwert sich. Schließlich zahlt Melpomene für ihre Dosis. Sie streckt Focaria die Hand entgegen, während diese den Becher in den Kessel taucht. Melpomene trinkt den Becher in einem Zug aus, schürzt die Lippen wegen des Geschmacks, dann gibt sie Focaria den Becher zurück, schiebt sich an den anderen Wölfinnen vorbei durch den Torbogen und ist verschwunden. Als Nächste ist Clio an der Reihe; sie macht ein schmatzendes Geräusch mit den Lippen und fährt sich mit der Zunge darüber, nachdem sie getrunken hat. Urania holt tief Luft, als wolle sie in tiefes Wasser eintauchen, und schüttet sich dann den Trank auf einmal in die Kehle. Thalia wiederum trinkt zaghaft einen kleinen Schluck nach dem anderen, als hoffe sie, dass der nächste besser schmeckt. Schließlich lässt Euterpe, die mich immer noch auf dem Arm hält, das Getränk in ihrem Mund kreisen, ehe sie es hinunterschluckt.
Als sie Focaria den Becher zurückgibt, strecke ich meine Hand aus und sage: »Ich.«
»Nein.« Euterpe schwingt mich rasch vom Kücheneingang weg.
»Ich will auch.« Ich winde mich in ihren Armen und versuche immer noch, den Becher zu fassen.
»Lass ihn doch«, meint Thalia. »Was kann es schon schaden?«
»Soll er doch sehen, wie’s schmeckt«, murmelt Clio.
»Ein bisschen ist noch übrig«, sagt Focaria.
»Er ist bloß ein kleiner Junge«, sagt Euterpe. »Er versteht das nicht.«
Focaria wackelt mit dem leeren Becher hin und her. »Willst du auch was?« Ihre Augen leuchten boshaft. »Ich kann dir garantieren, dass du nicht schwanger wirst!«
»Ich will!« Ich fange an zu heulen. »Will auch!«
Unter all seinem Fett verfügt Audo immer noch über die schnellen Reflexe eines Soldaten, und er stürzt sich so plötzlich von der Mauer nach vorn, dass die Wölfinnen wie ein Schwarm Vögel auseinanderstieben. Er packt Clio unsanft am Arm und wirbelt sie herum, sodass sie durch den Torbogen stolpert. Er schwingt seinen Adler nach Thalia, die den Kopf einzieht und Clio durch den Torbogen folgt. Urania tänzelt hinter ihm vorbei und folgt den anderen beiden. Nun geht Audo auf Euterpe los, die sich rasch so wegdreht, dass seine Faust mich nicht treffen kann. Er verpasst ihr einen Tritt in den Hintern, sodass sie auf Focaria zutaumelt; die wiederum zieht sich eilig in die Küche zurück und verschüttet dabei das Atocium aus dem Kessel in den Schmutz.
»Verdammt noch mal!«, brüllt Audo, nur wenige Zentimeter von Euterpes Ohr entfernt, und sein stinkender Atem umweht uns. Euterpe zieht die Schultern ein, als er ihr einen Klaps auf den Hinterkopf gibt, drückt mich an ihre Brust und duckt sich unter dem Türsturz hindurch in die Küche. Im dämmrigen Raum hasten die beiden Frauen jede in einer anderen Richtung um den Tisch, um ihn zwischen sich und Audo zu bringen. Hinter dem Tisch drängen sie sich aneinander, während Audos massige Gestalt die Türöffnung blockiert, sodass der Raum sich verdunkelt. Focaria hat den Blechbecher fallen lassen, umklammert aber noch den Kessel mit beiden Händen. Euterpe hält mich fest an sich gedrückt und ich schluchze an ihrem Hals.
»Seht bloß zu, dass er Ruhe gibt!« Audo steht schwer atmend da. »Das ist eure verdammte Aufgabe!«
Dann ist er genauso plötzlich wieder verschwunden und Focaria und Euterpe blinzeln ins hereinfallende Licht.
Focaria stößt die Luft aus. Sie stellt den Kessel auf den Tisch. Euterpe wippt mich leicht auf und ab. Ihr Herz pocht gleich neben meinem.
»Das war meine Schuld«, sagt Focaria.
Euterpe schaukelt mich. »Er ist noch ein Kind.«
»Ich weiß«, sagt Focaria. »Es tut mir leid.«
»Er ist nur ein Kind.«
Focaria greift nach dem Kessel. »Er kann was davon haben, wenn er unbedingt will.«
Behutsam löst Euterpe meine Glieder von ihrem Körper und setzt mich auf dem Tisch ab.
»Du wirst langsam zu schwer für mich«, sagt sie.
Inzwischen weine ich nicht mehr, sondern habe Schluckauf bekommen. Sie streichelt mir über das Haar und küsst mich auf Wange, Stirn und Nase. Focaria geht weg und kehrt mit dem Becher zurück.
»Nein«, sagt Euterpe. »Er wird den Geschmack nicht mögen.«
»Es ist bloß Wasser.« Focaria reicht ihr den Becher und Euterpe hält ihn an meine Lippen, während sie meinen Kopf mit der anderen Hand stützt. »Nur einen Schluck, mein Kleiner.«
Der Becher schmeckt immer noch ein wenig nach dem bitteren Atocium, aber ich schlucke das Wasser trotzdem hinunter.
»Er wird nicht ewig Kind bleiben«, sagt Focaria. »Bald wird er oben selbst mitstöhnen.«
Euterpe zuckt zusammen, als hätte ihr jemand einen kleinen Stich versetzt. Obwohl ich ihr doch angeblich schon zu schwer bin, nimmt sie mich wieder auf den Arm und wiegt mich hin und her.
»Ich weiß.« Ich kann ihren warmen Atem an meinem Ohr spüren.
»Du bist sehr gut zu ihm«, sagt Focaria.
»Danke«, entgegnet Euterpe.
»Das soll kein Kompliment sein«, meint Focaria. »Nur eine Beobachtung.«
Euterpe schaut sie an.
»Vielleicht tust du ihm damit auf lange Sicht keinen Gefallen«, sagt Focaria.
»Das weiß ich auch«, erwidert Euterpe.
»Ich könnte dir mit ihm helfen.«
Ein scharfer Blick von Euterpe. »Ich dachte, ich würde dir helfen.«
Ich habe mich weitgehend beruhigt und blicke über Euterpes Schulter hinweg Focaria an. Sie streicht mir eine Strähne meines strubbeligen Haars aus dem Gesicht.
»Ich könnte ihm beibringen, wie man arbeitet.« Focaria lässt die Hand fallen und richtet ihre Augen auf Euterpe.
»Ja«, sagt Euterpe. »Du könntest sein Vater sein.«
Focaria rollt mit den Augen, aber Euterpe lächelt. »Es sollte bloß ein Scherz sein«, sagt sie.
Die beiden Frauen sehen sich eine ganze Weile still an.
»Wir könnten beide seine Mütter sein.« Focaria streckt wieder die Hand aus, doch diesmal streicht sie mit den Fingerspitzen über Euterpes Haar und Wange. Euterpe rückt nicht näher, entzieht sich aber auch nicht der Berührung. Die beiden Frauen scheinen einander einzuatmen, und mit jedem Atemzug hebt und senkt sich das eiserne Halsband um Focarias Hals. Schließlich zieht Focaria ihre Hand zurück.
Euterpe gibt mir einen Kuss. »Würde dir das gefallen, mein Kleiner? Würdest du gerne zwei Mütter haben?«
Ich blicke Focaria an. Sie formt mit den Lippen ein unhörbares: »Sag ja!«
Ich vergrabe das Gesicht in Euterpes Haar.
»Ja«, sage ich dann.
Und so wurde Euterpe meine Mutter am Vormittag und Focaria wurde meine Mutter für den Rest des Tages. Euterpe passte auf mich auf, während Focaria den Garten verließ, um Wasser vom Brunnen zu holen oder Einkäufe zu erledigen, von denen sie mit ihrem Weidenkorb voller Gemüse, Brot oder Fisch zurückkehrte. Wenn sie glaubte, dass Audo sie nicht erwischen würde, setzte sich Focaria manchmal für eine Weile zu uns, bis Euterpe ins Haus musste oder in die Thermen ging. Bei diesen Gelegenheiten brachte sie Euterpe und mir ein Stück Obst mit, das wir uns teilten, während wir an den Wassertank gelehnt dasaßen und zusahen, wie sich der Schatten der Mauer hinter uns zurückzog und immer weiter auf unsere Zehen zubewegte. Die beiden Frauen saßen Seite an Seite, ihre Schultern berührten sich, sie flüsterten miteinander und lachten sogar. Manchmal verschränkten sich ihre Finger ineinander. Ich spielte in einiger Entfernung im Dreck und tat so, als würde ich nicht hinsehen.
Beinahe täglich kamen die anderen Wölfinnen am späten Vormittag in den Garten, um in die Thermen zu gehen, und Euterpe stand auf und klopfte sich den Staub ab. Sie küsste mich auf den Scheitel und flüsterte: »Zeit für die Parade der Wölfinnen«, dann gesellte sie sich zu den Frauen, die tuschelnd an der groben Holztür warteten, die zur Straße führte. Wenn Audo aus der Taverne trat, verstummten sie und stellten sich der Reihe nach auf: Melpomene an der Spitze, dann, in keiner festgelegten Reihenfolge, Clio, Thalia und Urania, und Euterpe meist als Letzte. Über ihren farbenfrohen Gewändern trugen sie helle Leinenumhänge, die ihren Körper vom Hals bis zu den Füßen bedeckten. Die Umhänge waren mit Kapuzen versehen, welche Euterpe, Thalia, Urania und Clio sich über die Köpfe zogen, wenn sie den Garten verließen, wohingegen Melpomene mit unbedecktem Kopf nach draußen ging. Wortlos öffnete Audo die Tür, scheuchte die Frauen auf die Straße und bildete dann das Schlusslicht. Wenn er die Tür hinter sich zugezogen hatte, huschte ich zur Mauer, wo ich das Klappern ihrer Sandalen hören konnte, während sie sich über das Pflaster bewegten. Ich lauschte, bis ich das Geräusch nicht mehr ausmachen konnte, wie ein Hund, der nicht glaubt, dass sein Frauchen jemals zurückkommt – bis es endlich wieder da ist.
»Warum kann ich nicht mit?«, fragte ich immer, worauf Focaria erwiderte: »Du bist zu jung« oder: »Wenn du älter bist« oder auch: »Du bist nicht so schmutzig.« Stattdessen wusch sie mich in der Küche mit einem Eimer Wasser, zog mir die Tunika über den Kopf und schrubbte mich von oben bis unten mit einem kratzigen Schwamm ab.
»Warum gehst du nicht mit?«, fragte ich.
»Ich gehe, wenn Audo mich entbehren kann. Aber für gewöhnlich kann Audo mich nicht entbehren.«
»Warum nicht?«
»Weil ich hier alles erledige, was Audo nicht macht – und er macht nicht besonders viel.«