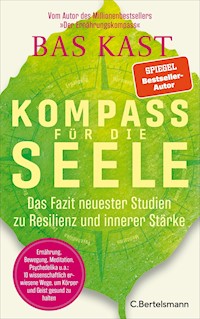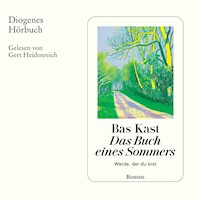9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
»Ein unterhaltsamer Entwurf zu der Frage, warum wir es uns oft so unnötig schwer machen« Gehirn und Geist Wir haben alle Chancen der Welt, wir können leben mit wem wir wollen, wo wir wollen und wie wir wollen, wir können unseren Neigungen nachgehen und an der Erfüllung unserer Wünsche arbeiten – aber warum tun sich viele von uns so schwer mit der Liebe und dem Leben? Ist es "nur" das Luxus-Problem einer bestimmten Generation, die mit sich und ihren Lebensentwürfen hadert, oder steckt mehr dahinter? Der Bestsellerautor Bas Kast fügt zusammen, was unterschiedlichste wissenschaftliche Disziplinen – wie Psychologie, Hirnforschung, Politik- und Wirtschaftswissenschaften – zur Qual der Wahl und unserer rasenden Wohlstandsgesellschaft herausgefunden haben. Denn erstmals lassen sich die Fragen nach Glück und Zufriedenheit empirisch beantworten. Ein Buch voller überraschender Analysen und Einsichten über uns und den Zustand der Welt, in der wir leben. »Bas Kasts Buch liest man mit Gewinn.« Hamburger Abendblatt »Gegen den zunehmenden Schwindel im Kopf.« Philosophie Magazin »Kurzweilig und unter Einflechtung vieler empirischer Studienergebnisse.« Deutschlandradio Kultur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Ähnliche
Bas Kast
Ich weiß nicht, was ich wollen soll
Warum wir uns so schwer entscheiden können und und wo das Glück zu finden ist
Fischer e-books
Für Sina
Vorwort
Warum tanzen wir nicht auf der Straße?
Stellen wir uns vor, ein Außerirdischer wäre soeben auf der Erde gelandet und würde sich bei uns danach erkundigen, wie wir so leben, sagen wir, in einem Land wie Deutschland. Der Außerirdische würde sich für ganz simple Dinge des Alltags interessieren, etwa die Frage, ob es bei uns genug zu essen gäbe oder ob wir hungern müssten, ob wir reich wären, ob wir so etwas wie Sklaverei und Unterdrückung kennen würden etc.
»Na ja«, würden wir vielleicht antworten. »Was heißt schon reich … Die meisten schwimmen nicht im Geld wie Dagobert Duck. Aber wenn man es mit anderen Regionen der Welt vergleicht, nagen wir nicht am Hungertuch, und fast jeder hat bei uns ein einigermaßen stabiles Dach überm Kopf.«
Danach gefragt, ob wir frei wären, unser Leben so zu leben, wie es uns vorschwebt, oder ob man uns alles vorschreiben würde, könnten wir sagen: »Gut, wer ist schon wirklich frei? Immerhin haben wir das Glück, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben – was man beileibe nicht von jedem Land auf dieser Erde behaupten kann und was auch bei uns, nebenbei gesagt, schon mal anders war.«
Womöglich würde der eine oder andere von uns im Verlauf des Gesprächs feststellen, dass wir in Deutschland sowohl im globalen als auch im historischen Vergleich ziemlich gut dastehen. Insgesamt gehört Deutschland bekanntlich nicht nur zu den demokratischsten, sondern auch zu den wohlhabendsten – und ich würde sogar hinzufügen: lebenswertesten – Ländern der Welt.
»Wow!«, würde unser Außerirdischer da vielleicht begeistert ausrufen. »Ihr müsst bestimmt ganz schön glücklich und zufrieden sein, oder? Wahrscheinlich tanzt ihr den lieben langen Tag fröhlich auf der Straße und feiert euer Glück!«
An der Stelle würden die meisten von uns wohl innehalten. Auf der Straße tanzen? Feiern? Wir?
Wie bitte?
Natürlich ist unser Außerirdischer naiv. Nur weil es uns relativ gutgeht, heißt das nicht, dass wir keine Probleme hätten und uns immerwährender Feierlaune erfreuen würden. Dennoch wäre unser intergalaktischer Freund vielleicht nicht zu Unrecht überrascht, wenn wir ihm, mit Blick auf handfeste statistische Befunde, offenbaren müssten: »Nein, mein Lieber, von fröhlichem Tanzen auf der Straße kann bei uns nicht wirklich die Rede sein. Im Gegenteil, es ist zwar so, dass unsere persönliche Freiheit und unser Wohlstand in den letzten Jahrzehnten nahezu stetig gestiegen sind, unsere Zufriedenheit jedoch ist im gleichen Zeitraum gesunken. Dafür sind nicht nur bei uns in Deutschland, sondern überhaupt in den reichen Ländern der westlichen Welt Angsterkrankungen, Depressionen, Stress und Burn-out fleißig auf dem Vormarsch. Was auch immer mit uns Privilegierten los ist, eins ist sicher: So richtig zu genießen scheinen wir die Privilegien, die wir haben, nicht.«
»Was? Aber warum nicht?«, könnte unser Außerirdischer verblüfft fragen, und damit hätte er die zentrale Frage dieses Buchs gestellt: Was an uns oder unserer Gesellschaft ist es, das uns, unserer objektiv recht guten Lage zum Trotz, aufs Gemüt schlägt und zu schaffen macht? In zahlreichen Industrienationen dieser Welt hat das Glück in den letzten Jahrzehnten kaum oder nicht zugenommen, und in manchen Ländern, darunter Deutschland, hat es sogar nachgelassen. Wie ist das möglich? Was ist los mit uns? Was fehlt uns denn im Überfluss?
Auf der Suche nach Antworten ist dieses Buch entstanden. Die Antworten und eventuelle Einsichten, die es anbietet, stammen dabei nicht aus meiner geheimen Schatzkiste mit dem eingravierten Schriftzug Die gesammelten Weisheiten aus dem Leben des B. K. Nein, ich habe eine weitaus spannendere und verlässlichere Quelle der Weisheit zu Rate gezogen: die Wissenschaft. Mit Hilfe empirischer Studien habe ich versucht, mir ein genaueres Bild davon zu machen, wie wir ticken, was uns antreibt, was uns glücklich stimmt und, umgekehrt, zur Verzweiflung bringt. Warum neigen wir inmitten steigenden Reichtums zu Unzufriedenheit und wachsender Rastlosigkeit? Wieso – wenn wir wirklich so frei sind – leben wir nicht das Leben, das wir eigentlich leben wollen? Warum fällt es uns so schwer, das Glück zu finden? Suchen wir es möglicherweise an den falschen Stellen? Um diesen und ähnlichen Fragen auf den Grund gehen zu können, habe ich eine Vielzahl statistischer Daten ausgewertet und Dutzende von Studien und Analysen aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen herangezogen, von der Psychologie über die Hirnforschung bis hin zu den Wirtschaftswissenschaften und der Soziologie.
Im Laufe der Recherche wurde dabei eine Sache immer klarer: Selbst so großartige Errungenschaften wie Freiheit und Wohlstand können ihre Schattenscheiten haben, Schattenseiten, die uns unzufrieden stimmen und sogar krank machen können.
Im ersten Moment mag das unglaubwürdig oder auch undankbar klingen, als wüsste ich diese Errungenschaften nicht zu schätzen. Das ist, wie ich Ihnen versichern kann, nicht der Fall. Dazu ein einfacher Vergleich: Es ist zweifellos großartig, dass bei uns so gut wie keiner mehr hungern muss. Aber das heißt doch nicht, dass deshalb umgekehrt Übergewicht kein ernstes Problem darstellen würde. Aus der Tatsache, dass ein grundsätzlich begrüßenswerter, ja geradezu privilegierter Zustand – so gut wie jeder kann jederzeit seinen Hunger stillen – seinerseits gewisse Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringt, folgt nicht, dass diese neuen Risiken und Nebenwirkungen nicht real oder unbedeutend wären. Die neuen Probleme können, wie das Beispiel Übergewicht zeigt, durchaus gravierend sein. Und was für den Körper gilt, das scheint mir teils auch auf unsere Psyche zuzutreffen.
Jede Umwelt stellt die Lebewesen, die sich in dieser Umwelt behaupten müssen, vor ihre ganz eigenen Herausforderungen. Versetzen wir uns einen Augenblick in unsere haarigen Vorfahren, wie sie vor Jahrmillionen in Jäger-Sammler-Grüppchen durch die afrikanische Savanne zogen.
Ganz hübsch, oder? Vor allem, wenn man in seinem Rucksack Proviant dabeihat und sich am Abend wieder in die klimatisierte Lodge mit gutgefüllter Minibar zurückziehen kann. Ohne all das wird die Savanne bald zu einem ziemlich unwirtlichen Ort. Gut möglich, dass unsere Ahnen immer wieder kurz vorm Hungertod standen. Um zu überleben, galt es, den ganzen Einfallsreichtum in die Nahrungsbeschaffung zu stecken, was sich wohl kaum im Alleingang, sondern nur in kleinen Gruppen bewerkstelligen ließ.
Wir modernen Stadtneurotiker sind in einer völlig anderen Lage. Auch wenn unser Gehirn maßgeblich vom Survival-Training in der afrikanischen Savanne geprägt worden ist, hat sich die Umwelt, in der wir uns bewegen, drastisch geändert. Mitunter ist sie der kargen Steppe diametral entgegengestellt.
Chronischer Mangel ist, einerseits, in vielen Lebensbereichen durch ein chronisches Zuviel ersetzt worden: durch zu viele Optionen, zwischen denen wir wählen können oder müssen, zu viele unterschiedliche Tätigkeiten, denen wir nachgehen sollen oder manchmal auch wollen, zu viele Informationen, die auf uns einprasseln, zu viele (uns unbekannte) Menschen auf einem Fleck etc.
Auf der anderen Seite macht es unsere Konsumgesellschaft möglich, dass jeder auf eigene Faust überleben kann. Bei uns kämpft jeder erst mal für sich. Die Folge: Dem materiellen Überfluss steht nicht selten ein zwischenmenschlicher Mangel gegenüber, ein Zuwenig an gegenseitiger Aufmerksamkeit, an Zeit füreinander, an Nähe und Geborgenheit.
Es soll in diesem Buch nicht darum gehen, unsere mühsam erkämpften Freiheiten und unseren harterarbeiteten Wohlstand aufzugeben (so wie jemand, der über die gesundheitlichen Gefahren von Übergewicht berichtet, ja für gewöhnlich nicht den flächendeckenden Abriss der Supermärkte im Sinn hat und sich eine Hungersnot herbeisehnt). Vielmehr muss jeder von uns Wege und Strategien auskundschaften, um mit der heutigen, modernen Gesellschaft fertig zu werden und sein Glück darin zu finden. Tatsächlich erscheint mir die Gesellschaft, in der wir leben und deren Vorzüge wir unserem außerirdischen Freund zu Recht geschildert haben, in mancherlei Hinsicht als nahezu ideal. Sie bietet so viele Chancen für ein erfolgreiches, glückliches Leben. Dieses Buch will dabei helfen, die Fallstricke und Abgründe, die sich auch in unserer Gesellschaft verstecken und die eng mit ihren Vorzügen verknüpft sind, zu erkennen – damit sich am Ende jeder, hoffentlich, etwas besser darin zurechtfindet.
Erster TeilDas Freiheitsparadox
1.Die Qual der allzu großen Wahl
Ein Grillabend mit Tränen
Nie werde ich die Wochen des Sommers 2009 vergessen, als Freunde von mir mit einem leicht heruntergekommenen Bauernhof etwas außerhalb Berlins regelmäßig freitags einen Grillabend veranstalteten, zu dem sich stets dieselben sechs, sieben Leute zusammenfanden. Man hätte an einem Freitagabend in Berlin hundert andere Sachen machen können, trotzdem entschied sich jeder von uns immer wieder aufs Neue zu diesem eher unspektakulären Abend »auf dem Lande«, wobei vielleicht gerade darin der Reiz lag: der Stadt mit ihren Verlockungen und Zumutungen für ein paar Stunden einfach den Rücken zu kehren.
Abgesehen von meiner Freundin und mir bestand die Grillrunde aus: den Gastgebern, Julia und Christian, einem Ehepaar von knapp über 40, sie Kinderpsychologin, er Journalist. Dann Tanja, Anfang 30, Single, sie war die Einzige, die gelegentlich fehlte, sei es, weil sie auf einem Meeting irgendwo auf der Welt sein musste, sei es, weil sie irgendein Date hatte. Dafür kamen Sophie und Nico immer, beide Mitte 30, beide mit wechselnden Jobs und noch weitgehend verwirrt darüber, was sie mit ihrem Leben denn nun eigentlich genau anstellen sollten.
Eines Abends tauchte Sophie alleine auf. Während Christian und ich uns am Grill teils nützlich, teils wichtig machten, verschwanden die Frauen ins Haus und kamen nicht wieder. Irgendwann, als die ersten Zucchinischeiben auf dem Grill langsam beunruhigend dunkel wurden, ging Christian los, um nachzusehen.
Minuten später kamen sie alle in den Garten, und ich erfuhr, was los war: Sophie und Nico hatten sich getrennt. Der Grund erwies sich als erschreckend einfach: Sie wollte Kinder, er nicht, noch nicht. Er war einfach noch nicht so weit. Jetzt hatte sie die Schnauze voll und nach einem langem Hin und Her, von dem wir nichts mitbekommen hatten, einen Schlussstrich gezogen.
»Ist ja schon typisch«, sagte Tanja nach einer Weile, wir saßen mittlerweile am langen Holztisch. Aßen, redeten. Versuchten, Sophie zu trösten. »Alle toben sich aus, keiner bindet sich wirklich, und am Ende bleiben wir Frauen dabei auf der Strecke.« Ich schätze, dass Tanja mit ihrem Job bei einem großen Pharmaunternehmen schon damals mehr als 70 000 oder 80 000 Euro verdiente, jedenfalls mehr als alle anderen in der Runde. Sie hatte ein Dauerabo bei Elitepartner.de und bei ihrer immer verzweifelteren Suche nach einem (einem? dem) Mann ihre astronomischen Ansprüche sukzessive und zähneknirschend heruntergeschraubt, bis dahin ohne Erfolg.
Ich fragte vorsichtig, was sie denn damit meine und ob nicht auch Frauen unter Umständen Spaß daran hätten, sich auszutoben.
Austoben sei ja schön und gut, entgegnete Tanja. »Aber je länger alles unverbindlich bleibt, desto mehr steigt für die Frau das Risiko, dass sie nur ihre Zeit verschwendet mit einem Typen, der sich davonmacht, sobald es ernst wird. Irgendwann steht sie alleine da, oder sie muss sich auf einen Mann einlassen, den sie vielleicht gar nicht so richtig will und den sie dann doch nimmt, weil ihr keine Zeit mehr bleibt.«
Christian, ein langer, schlaksiger Typ, sah Tanja irritiert an. »Und du denkst, Männer hätten mehr Zeit?«, fragte er.
»Ja, sicher«, entgegnete Tanja. »Charlie Chaplin ist noch mit 80 Vater geworden.«[1]
Christian schüttelte den Kopf. »Tja, so einfach ist das also«, sagte er in einem ironisch-sarkastischen Tonfall, woraufhin es unangenehm still wurde. Keiner sprach ein Wort. Auch Tanja schwieg. Vielleicht wurde ihr erst jetzt bewusst, dass ihre Sätze, so recht sie damit aus ihrer Sicht vielleicht hatte, für Christian und Julia einem Schlag ins Gesicht gleichkamen.
Christian und Julia hatten sich nach ihrem Studium mehr oder weniger ausschließlich um ihre Karrieren gekümmert. Erst hatten Kinder nicht in ihren Lebensplan gepasst, dann hatte sich der Plan geändert, zu dem Zeitpunkt jedoch war es bereits, wie ein Besuch beim Arzt bestätigte, zu spät. Jetzt besuchten sie einen Adoptionskurs, den das Jugendamt fordert, um für die Adoption eines Kindes in Frage zu kommen.
Die Diskussion zog sich noch bis weit nach Mitternacht hin, unter einem blassen Sternenhimmel. Als meine Freundin und ich schließlich nach Hause fuhren und über den Abend und unsere Probleme redeten (um nur eins zu nennen: Meine Freundin musste gerade arbeitstechnisch für längere Zeit nach Holland, hatte aber wenig Lust, mich, ihre Freunde und Familie und Berlin zu verlassen), platzte es irgendwann aus ihr heraus: »Warum fällt es uns so schwer, alles richtig zu machen? Eigentlich haben wir doch alle Möglichkeiten, trotzdem sind wir ständig unzufrieden!«
Ich weiß nicht mehr, was ich damals geantwortet habe, ob ich überhaupt etwas halbwegs Intelligentes gesagt habe, wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, ich stimmte, furchtlos und unerschrocken, wie ich bin, meiner Freundin zu. Sie hatte ja auch recht: Eigentlich haben wir wirklich alle Möglichkeiten, eigentlich sollten wir wirklich zufrieden sein. Warum also sind wir es nicht? (Oder sind wir es doch, und wir sind einfach zu verwöhnt, es zu merken?)
Frauen: Mehr Freiheit, mehr Glück?
Ein paar Tage später. Ich hatte immer mal wieder an den Grillabend und die anschließende Heimfahrt gedacht. Ich hatte mich mit Nico getroffen, mir seine Version der Geschichte angehört und darüber gegrübelt, was die Probleme, die an dem Abend zur Sprache gekommen waren, zu bedeuten hatten, ob sie – über die Probleme als solche hinaus – überhaupt etwas zu bedeuten hatten. Hatte es die Liebe in der heutigen Zeit besonders schwer? Hatten wir es besonders schwer, und wenn ja, warum? Worin bestand, auf einen Nenner gebracht, unser Problem? Etwa »nur« darin, dass es für uns schwierig geworden war, Arbeit und Liebe oder Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen?
Ich überlegte, ob das Ganze nicht eine kleine Recherche wert wäre, und fing an, mich in die Sache zu vertiefen, wenn zunächst auch nur halbherzig. Und selbst als ich schon einiges gelesen hatte, wurde ich das Gefühl nicht los, dass ich meine Zeit mit so etwas Trostlosem wie einem Luxus-Lamento verschwendete.
Einem Teil von mir kam es einfach naiv, fast ein bisschen peinlich vor, dass ausgerechnet meine Generation sich mit der Liebe und dem Leben schwertun sollte und zu Frust und Unzufriedenheit neigt. Na gut, wir stöhnen und jammern, etwas, das wir uns als Spezies wohl nie abgewöhnen werden, aber, herrje, stöhnen und jammern wir nicht auf einem verdammt hohen Niveau? Sind wir nicht, alles in allem, in einer weitaus besseren, privilegierteren Lage als die meisten, um nicht zu sagen: alle Generationen vor uns? So manche Angelegenheit ist sicher etwas komplizierter geworden als früher, aber war es früher wirklich besser? Als ob es jemals eine Zeit gegeben hätte, in der die Leute nicht unzufrieden gewesen wären! (Vielleicht, ja wahrscheinlich beschränkte sich die Sache gar nicht auf einen Jahrgang, sondern war mehr ein allgemeines Phänomen hochentwickelter, moderner Gesellschaften.)
Ich stand schon kurz davor, die Angelegenheit wieder fallenzulassen, als in diesem August 2009 zufällig eine Studie erschien, die meine Vorstellungen abermals auf den Kopf stellte. In der Studie untersuchen zwei US-Ökonomen minutiös, wie sich die Lebenszufriedenheit von Frauen und Männern der »westlichen« Welt in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat.
Spätestens seit den 1970er Jahren, entdeckte ich, führen Meinungsforscher nicht nur in den USA, sondern auch in zahlreichen europäischen und anderen Industrieländern Befragungen durch, die Teile der Bevölkerung unter anderem danach abklopfen, wie glücklich sie sind. Mit anderen Worten: Die Frage, ob wir heute zufriedener oder unzufriedener mit unserem Leben sind als noch vor wenigen Jahrzehnten – tiefer in die Vergangenheit gehen die meisten Daten leider nicht –, lässt sich inzwischen empirisch beantworten. Man ist nicht mehr auf Spekulationen oder indirekte Befunde angewiesen, nein, man kann sich einfach ansehen, wie sich die Menschen selbst über ihr Leben geäußert haben.
Als die Wissenschaftler das taten und die Glücksangaben von Männern und Frauen aus den 1970er Jahren bis heute auswerteten, offenbarte sich ihnen ein Ergebnis, das sie zunächst kaum glauben konnten. Verblüfft stellten sie fest, dass sich das Glück je nach Geschlecht unterschiedlich entwickelt hat: Während es bei den Männern über die Jahrzehnte weitgehend konstant geblieben bzw. sogar leicht gestiegen ist, sind die Frauen mit der Zeit – größtenteils relativ zu den Männern, teils aber auch absolut – immer unglücklicher geworden. Waren die Frauen in den 1970er Jahren noch eindeutig glücklicher als die Männer, so hat sich dieses Glücksplus über die Jahrzehnte, schleichend, Stückchen für Stückchen, in Luft aufgelöst.
Die Grafik zeigt einen Ausschnitt der Befunde aus den USA.[2] Man sieht, der Anteil sehr glücklicher Frauen ist gesunken, während dieser Anteil bei den Männern ungefähr gleich geblieben ist. Und was das Erstaunlichste ist: Als relativer Trend zeigt sich der Glücksschwund der Frauen nicht nur in den USA, sondern in praktisch allen Nationen, die die Forscher untersucht haben, in Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Spanien, Portugal und den Niederlanden. In Deutschland ist der Unterschied der Glücksentwicklung zwischen den Geschlechtern nicht ganz so klar, was einen erst mal positiv stimmen könnte, wäre es nicht so, dass wir in Deutschland in den letzten 30 Jahren insgesamt, also Frauen und Männer, unzufriedener geworden sind.[3]
Man stutzt, reibt sich die Augen, wundert sich. Ich bin weiß Gott kein Historiker, ich bin nur ein Laie, aber wenn ich so über die Entwicklung in den obengenannten Ländern nachdenke, wenn ich die Nachkriegszeit in groben Zügen an meinem geistigen Auge vorbeiziehen lasse und mich frage, was sich in den USA und bei uns in Europa so getan, was sich dort wie hier in den letzten Jahrzehnten verändert hat, zum Guten oder zum Schlechten, dann neige ich fast zu dem Schluss, dass es kaum eine gesellschaftliche Gruppe gibt, die ihre Situation so radikal verbessert hat wie die Gruppe der Frauen.
Es ist doch gar nicht so lange her, dass sich ein Großteil des Lebens der Frau noch in der Küche und dem Kinderzimmer abspielte, und obwohl das auch zu einem Mythos geworden ist, obwohl auch in den 1950er und 1960er Jahren zahlreiche Frauen außer Haus arbeiteten, so beschränkte sich das Job-Spektrum der Frau zu der Zeit überwiegend auf typische »Frauenberufe«, wie Sekretärin, Krankenschwester oder Lehrerin.
Ein weiterer Unterschied zu heute war, dass die meisten Frauen damals, auch wenn sie Jobs hatten, keine langfristigen Karrieren verfolgten. Sogar »die Uni war, statt ein Aufbruch in eine berufliche Laufbahn, für viele eher ein Weg, einen geeigneten Ehegatten kennenzulernen«, wie die Wirtschaftshistorikerin Claudia Goldin von der Harvard-Universität in einer kürzlich veröffentlichten Rückschau schildert.[4] Und spätestens, sobald sie heiratete und Kinder bekam, stand die Rollenverteilung unverrückbar fest – um sich diese kurz ins Gedächtnis zu rufen, genügt schon ein Blick auf die damalige Reklame, jene Anzeige für den brandneuen, revolutionär-innovativen Schnelltopfkoch von Fissler etwa.
Frappierend, wie haargenau Werbung und Alltagssitten sich gelegentlich spiegeln: Im einen wie im andern Fall liest er Zeitung, beschäftigt sich mit der großen Welt da draußen, und sie beschäftigt sich – mit ihm.
Bis in die 1960er Jahre hinein konnten Frauen in Deutschland nur dann ein Bankkonto eröffnen, wenn der Ehemann zustimmte, und noch in den 1970er Jahren, so wollte es das Bürgerliche Gesetzbuch, musste die Frau zuerst ihren Gatten um Erlaubnis bitten, bevor sie einen Beruf ergreifen konnte.
Ich will ja nicht suggerieren, dass heute alles perfekt wäre für Frauen, dass sie nach einem langen Leidensweg im Paradies angekommen wären, darum geht es in diesem Zusammenhang nicht. Es geht nur darum, dass sich die Situation der Frau objektiv, wie die Situation der meisten von uns, doch wohl eindeutig zum Besseren gewendet hat. Jeder halbwegs aufgeklärte Mensch würde doch selbstverständlich davon ausgehen, dass eine Erweiterung von Freiheit und Wahlmöglichkeiten zu unser aller Glück beitragen. Und dass also auch, ja dass gerade die Frauen der westlichen Welt mit der Freiheit, die sie sich in den letzten Jahrzehnten erkämpft haben – als wäre das nichts: Bundeskanzlerin, US-Außenministerin, eigene Fußball-WM –, insgesamt etwas glücklicher geworden sind, und wenn schon nicht glücklicher, so doch wenigstens nicht unglücklicher!
Trotzdem, anscheinend ist genau das teilweise der Fall.
Damit aber hatte für mich der Grillabend wieder an Aktualität gewonnen, schien der Befund doch einmal mehr die Frage aufzuwerfen, die meine Freundin damals auf der Autofahrt nach Hause gestellt hatte: Warum sind wir überhaupt noch unzufrieden – mitunter sogar, wie sich herausstellt, unzufriedener als früher –, angesichts der großen Freiheit und der vielen Möglichkeiten, die wir heute genießen? Anders gefragt: Warum genießen wir unsere Errungenschaften nicht ein bisschen mehr, als wir es den empirischen Erhebungen zufolge tun?
Ich recherchierte weiter, als sich allmählich eine erste, hypothetische Antwort auf die Frage andeutete, eine Erklärung, die sowohl etwas Licht auf das Frauenparadox warf als auch auf die Probleme, die uns grillende Stadtneurotiker beschäftigt hatten, auch wenn diese Erklärung ihrerseits zunächst etwas paradox anmutet: Vielleicht, so die Überlegung, vielleicht sind wir ja nicht unzufrieden obwohl, sondern weil wir so viele Möglichkeiten haben.
Bitte, reicht mir mein Prozac!
Als die New York Times über die Befunde der beiden Wirtschaftswissenschaftler berichtete und ihre Leser dazu aufforderte, das Rätsel der unglücklicher werdenden Frau zu lösen, entfesselte sich auf der Webseite der Zeitung binnen Stunden ein regelrechter Krieg der Geschlechter. Hunderte von Kommentaren liefen ein, Deutungsversuche, Analysen, Lebensgeschichten, zynische Bemerkungen und bittere Beschimpfungen. Hören wir kurz hinein:[5]
Was von Frauen erwartet wird:
Dass sie dünn sind
Dass sie gigantische straffe Brüste haben
Dass sie den Haushalt schmeißen
Dass sie die Kinder erziehen
Dass sie Termine und das soziale Leben regeln
Dass sie das emotionale Support-Center der Familie sind
Dass sie selbst keine Bedürfnisse haben
Was von Männern erwartet wird:
Dass sie Geld verdienen
– Anon
Sowohl mein Mann als auch ich arbeiten, aber er ist vielleicht glücklicher, weil er sich, sobald er von der Arbeit nach Hause kommt, auf die Couch legt und Fernsehen guckt (was er jetzt gerade tut), während ich für unsere Kinder (Alter 3 & 7) das Frühstück sowie das Pausenbrot mache, ihnen beim Anziehen und Zähneputzen helfe (Ehemann schläft während dieser vier Aktivitäten noch), sie zur Schule bringe, ihre Hausaufgaben kontrolliere, die Rechnungen zahle, das Abendessen koche, die Einkäufe für den gesamten Haushalt erledige (Essen, Klamotten, etc.), die Wäsche mache und das Geschirr spüle.
– NYCgirl
Der Punkt ist einfach, dass Frauen keine Ehefrauen haben.
– Zinaida
Wenn meine verheirateten, an Kindern festgeschnallten Freundinnen über ihre Ehemänner jammern, dass sie ihnen das Abendessen machen müssen, dass sie einkaufen und Kinder von hier nach dort schleppen müssen, dann lächle ich nur und erinnere sie daran, dass niemand ihnen diesen Lebensstil aufgezwungen hat. Es sind alles Entscheidungen, Leute!
– ParisRunner
Nur damit’s auch allen klar ist: Jede Erklärung für den Glücksunterschied zwischen Männern und Frauen muss natürlich zum Schluss kommen, dass der Fehler bei den Männern zu suchen ist. Denkt dran, wir sind unreife, aggressive, dominante, unsensible Mistkerle. Wer widerspricht, für den gibt’s heute Abend keinen Sex.
– Manuel Navarro
Nachdem ich all diese Kommentare gelesen habe, hab ich nur eins zu sagen: Bitte, reicht mir mein Prozac!
– Carol
Ein Großteil der Kommentare kommt von Frauen, und ein Großteil dieser Frauen macht ihrem Ärger darüber Luft, dass man als Frau heutzutage zwar durchaus Karriere machen kann, vieles habe sich in der Hinsicht zum Guten geändert, nur eines leider nicht oder zumindest nicht genug: die Männer. Während Frauen mehr und mehr Verantwortung im Berufsleben übernommen hätten, hätten die Männer ihrerseits nicht mitgezogen und mehr Verantwortung im Haushalt und Familienleben übernommen. Die Folge: Die Frauenbewegung, die auszog, den Frauen mehr Freiheit zu erkämpfen, habe ironischerweise dazu geführt, dass Frauen nun vor allem mehr Arbeit am Hals hätten, und zwar in Form von Karriere und Kind, wobei zu dieser letzten Kategorie in der Regel auch der Ehemann zu gehören scheint. Kein Wunder, dass die Frauen – relativ zu den Männern – immer unglücklicher geworden sind!
Die Erklärung leuchtet ein und soll ja auch bei uns, wie man hört, nicht gerade selten die Realität treffen. Und doch gibt es da ein kleines Problem: Die Erklärung geht stillschweigend davon aus, dass sich der Unglückstrend auf jene zweifellos überlasteten Frauen beschränkt, die zwischen Büro und Kita, zwischen Geschäftstermin und Schule hin- und herhetzen und vor lauter Multitasking und Jonglieren zwischen den Welten nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht.
Tatsächlich jedoch scheint das Phänomen der unglücklicher werdenden Frau viel umfassender zu sein. So ergab die Analyse der US-Ökonomen, dass Frauen ohne Ehemann von dem Unglückstrend ebenso betroffen sind wie ihre verheirateten Leidensgenossinnen. Und nicht nur das, nein, auch Frauen ohne Kinder und Frauen ohne Berufstätigkeit sind in den letzten Jahren, im Vergleich zu den Männern, immer unzufriedener geworden.[6] Mit anderen Worten: Die Doppelbelastung von Karriere und Kind erklärt sicher so manches, sie erklärt aber nicht alles, aus dem einfachen Grund, dass viele vom Unglückstrend ebenfalls betroffene Frauen dieser Doppelbelastung schlichtweg nicht ausgesetzt sind. Es muss also noch etwas geben, das den Frauen zunehmend zu schaffen macht. Nur was?
In diesem Kapitel werde ich die Antwort auf das Rätsel im Wesen der Freiheit selbst suchen, in dem Umstand, dass eine Erweiterung von Freiheit und Wahlmöglichkeiten nicht nur angenehme, sondern auch unangenehme, ja geradezu frustrierende Seiten haben kann. Dabei soll nicht in erster Linie das Schicksal der Frauen im Vordergrund stehen, sondern das Thema Freiheit. Da aber Frauen in den letzten Jahrzehnten eine besonders starke Ausdehnung ihrer Freiheit erfahren haben, wäre es nicht unlogisch, wenn sie auch deren Schattenseiten besonders stark zu spüren bekämen, mit der Folge, dass ihnen ihr Glücksplus, das sie einst den Männern gegenüber genossen, verlorengegangen ist.
Wenn es jedoch wirklich so ist, dass Freiheit und viele Möglichkeiten auch ihre Schattenseiten haben, die uns aufs Gemüt schlagen können, dann müssten nicht nur Frauen von diesen Schattenseiten betroffen sein, sondern wir alle. Jeder von uns muss schließlich mit der Freiheit und den zahlreichen Optionen, die uns die heutige Welt bietet und denen wir uns nicht entziehen können – weil wir, sogar wenn wir sie nicht nutzen, immer wissen werden, dass es diese Optionen gibt –, fertig werden.
Na gut, selbst wenn diese Überlegungen einigermaßen plausibel sein sollten, bleibt immer noch die entscheidende Frage: Was sollten die Schattenseiten der Freiheit sein?
Zu viele Marmeladensorten verderben den Appetit
Ein urbaner Feldversuch. An einem gewöhnlichen Samstag in San Francisco bauen zwei Marketing-Studentinnen – Irene und Stephanie – in einem Delikatessengeschäft, gleich beim Eingang, einen Probiertisch mit Feinkostkonfitüren auf. Es gibt zwei verschiedene Tisch-Varianten, die die jungen Frauen stündlich wechseln: In der ersten Variante bieten sie der vorbeikommenden Kundschaft sechs, in der zweiten 24 Marmeladensorten zum Verkosten an. Wer daraufhin eine Marmelade kaufen will, kann das nicht direkt bei den Damen am Probiertisch tun, sondern muss dafür zu dem entsprechenden Gang im Geschäft, wo sich die Marmeladen befinden. Dort lauert ein weiterer Mitarbeiter des Versuchs, Mark, der die Kunden heimlich beobachtet.
Nach und nach stellen die beiden Studentinnen fest[7], dass eine große Konfitürenauswahl deutlich mehr Kunden an ihren Tisch lockt als eine kleine Auswahl – nicht weiter überraschend. Doch was dann geschieht, ist bemerkenswert. Dem Spion Mark fällt auf, dass sich die Einkäufer je nach Tisch-Version unterschiedlich verhalten: Jene, die soeben von der großen Auswahl gekostet haben, wirken verunsichert. Lange bleiben sie vorm Marmeladenregal stehen, grübeln, zweifeln. Immer wieder prüfen sie die Marmeladengläser, und wenn sie mit jemandem zusammen im Laden sind, fangen sie an, die Vor- und Nachteile der Sorten zu diskutieren, was bis zu zehn Minuten dauern kann, woraufhin sie meist mit leeren Händen den Gang verlassen. Ganz anders dagegen die Kunden, die von der kleinen Auswahl gekostet haben: Sie scheinen genau zu wissen, was sie wollen, schreiten zum Marmeladenregal, nehmen ihre bevorzugte Sorte (»Zitronencreme«, bei der überwiegenden Mehrheit) und kaufen weiter ein.
In einer anschließenden Analyse der Daten kann die Leiterin des Versuchs, die US-Psychologin Sheena Iyengar von der Columbia University in New York, diese subjektiven Eindrücke bestätigen: Während 30 Prozent der Leute, die mit nur sechs Marmeladen konfrontiert worden waren, ein Glas kauften, entschieden sich bei einem Tisch mit 24 Sorten nur drei Prozent, also gerade mal ein Zehntel, zu einem Kauf.
Der Marmeladenversuch fand an zwei aufeinanderfolgenden Samstagen statt. Insgesamt beobachtete man dabei das Verhalten von über 750 Kunden. Die Grafik zeigt, was in einer durchschnittlichen Stunde geschah.[8]
Auf die wichtigste Erkenntnis in unserem Zusammenhang stößt die Psychologin Iyengar jedoch erst mit einem weiteren Versuch. Schauplatz ist diesmal das Labor der Forscherin, in dem ihre Mitarbeiter einer Gruppe von Testpersonen diverse Edelschokoladen anbieten. Die Auswahl besteht einmal aus sechs und einmal aus 30 verschiedenen Schokoladensorten, wobei es noch eine Kontrollgruppe gibt, die gar keine Wahl hat, sondern einfach eine bestimmte Schokoladensorte in die Hand gedrückt bekommt. Anschließend sollen alle auf einer Skala von 1 bis 7 bewerten, wie gut ihnen die Schokolade geschmeckt hat (je höher die Zahl, desto besser). Außerdem erhält jeder am Ende des Versuchs als Entschädigung fünf Dollar, die man, wenn man will, gegen Schokolade eintauschen kann.
Es stellt sich heraus, dass Menschen bei einer kleinen Auswahl von Möglichkeiten nicht nur weniger zweifeln und beherzter zugreifen, sondern am Ende auch zufriedener mit ihrer Wahl sind: Diejenigen Testpersonen, ergibt das Experiment, die ihre Schokolade aus dem Angebot von sechs verschiedenen Sorten herausgepickt haben, bewerten ihre Schokolade von allen Teilnehmern am besten – besser als jene, die keine Wahl hatten, überraschenderweise aber auch besser als jene, die aus einem großzügigen Angebot von 30 unterschiedlichen Schokoladensorten wählen konnten.
Und diese größere Zufriedenheit äußert sich auch im Verhalten: Von den Teilnehmern, die aus sechs Sorten wählen durften, ist immerhin knapp die Hälfte von ihrer Kostprobe dermaßen begeistert, dass sie sich spontan dazu entschließt, ihren Fünf-Dollar-Lohn gegen Schokolade einzutauschen. Jene, die keine Wahl oder eine sehr große Auswahl hatten, haben dagegen genug von Schokolade, sie wollen einfach nur ihr Geld und schleunigst nach Hause.[9]
Das Regenbogenphänomen
Mehr Auswahl, weniger Zufriedenheit und weniger Kauflust – das klingt natürlich erst mal paradox. Eigentlich haben wir ja das Gefühl, dass es sich genau umgekehrt verhält, dass gerade eine spärliche Auswahl unserem Kaufrausch einen Strich durch die Rechnung macht. Wer gar keine Wahl hat, muss sich wohl oder übel mit dem zufriedengeben, was ihm vor die Nase gesetzt wird. Wir sind unserem Schicksal, in diesem Fall der Marmelade oder Schokolade, die uns aufgezwungen wird, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Können wir zwischen verschiedenen Möglichkeiten wählen, bekommen wir dagegen eine gewisse Kontrolle über unser Schicksal, genauer gesagt: Aus Schicksal wird eine freie Wahl. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir am Ende auch zufriedener mit der Alternative sind, die wir uns selbst ausgesucht haben, egal, ob es sich dabei um eine Marmelade, eine Karriere oder einen Lebenspartner handelt.
Nun haben wir – um die Argumentation logisch fortzusetzen – bei einigen wenigen Möglichkeiten zwar schon etwas, bei vielen Möglichkeiten jedoch noch mehr Freiheit. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich unter einem großen Angebot zumindest einige Exemplare (Schokoladen, Lebenspartner) befinden, die uns so richtig schmecken, ist entsprechend größer. Allgemein formuliert, dürften wir davon ausgehen können, dass unsere Zufriedenheit mit der Zahl der Angebote stetig zunimmt, und genau in dieser Annahme bietet mein Lieblingssupermarkt am Alexanderplatz auch nicht schnöde sechs, sondern 250 Marmeladen, Konfitüren und Gelees an.[10] Würde man diese Annahme grafisch darstellen, sie würde ungefähr so aussehen:
Je größer das Angebot, desto größer unser Kaufrausch, wobei man vernünftigerweise einschränken sollte, dass ab einer bestimmten Menge wohl eine gewisse Sättigung eintreten wird. Schließlich ergibt es einen größeren Unterschied, ob wir zwischen zwei und zwölf oder zwischen 240 und 250 Sorten wählen können. Die zunächst steil ansteigende Linie sollte sich deshalb irgendwann krümmen und allmählich flacher werden.
So weit die Theorie. Wirft man nun aber einen Blick auf Experimente wie den Marmeladenversuch, scheint das Verhältnis zwischen Angebotszahl und Zufriedenheit anders auszusehen, grafisch nimmt die gekrümmte Linie die Form eines umgekehrten U, einer Wurfparabel oder die eines klassischen Regenbogens an.
Man könnte meinen, dass das Hinzufügen immer weiterer Möglichkeiten irgendwann zwar keinen Mehrwert mehr bringt, uns allerdings auch nicht weiter stören sollte, da wir die überflüssigen Angebote ja getrost ignorieren können. Sonderbarerweise ist das nicht der Fall: Ab einer gewissen Vielfalt tritt offenbar nicht einfach nur wohlige Sättigung, sondern regelrechter Überdruss ein, wie sich seit dem Marmeladenversuch in mehreren Studien bestätigt hat.
In einer dieser Folgestudien baute man in einer Uni-Bibliothek einen Tisch auf, wo die Leute keine Konfitüren, sondern Kugelschreiber ausprobieren und zu einem sehr günstigen Preis kaufen konnten. Wie üblich variierte man die Größe des Angebots, und zwar diesmal systematisch, angefangen mit nur zwei Kugelschreiber-Modellen, hin zu vier, sechs, acht Modellen, und so ging das weiter in Zweierschritten bis zu 20 verschiedenen Kugelschreibern. Ergebnis: Sowohl bei einem sehr kleinen als auch bei einem sehr großen Angebot hielten sich Leute beim Kauf zurück. Die meisten Kugelschreiber gingen bei einer mittleren Angebotsvielfalt von zehn Modellen über den provisorischen Uni-Ladentisch.[11]
In einem anderen Versuch bot man Testpersonen Bilder von Geschenkschachteln verschiedener Formen und Farben dar und fragte sie, welche Schachtel sie wählen würden, um darin das Geschenk für einen guten Freund/eine gute Freundin einzupacken. Anschließend sollten die Leute »ihre« Schachtel auf einer Skala von 1 bis 10 benoten. Wieder variierte man die Größe des Angebots, in diesem Fall die Zahl der unterschiedlichen Schachteln, wieder zeigte sich bei der Bewertung des gewählten Gegenstands jene Regenbogenform in Abhängigkeit der Auswahlgröße, und auch diesmal lag das Optimum bei zehn verschiedenen Angeboten.[12]
Das »Regenbogenphänomen« lässt sich sogar bis in unser Gehirn zurückverfolgen. So legte ein Forscherteam Probanden in einen Kernspintomographen und forderte die Versuchskaninchen in dem Gerät dazu auf, sich aus einer Sammlung von Landschaftsfotografien ihr Lieblingsexemplar auszusuchen. Die Fotosammlung bestand einmal aus sechs, einmal aus zwölf und schließlich aus einer Kollektion von 24 verschiedenen Fotografien.
Eine Analyse der Hirnscans ergab, dass die Aktivität einiger Hirnregionen mit der Anzahl der Fotografien, die zur Wahl standen, stetig zunahm. Dabei handelte es sich vor allem um Hirnregionen, die Körperbewegungen planen und steuern und visuelle Informationen empfangen. Der Befund ist nicht allzu verwunderlich, da man bei mehr Bildern ja auch mehr hin- und hergucken und mehr optische Eindrücke verarbeiten muss.
Bei anderen Hirnarealen jedoch tauchte die vertraute Regenbogenform in Abhängigkeit der Auswahlgröße auf – und bezeichnenderweise waren das Areale, die man zum sogenannten Belohnungssystem zählt, wie etwa der Nucleus accumbens und der Nucleus caudatus, beides Hirnkerne, die allgemein mit Begehren und Verlangen in Verbindung gebracht werden. Erhöhte man das Angebot von sechs auf zwölf Fotografien, stieg die Erregung in diesen Hirnstrukturen zunächst an, um dann bei einer weiteren Erhöhung auf 24 Fotos wieder abzuflachen.[13]
Schuldgefühle und weitere Schattenseiten der Freiheit
Was soll das? Wieso kommt es in den Experimenten wiederholt zu diesem Regenbogeneffekt[14], wenn es doch unzweifelhaft so ist, dass mit wachsender Angebotsgröße die Chance wächst, dass wenigstens eine Alternative dabei ist, die unserem Geschmack entspricht, und wir also eigentlich mit einer großen Auswahl besser dastehen müssten?
Es könnte natürlich sein, dass eine große Vielfalt einerseits zwar eine durchaus gute Sache ist, die sehr verlockend auf uns wirkt – dafür würden nicht nur die Supermärkte mit Riesen- bis Mega-Auswahl sprechen, sondern auch die Beobachtung beim Marmeladenversuch, dass wir bevorzugt bei einem Tisch mit großem Sortiment stehen bleiben. Üppige Vielfalt hat was, sie fasziniert uns, sie zieht uns an.
Zugleich könnte ein großes Angebot mit gewissen Risiken und Nebenwirkungen einhergehen, mit Nebenwirkungen, die unserem Wohlbefinden zuwiderlaufen, die wir aber unterschätzen, weil sie sich eher unbemerkt, gleichsam hinter unserem Rücken, entfalten.
Nehmen wir an, eine Erweiterung des Angebots hat zunächst einen grundsätzlich positiven Effekt, während sich die mutmaßlichen Nebenwirkungen erst nach und nach einstellen. In diesem Fall würden wir von den Nebenwirkungen erst mal nichts merken. Wenn dann aber ab einer gewissen Angebotsgröße der Glücksgewinn auf Grund der Sättigung nachlässt, die unangenehmen Nebenwirkungen jedoch weiter munter zunehmen, kippt unser Netto-Glück irgendwann – ab diesem Punkt sorgen noch mehr Möglichkeiten nicht für noch mehr Zufriedenheit, sondern für Verdruss. Grafisch könnte man diesen hypothetischen Prozess so darstellen, dass die negativen Nebenwirkungen die Glückskurve derart nach unten ziehen, dass daraus im Endergebnis jene Regenbogenform entsteht, die in den experimentellen Versuchen des Öfteren zum Vorschein kommt.[15]
Worin aber sollten jene ominösen Nebenwirkungen bestehen, die unser Glück kippen lassen und uns den Spaß an der Vielfalt verderben? Verschiedene Erklärungsansätze bieten sich an.
Eine naheliegende Erklärung besteht darin, dass eine große Auswahl nicht nur mit einem größeren Nutzen, sondern auch mit größeren »Kosten« einhergeht, insofern, als man bei mehr Möglichkeiten auch mehr Vergleiche anstellen, also mehr Informationen sammeln und verarbeiten, mehr hin- und herüberlegen muss etc. So schön es ist, dass man uns 200 Flachbildschirmmodelle zur Auswahl stellt, jeder weiß, dass es irgendwann einfach lästig werden kann, bei einem derart umfassenden Angebot exakt dasjenige Exemplar zu finden, das uns am besten gefällt, zumal ja die meisten von uns für gewöhnlich noch etwas anderes zu tun haben, als Flachbildschirmexperten zu werden.
Außerdem, was den grundsätzlichen Punkt der Informationsverarbeitung betrifft, hat der US-Psychologe George Miller bereits vor Jahrzehnten in einer zum Klassiker gewordenen Untersuchung gezeigt, dass die Speicherkapazität unseres Kurzzeitgedächtnisses eng begrenzt ist, und zwar auf sieben plus/minus zwei Informationseinheiten, seither auch bekannt als »Millers magische Zahl sieben«.[16] Würde man Ihnen zum Beispiel eine Telefonnummer nennen, die aus fünf bis neun (im Schnitt sieben) Ziffern besteht, könnten Sie sich die Nummer wahrscheinlich noch einigermaßen merken, bei mehr Ziffern jedoch versagt bei den meisten von uns der Arbeitsspeicher.
Wer weiß, vielleicht hat die Woche deshalb, wie Miller spekulierte, sieben Tage[17], vielleicht gibt es deshalb die sieben Weltwunder, die sieben Todsünden, das Buch mit sieben Siegeln und die sieben Zwerge, und man packt ja auch seine sieben Sachen zusammen und ist auf Wolke sieben im siebten Himmel. Womöglich kann unser Verstand auf Grund seines beschränkten Arbeitsspeichers ganz gut mit 7 ± 2 Möglichkeiten umgehen, während mehr ihn schlicht überfordern und eine Art von kognitivem Brechreiz erzeugen, und tatsächlich kommt das Miller’sche Maximum von neun Informationseinheiten verblüffend nah an das häufiger beobachtete Angebotsoptimum von zehn Möglichkeiten heran. (Übrigens: Die durchschnittliche Zahl der Freunde bei Facebook liegt bei 130, wobei es sich natürlich beim Großteil dieser »Freunde« eher um mehr oder weniger entfernte Bekannte handelt, lediglich ein kleiner Teil davon sind Freunde, die diesen Namen auch verdienen. Wie viele das sind? Richtig: Einer kürzlich durchgeführten Analyse zufolge sind es sieben.[18])