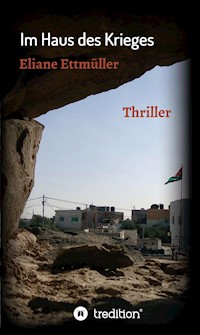
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In einem arabischen Land wird eine Frau nach der Hochzeit zur Attentäterin. Aus London flüchtet eine Medizinstudentin vor ihrer Vermählung ins Krisengebiet. Gleichzeitig leitet ein frisch verheirateter Leutnant ein Kommando der Spezialeinheiten, das die "Armee für den Universellen Dschihad" besiegen soll. Verschiedene Lebenswege kreuzen sich "im Namen Gottes" vor dem von Gewalt beherrschten Hintergrund des Terrors, dem niemand entkommen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Eliane Ettmüller
Im Haus des Krieges
Thriller
© 2019 Eliane Ettmüller
Lektorat: Rahel Rosa Neubauer
Verlag & Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44,
22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7497-7512-5
Hardcover:
978-3-7497-7513-2
e-Book:
978-3-7497-7514-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Für JOA 011646
Präambel
Ein lauter Knall, ein Schrei und dann Stille. Ein Soldat öffnete die Eisentür und packte sie unsanft am Arm. Sie störte sich kurz daran, dass sie nun nicht mehr von Frauen bewacht wurde. Dann wiederum schien es ihr durchaus natürlich, dass der direkte Umgang mit dem Tod den Männern vorbehalten war. Das hatte sie bereits gefühlt, als man sie dazu aufforderte, Menschen umzubringen, zu töten im Namen Gottes.
Wieder und wieder hatte sie in der Leere ihrer Gefangenschaft den Koran gelesen und nie den Aufruf darin finden können, Kinder als Opfer im Kampf gegen die Ungläubigen zu akzeptieren. Sie wusste, dass ihre Sprachkenntnisse des Hocharabischen beschränkt waren und sie daher nicht jedes Detail der Worte Gottes verstand. Eine innere Stimme diktierte ihr jedoch in gut verständlichem Dialekt, dass Töten falsch war. Als Opfer ihrer Einsamkeit hatte sie die heiligen Verse rezitiert und darüber nachgedacht. Viele Male war sie überrascht gewesen, lebendig aufzuwachen auf ihrem Bett, inmitten des leeren, weiten Unverständnisses. Dämonen und Geister verfolgten sie in der Dunkelheit. Tiefe Gräben taten sich vor ihr auf und verschluckten sie. Dennoch befreite sie morgens die heilende Stimme des Muezzins aus dieser schwarzen Hölle. Die Sonne erhob sich jeden Tag aufs Neue und mit ihr die Hoffnung.
Jetzt blickte sie auf ihre feinen kraftlosen Hände, die mit Stahl gefesselt waren. Gegen was? Konnten diese zerbrechlichen Finger überhaupt Gewalt ausüben? Metallgeräusche drangen mit stechender Schrille an ihr Ohr und erschütterten ihren ganzen Körper. Ein schweres Tor öffnete sich vor ihr. Irgendwie hatte sie sich die Himmelspforte anders vorgestellt.
Sie ignorierte wie man die in Tücher gehüllte Leiche eines Mannes an ihr vorbeitrug. Sie sah nicht, wie ein Soldat auf diese spuckte und dafür von seinem Vorgesetzten eine Ohrfeige bekam. Sie hörte die Stimmen nicht mehr.
Nur eine Sure des Korans wiederholte sich immer wieder in ihrem Kopf, Surat ar-Raid (13:24), die Donnersure:
„Der Friede möge dir zuteil werden für das, was du geduldig ertragen hast, und wundervoll ist das ewige Zuhause.“
1. Teil: Verlobung
1
Mohsin war auf dem Heimweg. Er war überglücklich. Lange hatte er auf diesen Tag gewartet, und jetzt war es endlich soweit. Es war, als ob er zu seinem Auto schwebte. Weder die Strapazen der Hitze noch der Staub noch der Stau machten ihm heute etwas aus. Fast hätte er vor dem Haus seiner Verlobten den Bawab, den Hausmeister, umarmt, hatte es aber doch bei einigen Münzen Trinkgeld belassen. Verlobte? Genau, jetzt waren sie ja schon so gut wie verheiratet!
Unlängst hatte Mohsin mit Erfolg die harte Ausbildung in der Offiziersschule gemeistert und war zum Leutnant befördert worden. Dies war der Grund dafür, dass der gestrenge Vater seiner Angebeteten Taghrid nun endlich der Vermählung der beiden Verliebten zustimmte.
„Eine sichere Stelle ist die Voraussetzung für die Gründung einer Familie“, hatte Abu Ahmed gesagt, „so will es Gott!“
Hinter dem Lenkrad sitzend, freute sich Mohsin strahlend über seine Verdienste. Der Leutnant hatte nicht nur viel Ausdauer in der Armee und beim Werben um seine Braut bewiesen, sondern lange für sein Auto gespart, das nun alle sehr beeindruckte. Es handelte sich um nichts weniger als einen Jeep. Mohsin hatte über Jahre hinweg davon geträumt und alles, was ihm möglich war, dafür auf die Seite gelegt. Und dann stand die Maschine plötzlich vor ihm, in elegantem Schwarz und mit funkelnden Scheinwerfern. Er konnte sein Glück kaum fassen und schlief die ganze Nacht nicht vor Aufregung. Immer wieder bestaunte der junge Mann sein Fahrzeug vom Balkon aus, natürlich auch aus Sorge, dass diesem Wunderwerk der Technik etwas zustoßen könnte. Wie ein Prinz fuhr er am Morgen nach dem Kauf zur Kaserne und wurde dort sofort von seinen Kameraden umringt. Der schwarze Viermalvier verhalf ihm bereits vor seiner Beförderung zum Leutnant zu großem Respekt. Der Jeep bewies, dass sein Besitzer eine stattliche Summe Geld hatte locker machen können, und diente nicht nur der Fortbewegung, sondern gleichfalls als Ausweis der Zugehörigkeit zu einer auserwählten Gesellschaftsschicht. Da Mohsin seinen Eintritt zu dieser jedoch selbst erarbeitet und der Kauf des Jeeps seine gesamten Ersparnisse verzehrt hatte, konnte er sich vorerst keine eigene Wohnung leisten und mietete ein modernes Appartement in einem noblen Quartier.
Ungleich seiner Kollegen war Taghrids Vater vom Jeep seines künftigen Schwiegersohnes wenig beeindruckt, und es war äußerst schwierig, Abu Ahmed davon zu überzeugen, dass seine Tochter in einer Mietwohnung glücklich werden könnte. Er kam zweimal, um sie zu inspizieren. Zuerst erschien er in Begleitung seines ältesten Sohnes Ahmed, der in der Wohnung herumstolzierte wie ein aufgeblasener Gockel und demonstrativ die Nase rümpfte. Beim zweiten Mal durfte Taghrid dabei sein, die ja schließlich in dem Appartement wohnen müsste, bis ihr künftiger Mann ihr eine andere Behausung kaufen könnte. Taghrid war entzückt. Ihr gefiel das Quartier, wo sie viele Freundinnen hatte, und sie freute sich darüber, am Anfang eine nicht allzu geräumige Wohnung unterhalten zu müssen. Abu Ahmed wunderte sich, dass seine Tochter gewillt war, anfänglich auf Personal zu verzichten und den Haushalt selbst in die Hand zu nehmen. Als er jedoch erkannte, welch große Freude aus den dunklen Augen seiner Tochter strahlte, wurde er weich. Die neue Position Mohsins würde sicherlich bald einen Wohnungskauf ermöglichen. Außerdem waren die beiden vom gleichen Stamm, dem der Abu Aisa, und hatten sich bereits im Kindergarten kennengelernt. Die Mütter waren ebenfalls befreundet und ihre Fürsprache zugunsten der Eheschließung erleichterte die Entscheidung der Männer.
Der Oberstleutnant Abu Ahmed hatte sich zudem selbstverständlich von Mohsins direkten Vorgesetzten über dessen Betragen in der Armee bis ins kleinste Detail hin informieren lassen. Was ihm zu Ohren kam, überzeugte ihn von den militärischen Fähigkeiten sowie der menschlichen Rechtschaffenheit des jungen Offiziers, der sein Schwiegersohn werden wollte. Taghrids Vater erinnerte sich natürlich auch an seine eigenen Tage als junger Offizier. Er wusste nur allzu gut, wie schwer es sein konnte, Väter davon zu überzeugen, dass ihre Töchter in der Ehe gut behütet sein würden. Damals, als er selbst zum Leutnant befördert worden war, war er jedenfalls sehr froh und dankbar gewesen, eine starke Frau an seiner Seite zu haben. Allerdings hatte er auf eine Wohnung gespart, so wie es sich gehörte, und nicht auf einen fahrbaren Untersatz!
„Die Zeiten haben sich geändert“, erklärte ihm seine Frau besänftigend, „es ist heute sehr wichtig, ein standesgemäßes Transportmittel zu besitzen. Du willst doch nicht etwa, dass deine Tochter Bus fährt?“
Abu Ahmed hustete vor Entrüstung: „Bus? Wie kommst du auf so etwas Absurdes?“
Taghrids Mutter lächelte und fuhr weiter: „Na also! Außerdem wird sein Vater ihm auch noch einen ordentlichen Batzen geben, damit das Sparen auf die Wohnung nicht ewig dauern muss. Das hat mir Marwa, Mohsins Mutter, geflüstert…“
Mit überbetont gespielter Opposition, wie es sich für einen Patriarchen schickt, willigte Abu Ahmed grummelnd ein. Er gönnte ja den beiden ihr Glück.
Die Verlobung sollte fünf Monate dauern. Diese ungewöhnlich kurze Zeit (vielfach dauerte die Verlobungszeit über ein Jahr) hatten die Familien so festgelegt, weil sie sich durch ihre Stammeszugehörigkeit bereits gut kannten und keine spektakuläre Verlobungsfeier organisieren wollten. Allerdings musste während der Zeit bis zur Hochzeit die Wohnung neu möbliert werden, der Tradition zufolge finanziert vom Vater der Braut.
Viel wichtiger schien Mohsin, dass es den beiden von nun an erlaubt war, sich häufig zu treffen. Ab sofort würde er mit seiner Angebeteten ins Kino gehen und hin und wieder ein Eis essen dürfen, ohne dabei ständig von deren lästigem Bruder begleitet zu werden.
Mohsin ließ den Motor aufheulen. Ganz richtig! Bald war er offiziell verlobt! Fest nahm er sich vor, nach der kleinen religiösen Verlobungszeremonie im engsten Familienkreis am Freitagabend Taghrid täglich zu sehen. Das würde ihn auf andere Gedanken bringen als die Bereitschaft zum Kampf gegen die islamistischen Terroristen, von denen in seinem Beruf ständig die Rede war.
Er konnte nicht verstehen, weshalb Menschen behaupteten, im Namen Gottes Zivilisten zu töten. Das war doch ganz klar gegen den Islam! So hatte er es in seiner Ausbildung gelernt. Jetzt mehr denn je war er entschlossen, seine Familie, seinen Stamm und vor allem die Frauen und Kinder gegen die Bedrohung durch diese Wahnsinnigen zu verteidigen. Dies war seine Pflicht, als Mann seines Volkes und seiner Religion!
Mohsin war unterdessen schon fast bei seiner Mietwohnung angekommen, die ihm nun bei der Vorstellung, dass er noch fünf Monate und fünf Tage auf seine Frau warten müsse, unangenehm leer vorkam. Seine Mutter würde ja – Gott sei Dank! – bald kommen, um ihm das Essen zu bringen. Was es heute wohl gab? Mohsin hatte Hunger.
2
Fünf Monate später, dreihundert Kilometer weiter östlich und auf der anderen Seite der Grenze waren die Vorbereitungen für eine Hochzeit in vollem Gange. Abd al-Fatah sollte seine Cousine Sama heiraten. Die Familie war glücklich, keiner hatte geglaubt, dass die Jüngste aus dem Hause der Beni Schagar noch einen Bräutigam finden würde. Sie kümmerte sich ja bereits um das Haus ihrer Mutter und die Kinder der kranken Schwester. Wie alt Sama war, wusste keiner so genau, aber die Nachbarn waren sich darin einig, dass sie dereinst als alte Jungfer enden werde. Der Zustand hatte bislang auch keinen gestört, nicht einmal Sama selbst, die sich nach den Erfahrungen ihrer Schwester vor einer Hochzeit fürchtete und bereits ihre zwei Neffen aufzog, die sie auf keinen Fall nach einer potentiellen Eheschließung vernachlässigen wollte. Deshalb war ihr nicht wohl beim Gedanken, ihren Cousin zu ehelichen, der als kampfgehärteter Mudschahid, Gotteskrieger, bestimmt nicht viel für Sentimentalitäten übrig haben würde. Allerdings hatten es der Stammesrat und ihr Vater so entschieden und dagegen konnte sie wenig ausrichten, obwohl die letzte Entscheidung ja theoretisch bei ihr lag. Mit gebeugtem Haupt willigte sie ein, steckte den Ring in die Rocktasche und ging in den Hof, um mit ihren Neffen zu spielen.
Kaum stand sie in der Sonne, fuhr sie erschrocken zurück. Die feurigen Strahlen durchdrangen die Kleidung und stachen in die Haut. Wieder im schützenden Haus, fand sie die Kinder schlafend in ihrem Zimmer. Auch ihnen war zu heiß geworden. Sama stellte den Ventilator an, der sich sofort in Bewegung setzte und anfing, an der Decke sirrend und ratternd vor sich hin zu kreisen. Sie blickte auf das mit Gardinen verhängte Fenster. Der vom Ventilator in Schwung gebrachte Luftzug strich ihr über das Kopftuch. Ihr wurde schwindlig. Sie legte sich zwischen die Kinder auf den Boden und starrte an die Decke. Der Luftwirbel schien sie in sich hinein zu ziehen. Sie zitterte, schloss die Augen und fing an, den Koran zu rezitieren. Das beruhigte sie. In einer Woche sollte sie heiraten. Eigentlich hatte sie gehofft, diesem Gebot Gottes entgehen zu können.
Samas Neffen Nur und Hassan schliefen an ihrer Seite. Der siebenjährige Nur zuckte dabei mit dem linken Fuß. Waren das nicht bereits ihre beiden Kinder? Weshalb sollte sie heiraten? Ihre Mutter, ihre Schwester und die beiden Jungen brauchten sie doch! Fest nahm sie sich vor, die Kinder nicht alleine zu lassen. Abd al-Fatah würde einwilligen, sie in ihrem Haus aufzunehmen. Er war ein guter Muslim, das würde er ihr nicht abschlagen können. Ihre Schwester Aischa, die leibliche Mutter von Nur und Hassan, würde sie auch bei sich beherbergen müssen und für die Mutter kochen. Aischa konnte ihr vielleicht hin und wieder dabei helfen.
Die zierliche Aischa war bereits als Kind sehr anfällig gewesen. Sie wurde manchmal ganz plötzlich ohnmächtig. Die langen Sessionen zur Geisteraustreibung beim Imam, der ihr laut betend verschiedenfarbige salzige Flüssigkeiten zu trinken gab, brachten keinen Erfolg. Sogar der Arzt in der nächsten großen Stadt wusste keine Abhilfe und hoffte, dass – wenn Gott es denn so wollte – die Anfälle mit dem Ende der Pubertät abnehmen würden. Das taten sie tatsächlich auch.
Kaum waren diese Dämonen der Kindheit vertrieben, verwandelte sich Samas Schwester in eine bemerkenswerte Schönheit. Mit einem feinen, blassen Gesicht, großen, tiefschwarzen Augen und einer filigranen Nase, welche äußerst selten war in dieser Gegend, verzauberte sie jetzt alle, die ihr begegneten. Kein Wunder, dass Mustafa ein Auge auf sie warf! Auch Aischa selbst hatte gegen eine Hochzeit mit dem Nachbarssohn, der dem gleichen Stamm der Beni Schagar angehörte, nichts einzuwenden. Des Nachts saß sie manchmal heimlich am Fenster und wartete auf das Aufblitzen einer Taschenlampe. Dann versank sie kichernd unter ihrer Decke. In solchen Nächten gab Sama vor zu schlafen und freute sich über das Glück der Schwester, die von ihrem Liebsten kontaktiert wurde.
Nach der Verlobung hatten die Verliebten ihre Lichtgeheimsprache nicht mehr nötig. Mustafa brachte Aischa am Aid al-Fitr, dem großen Fest nach Ramadan, zusammen mit Sama in die Stadt und kaufte beiden Mädchen ein Handy. Sama war begeistert, klebte glitzernde Steinchen auf die Rückseite und ließ alle Familienangehörigen das neue Gerät bewundern. Aischa hingegen zog sich mit ihrem Telefon zurück auf das Zimmer und las mit geröteten Wangen die Nachrichten ihres Verlobten.
Sama half ihrer Schwester und Mustafa, die zukünftige Wohnung des Brautpaares einzurichten. Aischa bestaunte entzückt die blauen Polstersessel, die den Besucherraum säumten, während Sama die goldenen Kissen darauf verteilte. Die baldige Braut umfasste die Hände der Schwester und schwärmte vom grobgewebten bunten Flachsteppich und dem mit Blumen dekorierten Geschirr.
„Mustafa ist ein guter Mann! Gott hat uns füreinander geschaffen! Wir teilen dieselben Wünsche und Gedanken und können es nicht erwarten, eine Familie zu werden, so Gott will!“
„So Gott will!“, antwortete Sama verträumt.
Die Hochzeit kam, die Kinder folgten. Das Paar schien so glücklich, wie es sich die Gesellschaft wünschte. Die Frauen kochten und die Verwandten besuchten sich. Die Kinder spielten freudig auf staubigen Straßen und in dunklen, engen Höfen.
Doch plötzlich wurde der kleine Sohn Hassan schwer krank. Er verlor seinen Appetit, zitterte am ganzen Körper und bekam hohes Fieber. Seine Mutter saß Tag und Nacht an seinem Bett und versuchte, ihm süßen Tee einzuflößen. Gleichzeitig fand sein Vater Mustafa keine Arbeit. Den Kinderarzt und die Medikamente konnte sich die Familie kaum leisten. Hassans Zustand verschlechterte sich, und er sollte ins Krankenhaus gebracht werden. Es war dringend, und das Geld nicht aufzutreiben.
Weil Mustafa auf seiner Suche nach Arbeit am Abend immer länger außer Haus blieb, war Sama eingezogen, um ihrer Schwester zu helfen. Aischa betete die ganze Nacht. Sie rezitierte lange Verse aus dem Koran. Während sie vor Hassans Bett kniete und die Hand ihres Sohnes hielt, bewegten sich Aischas Lippen unaufhörlich.
„Ob Gott meine Gebete erhören wird, wenn ich so ungewaschen, und ohne mich niederzuwerfen, meine Bitten an ihn richte?“
„Die Not erlaubt das Verbotene“, versuchte Sama ihre Schwester zu beruhigen.
Aber die Möglichkeit, dass Gott ihre Gebete wegen der fehlenden Formalitäten ablehnen könnte, schien Aischa trotzdem weiterhin zu beschäftigen. Die Nacht war lang und Hassan atmete schwer. Plötzlich sprang die Tür auf. Mustafa kam hereingerannt, bleich im Gesicht. Ohne ein Wort zu sprechen, nahm er seinen fiebernden Sohn in die Arme und trug ihn zur Tür, die noch offen stand. Aischa schrie laut auf.
„Es wird ihm nichts passieren, meine Liebste, ich bringe ihn zu den Ärzten!“
Aischa war außer sich und rannte mit offenen Haaren ins Freie. Sama schnappte sich ihren schwarzen Umhang und eilte hinterher. Mustafa war bereits mit Hassan verschwunden. Aischa stolperte und fiel zu Boden. Mit der Hilfe einiger Nachbarsfrauen, die vom Lärm aufgeschreckt worden waren, trug Sama ihre Schwester zurück in die Wohnung und bettete ihren Kopf auf eines der goldenen Kissen aus dem Empfangsraum. Sie hörte die Stimme des Muezzins. Ein neuer Tag brach an.
3
Nafisas Eltern stammten aus Pakistan. Gerne erinnerte sich die junge Studentin, die in London aufgewachsen war, an eine Reise zu ihren Großeltern. Die bunten Gewänder der Frauen, die Gerüche der Gewürze und die vielen herumstreunenden Hunde und Katzen hatten das kleine Mädchen nachhaltig beeindruckt. Von dieser Reise stammte die blassrosa Kordel an ihrem Bettgestell. Ein ihrer Großmutter vertrauter Khadim, der Wächter eines Sufigrabs, hatte sie ihr um den Hals geknüpft mit dem Versprechen, dass sie später einmal einen Sohn gebären würde. Nafisa hatte vor dem mit Blumen geschmückten Schrein des Heiligen jedoch nicht für einen Sohn, sondern für ein Fahrrad gebetet. Nach ihrer Rückkehr in die englische Hauptstadt erhielt sie auch tatsächlich das gewünschte Kinderbike und war infolgedessen von der magischen Wirkung der heiligen Schnur überzeugt. Vor schwierigen Prüfungen wickelte sie sich die Kordel um ihr rechtes Handgelenk, welches daraufhin die Kugelschreiber in ihren Fingern zu besten Noten lenkte.
Nafisa studierte Medizin und fuhr jeden Tag stolz, ihr buntbedrucktes Tuch auf dem Kopf, aus dem Vorstadt mit den kleinen Backsteinhäuschen zur Universität. Dort wurde sie eines Tages vor dem Hörsaal von einem jungen Mann angesprochen. Er hatte eine runde, dunkle Gebetsmarke auf der Stirn, trug einen schicken, dunklen Anzug und verteilte Informationsbroschüren von Islamic Medical Relief. Zuerst war Nafisa negativ überrascht, da sie sich höchst ungern in der Öffentlichkeit von fremden Männern ansprechen ließ. Sie nahm den Flyer, blickte zu Boden und bedankte sich, ohne dem Mann in die Augen zu sehen.
Zu Hause angekommen, legte sie das doppelseitig bedruckte A5-Blatt auf den Tisch und wurde später von ihrer Mutter darauf angesprochen. Als regelmäßige Spenderin war diese von der Güte und Aufrichtigkeit der Organisation überzeugt.
„Das sind wahre Muslime“, schlussfolgerte sie, bevor sie wieder in der Küche verschwand, „die helfen unseren Glaubensbrüdern, wo sie nur können!“
Nafisa kramte in ihrer Unitasche nach dem Laptop, öffnete es und suchte nach der Internetverbindung.
„Muhammad, mach das Modem an!“, rief sie ihrem Bruder zu.
„Psst…“, klang es aus der Küche, wo die Mutter ihr wild mit einem Handtuch zuwedelte, „dein Bruder hat Internetverbot! Er spielt zu viel und macht keine Hausaufgaben! Komm her, ich gebe dir den Schlüssel zum Schrank mit dem Modem. Du darfst Muhammad allerdings nicht sein Tablet da rausgeben.“
Nafisa öffnete den Schrank, fing die Tischdecken auf, die ihr entgegenrutschten und tastete mit ihren schlanken Fingern nach dem Einstellknopf des Modems, das unter Schachteln mit Besteck und Kaffeetassen begraben lag. Diese wurden nur ganz selten für wichtige Familientreffen benutzt. Zuletzt kam auch Muhammads Tablet zum Vorschein. Die Mutter hatte es ganz hinten hinter dem Geschirr versteckt. Kaum hatte Nafisa das Tablet erblickt, zerrte der kleine Bruder auch bereits an ihrer langärmligen Bluse und suggerierte mit zum Mund gebrachtem Zeigefinger, dass sie ihn nicht verraten möge.
Nafisa entgegnete laut: „Muhammad, mach deine Hausaufgaben!“
Und aus der Küche hallte das die Aufforderung bestärkende Echo: „Mach deine Aufgaben, und zwar sofort!“
Der zehnjährige Muhammad streckte Nafisa die Zunge raus und verschwand schnell im Keller, bevor sie ihn am Kragen packen konnte. Dabei klimperten einige der fast unbenutzten Gabeln zu Boden, und Nafisa musste zuerst den Schrank wieder in Ordnung bringen, bevor sie ihn schließen konnte.
In ihrem Zimmer und auf dem Bett sitzend, surfte sie schließlich auf der Webseite von Islamic Medical Relief. Sie sah die Fotos von verletzten Kindern und weinenden Alten und las Texte über die Einsätze der Organisation im Nahen Osten. Volontäre würden gesucht, hieß es, Frauen und Männer, und wenn immer möglich mit einer medizinischen Ausbildung. Genau das hatte sich Nafisa für die Zukunft vorgenommen, wieso studierte sie Medizin, wenn nicht dazu, um ihren Mitmenschen helfen zu können? Irgendwann, sobald sie mit dem Studium weiter war, wollte sie in arme muslimische Länder reisen, um ihren Schwestern und Brüdern zu helfen.
Seit drei Jahren besuchte Nafisa regelmäßig einen Arabischkurs. Die Lehrer am ägyptischen Kulturzentrum waren stolz auf den Kairenischen Dialekt und boten daher neben den Hocharabischlektionen auch Konversation in der Alltagssprache an. Nafisa nahm daran teil und freute sich, dass sie nach den ägyptischen Filmnächten im Kulturzentrum im Unterricht auf Arabisch davon berichten konnte. Wie gerne sie doch endlich arabische Länder bereisen würde! Ob ein Volontariat bei Islamic Medical Relief ihr die Möglichkeit dazu verschaffen könnte?
„Nafisa, essen!“, tönte es von unten und sie klappte das Laptop zu. Ihre Cousine hatte bereits den Tisch gedeckt. Seit sie studierte, war Nafisa von einem Teil der Hausarbeit befreit und ihre Cousine damit beauftragt worden.
Nafisa zog sich schnell die Stecknadeln aus dem Kopftuch, wickelte es auf und ließ es auf dem Bett liegen, bevor sie nach unten eilte. Dort saß Muhammad bereits strahlend hinter einem vollen Teller und machte sich mit beiden Händen über das Hähnchen her. Der Vater packte ihn am Ärmel, blickte seinem Sohn tief in die Augen und ermahnte ihn, an Gott zu denken, bevor er mit dem Essen beginne. Muhammad machte sich los, ließ ein kurzes „Bismillah“ (im Namen Gottes) über die Lippen gleiten und biss genüsslich in das mit einer würzigen Soße überzogene Hühnerbein.
„Braver Junge!“ lobte die Mutter, strich ihm über die Haare und schöpfte ihm nach.
Abu Muhammad, das Familienoberhaupt richtete sich nun an seine Tochter: „Nafisa“, sagte er, „du bist mein Herz und meine Seele, mein Leben! Ich bin stolz auf deine Leistungen an der Uni!“
„Danke, Papa“, flüsterte es vom anderen Ende des Tisches.
Die Mutter setzte sich nun auch und hielt Nafisas Hand: „Papa und ich, wir sind beide sehr stolz auf dich! Du machst unserer Familie große Ehre, und wir danken Gott dafür, dass er uns mit einer solchen Tochter beschenkt hat.“
„Nächste Woche wirst Du dreiundzwanzig Jahre alt. Du bist also eine erwachsene Frau, und da wird es höchste Zeit, an die Zukunft zu denken“, erklang die Stimme des Vaters in feierlichem Ton. „Letzte Woche habe ich mich mit meinem Bruder Omar unterhalten. Sein Sohn hat sein Informatikstudium in Manchester abgeschlossen und ist jetzt bereit, eine Familie zu gründen.“
Nafisa lief es eiskalt den Rücken hinunter. „Heiraten?!“, dachte sie, „jetzt, wo es im Studium so gut läuft?“ Gerade erst hatte sie die Küchenarbeit an ihre Cousine delegieren können, weil sie strenge, alles entscheidende Prüfungen vor sich hatte…
Nafisa versuchte mit gespielter Naivität vom Thema abzulenken: „Iqbal ist schon fertig? Das ging aber schnell! Wann war denn die Abschlussfeier?“
„Vor zwei Monaten, und er hat auch bereits eine Stelle.“
„Und wir waren nicht zu seiner Feier eingeladen? Das ist ja erstaunlich…“, improvisierte Nafisa weiter.
Ihr Vater meinte ausweichend: „Iqbals Anstellung erfolgte so schnell, dass Omar keine Zeit hatte, für seinen Sohn eine Feier zu organisieren, aber das will er jetzt nachholen.“
„Ach, wie schön, dann werden wir also doch noch die Möglichkeit haben, ihm zu gratulieren, wie Gott es will“, fiel Nafisa ein, in der Hoffnung, vor der unaufhaltbaren Wende des Gesprächs im Erdboden zu versinken.
„Allerdings“, antwortete Abu Muhammad und blickte seine Tochter ernst an, „Iqbal ist ein guter Junge, und sein Vater Omar mein liebster Bruder. Schon als Kinder waren wir unzertrennlich. Ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Omar hat mich bei sich aufgenommen, als ich zum ersten Mal nach England kam, und mir geholfen, Arbeit zu finden. Außerdem hat er eine großartige Familie gegründet – Gott sei Dank! –, mit der wir ja immer, obwohl sie in Manchester leben, intensiv Kontakt gepflegt haben. Du mochtest Iqbal sehr als Kind.“
Nafisa erinnerte sich daran, wie ihr kleiner Cousin ihr das rote Rennauto aus Plastik weggenommen hatte mit der Begründung, dass er ein Junge sei, und darin von ihrer Mutter unterstützt worden war.
„Ja, wir haben gerne miteinander gespielt“, zischte Nafisa ganz automatisch durch die Zähne.
„Ihr hattet ja immer ähnliche Interessen“, erinnerte sich die Mutter, „ihr mochtet beide dieselben Spielsachen, wart beide sehr gut in der Schule, besonders im Fach Mathematik, und habt beide ein Studium dieser Art gewählt.“
Muhammad war unruhig geworden und stieß in seinem Unmut ein Glas um. Nafisa sprang auf, erfreut über den erlösenden Zwischenfall, und lief zur Küche, um ein Tuch zu holen. Sie ergriff einen bereits vollgesaugten Stofflappen und schickte sich gerade an, einen anderen zu suchen, als ihre Cousine mit einer Schachtel Kleenex an ihr vorbeilief. Langsam bewegte sich Nafisa aus der Küche. Alle waren mit Muhammads Orangensaft beschäftigt, und sie versuchte, ungesehen, wie ein Schatten hinter dem Tisch, an der Mauer vorbeizugleiten.
„Nafisa!“, entlarvte sie ihr Vater, „Kind, komm mit mir zum Wohnzimmertisch, ich muss mit dir reden. Nadia, mach uns doch bitte einen Tee.“
Der Vater ließ sich aufs Sofa sinken, und seine Tochter setzte sich auf den Sessel gegenüber. Muhammad war auf sein Zimmer gerannt, und die Cousine räumte klimpernd das Geschirr vom Tisch.
„Meine geliebte Tochter, liebes Kind, du bist in einer entscheidenden Phase deines Lebens…“
„Aber nein, Papa“, fiel sie ihm ins Wort, „mein Staatsexamen werde ich erst in zwei Jahren machen. Bis dahin ist noch Zeit!“
„Genau“, meinte der Vater, „da wäre es ja durchaus möglich und angebracht, vorher eine Hochzeit zu organisieren! Iqbal hat um deine Hand angehalten.“
Nafisa schluckte und der Vater fuhr fort: „Es ist dir überlassen zu entscheiden, ob du diesen Antrag annehmen willst oder nicht. Ich würde dir aber ans Herz legen, es zu tun. Iqbal ist der beste Bräutigam, den ich mir vorstellen kann, und wäre mir ein willkommener Schwiegersohn.“
„Und mein Studium?“, Nafisa unterdrückte die Tränen.
„Das ist überhaupt kein Problem. Ich habe mit Omar und Iqbal vereinbart, dass du weiterstudieren sollst. Falls du vor deinem Abschluss noch ein Kind bekommst, kannst du ja auch ein Jahr unterbrechen und dann weitermachen. Iqbals Schwester würde dich in diesem Fall unterstützen. Sie ist gerade sechzehn geworden und wird voraussichtlich in den nächsten drei bis vier Jahren noch keine eigene Familie gründen.“
„Wie viel Zeit habe ich, um es mir zu überlegen?“
„Also ich finde schon, dass du Iqbal so schnell wie möglich antworten solltest. Ach, bevor ich es vergesse, er schickt dir das.“
Abu Muhammad kramte in seiner Westentasche und zog eine kleine Schmuckdose heraus, die unter einer überdimensionalen rosa Schleife kaum zu sehen war. Nafisa befreite mit zitternden Fingern das Blech vom Stoff und hob den mit einem Herzen verzierten Deckel. Auf gelbe Watte gebettet lag ein Ring.
„Es ist ein Diamant!“, verkündete der Vater stolz.
Die Cousine kam, von Neugier getrieben, herbeigelaufen. Sie betrachtete das Juwel mit Entzücken und tanzte vor Freude über die bevorstehende Hochzeit. Nafisa war nicht zum Scherzen zumute. Sie steckte den Ring zurück in seine Dose, sagte dem Vater, dass sie noch etwas Zeit zum Nachdenken bräuchte und ging leise auf ihr Zimmer. Der Vater starrte ihr verdutzt nach. Die Mutter stellte ihm den Tee hin und strich besänftigend über seinen Arm: „Sie ist nur aufgeregt, das ist alles.“
4
Sama öffnete die Tür, herein trat Mustafa, mit dem kleinen Hassan auf den Armen. Dem Jungen ging es sichtlich besser. Der Rhythmus seines Atems war zur Normalität zurückgekehrt, sein Gesicht leuchtete wieder rosig und glänzte nicht mehr vor Schweiß. Wortlos brachte Mustafa seinen Sohn ins Bett und kehrte daraufhin ins Wohnzimmer zurück zu seiner Frau. Aischa weinte. Sama brachte den beiden Tee und zog sich dann wieder in die Küche zurück, um das Frühstück vorzubereiten.
Mustafa umarmte Aischa und beruhigte sie: „Hassan wird gesund! Die Ärzte im Krankenhaus haben ihn gut versorgt, und in dieser Plastiktüte habe ich Medikamente, welche er noch eine Woche lang einnehmen muss. Dann sollte es ihm besser gehen. Er muss aber viel Tee trinken und gut essen. Du kannst ihm ja viele von deinen leckeren Fleischbällchen machen, die wird er bestimmt mögen.“
Aischa konnte es nicht glauben. Ihre Gebete waren erhört worden!
„Wie spät ist es?“, fragte sie unvermittelt ihren Mann.
„Sechs Uhr morgens“, antwortete Mustafa.
„Maghrib schon vorbei… Ich habe den Muezzin nicht gehört! Ich muss beten!“ Aischa löste sich aus der Umarmung, rannte ins Bad, wusch Hände, Füße, Beine, Arme, Nase und Mund, strich Wasser über ihr Haar, schlüpfte unter den Tschador und verneigte sich vor dem Schöpfer, der ihr ihren Sohn in der vergangenen Nacht zum zweiten Mal geschenkt hatte.
Als sie ins Wohnzimmer zurückkehrte, hatte Mustafa bereits einen Teller Bohnenbrei verzehrt. Er erhob sich und sprach: „Meine Liebste, auch ich werde mich nun aufmachen, um unserem Herrgott zu danken und um die Brüder in der Moschee bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Sie haben uns sehr geholfen.“
„Und was ist mit den Medikamenten?“
„Ich habe Sama erklärt, was sie Hassan geben muss. Sie wird es dir zeigen, damit du unseren Sohn pflegen kannst, sobald es dir wieder besser geht.“
Mustafa verließ das Haus. Man hörte seine schlurfenden Schritte auf den Treppenstufen. Aischa eilte zum Kinderzimmer und sah, dass beide Knaben ruhig schliefen.
Es war wie vorhergesagt, Hassan erholte sich schnell, und Aischa mit ihm. Sama verweilte im Haus, bis es ihrem Neffen gesundheitlich wieder gut ging. Als die Kinder erneut gemeinsam durch die Wohnung tollten, kehrte Sama zu ihrer Mutter zurück.
Abends und manchmal auch nachts rief Aischa sie an und erzählte ihr, wie die Stille und die Einsamkeit ihr zur Last wurden. Weinend klagte sie, dass Mustafa immer später nach Hause kommen und die ganzen Freitage in der Moschee verbringen würde, ohne sich um Familienangelegenheiten zu kümmern. Daher begann Sama zwischen dem Haus ihrer Mutter und Aischas Wohnung zu pendeln, um ihrer Schwester beizustehen.
An einem Donnerstag, während Sama das Frühstück vom Tisch räumte, balgten sich Nur und Hassan unter dem Tisch. Sie spielten mit einem alten Fußball, dem es an Luftfülle mangelte und an dem die Lederwaben wie Schuppen herunterhingen. Das war gut für Hassan. Der Zweijährige konnte die Kugel an diesen Fetzen bequem greifen und ihn so seinem protestierenden Bruder vor den Füßen wegschnappen, während dieser Anlauf holte, um den Ball in ein imaginäres Tor zwischen Stuhlbein und Sofa zu befördern. Aischa spielte mit, obwohl sie das runde Spielzeug mit dem Fuß verfehlte oder sich dieses unter ihren Röcken verfing. Die drei lachten und der kleine Hassan holte den Ball flink unter Aischas Kleidern hervor.
Die Tante unterbrach jedoch das Fußballspiel, nahm den größeren der Neffen bei der Hand und ging mit ihm auf den Markt. Das war sehr spannend für Nur. An Samas Hand drängte er sich durch die schmale, dicht von Menschenmassen begangene Gasse zwischen Tischen und ausgelegten Laken, auf denen die Ware ausgebreitet war. Nur drehte sich um und machte einen langen Hals, um zwischen den Leibern der um ihn herumstehenden Menschen hindurchsehen zu können. Einen Blick konnte er erhaschen. Auf einem Pickup sah er den wendigen Händler, der vor seiner Wassermelonenpyramide posierte und die Ware anpries: „Batich! Batich!“
Sama zog Nur am Arm hin zu einer Frau, die auf einer Decke hinter zugeschnürten Plastiktüten hockte und sich mit dem losen Ende des schwarzen Kopftuchs über die Nase strich. Als sie die beiden erblickte, öffnete sie zum Gruß ihren zahnlosen Mund. Sama kaufte bei ihr ein Kilo Fladenbrot, fein säuberlich verpackt in eine rosarote Plastiktüte. Nur durfte das Brot in Empfang nehmen und nach Hause tragen, was er mit viel Stolz tat. Jetzt war er dafür verantwortlich, seinem Bruder und der Mutter das Essen zu bringen, so wie es sich für einen großen Jungen gehörte!
Vorbei an Ständen mit verschiedenfarbigem Gemüse, Nüssen und Trockenfrüchten, Oliven und anderen eingelegten Leckereien ließen sich die beiden im Fluss der munteren Menge mittreiben. Ganz am Ende dieser Allee der aufgetürmten Nahrungsmittel befand sich der Eingang zu einer alten Markthalle, wo Kleidungsstücke, Handys und Haushaltsartikel zum Verkauf angeboten wurden. Sama zog Nur hinein. Sie mussten noch eine kleine Schüssel kaufen.
Kaum hatten sie sich mit dem Verkäufer auf den Preis geeinigt, gab es einen ohrenbetäubenden Knall. Die Erde bebte. Die Glasscheiben zersprangen. Die Küchenutensilien flogen durch die Luft. Dicker Rauch brach sintflutartig mit einer zähen Masse beißender Dunkelheit über alles herein. Sama hustete und schnappte nach Luft. Menschen rannten schreiend und mit angstverzerrten Gesichtern Richtung Ausgang. Schwarze, schwitzende, um ihr Überleben kämpfende Körper sprengten die Enge des Marktes. Tische fielen zu Boden, Gegenstände flogen durch die Luft, Äpfel kullerten bis hin zu Sama und Nur. Die beiden kauerten dicht aneinandergedrückt hinter der Theke des Ladens und merkten gar nicht, wie sie zitterten. War es nicht das massive Holzmöbel, das immer noch bebte? Sama hielt ihre Arme schützend um den Neffen. Dieser versteckte sich zusätzlich unter ihrem langen, weiten Chimar, ihrem Kopftuch, und weinte leise. Sein Wimmern ging unter. Der Lärm raubte ihm gnadenlos seine Stimme.
Nach einer gefühlten Ewigkeit wurde es wieder ruhig. Die zerstörte Markthalle lag gespenstisch leer und stumm. Die Menschen, die sich versteckt hielten, trauten sich nicht zu atmen. Doch diese Totenstille wurde bald von Polizeisirenen durchbrochen. Da kletterten auch langsam wieder Frauen, Männer und Kinder unter den Trümmern hervor.
Sama nahm Nur bei der Hand und rannte los, vorbei an den Polizisten, die sie aufhalten wollten. Nur war erstaunlich schnell, die Angst verlieh ihm einen Moment lang die Kräfte eines Erwachsenen. Als er dennoch nicht mehr konnte, hob ihn die Tante hoch und trug ihn nach Hause. Erst beim Eingang zum Treppenhaus fiel Sama auf, dass Nur noch immer die rosa Brottüte an sich drückte.
„Braver Junge!“, sagte sie und fügte schnell hinzu: „ Du darfst Mama aber nichts von der Bombe erzählen, sonst wird sie wieder krank, hast du mich verstanden?“
Nur nickte. Sama strich ihm und sich selbst mit einem zerknüllten Taschentuch über das Gesicht, atmete tief durch, sagte: „Im Namen Gottes!“ und trat ein.
Aischa saß bleich vor dem Fernseher. „Ein Märtyrer hat die schiitische Moschee angegriffen, die in der Nähe des Marktes! Wo wart ihr so lange? Habt ihr nichts gehört?“
„Doch doch“, antwortete Sama, gehört haben wir es, wir waren aber bereits auf dem Weg nach Hause. Hier ist das Brot.“
„Gott sei Dank!“, sagte die Schwester etwas ungläubig.
„Es stimmt“, ergänzte Nur, wobei dies das Einzige war, was der tapfere Junge hervorbrachte.
5
„Terroristen, so wie diese Hundesöhne, die unsere Märkte und Moscheen unsicher machen, bekämpfen wir! Genau dafür wird unsere Spezialeinheit trainiert! Für Gott, den Präsidenten und das Vaterland kämpfen wir mit unserem Blut!“
„Für Gott, den Präsidenten und das Vaterland!“, hallte das Echo aus den offenen Mündern der Offiziere.
Mohsin wurde mit seinen Männern zur Moschee nahe der Grenze abkommandiert und übernahm die Berichterstattung. Wie ihm die Polizisten vor Ort mitteilten, hatten zwei Selbstmordattentäter gleichzeitig Autobomben vor schiitischen Moscheen gezündet. Die eine hier und die andere im Nachbarland. Die Terrororganisation hatte es geschafft, sich auf die andere Seite der Grenze zu schlagen und Anschläge synchron in zwei Ländern auszuführen. Die Ermittlung und der Kampf gegen die Drahtzieher dieser Attentate erforderte daher die enge Zusammenarbeit mit den Sicherheits- und Streitkräften des Nachbarlandes.
Vor Mohsin lag ein Schlachtfeld: Fünf Kinder, die in unmittelbarer Nähe des Eingangs der Moschee mit den Schuhen der Gläubigen Türme gebaut hatten, lagen in ihrem Blut, so wie auch der Aufpasser, der versucht hatte, die Schlingel vom Schuhwerk seiner Kundschaft fernzuhalten. Mohsin starrte in die fassungslosen, staubverschmierten Gesichter von Männern, die immer noch unter Schock standen.
Zurück in seinem Büro in der Kaserne, wurde er sofort damit beauftragt, die protokollierten Einvernahmen der verhafteten Dschihadisten durchzulesen. Er konnte es kaum fassen: Bereits wenige Stunden nach der Explosion konnte ihm die Polizei die ersten Geständnisse vorlegen! Eigentlich funktionierte das System doch hervorragend. Weshalb war es dann trotzdem nicht möglich, solche Attentate gänzlich zu verhindern? Papperlapapp, solche Gedanken schickten sich nicht für einen Leutnant! Er war schließlich da, um die Befehle seiner Vorgesetzten auszuführen, und die schienen ganze Arbeit geleistet zu haben. Alles war glasklar: Die Aussagen der Verhafteten stimmten mit denen der bereits inhaftierten Dschihadisten überein: Eine Zelle der Armee für den Universellen Dschihad (AUD) hatte die Attentate organisiert. Dafür gab es auch ein Bekennerschreiben. Der Hauptverantwortliche schien ein Ahmad Bin Mahmud gewesen zu sein. Nur die Identität der Selbstmordattentäter war noch unklar.
„Auch die wird sich noch finden“, dachte Mohsin, strich seine Uniform glatt, kämmte sich vor dem Spiegel das Haar und verließ sein Büro.
Er war auf dem Weg zu Taghrid. Die beiden wollten zum Hochzeitsplaner. Der Stau auf der Straße schien ihm unerträglicher denn je. Die Hitze brannte, und Mohsin konnte sich nicht dagegen wehren. Die Klimaanlage funktionierte nicht. Das Thermometer seines modernen Jeeps zeigte 45 Grad, und Mohsin tupfte sich mit dem Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Dennoch sah er nur verschwommen das Heck des verbeulten Autos, das vor ihm stand. Er hupte, so wie auch die Fahrer hinter ihm in rhythmischen Abständen ihren Missmut laut kundtaten. Mohsin versuchte, mit seinen Augen einen näheren Gegenstand zu fixieren, in der Hoffnung danach auch wieder an Sehschärfe für die Weite zu gewinnen. Sein Blick fiel auf die Gebetskette, zusammengesetzt aus blauen, bemalten Glasperlen, die böse Augen von seinem neuen Fahrzeug ablenken sollte. Sie schwang langsam am Rückspiegel hin und her, und Mohsin ärgerte sich darüber, dass die magische Kraft des Gegenstands nicht vermocht hatte, die Klimaanlage zu schützen. Irgendwie hatte er sowieso nicht an dessen Schutzfunktion geglaubt. Der zerstörerische Blick des neidischen Nachbarn hatte dadurch nicht gebremst werden können. Mohsin war wütend. Er hätte das Auto nicht vor dessen Haus abstellen dürfen. Er schaltete, rollte zwei Meter vorwärts, hupte und kam wieder zum Stehen. Die neue Pause nutzte er, um seine Uniform zu betrachten. Auf seiner Brust zeichnete sich in dunklem Khaki die Form des durchgeschwitzten Unterhemds nach. Frustriert hupte er erneut. Endlich schien die Kolonne sich wieder in ein langsames Rollen zu versetzen. Die heiße Luft strömte durch die offenen Fenster und gab Mohsin eine Illusion von Abkühlung und den Hoffnungsschimmer, dass sein Hemd noch trocknen möge, bevor er bei seiner Verlobten einträfe. Am Ende der Brücke öffnete sich der Flaschenhals, und die Autos strömten in unterschiedliche Richtungen. Taghrids Wohnung war nicht mehr weit.
Mohsin winkte einem der Autoparker, stieg aus, gab ihm seinen Schlüssel, fragte nach seinem Namen und erklärte ihm mit mahnender Stimme, dass er in fünf Minuten wieder hier sein werde.
„Geht in Ordnung!“, rief der Junge mit der blauen Mütze, „sagen Sie, haben Sie keine Klimaanlage?“
Mohsin tat, als hätte er die Frage nicht gehört, und trat ins kühlende Innere des Gebäudes. Der Lift brachte ihn in den fünften Stock, wo ihn Taghrid bereits auf einem Sofa im Wohnzimmer mit frischgepresstem Guavensaft erwartete. Mohsin trank dankbar das kalte, dicke Getränk und lud Taghrid ein, auf der Stelle loszufahren. Noch mehr als vor ihren Blicken fürchtete sich Mohsin vor denen ihres Vaters. Der sollte ihn auf gar keinen Fall in der verschwitzten Uniform zu sehen bekommen. Taghrid war einverstanden. Sie hatte diesem Moment den ganzen Tag entgegengefiebert. Kurze Strecken im Auto waren die einzigen, die das Paar vollkommen alleine verbringen durfte. Im Stau und im Schutz der Dunkelheit eines Tunnels erschlich sich Mohsin manchmal einen Kuss, und Taghrid lächelte dabei verschämt und aufgeregt. Heute war Mohsin aber nicht in Stimmung. Er dachte an die verstaubten Gesichter der Männer vor der Moschee.
Taghrid durchbrach die unangenehme Stille mit einer Beschwerde: „Ich verstehe nicht, wieso meine Mutter darauf besteht, ihre Cousinen vom Stamm Beni Hama einzuladen! Die sind einfach nur gemein, und außerdem wissen alle, dass sie den bösen Blick haben!“
„Meine Liebste, deine Mutter muss ihre Verwandtschaft einladen. Sei nur unbekümmert, an ihrer Hochzeit schützt Gott die ehrenhafte Braut vor allem Bösen!“
„So Gott will!“, murmelte Taghrid.





























