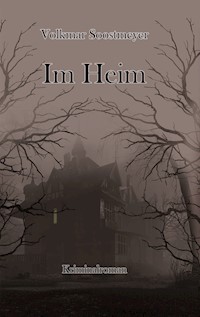
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Luise Remmers wird tot in der Seniorenresidenz "Lindenblüte" in ihrem Bett aufgefunden. Allem Anschein nach war es ein natürlicher Tod. Sabine und Jonas, die im Heim arbeiten, glauben, dass mehr hinter diesem Tod steckt und legen sich nichts ahnend bei ihren Nachforschungen mit dem Bösen an. Je tiefer sie in das Dickicht aus Habgier und Hass gelangen, desto größer wird die Gefahr für sie, darin umzukommen. Das Böse beherrschte die Vergangenheit und prägt das Jetzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Autor:
Volkmar Soostmeyer wurde 1962 in Weyhe, das südlich von Bremen liegt, geboren.
Er ist Polizist in Bremen und lebt gemeinsam mit seiner Frau Sabine in Syke.
Vor mehr als 20 Jahren hat der den Gedichtband „Verborgenes“ und 2016 das Märchenbuch „Acht Kostbarkeiten“ veröffentlicht.
Für Sabine in großer Dankbarkeit
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
11.03.1944
Kapitel 2
14.03.1944
Kapitel 3
16.04.1944
Kapitel 4
16.04.1944
Kapitel 5
20.04.1944
Kapitel 6
07.06.1944
Kapitel 7
14.06.1944
Kapitel 8
14.06.1944
Kapitel 9
03.07.1944
Kapitel 10
05.07.1944
Kapitel 11
06.07.1944
Kapitel 12
08.07.1944
Kapitel 13
(1)
Jonas Kaufmann zog die Wohnungstür hinter sich zu und ging zu seinem betagten Ford Fiesta, der am Fahrbahnrand stand. Es war ein nasskalter Februarmorgen und er fror, äußerlich, aber auch innerlich wurde ihm nicht warm. Er startete das Fahrzeug und fuhr an. Der einsetzende Regen peitschte gegen die Windschutzscheibe seines Autos. Das Radio war eingeschaltet und spielte Musik. Jonas legte den Weg zur Arbeit wie im Schlaf zurück und hing derweil seinen Gedanken nach. Früher einmal liebte er seinen Beruf als Altenpfleger und immerhin war er nun im zehnten Jahr in der Seniorenresidenz „Lindenblüte“ beschäftigt, aber die letzten Jahre hatten sehr an seinen Kräften gezehrt. Gab es zum Beispiel einstmals einen festen, verlässlichen Dienstplan, so sprang man heute hin und her und das vorwiegend auf Zuruf des Pflegedienstleiters. So war es auch an diesem Morgen, denn anstatt eines freien Tages, der nach dem anstrengenden Wochenende so wichtig gewesen wäre, folgte ein sogenannter außerplanmäßiger Frühdienst. Das hatte er gestern kurzfristig erfahren. Sarkastisch dachte er, ist ja erst der achte Dienst in Folge. Da ging bestimmt noch was. In der Freizeit gibt man nur Geld aus, eine gute Rechtfertigung für die fortwährende Unterbezahlung. Außerdem würden freie Tage, insbesondere die am Wochenende, sowieso überbewertet. Das Leben war eben kein Ponyhof. Süffisant wurde dieser Umstand zusätzlich durch den Spruch: „Altenpflege ist eben kein Zuckerschlecken“ untermalt, den der Pflegedienstleiter gestern hinterherschob, als er ihn über die kurzfristige Dienstplanänderung informierte. Seniorenpflege war eben mehr als ein Beruf; es war eine Berufung, der man seine privaten Belange jederzeit unterzuordnen hatte. Erst das Heim und dann erstmals gar nichts, so meinte der Pflegedienstleiter seine Mitarbeiter oder, wie er gerne zum Besten gab, seine Untergebenen zu überzeugen versuchte. Jonas schauderte bei diesem Gedanken und wünschte, er hätte damals einen anderen Beruf gewählt, aber mit Ende dreißig fühlte er sich zu alt dafür. Noch einmal ganz von vorne anzufangen, dafür war er zu feige. Schade, dass man über seinen einstigen Traum als Altenpfleger nun so denken musste. Dabei war das am Anfang mal ganz anders. „Wann ist mir bloß der Idealismus abhandengekommen?“, fragte er sich.
Jonas wohnte in Siekhausen, eine Kleinstadt irgendwo in Norddeutschland, und er fuhr allenfalls 10 Minuten mit dem Auto bis zum Heim. „Heim“ nannten sie sie alle, die Seniorenresidenz „Lindenblüte“. Die Bezeichnung war kurz, prägnant und lies offen, ob man etwas Positives oder Negatives damit verband. Das Seniorenheim lag außerhalb von Siekhausen und irgendwo im Nirgendwo. Die nächste Einkaufsmöglichkeit war zwei Kilometer entfernt und ansonsten bot die Umgebung der Einrichtung das gewisse Nichts, eine Kombination aus Ackerflächen und Kuhweiden, die durch Buschwerk getrennt wurden. Das nächste Wohnhaus lag einige hundert Meter entfernt.
Jonas lenkte sein Gefährt auf den Mitarbeiterparkplatz, der sich im Randbereich des Heimes befand, mit groben Schottersteinen versehen und nur durch provisorisches Licht spärlich ausgeleuchtet war. Die schief stehenden Lampen waren seinerzeit auf Initiative des ehemaligen Heimleiters gegen jeglichen Widerstand, ausgehend von der Geschäftsführung, angeschafft worden. Wenn es den Mitarbeitern zu dunkel war, könnten sie ihren Weg mit Taschenlampen ausleuchten, so war der gönnerhafte Ratschlag der Geschäftsführung. Taschenlampen gehörten allerdings nicht zum Equipment des Hauses und müssten aus eigener Tasche finanziert werden. Über Batterien wurde gar nicht erst diskutiert, obwohl die im Heim vorrätig gewesen wären. Um zum Haupteingang zu gelangen, überquerte er, leise vor sich hin fluchend, da es immer noch regnete, den Besucherparkplatz, der aufwändig gepflastert und hell ausgeleuchtet vor ihm lag. Hier hatte man keine Kosten und Mühen gescheut. Der Name „Besucherparkplatz“ war schon merkwürdig gewählt, denn zwei von insgesamt acht Parkplätzen waren dem Notarzt- und Rettungswagen vorbehalten. Das ergab durchaus Sinn, denn die Abstellflächen mussten so ausgewählt werden, dass die Fahrzeugbesatzungen den kürzesten Weg ins Haus hatten. Wer möchte schon eine Bahre querfeldein und über einen geschotterten Platz tragen bzw. fahren? Gehörten Notärzte und Rettungssanitäter aber wirklich zu den Besuchern im wahrsten Sinne des Wortes? Neben den Abstellflächen für die notärztliche Versorgung hatte man für den Heimleiter, Herrn Viktor Ohlsen, und den Pflegedienstleiter, Herrn Peter Becker, zwei weitere Stellflächen reserviert. Also blieben noch vier weitere Parkplätze für tatsächliche Besucher. Irgendwie grotesk, dass diese beiden Herren, die Vorsteher des Heimes, einen Besucherstatus und somit die Berechtigung zum Parken auf dem Besucherparkplatz erhielten. Allein die Parkplatzzuteilung spiegelt die mangelhafte Wertschätzung für alle anderen Kollegen wider. Aber über allem thronte der Sinnspruch, den der Heimleiter bei fast jedem Treffen mit den Kollegen zum Besten gab, denn man befände sich schließlich allesamt in einem Boot. Obwohl, in einem Boot zu sitzen, bedeutet erstmal nichts, da nicht unterschieden wurde, wer sich fahren lässt und wer ohne Unterlass die Paddel betätigte und sich dabei Schwielen an den Händen holte. In Jonas Vorstellungen kam das Bild einer Galeere zum Vorschein; einer saß an der Trommel und gab den Takt an und die anderen ruderten. Welche Rolle ihm auf diesem Schiff zugedacht wurde, war natürlich die des an Ketten befindlichen Ruderers. Letztendlich war es auch gleichgültig, denn wie sagte mal der Chef in angeheiterter Stimmung beim letzten Betriebsfest zu ihm: „Hättest in der Schule besser aufpassen sollen, dann wärest du heute auch Heimleiter.“ Das sollte wohl witzig klingen. Viel verletzender als der blöde Spruch war das süffisantarrogante Lachen der Überlegenheit des Heimleiters, das diese Lebensweisheit wohl zu unterstreichen versuchte. Herr Ohlsen oder „der schöne Viktor“, wie man ihn auch in Kollegenkreisen nannte, war eben ein Ausbund an Humor und Empathie. Jonas wusste nicht genau, wen er weniger mochte, den schönen Viktor oder seinen speichelleckenden Kettenhund, der immer zum Zubeißen bereit war und sich Pflegedienstleiter nannte. Er war der große Erfüllungsgehilfe und wäre in Deutschlands dunkelsten Stunden durchaus bedeutend gewesen, denn zu dieser Zeit machten genau diese Menschen eine steil aufsteigende Karriere. Und die braune Uniform verursachte dabei den nötigen Glanz. Während Ohlsen immer im maßgeschneiderten Anzug erschien und ständig darauf bedacht war, gepflegt wie ein männliches Mannequin aufzutreten, dessen schwingender Gang ein wenig zu affektiert selbst für einen Laufsteg wirkte, so war Becker fast genau das Gegenteil; übergewichtig, überhaupt nicht eitel und eher mit dem Hang zum Ungepflegten behaftet, mit schlurfendem Gang und dann mit diesem kalt-herzlosen Blick ausgestattet, der die aufgesetzte Nickelbrille unterhalb der Augenpartie entbehrlich erschienen ließ, denn durch die schaute er so oder so nicht. Auch die Haarpracht unterschied die beiden, während Ohlsen sein Haar bis zur letzten Spitze mit Pomade versah, sodass es dunkelblond glänzte, trug Becker aufgrund aufkommender Glatzenbildung das restliche, fettige Haar in langen Strähnen, die zottelig an seinen Kopfseiten herunterfielen.
Jonas betrat den Eingangsbereich des Heimes, lugte in das leere Schwesternzimmer der unteren Etage hinein und wunderte sich, dass Natalie ihn nicht erwartete. Stattdessen leuchtete die grüne Lampe auf dem Flur vor Luise Remmers Zimmer. Natalie war also bei Frau Remmers. Früher war das Haus mit drei Nachtwachen besetzt, aber im Zuge von Einsparmaßnahmen wurde auf eine dritte Kraft verzichtet. Natalie war Anfang vierzig und schob eine Nachtwache nach der anderen, da ihr Lohn ohne die Nachtzulagen zu gering ausfiel, um ihren Sohn und sich ein einigermaßen erträgliches Leben bieten zu können. Dabei gehörte weder ihr Sohn noch sie zu denen, die ein ausschweifendes Leben führten. Obwohl alles teurer wurde, hatte man wohl vergessen, ihren Lohn entsprechend anzupassen. Natalie hatte einen Arbeitsvertrag, der vom Tarifrecht abgekoppelt war, sodass das Merkmal „Billigarbeitskraft“ eins zu eins auf sie zutraf. Jegliches Ansinnen einer Lohnerhöhung war mit dem demütigen Gang zum Seniorenheimleiter verbunden, der dann versuchte, besonders mildtätig zu erscheinen und versprach, alles dafür zu tun, dass es bald mehr Geld für sie gäbe. Dabei wies er schon mal vorsorglich auf die bedenklichen wirtschaftlichen Zustände des Heimes hin und wie schwer es für ihn sein würde, auch die Geschäftsleitung von einer Lohnerhöhung zu überzeugen. Am Ende flossen dann neun Cent für jede Stunde mehr in die Haushaltskasse des Mitarbeiters. Der Vorteil der Tarifverhandlungen war, dass die Konditionen, zu denen natürlich vorwiegend auch Lohnerhöhungen gehörten, in schöner Regelmäßigkeit zwischen den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden für eine Vielzahl von Mitarbeitern ausgehandelt wurden, ob das nun der Geschäftsleitung gefiel oder nicht.
Jonas beschloss, sich zunächst umzuziehen und musste bei dem Gedanken daran lächeln, dass selbst die Zeit des Umkleidens nicht als Arbeitszeit anerkannt wurde. Ohlsen schlug vor, mit der weißen Kluft in den Feierabend zu gehen, bzw. mit ihr auch zum Dienstantritt erscheinen zu können. Er wusste selbst zu genau, dass das niemand wirklich machte und außerdem aus Gründen der Hygiene sowieso verboten war. Wem das nicht passt, der könne sich vertrauensvoll an den Betriebsrat wenden. Der schöne Viktor hatte die aufbegehrenden Kollegen nicht ohne Hintergedanken an die Betriebsratsvorsitzende, Silke Schacht, verwiesen. Sie war freigestellt, und der Sinn dieser Freistellung war, dass sie sich vollkommen den Geschicken der Mitarbeiter widmen konnte. Natürlich gehörte auch zu diesen Aufgaben, die Leitungen davon zu überzeugen, die Umkleidezeiten als Dienstzeiten zu klassifizieren. Ein einziger Blick in die im Internet einschlägigen Bestimmungen hätten ihr den richtigen Weg gewiesen. Silke Schacht war aber anderer Natur, weil sie ja nun gewählt worden war und nun glaubte sie fortwährend daran, dadurch eine exponierte Stellung ganz in der Nähe zur Leitung zu besitzen. Bedauerlicherweise vergaß sie schnell, dass sie damals die einzige Kandidatin gewesen war, ihr Amt nur auf Zeit ausgelegt war und der Sinngehalt ihres beruflichen Daseins darin lag, die Interessen der Mitarbeiter zu vertreten und um somit als Gegenspielerin zur Geschäftsleitung und zur der Leitung des Seniorenheims zu fungieren. Natürlich war sie dem Dreigestirn Geschäftsführerin, Ohlsen und selbst Becker intellektuell völlig unterlegen und genau dieser Umstand, dessen Erkenntnis sie ihrer Bauernschläue zu verdanken hatte, führte zu einem Kurs, der eine Konfrontation mit den Leitungen völlig ausschloss. Dass an ihren Händen und Beinen keine Fäden, wie sie Marionetten zu tragen gedenken, zu erkennen waren, war das einzig Bemerkenswerte an ihr. Leider kamen erst die Kollegen zu dieser Erkenntnis ihrer völligen Unfähigkeit, als die Wahl bereits abgeschlossen war. Das minderte natürlich die Chancen für eine Wiederwahl, denn, wenn sich einer ihrer Konkurrenten in der Wahl als Vierbeiner, der ggf. sogar zu bellen wusste, präsentiert hätte, hätte es an ihrer erfolgreichen Neuwahl erhebliche Zweifel gegeben.
Die Göttin, die alles überstrahlte und die dem Zirkel der Führungskräfte vorstand, hieß Frau Hilke Kasper-Leuser. Sie war die Geschäftsführerin des allgemeinnützigen Konsortiums und wurde wenig liebevoll kurz „die Laus“ genannt. Man war gut beraten, ihr aus dem Weg zu gehen. Eine Frau Mitte Fünfzig, immer adrett im Kostüm gekleidet und geschminkt, als hätte sie einen zweiten, etwas anrüchigen Beruf. Den hatte sie natürlich nicht, aber anstatt eines Herzens hatte man ihr einen Stein einoperiert. Für das Verkaufen ihres Lachens hat sie sicherlich mehr erhalten als seinerzeit Tim Thaler für das seine. Das, was „die Laus“ besonders gut konnte, war, mit Zahlen zu jonglieren, in Ungnade gefallene Mitarbeiter, und selbst wenn es sich um Führungskräfte handelte, auszutauschen und vor allem war sie befähigt zu sparen, natürlich zulasten der Bewohner und jeglicher Betreuungskräfte. Soweit Jonas einzuschätzen wusste, betraf die Sparwut nicht das eigene Gehalt der „Laus“, denn dem zeigte sie sich durchaus wohlwollend gegenüber. Ohlsen bewunderte „die Laus“, widersprach nie und zeigte sich stets demütig. Wenn er mit der „Laus“ durch die Flure des Heimes schritt, meinte man eine Duftnote von Unterwerfung, anstatt seines sündhaft teuren Parfüms, wahrnehmen zu können. Der Becker durfte sich manchmal auch im Dunstkreis dieser Technokraten aufhalten. Man erwartete aber, dass er den gebührenden Abstand hielt und nur antwortete, sofern er gefragt wurde. Jonas glaubte zu wissen, dass ihm niemals eine Frage gestellt worden war. In einem Hotel hatte er mal einen sogenannten „stummen Diener“ gesehen. Jonas hatte ihn sofort Becker genannt, aber dann fiel ihm auf, dass stumme Diener einen Anzug in Form halten sollen, und Becker war alles, aber kein Anzugträger und in Form war er auch nicht, es sei denn, man betrachtete sein Übergewicht in diesem Zusammenhang. Jonas schaute erneut ins Schwesternzimmer, das immer noch unbesetzt war. Also ging er den langen Flur entlang, um nach Natalie und Frau Remmers zu schauen.
11.03.1944
Endlich. Ich habe Geburtstag und bin zehn Jahre alt geworden. Mama schlich ganz früh morgens in mein Zimmer, setzte sich auf die Bettkante und strich mir liebevoll durch mein Haar, so als wolle sie mich besonders sanft wecken. Das war aber gar nicht nötig, denn ich war längst wach, tat aber so, als wenn ich noch schliefe. Ich streckte und reckte mich und rieb mir den Schlaf aus den Augen. Mama sagte mit leiser Stimme: „Mein kleiner Liebling. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Möge die Sonne immer für dich scheinen und mögest du die Sonne immer im Herzen tragen. Ich bin so froh, dass es dich gibt.“ Dann küsste sie mich auf die Stirn und legte mir ein kleines, quadratisches Päckchen auf die Bettdecke. „Das ist für dich. Ich hoffe, es gefällt dir“, flüsterte sie mir ins Ohr. Ich tastete nach dem Päckchen, hielt es in der Hand und fühlte durch das Papier, dass sich etwas Weiches darin befinden musste. Behutsam befreite ich den Inhalt vom Papier, achtgebend, dass das Geschenkpapier nicht einriss. Das muss ich wohl von meiner Mutter geerbt haben, denn sie achtete ebenfalls darauf, das Geschenkpapier nicht zu beschädigen, um es dann sorgfältig zusammenzufalten, da man es ja wiederverwenden könne. Ich glaube, manchmal hat sie es auch gebügelt, um die Knitter zu entfernen, damit es wieder ganz glatt aussah. „Ja“, juchzte ich, „endlich habe ich es, ein eigenes Tagebuch und dann noch in weichem Leder eingebunden. Das habe ich mir schon so lange gewünscht“. Dazu bekam ich noch einen Füllfederhalter von meiner Schwester Klara, die vier Jahre älter war als ich.
Ich schrieb die ersten Zeilen ins Tagebuch, in denen ich schilderte, wie Mama und Klara mich so reich zu meinem zehnten Geburtstag beschenkten. Alles, aber auch alles, was ich von nun an erlebe, schreibe ich auf. Das Tagebuch ist mein enger Vertrauter, mein Seelentröster und vor allem, mein wahrhaftiger, verschwiegener Freund. Niemand, aber auch niemand, sollte den Inhalt je zu lesen bekommen, das hatte ich mir fest vorgenommen. Meine Gedanken gehören nur mir allein und jetzt natürlich auch meinem neuen Freund. Die Freundschaft zwischen uns soll bis zur letzten Seite halten und darüber hinaus. Dass dieses Tagebuch noch einmal so bedeutsam werden würde, konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen.
(2)
Jonas betrat das Zimmer der Luise Remmers. Sie bewohnte als wohlhabende alte Dame eines der wenigen Einzelzimmer im Haus. Von 30 Zimmern gab es 25 Doppel- und tatsächlich nur 5 Einzelzimmer. Menschen, die Deutschland aufgebaut, ihre ganze Arbeitskraft geopfert und sich zum Teil ein überschaubares Vermögen erwirtschaftet hatten, wurden auf dem letzten Weg in einem Doppelzimmer untergebracht und das häufig zusammen mit einem anderen Bewohner, der ihnen gänzlich unbekannt war. Manchmal wurden sie auch einfach so aus ihrem Leben gerissen, weil die Angehörigen meinten, sich nicht mehr um sie kümmern zu können. Das eigene Familienleben, die Doppelbeschäftigung im Beruf, der ausgeprägte Freundeskreis und der Familienurlaub standen einer häuslichen Betreuung der Eltern im Wege. Außerdem wurden Vater oder Mutter immer vergesslicher und da die eigenen Kinder keine Beaufsichtigung mehr benötigten, für die man ja die Großeltern damals gut verwenden konnte, fehlte es an einem weiteren Grund, diese in ihrem Zuhause zu belassen. Das schöne elterliche Haus konnte man doch anderweitig besser verwenden und wenn es denn nur für Mieteinnahmen genutzt wurde, so war dieses Geld doch willkommen für die eigene Lebensfinanzierung. Oftmals reichten die Renten oder Pensionen der Alten aus, um den Heimplatz zu finanzieren und wenn nicht, wurde so lange gesucht, bis man ein günstiges Seniorenheim gefunden hatte und da Doppelzimmer nun einmal kostengünstiger waren, wurden die bevorzugt genommen. Immerhin wäre Mutter dann nicht mehr so allein, als wenn sie ein Einzelzimmer bewohnte. Darin drohte man ja sprichwörtlich zu vereinsamen. Dann wiederum gaukelten die Angehörigen ihnen vor, dass sie nur für eine Kurzzeitpflege im Heim bleiben müssten, weil man zum Beispiel das Zuhause renovierte. Danach wäre alles wieder so wie früher. Leider war dies ein Trugschluss, denn eine Heimkehr war nie wirklich vorgesehen, da die Renovierungsarbeiten für die Bedürfnisse der neuen Bewohner des Hauses notwendig gewesen waren. Vorher wurden natürlich alle Eigentumsverhältnisse in Form von Hausumschreibungen neu geregelt. Angehörige spielten eine besondere Rolle, denn sie waren es, denen die Unzulänglichkeiten im Umgang mit den Bewohnern auffallen müssten und die, die Einhalt gebieten, wenn etwas schiefläuft oder die Gesamtversorgung zu wünschen übrigließ. Wie soll sich denn ein an Demenz erkrankter Bewohner gegen Fehlbehandlungen effektiv wehren? Fatalerweise war immer häufiger zu bemerken, dass die Missstände fehlerhaft interpretiert wurden, und man die zweifelhaften Zustände unkommentiert hinnahm.
Das erste, was Jonas jetzt wahrnahm, war eine völlig verstörte Natalie, die ihre Hände vors Gesicht hielt und bitterlich weinte. Sie stand inmitten des Raumes, den Luise Remmers bewohnte, und verdeckte durch ihren Körper den freien Blick auf das Kopfende von Frau Remmers Bett. Er trat an das Bett und jetzt begriff er erst: Frau Luise Remmers war nicht mehr am Leben, sondern tot. Nie würde er den Gesichtsausdruck der toten Luise Remmers vergessen. Ihre Augen waren weit aufgerissen und der versteinerte Blick war nach oben zur Zimmerdecke gerichtet, als würde dort etwas gesucht werden. Jonas interpretierte den Blick, als verriete er totale Überraschung, die mit purer Angst gepaart war. Der Mund stand weit offen, so als würde jemand vergeblich nach Luft ringen. Das gesamte Gesicht war verzerrt und drückte alles andere aus, als wäre Luise Remmers friedlich eingeschlafen. Es war starr vor empfundenem Schmerz. Dem Gesamteindruck passten sich die Hände an, denn sie hatten sich fest in die Bettdecke gekrallt. Wäre das Blut nicht schon längst aus ihnen gewichen, so hätte man das Weiße der Handknöchel auch mit Blut in den Adern erkennen können. Alles wies darauf hin, dass sich die Finger mit größter Kraftanstrengung an die Bettdecke klammerten, um diese nie mehr wieder loslassen zu müssen. Die Füße hatten sich von der Bettdecke frei gestrampelt und lugten nun aus ihr hervor. Selbst die Zehen hatten sich verkrampft und gruben sich ins Bettlaken hinein. Der gesamte Körper schien immer noch unter immenser Anspannung zu stehen und schien nach wie vor bereit zu sein, jederzeit zu bersten. Zum Gesamteindruck passte auch das völlig zerwühlte Bettlaken. Der Kopf der Toten lag auf einem Kopfkissen, das offensichtlich seitlich zur Wand hin verrutscht war. Jonas wusste sofort, dass Frau Remmers lange mit dem Tod gerungen haben musste, aber schließlich den letzten Kampf ihres Lebens verloren hatte.
Jonas wurde aus seinen Beobachtungen herausgerissen, da Natalie stammelte, dass sie jetzt den Arzt, Dr. Waldheim, zwecks Leichenschau benachrichtigen müsse. Ob Dr. Waldheim wirklich promoviert hatte, war nicht bekannt, aber jeder nannte ihn Doktor, wie man es zu jedem Arzt sagte, unabhängig davon, ob eine Promotion vorlag oder nicht. Herr Waldheim war der sogenannte Hausarzt des Seniorenheimes und behandelte alle Bewohner gleichermaßen inkompetent. Er hatte zwar seine Praxis in Siekhausen, an der es allerdings an Patienten mangelte, da ihn niemand für ausreichend fachkundig hielt. Jonas war einmal in seiner Behandlung, entschied sich aber direkt danach dafür, Waldheim nur noch dann aufzusuchen, wenn ihm der Hals kratzen würde. Landläufig wurde gesagt, dass er zu jedem seiner Patienten die Behandlungsmethode: „Spritze oder Dragee“ bereithielt. Eine weiterführende Behandlungsmethode befand sich nicht in seinem Repertoire und entsprach nicht seinem Budget. Das Alleinstellungsmerkmal des Seniorenhausarztes war sein finanzielles Standbein, auf dessen Einnahmen er unmöglich verzichten konnte. Um überhaupt einen Patientenstamm aufrechtzuerhalten, war Waldheim dafür bekannt, in seiner Praxis für Allgemeinmedizin „gelbe“ Scheine in Hülle und Fülle über jeglichen, beliebigen Zeitraum auszustellen. Deshalb galt er auch als Fachmann für den berühmten „gelben“ Urlaub. In Deutschland gilt zwar allgemein die freie Arztwahl, die Bewohner des Heimes hatte man davon allerdings wohl nicht unterrichtet, sodass Dr. Waldheim der Arzt für alle Fälle war und bevor jemand ins Krankenhaus eingewiesen wurde, musste er an Waldheim vorbei. Das war schwer genug, sodass zu befürchten war, dass der eine oder andere Bewohner am Unwillen des Arztes nicht nur scheiterte, sondern auch an den Folgen verstarb. Jonas wusste, dass Dr. Waldheim wie immer die natürliche Todesursache bei Frau Remmers feststellen würde. Selbst wenn sie ein Messer im Rücken trüge, wäre er geneigt, dieses als Unfall zu deklarieren. Sie könnte ja auch immerhin hineingefallen sein. Außerdem war das Ausstellen von Todesbescheinigungen ein lukrativer Nebenerwerb mit viel Lohn für wenig, eigentlich gar keine Arbeit.
Wenig später erschien Dr. Waldheim im Zimmer der Luise Remmers, schaute sich die Tote kurz an, murmelte etwas und setzte sich sofort daran, den natürlichen Tod schriftlich zu attestieren. Wenn Waldheim aufgrund seines mittlerweile betagten Alters alles so langsam vergaß, die passenden Formulare hatte er immer dabei. Jonas war während der ausgeprägten Leichenschau anwesend. Ihm war aufgefallen, dass Waldheim noch nicht einmal die Tote angefasst hatte und alles aus gebührender Entfernung beurteilte.
Dr. Waldheim verließ nach gefühlten fünf Minuten das Zimmer, wovon er vier davon mit dem Ausfüllen beschäftigt war. Jonas bemerkte den Weggang des Arztes kaum, denn er konnte sich noch nicht von Frau Remmers trennen. Das Verabschieden von einem Bewohner fiel ihm dieses Mal besonders schwer. Zwar machte ihm der Tod eines Bewohners nichts mehr aus, da der Sensenmann in regelmäßigen Abständen zu Besuch kam, auch ohne, dass für ihn ein Stellplatz auf dem Besucherparkplatz reserviert wurde. Aber bei Luise Remmers war es fast so, als wäre Jonas leibliche Oma plötzlich und unerwartet verstorben.
Er wusste, dass die Zeit, die er in Luises Zimmer verbrachte, zulasten der Versorgung der übrigen Bewohner ging. Entgegen seines sonstigen Pflichtbewusstseins war es ihm jetzt aber einerlei. Letztlich ging er dann doch zur Zimmertür, blickte noch einmal auf Luise zurück und trat auf den Flur, um endlich mit seiner eigentlichen Arbeit beginnen zu können. Er vergaß zunächst sogar Natalie und die damit verbundene notwendige Übergabe, glaubte aber, als er sich an sein Versäumnis erinnerte, dass einer seiner Kollegen den Informationsaustausch in der Zwischenzeit übernommen hatte. Übergaben waren wichtig und gehörten zu jedem Schichtwechsel zwingend dazu.
Plötzlich hielt er inne, denn irgendetwas kam ihm in Luises Zimmer merkwürdig vor. Er wusste nur im Moment nicht, was es war.
14.03.1944
War das ein schöner Geburtstag. Mama hatte den ganzen Tag frei und nachmittags gab es einen Topfkuchen. Ich konnte es kaum abwarten, aus der Schule zu kommen und in mein Tagebuch zu schreiben. Es ist so schön, dass mein Tagebuch mit meinem zehnten Geburtstag beginnt, dachte ich bei mir. Ein runder Geburtstag eben, und ich muss bei dem Gedanken, dass es mein erster „runder“ war, lächeln.
Aber nun ist der Tag vorbei und Klara und ich müssen wieder vor der Schule zu unseren Nachbarn gehen. Das sind die Lehmanns, die zwei Häuser weiter wohnten. Mama muss schon ganz früh zur Arbeit und manchmal kommt sie erst spät abends davon zurück. Mama will nicht, dass wir allein zu Hause bleiben, weil die Stadt, in der wir leben, immer häufiger bombardiert wird, und wenn sie dann nicht da ist, hat sie Angst, dass uns etwas passiert. Neuerdings möchte sie auch, dass wir nach der Schule zu den Lehmanns gehen. Wir sollen dort warten, bis sie uns von der Arbeit von dort abholt. Sie sagt, dass die Stadt vor einiger Zeit überflutet wurde, weil man einen Staudamm gesprengt hätte. Zwar befand sich unser Haus auf einer kleinen Anhöhe, aber die Flut hat Mama noch ängstlicher gemacht, obwohl das Wasser damals unser Haus gar nicht erreichte. Ich weiß, dass in der Flut viele Menschen gestorben sind. Das Wasser war auf einmal da und kam von überall her, hat alle überrascht und alles mitgerissen, was sich ihm in den Weg gestellt hatte.
Frau Lehmann ist eigentlich ganz nett und herzlich, nur ihr einziger Sohn Karl, der gerade sechzehn Jahre alt geworden ist, ist irgendwie eigenartig. Herr Lehmann ist vor ein paar Jahren gestorben. Frau Lehmann sagt, dass der Franzmann ihm feige in den Rücken geschossen hat. Sie hasst die Franzosen und alles, was irgendwie Französisch ist. Irgendwann klingelten dann zwei Männer an Frau Lehmanns Haustür, brachten ihr Mitgefühl zum Ausdruck und sagten, dass Herr Lehmann heldenhaft für Führer, Volk und Vaterland gestorben sei. Ob das Frau Lehmann wirklich getröstet hatte, weiß ich nicht.
Nun lebt sie allein mit ihrem Sohn in diesem großen Haus. Seit Herr Lehmann nicht mehr da ist, darf Karl alles, und er weiß das auch und nutzt das aus. „Er sei jetzt schließlich der Mann im Haus und somit könne er über alles bestimmen, wie sein Vater vorher auch“, sagt er dann, und der Stolz in seinem Gesichtsausdruck, wenn er das gesagt hatte, war unverkennbar. Manchmal habe sie den Verdacht,





























