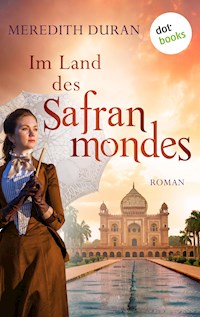
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie scheint alles verloren zu haben – auch ihre Hoffnung auf Glück? Der Exotikroman »Im Land des Safranmondes« von Meredith Duran als eBook bei dotbooks. Indien, 1857. Auf dem Weg zu ihrem Verlobten erleidet die junge Emmaline Schiffbruch und verliert ihre Eltern an die raue See. Und nicht nur das: Ihr Verlobter, für den sie die gefährliche Reise ins schillernde Delhi auf sich nahm, erweist sich als Frauenheld und Mitgiftjäger. Kann das Land des leuchtenden Safrans und des duftenden Sandelholzes noch etwas Gutes für sie bereithalten? Als sie auf einem Ball Julian Sinclair kennenlernt, den Marquess of Holdensmoor, scheint das Glück ihr endlich hold: Julian verliebt sich ebenso heftig in Emmaline, wie sie in ihn. Doch während die beiden noch gemeinsame Pläne schmieden, bricht in Indien der Sepoy-Aufstand aus, in dessen Wirren sie sich verlieren … Wird es zwischen Emmaline und Julian je ein Wiedersehen geben? Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Indien-Roman »Im Land des Safranmondes« von Meredith Duran voller Gefahr und Sehnsucht ist eine köstliche Mischung aus Liebes- und historischem Roman. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch:
Indien, 1857. Auf dem Weg zu ihrem Verlobten erleidet die junge Emmaline Schiffbruch und verliert ihre Eltern an die raue See. Und nicht nur das: Ihr Verlobter, für den sie die gefährliche Reise ins schillernde Delhi auf sich nahm, erweist sich als Frauenheld und Mitgiftjäger. Kann das Land des leuchtenden Safrans und des duftenden Sandelholzes noch etwas Gutes für sie bereithalten? Als sie auf einem Ball Julian Sinclair kennenlernt, den Marquess of Holdensmoor, scheint das Glück ihr endlich hold: Julian verliebt sich ebenso heftig in Emmaline, wie sie in ihn. Doch während die beiden noch gemeinsame Pläne schmieden, bricht in Indien der Sepoy-Aufstand aus, in dessen Wirren sie sich verlieren … Wird es zwischen Emmaline und Julian je ein Wiedersehen geben?
Über die Autorin:
Meredith Duran hatte schon immer ein reges Interesse an englischer Geschichte. Sie hat einen Doktortitel in Anthropologie und begeistert sich besonders für das Schicksal unerschrockener Frauen aus dem 19. Jahrhundert. Ihr Roman »Im Land des Safranmondes« wurde als einer der besten historischen Liebesromane des Jahres ausgezeichnet.
Die Website der Autorin: meredithduran.com
***
eBook-Neuausgabe Februar 2022
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2008 unter dem Originaltitel »The Duke of Shadows« bei Pocket Star Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Das Leuchten des Safranmondes« bei Weltbild.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2008 by Meredith McGuire
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with the original publisher, Pocket Books, a division of Simon & Schuster, Inc., New York.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2010 Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg
Copyright © der Neuausgabe 2021 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock / Kateryna Yakovlieva / Amit kg / AlexAnton / Gayvoronskaya_Yana / Nina Lishchuck
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ae)
ISBN 978-3-96655-790-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Liebe Leserin, lieber Leser, in diesem eBook begegnen Sie möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. Diese Fiktion spiegelt nicht unbedingt die Überzeugungen des Verlags wider.
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter.html (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Im Land des Safranmondes« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Meredith Duran
Im Land des Safranmondes
Roman
Aus dem Amerikanischen von Ulrike Laszlo und Karin Dufner
dotbooks.
Prolog
»Ich will nicht!« Ihre eigene Stimme hörte sich für sie seltsam an. Heiser und dunkel. Sie hatte so viel Salzwasser geschluckt, dass ihr Nase und Kehle brannten, als hätte man sie mit Lauge gespült. Mühsam hustete sie. Hinter dem Rumpf des gekenterten Ruderbootes tanzten die Wellen in einer endlosen Reihe, die sich bis zum Horizont erstreckte.
Lass einfach los.
Sie bewegte ihre beinahe abgestorbenen Finger, die von der Sonne gerötet und aufgeraut waren, denn sie klammerte sich nun schon seit Stunden an das gekenterte Rettungsboot des Kapitäns. Es war ihr sogar gelungen, den Oberkörper auf den Rumpf zu hieven. Eine Weile hatte sich ein Mann an der anderen Seite festgehalten – ein anderer Überlebender, der wie sie vom Bug des sinkenden Dampfers gesprungen war. Er hatte gedacht, dass es ihm vielleicht gelingen würde, das Boot aufzurichten, wenn sich die See endlich beruhigte.
Doch es war ihm nicht einmal mehr die Zeit für einen Aufschrei geblieben. Eine Welle war über sie hinweggebrandet, sodass sie beinahe mitgerissen worden wäre. Und als sie prustend wieder aufgetaucht war, war der Mann fort gewesen.
Seitdem war es totenstill. Wasser plätscherte sanft gegen ihren Rücken. Ein Fisch sprang aus den Fluten. Aber so weit draußen auf dem Meer gab es keine Vögel. Der Himmel war blau, wolkenlos und grell, dass es in den Augen blendete.
Wie sollte sie jetzt nicht loslassen?
Sie schluckte. Ihre Arme schmerzten, und vom Hochwürgen des Wassers tat ihr der Magen weh. Doch das Schlimmste war der Durst. Der Sturm hatte ohne Vorwarnung zugeschlagen. Maste knirschten. Mama schrie. Nun erwarteten Mama und Papa sie auf dem Meeresgrund.
Auch das Meer wartete. Träge wälzte es sich unter der tropischen Sonne dahin, sodass es gar nicht schwierig sein würde, sich hineinfallen zu lassen. Die Hitze war wie eine warme Hand, die sich ihr auf den Rücken drückte und sie abwärts und weg vom Boot drängte. Das gewaltige Schiff war spurlos verschwunden. Niemand, der diese glatte, verlassene Wasserfläche absuchte, hätte vermutet, was hier geschehen war. Kein Mensch würde sie retten.
Aber ihre Hände wollten einfach nicht loslassen. Mama hatte diese Hände so gern gehabt. Die Hände einer Pianistin hatte sie sie genannt. »Mit dem Terpentin wirst du sie dir ruinieren. Zieh zum Malen Handschuhe an, Emmaline. Achte bis zur Hochzeit auf deine Hände.«
Für Emma war es eine seltsame Vorstellung gewesen, dass sie heiraten sollte. »Ich freue mich auf ein großes Abenteuer«, hatte sie gestern beim Dinner zum Kapitän gesagt. Später, in ihrer Kabine, hatten ihre Eltern sie zurechtgewiesen. Schließlich führe sie nach Delhi, um zu heiraten, und dürfe die Reise deshalb nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ihr Zukünftiger sei immerhin ein sehr einflussreicher Mann, weshalb sie sich dementsprechend betragen müsse.
Eine Träne fiel auf ihren nackten Arm. Heißer als die Sonne und salziger als das Meerwasser brannte sie ihr auf der Haut. Es waren stets dieselben freundlichen Worte gewesen. Du bist so dickköpfig, liebes Kind. Wir müssen in dieser Angelegenheit sorgfältig auf dich aufpassen. Du erregst zu viel Aufmerksamkeit. Deine Bemerkungen waren ziemlich ungehörig. So sanft hatten ihre Eltern sie getadelt, obwohl sie an ihrer störrischen Tochter verzweifelten.
Der Mann hatte gemeint, dass sich das Boot würde aufrichten lassen, und war entschlossen gewesen, dies auch zu tun. Wenn es einem Mann gelingen konnte, musste eine Frau doch auch dazu in der Lage sein.
Sie holte tief Luft und kroch höher auf den Rumpf. Ihre Arme zitterten und brannten von der Anstrengung, als sie die Hand langsam zur anderen Seite streckte … nur noch ein kleines Stück. Aber die Entfernung zum Bootsrand war zu groß. Ihre Kräfte reichten nicht aus, und sie rutschte mit einem Aufstöhnen ab.
Wieder am Anfang. Sie schloss die Augen.
Inzwischen flossen die Tränen schneller, doch sie würde nicht aufgeben.
Teil I
Kapitel 1
Delhi, Mai 1857
Julian bemerkte die Frau hauptsächlich deshalb, weil sie so gelangweilt wirkte. Das Warten auf den Regierungskommissar versetzte ihn zunehmend in schlechte Laune. Er stand im vorderen Teil des Raums, lauschte mit halbem Ohr dem exaltierten Stimmengewirr, das ihn umgab, und behielt dabei die Tür im Auge. Die Gerüchte, die im Basar kursierten, wurden von Tag zu Tag bedrohlicher, sodass er inzwischen zu dem Schluss gekommen war, dass die hiesige Regierung handeln musste, so lange man in Kalkutta die Hände in den Schoß legte. Heute Abend würde er eine diesbezügliche Zusage einfordern.
Zunächst nahm er die Frau nur am Rande wahr, und zwar zum Großteil deshalb, weil sie völlig reglos verharrte. Sie lehnte keine drei Meter entfernt an der Wand. Obwohl einige Leute sie umringten, die lachend und lässig an ihren Weingläsern nippten, machte sie den Eindruck, als sei sie ganz weit weg und des Treibens überdrüssig. Plötzlich richteten sich ihre Augen, die ausdruckslos einen Punkt über seiner Schulter fixiert hatten, auf ihn. Sie waren so durchdringend blau, dass Julian zusammenfuhr, und er stellte fest, dass sie ganz und gar nicht gelangweilt war. Eher schien sie ihm unglücklich.
Im nächsten Moment wandte sie sich ab.
Nachdem der Regierungskommissar ihm entwischt war, sah er sie im grünen Salon wieder. »Nach dem Abendessen«, hatte der Mann gemurmelt, »falls Sie wirklich darauf bestehen, Dienstliches mit Vergnügen zu vermischen, wird es mir eine große Ehre sein, mit Ihnen zu sprechen.« Als Julian sich, verärgert über diese brüske Abfuhr, umdrehte, bemerkte er, dass sie hinter ihm stand und das Weinglas an die Lippen hob. Erneut trafen sich ihre Blicke, und sie ließ das Glas sinken.
»Sir«, sagte sie ruhig und deutete einen kleinen Knicks an. Etwas an ihrem Tonfall verriet ihm, dass sie das Ende seiner Auseinandersetzung mit Fraser mitgehört hatte. Er öffnete den Mund, um zu antworten – immerhin schien die Dame auf ihn gewartet zu haben –, doch da rauschte sie schon, eine Wolke aus kornblumenblauer Seide, davon, und er war nicht in der Stimmung, ihr zu folgen.
Als sie später kurz nach ihm in den Garten hinaustrat, fragte er sich allmählich, ob es sich tatsächlich um einen Zufall handelte. Stellte sie ihm etwa nach? In London hätte sich vielleicht ein gewisser Jagdinstinkt geregt – er hatte eine Schwäche für Frauen, insbesondere für solche, die ihm die Mühe ersparten, ihnen den Hof zu machen –, aber von Memsahibs ließ er grundsätzlich die Finger. Ihre Ehemänner hatten nur selten Verständnis für derlei Eskapaden, und die Damen selbst langweilte der Alltag in einer britischen Garnison so sehr, dass sie flüchtige Liebeleien gern zu ihrem alleinigen Lebensinhalt aufbauschten. Außerdem kursierten in anglo-indischen Kreisen einige absurde Gerüchte über ihn, die ihn als exotischen Liebhaber darstellten und die er inzwischen gründlich leid war.
Allerdings schien die Frau ihn gar nicht bemerkt zu haben. Am Rand der Rasenfläche hielt sie inne, fasste sich mit der Hand an die Kehle und stand da, ruhig und mit geistesabwesender Miene. Eine leichte Brise wehte über das Gras, und als ihre Finger sich lockerten, bauschte sich das Umschlagtuch um ihre Schultern. Kurz spielte ein Lächeln um ihre Lippen.
Wieder hatte er das Gefühl, dass sie offenbar in Gedanken ganz weit weg war. Wie eigenartig. Er musterte sie eingehender, konnte jedoch nichts Außergewöhnliches an ihr erkennen. Ihr lockiges Haar war von einem unauffälligen, sonnengebleichten Aschblond, das zusammen mit ihrer hellen Haut den Eindruck erweckte, als habe sich all ihre Kraft in ihren strahlend tiefblauen Augen konzentriert. Eine seltsame Schönheit, wenn man sie überhaupt als solche bezeichnen konnte. Er fragte sich, ob sie vor kurzem krank gewesen war.
Dass er sich überhaupt Gedanken über sie machte, ärgerte ihn. Sie war noch jung, höchstens 22 oder 23 Jahre alt, und hatte jene glatte, weiße Haut, die sie als typische Memsahib auswies. Warum sich also mit ihr beschäftigen? Gewiss verbrachte sie ihre Tage im Haus, las oder stickte. Und wenn ihr die Eintönigkeit zu viel wurde, würde sie sich in eine fanatische Anhängerin der Auffassung verwandeln, dass die englische Lebensweise die weltweit einzig richtige war.
Sie murmelte etwas vor sich hin, sodass er sich wider Willen vorbeugte. Er konnte sie nicht ganz verstehen, aber sie hatte doch sicher nicht …
Mit einer zornigen Bewegung schüttete sie den Inhalt ihres Weinglases ins Gebüsch. »Widerliches Gesöff«, schimpfte sie.
Im Garten war es zwar nicht kühl, aber wenigstens still. Emma hielt ihr Gesicht in die schwüle Brise und schloss die Augen. Hatte Mrs. Greeley die Wahrheit gesagt? Jedenfalls war sie gewiss überrascht gewesen, wie gelassen Emma die Nachricht aufgenommen hatte. Natürlich war es eine Hiobsbotschaft, denn wie oft bekam man schon zu hören, der eigene Verlobte unterhalte eine leidenschaftliche Affäre mit einer verheirateten Frau? Allerdings passte dieses Verhalten ausgezeichnet zu dem Menschen, zu dem Marcus seit ihrer Verlobung geworden war.
Vielleicht hatte ihn ja dieses Land so verändert. Obwohl Emma sich erst seit wenigen Wochen hier aufhielt, spürte sie bereits, wie Indien von ihr Besitz ergriff, ihr die Zunge löste und ihr die Augen öffnete. Selbst jetzt, da sich ihre Gedanken wegen Mrs. Greeleys Eröffnung eigentlich hätten überschlagen sollen, wurde sie vom sanften Schwanken der Bäume und dem Schnattern der Papageien in den Ästen abgelenkt. Die Nachtluft legte sich schwer, warm und nach nachts blühendem Jasmin duftend um ihre nackten Schultern, sodass sie sich fragte, ob sie den Duft wohl mit nach drinnen nehmen konnte.
In der Ferne muhte eine Kuh. Kurz hatte sie Mitleid mit ihr, denn die Freiheit, die die hiesige Kultur ihr zugestand, musste sie doch sicher verwirren. Marcus hatte ihr erklärt, die Rinder liefen hier ungehindert auf den Straßen herum, weil die Hindus sie als eine Art Gottheit verehrten. Allerdings war er nicht weiter darauf eingegangen. Marcus fehlte häufig die Geduld für Details.
Da war zum Beispiel dieses Fest. Er hätte ihr reinen Wein einschenken und sie vor den Leuten warnen sollen, denen sie hier begegnen würde. Denn schon nach fünf Minuten war ihr klar geworden, dass Delhis bessere Gesellschaft keineswegs geneigt war, sie mit offenen Armen zu empfangen. Die Nachricht vom Schiffbruch und ihrer »zweifelhaften« Rettung hatte die Menschen gegen sie eingenommen. Dennoch hatte er sie einfach wie ein Lamm zur Schlachtbank geschickt und sie aufgefordert, sich unter die spitzzüngigen Megären zu mischen, während er sich mit dem Regierungskommissar besprach. Und um das Maß vollzumachen, musste sie nun erfahren, dass er sie mit der Gastgeberin betrog!
Ganz gleich, was die beiden so trieben, wenn sie miteinander allein waren – Mrs. Evershams Weinliste konnte er sich jedenfalls nicht gewidmet haben. Denn er hatte einen ausgezeichneten Geschmack. Erbost kippte Emma den Rest ihres Bordeaux ins Gebüsch. »Mieses Gesöff!«
Als sie ein leises Lachen hörte, fuhr sie nach Luft schnappend zusammen und spähte in die Dunkelheit. »Wer ist da?«
Eine Gestalt trat zwischen den Bäumen hervor und prostete ihr mit einer silbernen Taschenflasche zu. »Ein mieses Gesöff, in der Tat«, bestätigte der Mann, hob die Flasche an die Lippen und trank einen großen Schluck. Sein Oxfordakzent, der zu der dunklen, rauen Stimme passte, beruhigte sie ein wenig. »Bitte verraten Sie mich nicht bei unserer Gastgeberin, Sir.« Oder tu es doch, fügte sie in Gedanken hinzu.
Ein weiterer Schritt vorwärts, und sie hatte ihn klar im Blick. Sie hielt den Atem an. Es war der Mann, mit dem sie vorhin im Haus beinahe zusammengestoßen wäre. Wieder war sie von seiner Größe beeindruckt. Er war sogar noch höher gewachsen als Marcus und überragte sie um einen ganzen Kopf, obwohl sie selbst auch nicht eben kleinwüchsig war. Seine Augen waren grüngolden, leuchteten und reflektierten das Dämmerlicht, das vom Haus hinüberdrang, wie die einer Katze. Er beobachtete sie abwartend.
»Kennen wir uns?«, platzte sie heraus, wohl wissend, dass es sich nicht so verhielt.
Er schmunzelte. »Nein.«
Als er nichts hinzufügte, zog sie die Augenbrauen hoch und starrte ihn ebenso unhöflich an wie er sie. Zumindest hoffte sie, dass er es so auffassen würde, denn sie befürchtete, sie könnte ihn anhimmeln. Der Mann war so unverschämt gutaussehend wie eine Gestalt aus einem Fiebertraum und wirkte klug und durchsetzungsfähig. Seine Haut hatte einen goldenen Schimmer, und das Haar war so schwarz, dass es das Licht schluckte. Vorhin im Haus hatte sie sich dabei ertappt, wie sie ihn gemustert hatte und zu dem Schluss gekommen war, dass sein Gesicht förmlich danach schrie, gezeichnet zu werden. Einige sparsame Linien würden genügen – scharfe, kantige Striche für die Wangenknochen, eine kühne Gerade für die Nase und ein markantes Viereck für das Kinn. Die Lippen würden vielleicht mehr Zeit in Anspruch nehmen, denn sie waren voll und beweglich und verhinderten, dass seine Züge allzu streng wirkten.
Außerdem war er sehr sonnengebräunt. Ein leichter Zweifel kam auf, den sie sofort wieder verwarf, als sie seine gestärkte Krawatte und den elegant geschnittenen Gehrock betrachtete. Natürlich war er Engländer. Seine träge und zugleich anmutige Haltung machte ihr bewusst, dass sie unmanierlich die Schultern hängen ließ. Sie richtete sich auf und blickte zum Sternenhimmel hinauf.
»Eine wunderschöne Nacht«, sagte sie.
»Angenehmes Wetter«, stimmte er zu, worauf sie erstaunt auflachte.
»Sie scherzen!«, widersprach sie. »Es ist entsetzlich heiß«, setzte sie hinzu, als er fragend den Kopf zur Seite neigte.
»Finden Sie?« Er zuckte die Achseln. »Dann würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie sich nach Almora zurückziehen. Die Garnisonen in den Hügeln sind um diese Jahreszeit sehr beliebt.«
Seine Anspielung auf die Tradition, die heiße Jahreszeit in den Hügelausläufern des Himalaja zu verbringen, klang beinahe abfällig.
»Planen Sie hinzufahren?«
»Meine Geschäfte halten mich hier fest.«
»Geschäfte? Dann sind Sie also bei der Company?« Beinahe jeder, den sie bis jetzt kennengelernt hatte, arbeitete für die East India Company, entweder im Staatsdienst oder, wie Marcus, als Offizier bei der Armee.
Offenbar amüsierte ihn diese Vorstellung. »Du meine Güte, nein. Anscheinend eilt mein Ruf mir nicht voraus.«
»Oh, ist er denn so schlecht?« Die Frage war ihr ohne nachzudenken herausgerutscht, und sie errötete, als er wieder auflachte.
»Sogar noch schlechter.«
»Sie müssen mir von sich erzählen«, meinte sie, da ihr klar wurde, dass er die Bemerkung nicht weiter ausführen würde. »Ich bin nämlich eben erst in Delhi eingetroffen.«
»Wirklich?« Er wirkte überrascht. »Ich wusste gar nicht, dass es in England solche Frechdachse wie Sie gibt.«
»Frechdachse wie mich?« Sie verzog das Gesicht. Er hatte sich an einen Baumstamm gelehnt und betrachtete sie nachsichtig, als sei sie – und dieser Gedanke kam ihr plötzlich – ein kleines Mädchen, das ihm gerade ein Kunststück mit seiner Puppe vorgeführt hatte. »Wollen Sie mich beleidigen?«
»Das sollte nur heißen, dass Sie Temperament haben.«
»Es war aber beleidigend«, beharrte sie. »Für mich und für England.«
»Nun denn.« Seufzend bewegte er die Schultern. Sein Gehrock saß so eng, dass man die Muskeln unter dem Stoff spielen sehen konnte. Sie fragte sich, woher er sie wohl hatte, denn sie entsprachen ganz und gar nicht der Mode. »Jetzt kennen Sie einen Teil meines Rufs. Ich gelte als ausgesprochen ungezogen.«
»Das war mir von Anfang an klar! Ein Gentleman würde nämlich in Gegenwart einer Dame keinen starken Alkohol trinken – schon gar nicht aus einer Taschenflasche.«
Er zog die Augenbrauen hoch. »Und eine Dame würde den Wein ihrer Gastgeberin nicht als – was war es noch einmal – ›mieses Gesöff?‹, bezeichnen.«
Sie lachte wider Willen auf. »Gut, Sie haben mich ertappt. Ich bin auch ein schwarzes Schaf. Es ist ein Wunder, dass mein Zukünftiger mich überhaupt heiraten will.«
»Er ist wohl ein Sinnbild der Tugendhaftigkeit.«
»Nicht unbedingt«, entgegnete sie spöttisch. »Aber man wird ihm nahezu alles nachsehen.« Selbstverständlich schickte sich ein solches Gespräch nicht, doch sie hatte vergessen, wie angenehm es war, mit jemandem zu plänkeln und herumzualbern, ohne ständig einen mitleidigen oder argwöhnischen Unterton heraushören zu müssen. »Gerade hat ihn jemand sogar als den Liebling von Delhi bezeichnet.«
»Offenbar ein entsetzlicher Langweiler. Kenne ich ihn?«
»Oh, ganz gewiss. Diese Feier findet nämlich uns zu Ehren statt – wegen unserer Verlobung.« Dass er plötzlich so verschlossen wirkte, wunderte sie, und sie musterte ihn fragend, um festzustellen, ob sie ihn womöglich in Verlegenheit gebracht hatte. »Falls Sie nicht gewusst haben sollten, welchen Grund das Fest hat, verspreche ich Ihnen, Sie nicht zu verraten.«
»Oh, das war mir durchaus bekannt.« Er senkte die Stimme. »Das heißt, dass Sie Miss Martin sind.«
»Richtig. Und nun müssen Sie mir Ihren Namen sagen. Sonst wäre es ungerecht.«
Seine Katzenaugen wanderten über ihre Schulter, und er lächelte wieder, diesmal jedoch ziemlich abfällig. »Hier kommt Ihr Verlobter«, stellte er fest und nahm einen weiteren Schluck aus der Flasche.
»Emmaline! Da bist du also!«
Sie wandte sich zur Tür und hielt sich wegen des Lichts schützend die Hand vor Augen. »Marcus!« Als er sich hastig die Krawatte zurechtrückte, fragte sie sich höhnisch, ob er vielleicht auf dem Weg vom Regierungskommissar in den Garten von ihrer Gastgeberin abgefangen worden war. »Ich habe frische Luft geschnappt«, erwiderte sie. »Flanell ist in diesem Klima ausgesprochen ungeeignet.«
Marcus trat in den Garten hinaus. »Es gehört sich wohl kaum, so etwas öffentlich zu erörtern«, tadelte er sie. »Außerdem hast du darauf bestanden, obwohl ich dich eindringlich vor dem Wetter gewarnt habe …« Er verstummte und starrte ihren Begleiter an. »Was zum Teufel haben Sie hier verloren?«
»Lindley«, entgegnete der Mann knapp. »Es ist mir ein Vergnügen.«
Marcus schnaubte verächtlich und maß sein Gegenüber mit einem eisigen Blick. »Das kann ich von mir leider nicht behaupten. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Mrs. Eversham, was ihre Gästeliste angeht, so wenig wählerisch ist.«
Verblüfft blickte Emma zwischen den beiden hin und her. Während der Fremde die Gelassenheit in Person zu sein schien, wirkte Marcus aufgebracht wie ein Stier, der ein rotes Tuch gesehen hat. »Aber Marcus! Dieser Herr …«
»Weiß, dass er unerwünscht ist«, fiel Marcus ihr ins Wort. »Zumindest dort, wo ich mich aufhalte, und ganz klar in Gegenwart meiner zukünftigen Frau. Ich würde Ihnen jetzt vorschlagen, sich zu verabschieden, Sir.«
Der Mann zuckte die Achseln. »Wie Sie meinen.« Er steckte die Flasche ein und verbeugte sich leicht. »Ich möchte Sie herzlich zu Ihrer Verlobung beglückwünschen, Lindley. Miss Martin ist wirklich sehr charmant.«
»Sie beleidigen sie, indem Sie ihren Namen in den Mund nehmen«, zischte Marcus. »Wenn Sie sich nicht vorsehen, bin ich gezwungen, Sie zum Duell herauszufordern!«
Nun bekam Emma es wirklich mit der Angst zu tun. Etwas an diesem Mann – vielleicht sein Schmunzeln angesichts von Marcus’ Drohung – ließ sie befürchten, dass er ihrem Verlobten überlegen sein könnte. »Gentlemen, das ist doch absurd!«
»Komm mit!« Marcus umklammerte schmerzhaft ihren Unterarm und zerrte sie beinahe zurück zum Haus.
Drinnen musste sie wegen des Lichts der zahlreichen Lampen und Kerzenleuchter die Augen zusammenkneifen. Sie brachte Marcus am Rand der Menschenmenge unter einem Pankha zum Stehen, einem riesigen Deckenventilator, dessen Flügel aus gestärktem Chintz in der feuchten Luft schlaff geworden waren. »Ich fasse es nicht, wie du dich so benehmen konntest«, empörte sie sich. »Was ist nur in dich gefahren?«
»Was in mich gefahren ist?« Marcus riss sie zu sich herum. »Weißt du überhaupt, wer dieser Mann ist?«
»Hör auf, mich zu schütteln!« Unsanft machte sie sich los. Er roch nach Wein und Schweiß. Vielleicht hatte er sich ja ein Glas zu viel genehmigt, auch wenn das keine Entschuldigung war. »Was ist nur los mit dir?«
»Das war mein Cousin«, stieß er mit hochrotem Gesicht hervor. »Das Halbblut, das an meiner Stelle das Herzogtum an sich reißen will.«
»Dieser …« Als ihr plötzlich ein Licht aufging, verstummte sie. »Dieser Mann ist Julius Sinclair?«
»Wie er leibt und lebt.«
Sie wandte sich ab und betrachtete die Tanzenden, ohne sie wirklich zu sehen. Marcus hatte ihr von Julius Sinclair, seinem Cousin zweiten Grades, geschrieben. Sinclairs Vater Jeremy hatte eine Eurasierin, eine Frau anglo-indischer Herkunft, geheiratet, als er vermutet hatte, sein Bruder, der Marquis, werde das Herzogtum übernehmen. Aber kurz darauf hatte die Cholera Jeremy hinweggerafft, während der Marquis bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen war. Dadurch war Jeremys kleiner Sohn zum Erben des Herzogtums geworden – Julian, in dessen Adern zu einem Viertel eingeborenes Blut floss.
Inzwischen war Julian erwachsen, und sein Goßvater, der derzeitige Herzog, hatte sämtliche rechtlichen Register gezogen, um sicherzustellen, dass sein Enkel die Erbfolge antreten konnte. Allerdings mochte Marcus sich nicht mit der Vorstellung abfinden, dass ein Mischling den Titel tragen würde. Immerhin war er, Marcus, ein reinblütiger Engländer und nach Sinclair an der Reihe, weshalb er sich als der rechtmäßige Erbe fühlte.
»Er wirkte so gar nicht indisch«, flüsterte Emma.
»Natürlich nicht«, stieß Marcus hervor. »Der Herzog hat ja auch alles in seiner Macht Stehende unternommen, um dafür zu sorgen. Eaton, Cambridge, ein Sitz im Unterhaus. Doch so gut ein Mann die, die ihm überlegen sind, auch nachäfft, an seinem Blut lässt sich nichts ändern. Und nun soll der angesehenste Titel in Großbritannien an einen halbblütigen Bastard fallen!«
Entsetzt starrte sie ihn an. »Marcus, du klingst so … voller Hass.«
Er sah sie an und presste finster die Lippen zusammen. »Ach, wirklich? Wenn ich daran denke, dass du erst seit fünf Tagen hier bist und dich schon den Eingeborenen an den Hals wirfst. Was würden deine Eltern dazu sagen?«
Emma zuckte zusammen. Als ein Diener mit einem Tablett voller Weingläser vorbeikam, nahm sie sich eines. »Das war gemein.«
»Mag sein, aber es ist die Wahrheit. Die Martins würden selbst im Tode ihre Ehre nicht verraten.«
Emma trank einen großen Schluck von dem scheußlichen Bordeaux und schloss die Augen. Wieder hatte sie das Bild vor sich, das sie ständig verfolgte – die kleinen bleichen Gesichter ihrer Eltern, als der Ozean sie verschlang. Sie hatte ihren Tod noch nicht verwunden und wachte in den meisten Nächten weinend auf, weil sie geträumt hatte, sie sei mit ihnen ertrunken. Nur durch ein Wunder hatte sie das Rettungsboot gefunden, auf dem sie fast einen Tag lang im Meer getrieben war. Zum Glück hatte Gott ihr die Kraft geschenkt, sich daran festzuklammern, während die Sonne heiß auf sie hinunterbrannte und ihre Hoffnung schwand, dass man sie je finden würde.
Sie stellte das Glas auf eine Kredenz und blickte Marcus ins Gesicht. Die Luft war stickig und schwül, sodass ihr der Schweiß den Nacken hinunterlief. Seltsamerweise fror sie dennoch. »Hättest du es für ehrenhafter gehalten, wenn ich auch ertrunken wäre?«
Nach einem Moment starrsinnigen Schweigens wurde seine Miene versöhnlicher, und er griff nach ihren Händen. »Nein, mein Liebling, selbstverständlich nicht.«
Allerdings hatte Emma da ihre Zweifel. Schließlich konnte er mit seiner kostbaren Ehre tun und lassen, was er wollte, auch wenn er sie mit seinen allgemein bekannten Frauengeschichten und seinen astronomischen Spielschulden riskierte. Aber zu dulden, dass eine Frau sie beschmutzte? Gewiss wurmte es ihn, dass er sich womöglich zum Gespött machte, indem er die Verlobung mit einer Frau von zweifelhaftem Ruf aufrechterhielt – einer Frau, die nicht etwa unter der Obhut ihrer Eltern, sondern begleitet von einer Mannschaft raubeiniger Seeleute in Indien eingetroffen war. Obwohl diese Seeleute ihr das Leben gerettet hatten, beschäftigte die bessere englische Gesellschaft Indiens hauptsächlich die Frage, ob sie ihr dafür nicht etwas Wichtigeres geraubt hatten, etwas, das viel wichtiger war als ihr Leben: ihre Unschuld. Dass man mit der Unschuld ihres Verlobten keinen Staat mehr machen konnte, kümmerte natürlich niemanden.
Emma reckte das Kinn. »Ach, ich habe nur mit ihm geplaudert, Marcus. Wir wollen die Sache vergessen. Schau doch nicht so finster drein.«
Marcus seufzte auf und ließ den Blick suchend über die Menschenmenge hinter ihr schweifen. »Mich wundert, dass man ihn noch nicht vor die Tür gesetzt hat.«
»Vielleicht, weil er der Marquis von Holdensmoor ist?«
Er sah sie tadelnd an. »Ich bin nicht in der Stimmung für deine frechen Bemerkungen, Emmaline. Dieser Mann stellt eine Gefahr für die Krone dar, nur damit du es weißt. Er verbreitet Gerüchte über einen möglichen Aufstand und will uns dazu verleiten, Delhi aufzugeben. Seiner Ansicht nach könnten sich die eingeborenen Truppen gegen uns erheben.«
»Ach, du meine Güte! Wäre das denn möglich?«
Marcus machte eine wegwerfende Geste. »Allein der Gedanke ist schon Landesverrat. Selbstverständlich nicht. Schließlich bekommen sie von uns das Brot, das ihre Familien essen. Nur wegen dieser dummen Geschichte in Barrackpore …«
Ja, daran erinnerte sie sich, denn bei ihrer Ankunft in der Hafenstadt Bombay war der Vorfall Tagesgespräch gewesen. Ein Sepoy, ein einheimischer Soldat, hatte britische Offiziere angegriffen und zwei von ihnen erschossen, bevor seine Vorgesetzten ihn hatten überwältigen können. Wenn sie sich recht entsann, war das Schockierende daran gewesen, dass keiner der anderen Eingeborenen versucht hatte, ihn zu entwaffnen.
»Seine Besorgnis hat etwas für sich«, wandte sie ein. »Es ist ein wenig beängstigend.«
»Es war ein einmaliges Ereignis und außerdem das erste seiner Art auf diesem Kontinent in mehr als zweihundert Jahren. Hinzu kommt, dass der Mann sofort gehängt wurde. Ich kann dir also versichern, dass er keine Schwierigkeiten mehr machen wird.«
»Aber als Halbblut hat Lord Holdensmoor womöglich etwas aufgeschnappt …«
»Emmaline!« Marcus wirbelte zu ihr herum. »Ja, der Mann ist ein Halbblut, und ich habe den starken Verdacht, dass er uns aus Delhi vergraulen möchte, damit die Eingeborenen die Stadt zurückbekommen! Meiner Meinung nach ist genau das seine Absicht, und das habe ich auch dem Regierungskommissar mitgeteilt. Und jetzt verschone mich mit deinem törichten Gerede und sei freundlich zu unserem Gastgeber.«
»Gastgeber? Ist das der Herr, dem du Hörner aufsetzt?«
Marcus wurde kreidebleich. Ach herrje. Blondes Haar passte ganz und gar nicht zu einem leicht grünlich verfärbten Teint. »Was hast du gesagt?«, stammelte er.
»Also stimmt es.« Ihr wurde flau im Magen. »Nun, ich nehme an, dass du jetzt beteuern wirst, du liebtest mich trotz alledem.«
Ein treuherziger Ausdruck malte sich in seinen blauen Augen, als er ihr Gesicht musterte. »Selbstverständlich liebe ich dich.«
Emma zwang sich zu einem Lächeln. »Ja. Wir lieben einander schon seit einer geraumen Weile, richtig? Seit unserer Geburt, wenn ich mich recht entsinne.«
»Von Anfang an«, bestätigte er mit bemerkenswert gut gespielter Aufrichtigkeit. »Und ganz gleich, welche Gerüchte dir auch zu Ohren gekommen sein mögen, gibt es auf der Welt für mich keine andere Frau als dich. Manche Leute sind eben neidisch und verbreiten böswilligen Klatsch, um mir zu schaden …«
»Ich weiß«, unterbrach sie ihn, verstummte und schluckte, da ihre Stimme zu versagen drohte. Es war eine traurige Erkenntnis, dass sie ihm kein Wort mehr glaubte. »Marcus, ich denke, ich möchte jetzt gehen.«
Er betrachtete sie eine Weile und nickte dann. »Wenn du meinst. Aber ich werde dich morgen im Sitz des Ministerresidenten aufsuchen. Dann können wir darüber sprechen, und du wirst alles verstehen, mein Liebling. Du darfst nicht weiter über diese Lügen nachgrübeln.«
»Einverstanden«, murmelte sie. »Könntest du bitte Lady Metcalfe suchen?«
An die Wand gelehnt, beobachtete sie, wie er sich durch die Menge der Gratulanten schob, um ihre Anstandsdame zu finden. Obwohl er ihr den Rücken zukehrte, erahnte sie jede seiner Gesten und jedes Lächeln, das über sein Gesicht huschte. Nach zwanzig langen Jahren, in denen ihre Familien alle Register gezogen hatten, um sie miteinander zu verkuppeln, ihre Verlobung zu planen und die Namen ihrer ungeborenen Kinder zu bestimmen, kannten sie einander sehr gut. Weder die Martins noch die Lindleys hatten geahnt, dass nur die beiden, die am wenigsten begeistert davon waren, die Erfüllung dieses Traums erleben sollten: die Braut und der Bräutigam.
Emma schloss die Augen, wandte den Kopf und presste die Wange an die kühle Wand. Ein heißer Windstoß brachte die Fenster zum Klappern. Die Kerzen flackerten, als Jasminduft und Dunkelheit hereinwehten. Seltsam, wie die Nacht ihr verlockend zurief und ihr einen paradiesischeren, unschuldigeren Ort verhieß. Ja, es war, als lege Indien ihre Seele frei und risse ihre Fassade nieder, sodass sich eine tiefe Melancholie in ihr breitmachen konnte.
Sie trauerte doch nicht etwa wegen Marcus? Den Kleinmädchentraum von der romantischen Liebe hatte sie schon vor drei Jahren über Bord geworfen, als sie zum ersten Mal von einer seiner vielen Geliebten erfuhr. Damals hatte es ihr das Herz gebrochen, aber ihre Mutter hatte ihr erklärt, wie es in der Welt wirklich zuginge: Die Ehe fuße nicht auf etwas so Unvernünftigem und Vergänglichem wie der Liebe, sondern diene der Pflege von Beziehungen und Verbindungen und der Fortsetzung der Familientradition. Marcus’ riesige, aber verfallene Güter könnten dank des beträchtlichen Vermögens der Familie Martin wieder instand gesetzt werden. Außerdem würden die beiden eine Dynastie begründen, den Ausgleich dafür, dass ihrer Mutter ein Stammhalter verwehrt geblieben sei.
Was also war der Anlass für diese plötzliche unheilvolle Vorahnung? Sie schob sich wie ein Schatten zwischen Emma und den hell erleuchteten Raum und vermittelte ihr das eigenartige Gefühl, sie stünde abseits und betrachte ein großes Panorama, wie es manchmal im British Museum ausgestellt wurde. Der Raum erinnerte sie an Pompeji vor dem Vulkanausbruch oder an Rom vor dem Untergang: eine Zivilisation am Rande der Katastrophe.
Ein Schauder überlief sie. Als sie sich umblickte, fuhr sie zusammen, denn sie stellte fest, dass sie in ein strahlend smaragdgrünes Augenpaar schaute. Lord Holdensmoor kam aus dem Garten herein und musterte sie mit ausdrucksloser Miene. Um Marcus und den eigenen Grübeleien zu trotzen, lächelte sie ihm zu.
Sein Lächeln war verwegen und mühelos und übte eine erstaunliche Wirkung auf seine herablassenden, aristokratischen Züge aus. Und dann war er fort. Seine hochgewachsene und breitschultrige Gestalt wurde von der Menschenmenge verschluckt und verschwand in einer Masse aus zerknitterter Seide und wippenden Pfauenfedern.
Kapitel 2
Nachdem Emma sich während der ersten Wochen in Delhi an die unausgesprochene Übereinkunft gehalten hatte, so zu tun, als hätte man England nie verlassen, beschloss sie, das Land besser kennenzulernen. Allerdings fürchtete sich Lady Metcalfe, die Frau des Ministerresidenten und ihre Gastgeberin, vor der einheimischen Kultur und weigerte sich, den Basar zu betreten. »Ich könnte Ihnen doch etwas vorlesen«, hatte sie an diesem Morgen vorgeschlagen. »Ich habe eine neue Ausgabe von ›Des Pilgers Wanderschaft‹ da.«
Aber Emma konnte die Vorstellung nicht ertragen, wieder einen Tag in dem stickigen Haus herumzusitzen. Mama hätte ihr empfohlen, Besuche zu machen oder Lady Metcalfe auf ihrem Spaziergang durch den Maidan-Park und zu den Zusammenkünften ihres Nähkränzchens zu begleiten. Doch beim bloßen Gedanken daran fühlte sich Emma, als würde ihr die Luft abgeschnürt, und ihr wurde flau im Magen. So ging es nun schon seit ihrer Ankunft. Die aufdringliche Besorgnis ihrer neuen Bekannten raubte ihr den Atem, denn sie wusste nicht, was sie auf die Fragen antworten sollte, die aus ihren Blicken sprachen. Außerdem hatte sie zunehmend weniger Lust, es überhaupt zu versuchen. Deshalb hörte sie dem Geplauder nur mit halbem Ohr zu und verlor mitten im Gespräch den Faden, weil sie nicht mehr wusste, was sie hatte sagen wollen.
Marcus nahm sie in Schutz und erzählte seinen Freunden, sie müsse sich noch von der langen Reise, dem Schock und dem Verlust ihrer Eltern erholen. Selbstverständlich war das richtig, erklärte jedoch nicht ihre Ungeduld und Rastlosigkeit. Den Grund für ihre Gefühle bekam sie einfach nicht zu fassen, und ihr fiel auch keine Lösung ein. Natürlich war sie dankbar; es war wirklich ein Wunder, dass sie überlebt hatte. Aber sie konnte deshalb doch nicht den Rest ihres irdischen Daseins damit zubringen, sich über die hiesige Laienspielgruppe oder die Pferderennen der letzten Saison zu unterhalten.
Deshalb hatte Emma Lady Metcalfes Angebot höflich abgelehnt und zum Entsetzen ihrer Gastgeberin ihre Ayah, eine Hindufrau namens Usha, gebeten, sie ins Eingeborenenviertel zu begleiten. Als die Straßen in Chandni Chowk zu eng für die Kutsche wurden, erbot sich Usha, sie zu Fuß zu führen. Und so schlängelten sie sich nun durch das Menschengewühl auf der Straße, wobei Emma darauf achten musste, nicht auf Kuhdung oder die Tonscherben zerbrochener Teetassen zu treten. Rechts erhob sich ein Tempel aus weißem Marmor, in dem die Betenden dröhnende, an der Decke baumelnde Glocken läuteten. Rechts hasteten einige Frauen in bunten Saris im Gänsemarsch vorbei. Ihre schlanken braunen Arme stützten die Säcke auf ihren Köpfen. Armreifen und Fußkettchen mit Glöckchen daran funkelten in der Sonne.
Noch nie im Leben hatte Emma eine quirligere und buntere Szene gesehen. Die Aquarellfarben, die sie in Bombay gekauft hatte, hätten nicht gereicht, um sie auch nur annähernd einzufangen. Dazu hätte es üppiger, greller Ölfarben bedurft. Mit etwas Glück hatte ihre Cousine in London die bestellten Farben bereits abgeschickt. Ansonsten würde sie versuchen müssen, die bunten Farben aufzutreiben, wie man sie zum Bemalen der hübschen Schilder an den Hauswänden benutzte, zum Beispiel jenes über dem Laden, der Gefäße aus Messing im Angebot hatte. Es stellte einen Gott mit blauer Haut dar, der die Passanten mit seinen vielen Armen heranwinkte.
Emma seufzte auf. Marcus würde einen Wutanfall bekommen, wenn sie sich einheimische Farben beschaffte. Er stand ihrem »kleinen Steckenpferd« ohnehin ablehnend gegenüber. »Du zeichnest ausgesprochen unpassende Dinge«, hatte er am Vortag angemerkt, nachdem er ihr Skizzenbuch durchgeblättert und anschließend achtlos weggelegt hatte. Sie war klug genug gewesen, ihm nicht zu widersprechen. Blumen, ländliche Idylle, Kinder – das waren Themen, die sich für eine Dame schickten. Fakire, Mahouts und andere interessante Modelle waren den Herren vorbehalten, die wahre Kunstwerke, nicht nur schmückendes Beiwerk, schufen.
»Memsahib, stört Sie die Sonne?«
Emma wurde jäh in die Wirklichkeit zurückgeholt. »Nein, Usha, ich fühle mich ausgezeichnet. Es ist nur so …« Als sich hinter Usha etwas bewegte, merkte sie auf. Eine weiße Kuh, einen Kranz aus Ringelblumen um den Hals, trottete vorbei. Es zuckte um Emmas Lippen. Ein prachtvolles Tier und sicherlich von großer Bedeutung, denn es trabte sehr zielstrebig dahin. Sie lachte auf. »Es ist wundervoll, Usha. Wirklich beeindruckend.«
Usha lächelte schüchtern. »Im Gali ist mehr Schatten. Wollen wir hingehen?«
Sie schlängelten sich durch die Passanten, bis sie eine weniger belebte Gasse erreichten, die von der Hauptstraße abzweigte. Hier drängten sich die Häuser – Usha nannte sie »havelis« – dicht aneinander. Die Fenster waren mit Gitterwerk aus rotem Stein versehen, das über die Straße ragte und den Weg in Schatten tauchte. Da dieses Gitterwerk den Blick ins Innere der Häuser versperrte, bemerkte Emma erst nach einiger Zeit, dass hinter dem Fenster, das sie gerade betrachtete, eine Frau stand. Das Gesicht der Frau war mit einem Schleier bedeckt, sodass Emma sie zunächst für einen Vorhang gehalten hatte.
Emma berührte das Dienstmädchen am Handgelenk. »Usha, warum verhüllt die Frau ihr Gesicht?«
Usha schaute hinauf zum Fenster. »Ach, das ist Parda, Memsahib. Die Muselmaninnen und auch die Brahmaninnen, die Frauen und Töchter unserer Priester, verschleiern sich, um zu zeigen, dass sie …« Sie hielt inne und suchte nach dem richtigen Wort. »Um ihre Izzat zu schützen. Ihre Ehre.«
»Sogar im Haus?«
»Überall, wo fremde Männer sie sehen könnten.«
»Und wie sehen sie selbst etwas, wenn sie das Haus verlassen?«
»Die Schleier sind durchsichtig. Außerdem geht eine Frau in Parda nicht oft aus dem Haus.«
Emma nickte langsam und blickte noch einmal zur Frau im Fenster hinüber. Beobachtete sie sie ebenfalls? War sie neugierig, wer sie waren und wohin sie wollten?
Emma hätte ihr antworten können, dass es keine Rolle spielte. Ganz gleich, ob Inderin oder Britin, so viele Frauen waren zur Zeit ans Haus gefesselt. Einigen schien es zu gefallen, dort herumzusitzen und zum fünfzigsten Mal »Des Pilgers Wanderschaft« zu lesen. »Wie halten sie das aus?«
»Sie wollen ihren Familien eben keine Schande machen, Memsahib.«
Ja, natürlich. Wie gut erinnerte sie sich an Marcus’ gequälten Gesichtsausdruck, als ihm klar geworden war, wie sie Bombay erreicht hatte. Als ob der Tatsache, dass sie ihr Leben der Besatzung eines Frachters verdankte, ihre wundersame Rettung entwertete. Offenbar hing die Ehre einer Frau hier mehr von der Meinung irgendwelcher Hohlköpfe ab als von ihren eigenen Grundsätzen. »Das ist uns gegenüber ziemlich ungerecht, findest du nicht?«
»Uns?« Usha musterte sie prüfend. »Aber Memsahib kann doch kommen und gehen, wie sie möchte, oder?«
Emmaline wollte ihr gerade eine scherzhafte Antwort geben, als ein heftiger Schlag ihren Rücken traf, sodass sie gegen eine Hauswand taumelte. Sie drehte sich um und stellte fest, dass ein gedrungener, rotgesichtiger Mann in Armeeuniform ihren Arm umklammert hielt.
»Hallo, Missus«, sagte der Angreifer in starkem Herfordshire-Akzent. »Ein hübscher Tag für einen Spaziergang, richtig?«
»Lassen Sie mich los!« Sie versuchte, sich zu befreien. Als er lachte, stieg ihr sein stinkender Atem in die Nase.
»Was macht eine nette Memsahib wie Sie denn ganz allein im Basar?«, fragte er, ohne sich darum zu kümmern, dass sie sich bemühte, ihm ihre behandschuhte Hand zu entreißen.
»Ich bin nicht allein, sondern in Begleitung meines Dienstmädchens!«
»Die da?« Er sah Usha an, die zu Emmas Entsetzen vom Kumpanen des Mannes festgehalten wurde. »Eine Eingeborene ist doch keine richtige Anstandsdame.«
»Und Sie sind kein richtiger Gentleman«, zischte sie. »Eine Dame zu überfallen!«
»Ich habe Sie doch noch gar nicht überfallen«, höhnte er. Mit der freien Hand fuhr er unter ihre Haube, packte die Haarnadel in ihrem Dutt und zerrte ihr den Kopf nach hinten. »Ist aber keine schlechte Idee. Denn eine wirkliche Dame würde nicht wie Sie alleine auf die Straße gehen, sich mit den Eingeborenen herumtreiben und ihnen Flausen in den Kopf setzen.«
»Genau das hat sie getan«, stimmte der andere mit abscheulich schriller Stimme zu. »Sie wiegelt die Schwarzen zum Aufstand auf, indem sie vor ihnen herumspaziert, als ob sie eine von ihnen wäre.«
»Weißt du, Harry, ich habe gehört, eine neue Schiffsladung Flittchen für die Offiziersmesse sei eingetroffen. Vielleicht ist sie ja eine von denen.« Er presste die Hüften an sie und zerdrückte ihr den Reifrock. Als sie sich wegdrehte, biss er sie in die zarte Haut am Hals.
»Du Schwein!« Sie holte mit dem Arm aus und rammte ihm den Ellbogen ins Gesicht. Mit einem Aufschrei schleuderte er sie zur Seite, sodass sie auf den Unterarmen landete und ihr die Haube vom Kopf fiel. Benommen rang sie nach Luft. Steh auf, steh auf! Stöhnend stützte sie sich hoch.
»Jetzt beschimpft mich die Schlampe auch noch! Harry, der werde ich eine Lektion erteilen!«
Hinter Emma ertönte ein metallisches Klicken. Der Angreifer erstarrte. »Verdammt«, murmelte er und wich einen Schritt zurück.
»Keine Bewegung«, befahl eine ruhige Stimme. »Zumindest nicht, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist.«
Emma erkannte den kultivierten Akzent sofort. Sie atmete tief durch und rappelte sich auf. Ihre Ellbogen fühlten sich an wie verbrannt. Sie raffte die Röcke, stülpte sich die Haube auf den Kopf, hievte sich auf die Füße und versetzte dem Dreckskerl, der sie festgehalten hatte, aus Rache noch einen kräftigen Schubs. Der starrte sie zwar zornig an, schwieg aber. Dann wirbelte sie herum.
Vor ihr stand der Marquis von Holdensmoor, eine gespannte Pistole in der ausgestreckten Hand, deren Lauf genau zwischen die Augen des Übeltäters zielte. Nachdem er sie mit einem kurzen, eher neugierigen als tadelnden Blick bedacht hatte, wandte er sich wieder an den Soldaten.
»Name?«
Der Mann schluckte hörbar. »Ich wollte ihr nichts tun, Sir. Ich dachte nur …«
»Ich habe Sie nach Ihrem Namen gefragt.«
»Wir haben sie für ein Straßenmädchen gehalten«, platzte der andere Mann heraus und stieß Usha weg. »Keine Dame spaziert allein in Chandni Chowk herum!«
»Ich will kein Wort mehr hören«, sagte Lord Holdensmoor, den die Situation ziemlich zu langweilen schien. »Ich glaube, die Company wird einen oder zwei Soldaten weniger nicht vermissen. Oder haben Sie vielleicht Lust, Colonel Lindley zu erklären, warum Sie seine Verlobte belästigt haben?«
»Colonel …« Der Mann, der Emma überfallen hatte, erbleichte. »Gütiger Himmel«, entsetzte sich sein Spießgeselle.
Mit einem verächtlichen Schnauben entspannte der Marquis die Pistole und ließ sie sinken. »Abhauen«, wies er sie leise an. »Falls Sie mir noch einmal über den Weg laufen, erschieße ich Sie.«
Nachdem die Männer die Flucht ergriffen hatten, drehte er sich zu Emma um. »Sind Sie unverletzt?«
»Ja.« Da ihre feste Stimme ihr Mut machte, sprach sie weiter, nur um sie zu hören. »Ja, es geht mir gut.«
Er nickte und wandte sich an Usha. »Aap theek hain, na?«
Die Frau stieß einen Wortschwall auf Hindustanisch aus, worauf der Marquis spöttisch lächelte. »Ich fürchte, Ihre Ayah ist gar nicht zufrieden mit mir«, meinte er zu Emma.
»Mit Ihnen?«
»Weil ich die beiden nicht erschossen habe.«
»Ganz recht«, gab sie zurück und lehnte sich an die Mauer. Ihre armen Ellbogen! Sie umklammerte sie und schüttelte den Kopf. Auf einmal klapperten ihr die Zähne. »Ganz recht«, flüsterte sie.
Als eine warme Hand sie an der Schulter berührte, hob sie den Kopf. Der Marquis stand vor ihr und betrachtete sie eindringlich. »Es ist alles in Ordnung«, stellte er mit sanfter Stimme fest.
»O ja, ich fühle mich blendend.«
»Offenbar ist mit Ihnen nicht gut Kirschen essen. Sie haben den Kerl ordentlich geschubst.«
»Nun, ich finde, er hatte es verdient.« Sie holte tief Luft. »Die beiden wollten uns … schänden, glaube ich.«
»Vermutlich.«
Er tätschelte ihr die Schulter. Im nächsten Moment fiel ihr ein, dass es sich nicht gehörte, sich von ihm anfassen zu lassen, und sie wich einen Schritt zurück.
Er steckte die Pistole weg. »Kommen Sie nicht wieder hierher, Miss Martin. Nicht ohne Colonel Lindley.«
»Ich …« Es schnürte ihr die Kehle zu. »Ja. Es war leichtsinnig von mir.«
Er wandte den Blick ab. »Wir sind hier nicht in England. In diesem Land gelten andere Regeln.«
Emma lachte auf. Das Geräusch klang so seltsam und bedrückend, dass sie ihre Lippen berührte, um sicherzugehen, dass sie selbst es ausgestoßen hatte. »Da muss ich Ihnen widersprechen. Wie ich gerade erfahren durfte, scheinen die Regeln hier dieselben zu sein wie überall.«
Er fuhr sich mit der Hand durch das dichte schwarze Haar. Dass es ihm daraufhin zu Berge stand, verlieh ihm einen verwegenen Ausdruck, der so gar nicht zu seiner ernsten Miene passen wollte. »Welcher Teufel hat Sie geritten, auf den Basar zu gehen?«
»Soll ich etwa den ganzen Tag in einem stickigen Haus herumsitzen?«
»Ja.« Sein Tonfall war barsch und ungeduldig. »Man hat Sie doch sicher darüber aufgeklärt, wie es in Indien sein wird.«
»Hat man nicht! Genau das ist mir soeben klar geworden, als ich von diesen beiden kläglichen Gestalten, die sich Engländer schimpfen, angegriffen wurde!«
Ein spöttisches Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus. »Ach, wirklich?«
»Ja!« Wut, dachte sie. Das war das Gefühl, das sie gerade empfand. »Das hier ist ein fremdes Land und eine völlig andere Welt. Warum erwartet man von mir, dass ich tue, als wäre ich noch in England?«
Emma starrte ihn unverwandt an. Offenbar hatte er nicht vor, die Herausforderung anzunehmen. Er erwiderte nur ihren Blick und zog schließlich die Augenbrauen hoch. »Das war eine rhetorische Frage, oder?«
Sie verdrehte die Augen. »Gut, dann höre ich eben auf den Rat eines Mannes, der in fremden Gärten herumlungert und heimlich Schnaps in sich hineinkippt. Wie ignoriere ich am besten das Land, in dem ich mich befinde? Soll ich mir vielleicht die Augen verbinden?«
»Aber, aber, Miss Martin!« Sein Tonfall wurde weicher und vertraulicher. Sicher wollte er sie auf den Arm nehmen! »Gewiss sind Ihre Freunde schockiert über Ihre unangebrachte Neugier! Indien ist dazu da, um es zu erobern, nicht, um es zu besichtigen.«
»Ist das Ihr Ernst?«
»Colonel Lindley vertritt jedenfalls diese Auffassung.«
Aus reiner Gewohnheit sprang sie für Marcus in die Bresche. »Und wennschon. Immerhin dient er der Königin und seinem Vaterland!«
»Meinetwegen«, antwortete er lachend. »Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen. Wollen Sie Ihren eigenen Wünschen folgen oder denen Großbritanniens und des Colonels?«
Emma rang die Hände. »Jetzt haben Sie mich erwischt, Mylord. Vermutlich werden Sie mich in Ihrem nächsten Satz zu lebenslanger Haft mit Stickarbeiten vergattern.«
Er seufzte auf. »Besser, als wenn Sie mit hochgeschobenen Röcken in einer Seitengasse enden.«
»Wie vulgär!«
»Doch es ist die Wahrheit«, entgegnete er. An seinem gleichmütigen Achselzucken war zu erkennen, dass das Gespräch ihn zu langweilen begann. »Ich begleite Sie nach Hause. Sie können Lindley ja vorschlagen, Ihnen die Stadt zu zeigen.«
Allerdings würde Marcus nichts dergleichen tun, dachte sie. Ihn interessierte die einheimische Kultur weniger als die Frage, welchen Hut er aufsetzen sollte. »Einverstanden«, sagte sie und rieb sich wieder die Arme. Sicher hatte sie blaue Flecke und würde deshalb beim Abendessen ein Umschlagtuch tragen müssen.
Schweigend kehrten sie zur Kutsche zurück, wo der Kutscher dem Marquis die Zügel übergab. Da hinten nicht genug Platz für drei Personen war, kletterte Emma zu Lord Holdensmoor auf den Kutschbock, ohne auf seinen fragenden Blick zu achten. Falls das wirklich ihr letzter Ausflug gewesen sein sollte, wollte sie wenigstens die Aussicht genießen.
»Es ist ein wunderschönes Land«, seufzte sie nach einigen Minuten.
»Sie sollten nach Almora fahren«, erwiderte der Marquis, während er die Pferde geschickt zwischen Kühen, Ziegen und umhertollenden Kindern hindurchmanövrierte.
»Laut Colonel Lindley fährt in diesem Jahr niemand hin. Er findet, das Wetter sei zu angenehm, um sich die Mühe zu machen. Vermutlich muss ich ihm das glauben. Was mich angeht – ich habe noch nie so geschwitzt.«
Der Marquis schwieg eine Weile. »Verdammtes Wetter«, sagte er nach einer Weile leise.
Als sie den Kraftausdruck hörte, fiel ihr etwas ein. »Wünschen Sie sich etwa, es wäre noch heißer?«
»Vielleicht.«
»Weil wir dann Delhi während der Saison den Rücken kehren würden«, sprach sie weiter. »Ja, mein Zukünftiger hat mir nämlich mitgeteilt, Sie wollten die Briten überreden, die Stadt zu verlassen.«
»Ihr Zukünftiger hat die unangenehme Angewohnheit, mir die Worte im Mund herumzudrehen. Ich möchte die Frauen und Kinder aus der Stadt schaffen und dafür mehr europäische Soldaten herholen. Könnten Sie das Lindley von mir ausrichten?«
»Ich glaube, ich werde diese kleine Eskapade lieber gar nicht erst erwähnen.« Emma lehnte sich zurück und musterte ihn. Allmählich wurde ihr klar, dass sie sich schrecklich unhöflich verhielt. Immerhin hatte er sie aus einer Notlage gerettet, und sie dankte es ihm, indem sie ihm Vorhaltungen machte. Allerdings schien er keinen Anstoß daran zu nehmen, sondern wirkte eher amüsiert. »Sie sind ein außergewöhnlicher Mensch, Lord Holdensmoor.«
»Das Gleiche könnte ich auch von Ihnen behaupten.«
»Ja, aber möglicherweise wäre das nicht als Kompliment gemeint.«
Er warf ihr einen kurzen Blick zu. »Vielleicht doch.«
Seine Augen waren auffällig grün. Ob er deshalb so schwer aus der Ruhe zu bringen war, weil es öfter vorkam, dass die Menschen ihn verdattert anstarrten, wenn er sie ansah?
Als Usha ihr eine Wasserflasche reichte, schüttelte Emma den Kopf und gab die Flasche dem Marquis weiter. Er hielt sie beim Trinken ein paar Zentimeter über seine Lippen. Die Muskeln an seinem Hals spielten. Emma ertappte sich dabei, dass sie wie gebannt hinschaute. Wie würde es sich wohl anfühlen, die Hand auf seine Kehle zu legen, während er trank? Sie berührte ihren eigenen Hals und schluckte, um es auszuprobieren.
Erschrocken stellte sie fest, dass er sich ihr zugewandt hatte und sie forschend musterte. Errötend drehte sie den Kopf weg.
»Miss Martin, ist Ihnen klar, was gerade in Nordindien geschieht? Sind die Damen überhaupt über die jüngsten Entwicklungen im Bilde?«
Sie räusperte sich. »Wir sind nicht auf den Kopf gefallen, Mylord, und haben von den Unruhen gehört. Aber so lange die Offiziere sich auf die Treue ihrer Soldaten verlassen können …«
»Eingeborene Soldaten, Miss Martin. Andere gibt es in Delhi nicht.« Als er sich ein Stück zu ihr hinüberbeugte, stieg ihr ein leichter Geruch nach Sandelholz, Leder und Seife in die Nase. »Verraten Sie mir, warum diese Soldaten sich den Menschen, die sie in ihrer eigenen Heimat unterjocht haben, in irgendeiner Form verpflichtet fühlen sollten.«
Sie neigte den Kopf. »Dazu kenne ich mich zu wenig in der Kolonialpolitik aus.«
»Doch Sie haben einen scharfen Verstand, was Sie von den meisten Männern hier unterscheidet.«
Sie betrachtete ihn eine Weile. »Sie glauben also wirklich, dass etwas passieren wird.«
Er nickte und sah ihr in die Augen. »Und deshalb schlage ich vor, Miss Martin, dass Sie nach Almora fahren, selbst wenn der Colonel Sie nicht begleiten möchte.«
Emma bekam es mit der Angst zu tun, was dafür sorgte, dass sie sich ebenfalls vorbeugte. »Wenn Ihnen Informationen oder irgendwelche Beweise dafür vorliegen, dass die Eingeborenen einen Aufstand planen, müssen Sie das so schnell wie möglich dem Regierungskommissar melden!«
Seine schmalen Lippen verzogen sich zu einem hämischen Lächeln. »Denken Sie, ich war bei Mrs. Evershams Abendeinladung, weil ich deren Gesellschaft genieße?«
Die Worte trafen sie wie eine Ohrfeige. Sie hatte sich sicher verhört! Bestimmt hatte er nicht auf Marcus’ Affäre angespielt. So gehässig konnte er nicht sein.
Offenbar standen ihr die Zweifel ins Gesicht geschrieben, denn er kam ihr zuvor. »Nein. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe mich ungeschickt ausgedrückt.« Er wollte noch etwas hinzufügen, überlegte es sich aber anders. Seine Miene wurde nachdenklich.
Wohl wissend, dass sie sich geirrt hatte, wandte sie sich ab. Wenn der eigene Verlobte zur Untreue neigte, gebot es der gute Ton, in dieser Hinsicht die Ahnungslose zu spielen. Allerdings war Lord Holdensmoor inzwischen anscheinend klar, dass sie ganz und gar nicht ahnungslos war.
»Sie sind wirklich außergewöhnlich«, murmelte er.
»Ja«, erwiderte sie leise. »Das fürchte ich auch.«
Sie lehnten sich gleichzeitig zurück. Eine plötzliche willkommene Brise Nordwind fing sich in Emmas Haube, riss sie ihr vom Kopf und ließ sie durch die Luft fliegen. Emma drehte sich um und blickte ihr nach. Ein Kind von etwa fünf oder sechs Jahren lief auf die Straße, griff nach der Haube und stülpte sie über seine winzigen Ohren. Trotz ihrer bedrückten Stimmung brachte der Anblick Emma zum Lachen.
Sie spürte den Blick des Marquis auf sich. »Sollen wir umkehren und sie holen?«, fragte er.
»Nein, lassen Sie nur.« Wieder lachte sie, als sie an das komische Bild des kleinen Jungen mit der Rüschenhaube dachte. »Sie hat mir sowieso nie gefallen.« Emma wandte sich wieder um und reckte das Kinn. Es war angenehm, die Wärme auf der Kopfhaut zu spüren. »Sie wollen diese Stadt nicht verlieren«, stellte sie fest. »Wenn Gefahr droht, werden sie etwas unternehmen.«
»Sprechen Sie von den Briten oder von den Indern?«, erkundigte sich der Marquis. »Ich fürchte nämlich, Sie haben in beiden Fällen recht.«
Kapitel 3
Emma erwachte nach Atem ringend und fuhr im Bett hoch. Die Lampe in der Ecke war ausgegangen, sodass Möbel und Teppich zu einer einheitlichen Masse verschmolzen, die durch das grüne Moskitonetz nur undeutlich zu erkennen war. Gütiger Himmel, dieser Traum! Tosendes Wasser. Das Schiff wurde von den Wogen gebeutelt. Würde es denn niemals aufhören?
Sie suchte nach der Lücke im Moskitonetz, stand auf und öffnete die Vorhänge. Der Garten, der den Sitz des Ministerresidenten umgab, grenzte an die breite Straße, die rings um die mauerumschlossene Stadt verlief. In der bläulichen Dämmerung wirkte diese Straße unheimlich und verlassen. Eine milde Brise strich durch die Bäume und trug das Knirschen der Rikschas und die gedämpften Rufe der fliegenden Händler im einen halben Kilometer entfernten Basar heran.
In wenigen Stunden würde Marcus sie zum Abendessen abholen. Er war fünf Tage lang in Agra gewesen und würde von ihr erwarten, dass sie Fröhlichkeit vorspielte. Emma freute sich beinahe über seine Rückkehr, und wenn es nur deshalb war, weil sie eine Gelegenheit bedeutete, aus dem Haus zu kommen. Lady Metcalfe war nämlich erkrankt, und Emma hatte nicht gewagt, noch einmal allein einen Ausflug zu unternehmen. Ohne das Skizzenbuch und die Zeichenkohle, die Sir Metcalfe ihr geschenkt hatte, wäre sie wohl vor Langeweile wahnsinnig geworden. Dennoch wurde das Gefühl, dass ihr die Decke auf den Kopf fiel, immer stärker.
Seufzend drehte sie sich zum Zimmer um, wo ihr Blick auf die blaue Flasche auf der Kommode fiel. Sie enthielt eine Mischung aus Laudanum und Chinin. Lady Metcalfe hatte sie ihr gegeben, nachdem Marcus sich lobend über die beruhigende Wirkung geäußert hatte. Insgeheim hatte Emma gehofft, dass die Medizin auch gegen Albträume half. Jedenfalls beruhigte sie tatsächlich.
Sie maß eine winzige Dosis ab und verschüttete ein wenig auf ihren Ärmel, als sie den Löffel zum Mund führte. Dann stellte sie die Flasche weg und sah in den Spiegel. Ein blasses, ovales Gesicht, beherrscht von Augen, in denen sich Erschöpfung malte, schaute ihr entgegen. Sie schlief schlecht. Ihr Haar war schlaff und braun vom Schweiß. Mit Fingern, die sich unter dem Einfluss des Opiats lockerten, strich sie sich eine Locke aus der Stirn. Obwohl sie niemand für mehr als leidlich hübsch gehalten hätte, gab sie heute ein besonders elendes Bild ab.
Als ein Papagei vom Fensterbrett aufflog, flatterte ihr Herz so schnell wie seine leuchtend grünen Flügel, sodass sie sich schwer atmend die Brust rieb.
Einem plötzlichen Impuls folgend, griff sie nach ihrem Schal, schlang ihn rasch um die Schultern und schlüpfte aus dem Zimmer. Als sie über den türkischen Läufer im Flur hastete, wehte der Wind durch die offenen Fensterläden herein und brachte den Duft von Oleander und einen metallisch scharfen Geruch nach Hitze mit.
Als sie die Tür zur Bibliothek öffnete, bemerkte sie, dass sie nicht allein im Raum war. Doch es war zu spät. Das Quietschen der Türangeln ließ das Gespräch verstummen, weshalb ihr nichts anderes übrig blieb, als auf sich aufmerksam zu machen.
Lord Holdensmoor und Sir Metcalfe standen, eine ausgerollte Landkarte zwischen sich auf dem Schreibtisch, am anderen Ende des Raums. Sir Metcalfe wirkte erleichtert, sie zu sehen, auch der Marquis lächelte, wandte sich aber sofort wieder der Karte zu.
»Miss Martin«, fragte der Ministerresident besorgt. »Ist alles in Ordnung?«
»Bestens. Ich wollte Sie nicht stören.«
»Nein, nein, wir sind hier fertig.«
Der Marquis blickte auf, und sein Gesicht nahm einen seltsamen Ausdruck an. »Das würde ich nicht behaupten.«
»Dann gehe ich besser«, meinte Emma rasch, doch Sir Metcalfe wedelte wegwerfend mit der Hand und zog den Glockenzug.
»Unsinn. Ich warte nun schon seit über einer halben Stunde darauf, dass der Diener den Tee bringt. Wo ist er? Ich komme sofort zurück.«
Mit einer für ihn ungewöhnlichen Geschwindigkeit drängte sich Sir Metcalfe an ihr vorbei. »Er läuft vor mir davon«, stellte der Marquis resigniert fest, nachdem die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen war.
»Wirklich?« Emma näherte sich dem Schreibtisch. »Warum denn? Was sehen Sie sich da an?«
Er zögerte und schob dann seufzend ein Blatt Papier zu ihr hinüber. Wegen der Wirkung des Laudanums musste sie einige Male blinzeln, bis die Zahlen und Namen ihr nicht mehr vor den Augen verschwammen: Siebte Dragonergarde, königliche Armee, 23000, 58. Eingeborenen-Infanterie. »Stationierungsorte und Regimenter«, meinte sie fragend. »Wozu um alles in der Welt brauchen Sie diese Karten? Sie haben doch nichts mit dem Militär zu tun. Sonst hätte Marcus sich bestimmt schon darüber beschwert.«
»Schauen Sie sich diese Zahlen an.« Er wies auf die Ziffern, die in winziger Handschrift in der oberen rechten Ecke standen. »300 000 und 14000. Die indische Armee verfügt über 300000 Soldaten.« Er fuhr mit dem Finger über die Zahl. »Die Europäer nur über 14000.«
»Das sind ziemlich wenige«, erwiderte sie zögernd. »Aber in der Armee haben doch schon immer Eingeborene gedient.«
»Vor zwanzig Jahren kamen drei Inder auf einen Engländer«, entgegnete er. »Heute sind es sechs …«





























