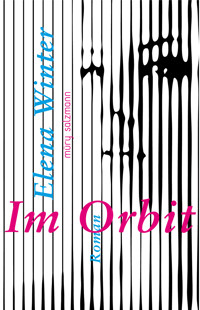
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Müry Salzmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie in einer Weltraumkapsel fühlt sich Leonie Warmers in ihren vier Wänden: außerhalb von Raum und Zeit, geschützt vor dem, was sie umgibt. Tagsüber, in "der Company", erträgt sie als Auszubildende die Anzüglichkeiten ihres Chefs. Nachts surft sie in Gesundheits-Foren, tauscht sich aus über Symptome, von stechenden Schmerzen im Fersenbein bis hin zu nächtlichem Schlafwandeln. Leonie fühlt sich fremd in ihrem Körper. Lässt sich vom Arzt ein Dutzend Elektroden auflegen. Irgendwas muss da doch zu finden sein? Das hofft auch ihre Mutter, wenn sie auf Dating-Plattformen nach einem neuen Mann sucht. Über ihren Vater weiß Leonie nicht recht viel mehr, als dass er Erbsensuppe hasste und ein Langweiler war. Leonie imaginiert ihn sich als Straßenmusiker, Lucky Luke, jedenfalls als eine "coole Sau". Dann wird die Umlaufbahn ihrer Kapsel durchkreuzt, von einer Obdachlosen, die ihr "Quartier" vor Leonies Wohnungstür aufgeschlagen hat, vor allem aber von Torsten ohne h, ihrem Kollegen in der Company. Auf einmal beginnt Leonies Raumschiff zu schweben, völlig schwerelos...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Wie in einer Weltraumkapsel fühlt sich Leonie Warmers in ihren vier Wänden: außerhalb von Raum und Zeit, geschützt vor dem, was sie umgibt. Tagsüber, in „der Company“, erträgt sie als Auszubildende die Anzüglichkeiten ihres Chefs. Nachts surft sie in Gesundheits-Foren, tauscht sich aus über Symptome, von stechenden Schmerzen im Fersenbein bis hin zu nächtlichem Schlafwandeln. Leonie fühlt sich fremd in ihrem Körper. Lässt sich vom Arzt ein Dutzend Elektroden auflegen. Irgendwas muss da doch zu finden sein? Das hofft auch ihre Mutter, wenn sie auf Dating-Plattformen nach einem neuen Mann sucht. Über ihren Vater weiß Leonie nicht recht viel mehr, als dass er Erbsensuppe hasste und ein Langweiler war. Leonie imaginiert ihn sich als Straßenmusiker, Lucky Luke, jedenfalls als eine „coole Sau“. Dann wird die Umlaufbahn ihrer Kapsel durchkreuzt, von einer Obdachlosen, die ihr „Quartier“ vor Leonies Wohnungstür aufgeschlagen hat, vor allem aber von Torsten ohne h, ihrem Kollegen in der Company. Auf einmal beginnt Leonies Raumschiff zu schweben, völlig schwerelos...
Die Autorin
Elena Winter wurde 1980 in Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen, geboren. Sie arbeitet als freie Journalistin, Texterin und Redakteurin und lebt in Berlin. Nach ihrem Studium der Germanistik, Medienwissenschaft und Linguistik in Düsseldorf promovierte sie 2009 mit einer Arbeit über Improvisationsformate im Fernsehen. Neben Veröffentlichungen in Literaturzeitschriften und Anthologien ist Im Orbit ihr erster Roman.
Inhalt
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Seitenliste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
Orientierungsmarken
Cover
Haupttitel
Textbeginn
Impressum
Ground Control to Major Tom
Take your protein pills and put your helmet on …
David Bowie, Space Oddity
EINS
Ich schätze, ich werde durchsichtig. Heute Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich im Bett an mir heruntergesehen. Ich habe gesehen, wie sich die Adern auf meinen Oberschenkeln abzeichnen. Es sind wilde Verästelungen von Flüssen auf einer Landkarte. Rinnsale unter der Haut. Ein paar von ihnen sind bindfadendünn, die meisten etwas größer. Es sind keine Krampfadern und auch keine Besenreiser, sagen die Leute im Forum. Nicht in meinem Alter, nicht mit dreiundzwanzig. Die Leute im Forum sagen, ich solle Faszientraining machen, viel Gemüse essen, wenig Süßes. Ich sitze am Laptop. Seit drei Stunden schreibe ich mit den Leuten, sie nennen sich KittyFit und Rund-na-und. Ich verfolge ihre Posts und gebe ab und zu meine Kommentare ab. Es ist später Abend. Ich kann nicht schlafen. Meine Haut hat einen Blaustich. Sie klebt auf meinen Adern wie der Teig von vietnamesischen Sommerrollen. Unter meiner Bauchdecke lassen sich die Eingeweide erahnen. Mein Magen, meine Gebärmutter. Den Blinddarm haben sie schon entfernt, als ich sieben war. Ich könnte eine Anatomiepuppe abgeben. Von meinen Brustwarzen aus laufen die Adern strahlenförmig nach außen. Heute Morgen habe ich im Spiegel entdeckt, dass auch an meinen Schläfen und unter den Ohrläppchen die Blutbahnen zu erkennen sind. Sie führen nach oben Richtung Hirn. Mein Hirn ist unsichtbar, denn ich habe dichtes Haar. Was man von meinem Hirn mitbekommt, sind Worte und Taten, die vermuten lassen, dass es ordnungsgemäß arbeitet.
Effizienz ist das Stichwort, höre ich immer wieder. Dazu braucht es Hirn. Ohne könnte ich meinen Job nicht machen. Schalten Sie Ihr Gehirn ein! Und keine Kontrollverluste, Frau Warmers. Manchmal sieze ich mich selbst. In der Company wird sich geduzt. Die Company ist eine sehr eigene Welt. Ich bin gut darin, mich in ihr zu bewegen und dabei nicht aufzufallen. Ich bin gut darin, zum richtigen Zeitpunkt zu lächeln. Noch 17 Monate, dann ist die Ausbildung vorbei. Aber so weit denke ich gar nicht. Was mich denn eigentlich interessiere, fragt Mama mich oft.
Im Forum diskutieren sie jetzt über ayurvedische Kräuter. Hanna73 hat sich erkundigt, ob es, wenn man die nimmt, zu Unverträglichkeiten oder unerwünschten Nebenwirkungen kommen kann. Ich schätze, da bin ich Expertin. Also schreibe ich in die Gruppe: Da wäre ich vorsichtig. Was ich nicht schreibe, weil ich keine Lust auf einen längeren Chat habe und Hanna73 auch nicht verunsichern will: Meine Ayurveda-Therapeutin hat mir vor ein paar Monaten empfohlen, dreimal täglich vier Rasayanas-Kapseln einzunehmen. Sie meinte, damit könnte ich die Schmerzen in der Bauchgegend und im Rücken behandeln, die mich seit Monaten verfolgen. Mein Hausarzt hat aufgegeben, er kann sich meine Krankheit nicht erklären. Es fühlt sich an wie kurz vorm Zerrissen-Werden. Als ob vor und hinter mir jemand stünde und die beiden sich ein Tauziehen um meine Organe lieferten. Ich schwanke, aber ich halte stand. Die Kapseln allerdings waren genau die falsche Medikation, sie haben meinen Körper erst recht durcheinandergebracht. An den ersten zwei Tagen konnte ich vor Schmerzen nicht aufstehen und habe mich krank gemeldet. Ich habe das Medikament abgesetzt und meine Ernährung umgestellt. Zwei Wochen lang habe ich nur warmen Getreidebrei mit Obst zu mir genommen. Morgens. Mittags. Und abends vor 18 Uhr. In der Company hat man mich belächelt, wenn ich in der Küche stand und mir meine Flocken mit heißem Wasser aufgegossen habe. Dabei hat es nicht einmal geholfen. Meine Schmerzen sind nicht verschwunden, dafür sind sie in die rechte Seite gewandert und haben sich in ein permanentes Stechen verwandelt. Aber vielleicht ist das auch ein Fortschritt. Mein Körper arbeitet dran. Ich denke, ich sollte die Hoffnung nicht aufgeben.
Letzten Sonntag lief morgens leise das Radio, als ich in die Küche kam. Ein leerer Teller, auf dem am Vorabend noch ein paar vertrocknete Weintrauben gelegen hatten. Die Zeitschriften, die ich immer Kante auf Kante auf den Esstisch lege, waren verrutscht. Ich habe es schon mal erlebt. Vor zwei Monaten. Abends hatte ich Dokumente für einen Mandanten auf den Küchentisch gelegt. Jochen hatte mich beauftragt, sie als Einschreiben aufzugeben. Die Post hatte aber an dem Abend schon geschlossen. Als ich am nächsten Morgen in die Küche kam, war der Umschlag zerrissen. Im Büro habe ich mich herausgeredet. Habe Jochen erzählt, dass der Regen alles aufgeweicht hätte. Zum Glück hatte es am Vorabend tatsächlich geregnet. Und zum Glück war die Frist für die Einsendung noch nicht verstrichen. Nochmal gut gegangen, Frau Warmers.
Im Forum suche ich nach Schlafwandeln. Kein Eintrag. Alle schlafen, keiner wandelt. Auch mein Hirn braucht Ruhe, aber mein Körper ist rastlos. Restlos aktiv. Wenn er sich nachts wenigstens nützlich machen, zum Beispiel die Dusche putzen würde. Aber nein, mir ist nicht zum Lachen. Ich bin mir ein Rätsel, bin mir unheimlich, wenn ich schlafwandle. Ich wohne ganz oben, im fünften Stock. Das würde kein Mensch überleben. Seit letztem Sonntag ist das Einschlafen ein echtes Problem. Wenn ich kurz davor bin, in den Schlaf hinüberzugleiten, wenn meine Muskeln zucken und drohen, sich zu entspannen, schrecke ich hoch. Zweimal mindestens. Irgendwann gewinnt die Müdigkeit gegen die Angst.
Manchmal kommt es auch vor, dass ich nachts wach werde und in der Dunkelheit meines Zimmers nicht weiß, wo ich bin. Oder gar: wer ich bin. Quälende Momente lang fehlt mir jede Erinnerung an mich selbst. Dann rufe ich Hallo oder etwas ähnlich Sinnloses in die Finsternis, um durch den Klang meiner Stimme mir selbst wieder nahezukommen. Seit Kurzem lasse ich nachts das Kaninchen an, eine kitschige Lampe aus Polycarbonat, die mir Mama mal geschenkt hat, weil ihr nichts Besseres einfiel. Das Ding hilft mir immerhin dabei, nicht in Panik zu verfallen, wenn ich die Augen öffne.
Auf der Kreuzung vor meinem Haus hat es eben einen Unfall gegeben. Kein abgestürzter Schlafwandler, sondern ein Verkehrsunfall. Das Blaulicht der Krankenwagen dringt durch die Jalousien und bringt mein Zimmer zum Vibrieren. Meine Wände leuchten. An. Aus. An. Aus. Sie blinken im Rhythmus meines Herzschlags. Mein Zimmer ist eine Weltraumkapsel, die unterwegs durchs All von blauen Nebelbahnen gestreift wird. Ich frage mich, ob ich hier im Orbit sicher bin, außerhalb von Raum und Zeit. Sicher vor was überhaupt.
Die Nächte durchzumachen ist nicht gesund. Samstag nehme ich am Halbmarathon teil. Wenn ich nicht auf dem Weg zur Startlinie eingeschlafen bin. Seit April trainiere ich jeden zweiten Tag, mehr geht nicht, weil mir sonst meine Fußsohlen zu schaffen machen. Ich tippe auf plantare Fasziitis oder eine Vorstufe davon. Der stechende Schmerz im Fersenbein spricht dafür. Noch dazu tendiere ich rechts zum Plattfuß. Foot-for-fun hat im Forum geschrieben, dass diese anatomische Abweichung die Krankheit noch begünstigt. Wenn ich meinen rechten Unterschenkel abtaste, habe ich Knetmasse in der Hand – auch meine Gastrocnemius-Muskeln dürften also betroffen sein. Das volle Programm. Ich habe mir Laufschuhe mit einer verstärkten Zwischensohle bestellt, die speziell für Betroffene gefertigt wurden. Hoffentlich werden sie noch vor Samstag geliefert.
Ich verstehe meinen Körper einfach nicht. Neulich bin ich auf Youtube bei einer Influencerin hängengeblieben, die sich ausschließlich von Schokolade ernährt. Sie sah nicht nur kerngesund, sie sah wie ein Model aus. Schlank wie ein Strich, samtig-glatte Haut und so weiter. Dabei isst sie täglich mindestens 500 Gramm Schokolade, macht aber kaum Sport.
Mein Körper ist in vielen Dingen nochmal komplett anders. Er funktioniert anders, reagiert anders. Er ist unberechenbar. Mit Schokolade experimentiere ich lieber nicht. Ich befürchte einen Darmverschluss oder Schlimmeres.
Wenn ich nur schlafen könnte. Ohne Angst davor, durch die Wohnung zu geistern. Morgen wird ein voller Tag in der Company, da sollte ich fit sein. Die Konferenz habe ich wochenlang mit vorbereitet. Anzugträger unter sich. 37 Stück, wenn ich mir die Liste der Teilnehmer richtig gemerkt habe. Sie werden sich über die Pumpernickelhäppchen hermachen, sich im Gespräch gegenseitig kollegial auf die Schulter klopfen oder wichtig in ihr Smartphone schauen. Mein Job ist das Drumherum. Alle lächelnd in Empfang nehmen. Fragen: Hatten Sie eine gute Anreise? Sagen: Ja, es ist viel los in der Stadt, die Straßen völlig verstopft, eine Messe vermutlich, nein, Sie haben recht, sicher wieder eine Großdemo, war ja erst letzte Woche eine, man meint, es werden immer mehr. Dann die Namensschildchen von der widerspenstigen Folie knibbeln und den Richtigen aufs Revers kleben. Danach sind es nur ein paar Klicks auf dem Laptop und am Beamer, damit die Präsentation startet. Eigentlich nichts Besonderes, aber ausgeschlafen sollte ich schon aussehen.
Gut, dass ich das Sommerfest abgesagt habe. Ich muss nicht auch noch am Abend von Kolleginnen und Kollegen umgeben sein. Ich habe den neunzigsten Geburtstag meiner Oma vorgeschoben. Dass die seit mehr als zehn Jahren keinen Geburtstag mehr hat, weiß niemand. Jochen habe ich gestern noch eine Nachricht geschrieben und Bescheid gesagt. Ich habe gemeint, das gehört sich so seinem Chef gegenüber. Schönes Profilbild, war seine Antwort. Und dann noch, dass es ohnehin besser sei, wenn ich nicht zum Sommerfest komme. Warum, habe ich gefragt. Darauf er: Der Rahmen sei zu locker, das verleite zu so vielem. Er sei zwar mein Chef, aber eben auch ein Mann, hat er geschrieben und verschiedene Emojis angehängt. Daraufhin habe ich ihn aus meinen Kontakten gelöscht, damit er mein Profilbild nicht mehr sieht. Zurückgeschrieben habe ich nichts mehr. Vielleicht hätte ich es doch tun sollen. Ihm seine ganze Erbärmlichkeit vor Augen führen. Aber dazu bin ich zu verstockt. Ich bin unfähig zu sprechen, wenn es darauf ankommt. Und wenn es auf nichts ankommt, schweige ich sowieso. Stattdessen versuche ich alles wegzulächeln. Mein Lächeln ist wie ein Schutzschild aus Pappkarton. Sichtbar, aber zu nichts nütze. Auch eine Form von Erbärmlichkeit. Aber ich komme nicht aus ihr heraus. Dazu bräuchte ich ein anderes Ich und einen anderen Körper. Bei der Konferenz morgen wird Jochen sich nichts anmerken lassen. Da ist er Profi. Im Gegensatz zu mir. Ich sehe mich jetzt schon vor ihm stehen, am Büfett oder an der Garderobe. Verschreckt. Ein angeschossenes, lächelndes Reh.
Wenn ich darüber nachdenke, fallen mir noch weitere Situationen ein. Szenen im Büro, die weniger eindeutig als diese Nachricht waren, die mich aber genauso verunsichert haben. Als ich mal am Kopierer stand und Jochens Blick auf meinem Hintern gespürt habe. Es war nur sein Blick. Und das Lächeln auf den Lippen, als ich mich umgedreht habe und seine Augen nach oben zu meinem Gesicht gewandert sind. Da wusste ich, wohin sie vorher geschaut hatten. Oder als er sich einmal am Rechner neben mich gestellt hat, mir die Hand auf die Schulter gelegt und meine Präsentation kommentiert hat. Ganz kollegial sollte das wirken.
Mama meint, ich soll mehr rausgehen. Wohin, frage ich dann, und dann redet sie von Hobbys, Freundinnen und Feten. Sie sagt tatsächlich Feten. Sie könnte auch sagen: Warum trägst du keine Dauerwelle und keine Frotteeslips in Neonfarben? Warum kiffst du nicht? Mama hätte gerne ihre Jugend zurück. Wenn sie von früher erzählt, von ihren Feten und wie sie mit irgendwelchen Männern die Nächte durchgefeiert hat (mein Vater kommt dabei nie vor), kriegen ihre Augen immer etwas Glasiges. Dann sieht sie mich nicht wirklich an, sondern durch mich hindurch. Sie wirkt nicht mehr wie meine Mutter, sondern wie ein zeitreisendes Wesen, das sich im Heute unwohl fühlt. Wenn sie von früher erzählt, tut sie das meist ungefragt. Und ich bin froh, wenn sie mir die Details erspart. Wer mit wem und so weiter. Ich will das nicht wissen. Nicht von meiner Mutter. Von ihr schon gar nicht. Es passt nicht zwischen uns. Ein bisschen zweifle ich manchmal sogar daran, dass ich ihre Tochter bin. Dabei sehen es uns alle an. Ich habe die gleichen aschblonden Fransen auf dem Kopf, die gleiche langgezogene Nase, die gleiche Figur. Keine Schultern, viel Hüfte. Ich bin ihr Abziehbild. Aber anders als sie klebe ich nicht an irgendeiner Zeit fest. Eigentlich klebe ich an gar nichts. Ich schwebe im luftleeren Raum und bin immer kurz davor, die Orientierung zu verlieren. Es fühlt sich an wie in einer riesigen Blase, in der ich mich nicht auskenne. Um irgendeinen Anhaltspunkt zu haben, nehme ich mich selbst ins Visier.
Der Krankenwagen muss abgefahren sein. Das blaue Flackern an den Wänden ist verschwunden. Das Schwarz meines Zimmers hüllt mich wieder ein. Nur der Bildschirm meines Laptops sendet noch ein künstliches Licht. Ein grelles Rechteck, das an den Rändern ausfranst, wenn ich eine Weile nicht blinzle.
Eben hatte ich Nasenbluten. Einfach so. Vielleicht doch ganz gut, dass ich immer noch wach bin. Es soll Leute geben, die im Schlaf an ihrem eigenen Blut ersticken. Das Blut fließt von der Nase in den Rachenraum, dort gerinnt es und verstopft als gallertartiger Pfropf die Luftröhre. So stelle ich es mir vor, aber ich müsste es nochmal genauer recherchieren.
Ich habe also eine Tüte Tiefkühlerbsen aus dem Gefrierfach genommen, sie in ein Küchentuch eingeschlagen und mir das Päckchen in den Nacken gelegt, damit sich die Adern durch die Kälte zusammenziehen und die Blutung aufhört. Es ist das Einzige, was hilft. Ich habe versucht mich zu entspannen, während die Kälte sich langsam in meinem Körper breitgemacht hat. Vom Nacken in die Schultern und Arme und in meinen Rumpf und von dort hinunter bis in die Beine und Zehenspitzen ist sie gewandert. Irgendwann ist sie auch in der Nase angekommen. Die Blutung ist verebbt, das Taschentuch ist weiß geblieben. Was ich nicht bedacht habe, war, dass die Tiefkühlerbsenpackung schon geöffnet war (erst gestern habe ich diesen faden Erbsen-Kartoffelstampf gemacht). Als ich sie aus dem Küchentuch holen und zur Seite legen wollte, fielen tausend grüne Kugeln zu Boden. Dort liegen sie immer noch. Sie werden zu weichen Einzelgängern, sie verstecken sich hinter den Tischbeinen und unter der Kommode und zwängen sich in die Ritzen des Parketts. Ich fühle mich zu schwach, um den Staubsauger zu holen. Ich kenne mich, später werde ich die Erbsen nur grob auflesen und dann wird man irgendwann nach meinem Ableben einzelne von ihnen wiederfinden. Aufgetaut, angegraut und plattgetreten.
Vor ein paar Monaten, an meinem ersten Arbeitstag, hatte ich schon einmal Nasenbluten. Ich saß am Schreibtisch und blätterte die alte Imagebroschüre der Company durch. Ich sah aus wie jemand, der sich gerade einarbeitet. Da floss es auf die Broschüre. Zwei dickflüssige tiefrote Tropfen landeten direkt auf dem Gruppenbild mit der gutgelaunten Belegschaft. Einer auf der Schläfe von Jochen, der größere auf der Brust von Frau Engel aus der Buchhaltung. Ich betrachtete das Foto, und einen Moment lang schien es, als läge da eine Mischung aus Erstaunen und Ekel auf den Gesichtern. Nur für einen kurzen, unkontrollierten Augenblick. Seitdem bin ich mir sicher, dass meine Ausbildung unter einem schlechten Stern steht.
Mein Hausarzt meint, mein Nasenbluten sei harmlos. Habituell sei es. Er schließt auf zu trockene Nasenschleimhaut. Damit macht er es sich zu einfach. Ich sollte besser einen HNO-Spezialisten aufsuchen und ihn um einen Bluttest und eine Rhinoskopie bitten. Auch eine Gewebeprobe wäre angebracht. Im Forum hat jemand unter dem Thema Nasenbluten gerade Blutgerinnungsstörungen ins Spiel gebracht. Womöglich ist das ein Anhaltspunkt. Dafür spricht bei mir, dass meine Regel in letzter Zeit stärker geworden ist. Und wenn ich so darüber nachdenke: An den oberen Schneidezähnen hatte ich vor kurzem leichtes Zahnfleischbluten.
Peter_h_punkt berichtet gerade ausführlich über seine Kontinenzprobleme nach einer Prostataoperation, Larissa über ihren empfindlichen Magen. Es hat etwas Beruhigendes, das zu lesen. Kurz war ich versucht, Larissa zu antworten und ihr den Tipp mit den Flohsamenschalen zu geben. Aber dann habe ich mir gedacht, soll Larissa doch selbst draufkommen, und mich ausgeloggt aus dem Forum. Es ist jetzt 2:11 Uhr. Alles schläft, eine wacht. Es ist nicht mehr gestern und noch nicht ganz morgen. Ein Vakuum, in dem ich befürchte zu ersticken, und hinterher hat’s keiner gemerkt.
Heute Nachmittag war ich kurz draußen. Spazieren. Ich hasse dieses Wort, es klingt naiv. Die Spätsommersonne hatte noch Kraft. Sie hat mir in die Augen gestochen wie ein dreistes Insekt. Auf dem Gehweg hatte sich ein Hund erleichtert. In dem Haufen, dem ich ausgewichen bin, steckte ein Zahnstocher mit einer kleinen Deutschlandfahne. Vielleicht sollte ich auch mal auf den Asphalt machen.
In einem Café habe ich mir einen Cappuccino und ein Stück Bananenbrot bestellt und mich an einem Stehtisch auf einen Hocker gesetzt. Ich habe die Leute beobachtet und mir meinen Teil gedacht. Ein Typ in hellgrüner Steppjacke hat an der Theke auf seinen Coffee to go gewartet. Er hat in seinen Berliner gebissen und auf sein Smartphone eingetippt. Ein Klacks Marmelade ist beim Abbeißen auf seine Jacke getropft. Dunkelrot auf Grün. Ein komplementärfarbenes Missgeschick. Warum fällt mir das auf. Vielleicht weil mich Missgeschicke faszinieren. Aber ich werde überheblich, ich bin ja selbst eines.
*
Lauter Erbsen auf der Erde. Mein Vater hat Erbsensuppe gehasst, hat sie mal gesagt. Jetzt erinnere ich mich. Es ist das Wenige, das Mama jemals von ihm erzählt hat. Und dass er ein Langweiler gewesen sei. Das möchte ich nicht glauben. Ich glaube, mein Vater ist jemand und kein Niemand. Einer mit Träumen und Ideen. Doch letztlich denke ich nur an ein Phantom von ihm, was bleibt mir anderes übrig.
Manchmal stelle ich mir vor, dass er der Mann ist, der mir gelegentlich im Bus gegenübersitzt. Schmales Gesicht, schütteres dunkelblondes Haar, schlanke Figur. Eine leicht gebückte Haltung. Er ist etwa Mitte Fünfzig, gut aussehend für sein Alter. Er steigt immer zwei Haltestellen nach mir ein, setzt sich und legt seinen schwarzen Koffer auf den Oberschenkeln ab. Es ist ein typischer Aktenkoffer mit Zahlenschloss und aus abgegriffenem Leder, aber er birgt ein Geheimnis. Das stelle ich mir vor. Ich sehe meinen Vater, wie er sich morgens, den Aktenkoffer in der Hand, mit einem flüchtigen Kuss von seiner neuen Frau verabschiedet. Am Hauptbahnhof muss er raus. Statt aber von dort mit der S-Bahn ins Büro zu fahren, wie es alle von ihm erwarten, nimmt er die U-Bahn Richtung Innenstadt. Kurz vorher steigt er aus. Langsam, er hat keine Eile. Lieber macht er noch einen Abstecher durch den Park. Das Morgenlicht fällt durch die Bäume und wandert in goldenen Flecken über das Gesicht meines Vaters. Ein bisschen entrückt wirkt er auf die Leute, die ihn streifen. Weil er lächelt, was um die Uhrzeit an einem Werktag kaum jemand tut. Mein Vater schon. Jetzt läuft er über die Brücke und blickt hinunter auf den Fluss. Sein Wasser kräuselt sich und verwandelt das Sonnenlicht, das auf seine Oberfläche fällt, hier und da in glitzernde Punkte. Mein Vater sieht es, wie er so vieles Schönes sieht. Er hat einen wachen Blick und er hat einen Glauben. An sich selbst vor allem. Sein Koffer schwingt beim Laufen an seinem Arm hin und her. Beschwingt sieht es aus, wie mein Vater da hinter dem Theater vorbei und durch die Gassen geht. Auf dem Vorplatz des Museums bleibt er stehen, stellt den Koffer neben sich ab und blickt sich um. Er sieht die morgendlichen Passanten. Eine Gruppe von Jugendlichen, einen jungen Mann im Trenchcoat, einen Herrn im blauen Jogginganzug, der seinen Dackel spazieren führt. Dann klappt mein Vater den Koffer auf. Das Instrument schimmert ihm golden entgegen, als hätte es nur darauf gewartet. Mein Vater nimmt das Mundstück heraus und bläst ein paarmal tonlos hinein. Er setzt es auf die Trompete, und dann fängt er an zu spielen. Somewhere over the rainbow





























