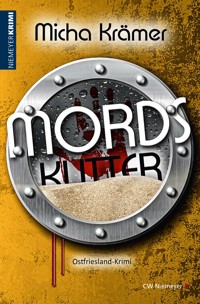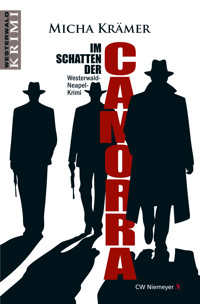
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Kriminalhauptkommissarin Nina Moretti ist mehr als nur besorgt: Die Nachrichten aus Neapel verheißen nichts Gutes. Ihr Bruder Antonio liegt nach einer Schussverletzung im Koma. Von seiner Frau fehlt jede Spur. Auf der Tatwaffe befinden sich deren Fingerabdrücke. Ist sie auf der Flucht, oder ebenfalls ein Opfer? Gemeinsam mit ihrem Neffen Marcello reist Nina Moretti nach Italien, um der Sache auf den Grund zu gehen und nach ihrer Schwägerin zu suchen. Dabei taucht sie immer tiefer in die Schattenwelt der Camorra und in ihre eigene familiäre Vergangenheit ein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Für meinen Freund Carsten.Ich wünsch dir in deinem Ruhestand alles erdenklich Gute.
Der Roman spielt hauptsächlich in bekannten Regionen, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über https://www.dnb.de© 2025 dotbooks GmbH, Max-Joseph-Straße 7, 80333 Mü[email protected]/dotbooks/CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Osterstraße 19, 31785 [email protected] Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerDer Umschlag verwendet Motiv(e) von Adobe StockSatz: CW Niemeyer Buchverlage GmbHEPub Produktion durch CW Niemeyer BuchverlageeISBN 978-3-8271-8736-9
Micha KrämerIm Schatten der Camorra
Prolog
Sonntag, 14. Dezember 2025Corso Umberto I, Ercolano, Neapel/Italien
Noch bevor sein Gehör den Knall wahrnahm, spürte er den Schlag auf seiner Brust. Der Schuss hatte ihn überrascht und im wahrsten Sinne des Wortes umgehauen. Die zweite Kugel traf ihn im Fallen in die Schulter. Der Schmerz war zu seiner Verwunderung gar nicht so schlimm, wie er es sich vorgestellt hätte. Vermutlich würde der erst später eintreten, wenn der Adrenalinausstoß seines Körpers wieder nachließ. Zumindest hieß es doch so. Oder nicht? Vielleicht würde er aber auch gar keinen Schmerz mehr spüren, weil das Leben ihn dann bereits verlassen hätte.
Noch bevor er auf dem Boden aufschlug, kam ihm die Ahnung, dass es hier und jetzt ein jähes Ende nehmen könnte. War es das gewesen? Würde er in den nächsten Minuten jämmerlich auf dem Boden liegend verbluten oder gab es noch Hoffnung? Er wollte noch nicht sterben. Eine wahre Flut an Gedanken überschwemmte sein Hirn. Einige klar, andere durcheinander. Innerhalb eines Sekundenbruchteils dachte er an seine Familie, seine Kinder und an die Möglichkeit, sie niemals mehr wiederzusehen.
Er war nicht gläubig, obgleich seine Mutter sich alle Mühe gegeben hatte, ihn zu einem guten Christen zu erziehen. Wenn man starb, so war es seine Überzeugung, dann war man einfach nicht mehr. Nach dem Tod kam das Nichts. Aber er war noch nicht bereit für den Tod. Es gab noch so viele Dinge, die es noch zu erledigen gab. Er musste also kämpfen. Aufstehen, eine Lösung finden und dem offensichtlich Unausweichlichen entgegentreten. Er hatte noch nie aufgegeben und war zeitlebens ein Kämpfer gewesen. Aufgeben, auch wenn die Schlacht bereits verloren schien, war keine Option. Aus einfachsten Verhältnissen hatte er es nach ganz oben geschafft. Das dritte Projektil traf ihn an seiner Schläfe, als er versuchte sich wieder auf zurichten. Erneut taumelte er und bemerkte, wie die Gedanken, die sein Hirn durchströmten, immer nur noch diffuser wurden. Die Datenflut, die durch seinen Kopf strömte, war so gewaltig, dass er sie kaum noch bändigen konnte. Sein Blick fiel auf das Blut, welches sich vor seinen Augen auf dem weißen Marmorboden auf der Schwelle seines Arbeitszimmers zu der Eingangshalle ausbreitete und nun langsam im Dunkel der Ohnmacht verschwamm. Aus der Ferne vernahm er das Zuschlagen einer Autotür. Wie hatte es nur so weit kommen können? Noch einmal versuchte er erfolglos, sich von dem kalten Boden zu erheben. Nein, er hatte verloren. Das Ende war gekommen. Mit letzter Kraft begannen seine Finger, noch eine Botschaft in das Blut zu zeichnen, doch es war bereits zu spät, und er verlor nun endgültig die Besinnung.
Kapitel 1
Sonntag, 14. Dezember 2025, 11:17 Uhr Corso Umberto I, Ercolano, Neapel/Italien
„Idiot“, schrie der Fahrer des Taxis dem Wagen hinterher, der ihnen gerade in einem Wahnsinnstempo entgegengekommen war und sie um ein Haar noch gerammt hätte. Sophia Gerdes riss den Kopf herum und sah dem schwarzen Geländewagen durch die Heckscheibe hinterher, der bereits nach wenigen Augenblicken an der nächsten Straßenecke verschwunden war. Der hatte es wahrlich eilig gehabt. Sophia hatte keinen blassen Schimmer, von was für einer Marke der Wagen war. Für sie war ein Auto ein Auto. Bei dem Taxi, in dem sie gerade saß, handelte es sich um einen Lancia. Das wusste sie auch nur, weil ihr Papa früher einmal einen ähnlichen gefahren hatte. Da war sie sich ziemlich sicher. Doch ansonsten waren Autos einfach nicht so Sophias Ding. Zu laut, zu dreckig, zu hektisch. Sie selbst besaß zwar einen Führerschein, aber keinen eigenen Wagen. Wozu auch, wenn man wie sie seit Jahren auf einer autofreien Insel mitten in der Nordsee lebte. Sich selbst hinter das Steuer zu setzen, würde sie sich nach solch langer Autoabstinenz auch nicht trauen. Schon gar nicht in Neapel, wo sie alle fuhren, als wäre der Leibhaftige hinter ihnen her. Nein, da investierte sie lieber ein paar Euro in ein Taxi und ließ sich chauffieren. In ihrer Zeit als Jugendliche in Napoli hatte sie einen Roller besessen, von dem sie allerdings keine Ahnung hatte, wo der nach ihrem Umzug abgeblieben war. Vermutlich hatte ihr Papa das gute Stück verkauft oder entsorgt.
Überhaupt kam ihr heute vieles, was sie früher als selbstverständlich angesehen hatte, so unwirklich und beinahe beängstigend vor. So wie Neapel selbst. Dieser riesige, laute Moloch aus Steinen, Beton, Schmutz, Müll und hupenden, stinkenden Benzinkutschen am Fuße eines schlafenden Berges, welcher, wenn er explodierte, die Stadt innerhalb von Stunden oder Minuten unter sich begraben könnte.
Auf der halbstündigen Fahrt vom Airport Napoli bis nach Ercolano hatte sie dennoch gebannt dem Treiben der Großstadt zugesehen. Neapel war ihr fremd geworden, obgleich sie hier geboren worden war und den größten Teil ihres Lebens verbracht hatte. Der Gedanke, irgendwann zurück in die Heimat zu gehen, war für Sophia keine Option mehr. Zwar vermisste sie, wenn es in Ostfriesland wieder einmal stürmte und regnete, die Wärme der italienischen Sonne. Doch es war gut so, wie es gerade war. Juist, das kleine Eiland in der Nordsee, war zu ihrer neuen Heimat und ihrem Lebensmittelpunkt geworden.
Das Taxi stoppte nun direkt vor dem zweistöckigen gelben Gebäude im Corso Umberto I.
Das von außen eher schäbig wirkende Haus ihrer Eltern kam ihr heute wie aus einer anderen Welt vor. Ähnlich wie, wenn man an den Schauplatz eines Filmes oder einer Fernsehserie kam. Es war einem vertraut, weil man diesen Ort schon Hunderte Male auf der Mattscheibe in der Glotze gesehen hatte. Wenn man dann aber irgendwann einmal wirklich dort hinkam, war er einem dennoch fremd.
Die Tage, die Sophia bei der Familie in Neapel verbrachte, waren selten geworden. Der letzte Besuch lag nun ziemlich genau ein Jahr zurück. Ein Weihnachtsbesuch. Das letzte Mal hatte Ben, ihr Mann, sie begleitet. Doch der musste sich noch um den gemeinsamen Laden kümmern und würde erst am Heiligen Abend nachkommen. Am ersten Januar ging es dann wieder gemeinsam zurück nach Juist.
Das Taxi stoppte nun, Sophia stieß die Tür auf, ließ sich von dem Fahrer ihr Gepäck aus dem Kofferraum heben und bezahlte den Mann.
„Warten Sie, Signora. Ich werde Ihnen Ihre Koffer ins Haus tragen“, schlug der Fahrer vor, doch Sophia lehnte dankend ab.
Dabei fragte sie sich unwillkürlich, ob der Mann bei all seinen Fahrgästen so zuvorkommend war. Nein, vermutlich lag es entweder an dem üppigen Trinkgeld oder an ihrem Kugelbauch, der seit nun sieben Monaten stetig wuchs und sich hoffentlich Ende Januar, nach der Geburt, wieder vollständig zurückbilden würde. Sie hatte, bevor sie die Reise antrat, mit sich gehadert, die Bedenken und die Sorge, das Baby könnte früher als geplant während der Reise kommen, beiseitegeschoben.
Sie sah noch einmal flüchtig dem Taxi hinterher, warf sich dann ihren Rucksack über die Schulter, griff ihren Koffer und zog ihn hinter sich her zum Haus.
Sophia konnte nicht sagen, ob sie gerade mehr wütend oder eher doch enttäuscht war. Wochenlang hatte sie sich auf das Wiedersehen mit ihrer Mama und ihrem Papa gefreut. Nur wegen ihnen hatte sie den weiten Weg auf sich genommen. Sie hatte sich ausgemalt, wie die beiden, oder zumindest einer von ihnen, sie am Airport mit offenen Armen begrüßte. Doch nichts dergleichen war geschehen. Fast eine geschlagene Stunde hatte sie in der für italienische Verhältnisse eisigen Kälte vor dem Terminal gewartet und dabei immer wieder erfolglos versucht, ihren Papa Antonio und ihre Mama zu erreichen. Doch die beiden gingen weder an ihre Mobiltelefone noch an ihren Festnetzanschluss. Minutenlang hatte sie es klingeln lassen und sich dann total genervt ein Taxi genommen. Den Preis mit dem Fahrer hatte sie, wie es sich gehörte, zuvor rigoros ausgehandelt, dann aber vor Ort doch noch ein Trinkgeld obendrauf gepackt. So wie es in Neapel üblich war. Wäre sie eine gewöhnliche Touristin, hätte der Kerl ihr vermutlich mindestens das Doppelte oder noch mehr abgeknöpft. Doch zumindest dies hatte sie in den Jahren in Deutschland nicht verlernt.
Sophia vermutete, dass ihre Eltern sie schlichtweg vergessen hatten. Wobei sie erst gestern mit Mama telefoniert und ihr sowohl Flugnummer als auch die geschätzte Ankunftszeit mitgeteilt hatte. Doch vermutlich dachten die beiden wieder einmal, dass der jeweils andere sie abholen würde. Was aber auch nichts Neues war.
Okay, sowohl ihre Mutter als auch ihr Vater waren berufstätig und irgendwie permanent gestresst. Sie war Chefärztin in der Kieferchirurgie des Ospedale del Mare und er stellvertretender Chef der Carabinieri von Neapel. Beides Jobs, in denen es gelegentlich schon einmal hektisch zuging und immer wieder etwas Unvorhersehbares dazwischenkommen konnte. Irgendein medizinischer Notfall oder im Falle ihres Vaters ein Verbrechen, das seine volle Aufmerksamkeit forderte.
Aber war es tatsächlich zu viel verlangt, sich, wenn die einzige Tochter einmal im Jahr zu Besuch kam, abzustimmen und sie am Flughafen abzuholen? Oder ihr wenigstens eine Nachricht zukommen zu lassen? Dann hätte sie sofort ein Taxi genommen und keine Stunde sinnlos gewartet.
Vor der einen spaltbreit offenen Haustür hielt sie inne. Warum war die Tür nicht geschlossen? Das war mehr als ungewöhnlich. Ihr Vater achtete immer streng darauf, dass, wenn niemand zu Hause war, die Fenster und Türen geschlossen waren.
„Hallo? Papa? Mama?“, rief sie in den geräumigen Flur und entdeckte dann das Blut auf dem hellen Steinboden.
Vorsichtig trat sie über die Schwelle und blickte sich um. Als sie die reglose Gestalt im Durchgang zum Arbeitszimmer entdeckte, schnürte es ihr die Kehle zu. Ihr Herz begann zu rasen. Sie ließ den Koffer los. Der Rucksack glitt von ihrer Schulter zu Boden.
„Papa …“, kam es beinahe unhörbar über ihre Lippen, dann rannte sie zu ihm hin und sank neben ihm auf den Boden. Früher, bevor sie sich entschied, zu Ben nach Juist zu ziehen, war es immer ihr Wunsch gewesen, Ärztin zu werden. Genauso wie ihre Mutter und vor ihr ihr deutscher Großvater Ärzte waren. Sophia versuchte, die in ihr aufkeimende Panik zu unterdrücken. Zitternd ertastete ihre linke Hand die Halsschlagader ihres Vaters, während sie mit der rechten ihr Mobiltelefon aus der Jackentasche zog, um die Nummer des Notrufs zu wählen.
Nina Moretti stand am Fenster und blickte hinaus in den Garten hinter dem Haus und beobachtete Klaus und die Zwillinge, wie sie gemeinsam die große Schneekugel auf den Rumpf des Schneemannes hievten. Na, wenigstens die drei hatten bei dem Mistwetter ihren Spaß. Ihr Ding war dieses weiße Zeug, welches seit der letzten Nacht die Häuser, Wälder und Wiesen bedeckte, nicht.
Der Winter war definitiv eine Jahreszeit, die man ersatzlos streichen könnte. Wobei ihr der Schnee schon noch lieber war als das regnerische, nasskalte Wetter der letzten Wochen.
Ihr Blick glitt zu dem großen Pool der Villa, von dem unter der weißen Pracht nicht mehr viel zu sehen war. Ja, wegen ihr könnte es langsam wieder Frühling werden. Heute war der vierzehnte Dezember. Noch sieben Tage bis zur Wintersonnenwende. Ab dann würden die Tage wieder länger. Das war zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer.
Das Vibrieren ihres Mobiltelefons riss Nina aus ihren Tagträumen. Sie zog das Gerät aus der Tasche ihrer Jeans und hoffte dabei inständig, dass es nicht die Arbeit war. Erleichtert stellte sie nach einem Blick auf das Display fest, dass es sich bei der Anruferin um ihre Stieftochter Sarika handelte.
„Hallo Sari“, begrüßte sie die bereits erwachsene Tochter ihres Mannes Klaus.
„Hallo Nina … gut, dass ich dich erreiche“, schluchzte Sarika, worauf Nina sogleich ein ungutes Gefühl überkam.
„Ist was passiert?“, erkundigte sie sich besorgt und war gespannt, was die junge Frau gerade so aus der Bahn geworfen hatte, dass sie kaum ein Wort herausbrachte. Ninas erster Gedanke war, dass es vielleicht irgendetwas mit ihrer Mutter Inge oder deren Lebenspartner Hans Peter Thiel sein könnte, in deren Dachgeschosswohnung Sarika und Marcello zur Miete wohnten. Erinnerungen an Hans Peters Herzinfarkt vor einigen Jahren kamen ihr in den Sinn.
„Antonio … er wurde angeschossen“, schluchzte das Mädchen nun allerdings.
„Was? Ist er …?“ Nina wagte nicht, es auszusprechen.
„Keine Ahnung … Sophia hat ihn gefunden. Er ist im Krankenhaus und wird operiert … die Ärzte wissen nicht, ob er es schafft“, stammelte sie mit erstickter Stimme.
Obwohl Nina das Gefühl hatte, als würde sich gerade der Boden unter ihren Füßen in Bewegung setzen, schaltete sie wie so oft in solchen Momenten in ihren Dienstmodus. Als Kriminalhauptkommissarin hatte sie es gelernt, Ruhe zu bewahren, auch wenn um sie die Welt im Chaos versank. Panik half in ihrem Job niemandem und war kontraproduktiv. Zumindest versuchte sie es gerade, die Contenance zu wahren. Wirklich funktionieren wollte es nicht. Dafür war ihr ihr Halbbruder Antonio zu wichtig. Ihr großer Bruder, von dem sie lange Jahre noch nicht einmal gewusst hatte, dass es ihn gab.
„Wo ist Marcello?“, fragte sie, da es vermutlich einfacher war, mit ihm zu reden. Marcello war genau wie Nina Kriminalpolizist. Darüber hinaus gleichzeitig ihr Neffe und auch Schwiegersohn. Eine durchaus seltene Kombination, die ja aber kein Problem darstellte, da Sarika und er nicht wirklich blutsverwandt waren.
„Der packt gerade seinen Koffer. Ich soll ihn gleich zum Flughafen nach Frankfurt fahren.“
„Gib ihn mir!“, sagte Nina schroffer, als sie es gewollt hatte.
„Moment. Warte kurz“, antwortete die junge Frau.
Während es im Telefon raschelte, sah Nina noch einmal aus dem Fenster, klopfte dann an die Scheibe und gab Klaus, der verwundert zu ihr herübersah, ein Zeichen, er solle hereinkommen.
„Nina?“, hörte sie dann die fragende Stimme ihres Neffen Marcello aus dem Telefon.
Klaus, der gerade das Wohnzimmer durch die Terrassentür betrat, blickte sie fragend an.
„Marcello, was genau ist deinem Vater passiert, und was hast du vor?“, erkundigte Nina sich sachlich und hörte dann zu, was der junge Polizist zu sagen hatte.
Wirklich viele Informationen waren es nicht.
„Hast du deinen Flug schon gebucht?“, fragte sie.
„Nein … das wollte ich auf dem Weg nach Frankfurt. Irgendein Platz wird schon in einem Flieger frei sein“, antwortete er und hatte damit vermutlich recht. Von Frankfurt aus starteten mehrmals täglich Maschinen nach Neapel.
„Marcello, ihr kommt jetzt hier zu mir. Klaus wird uns, während ich meine Klamotten packe, zwei Flüge buchen und uns dann nach Frankfurt fahren“, beschloss sie jetzt einfach, ohne vorher mit ihrem Mann darüber zu sprechen. Klaus würde es verstehen. Ihren Neffen Marcello alleine nach Neapel zu lassen, war keine Option.
„Mama, verdammt, wo steckst du?“, presste Sophia hervor, als zum gefühlt einhundertsten Mal die Mailbox ihrer Mutter das Telefonat entgegennahm. Immer und immer wieder hatte sie versucht, sie zu erreichen. Erfolglos. Auch hier im Krankenhaus auf der Station, auf der sie arbeitete, wusste niemand, wo Michaela Berlutschi abgeblieben war. Sie sei heute einfach nicht zum Dienst erschienen. Etwas, das Sophia von ihr nicht kannte. Niemals würde sie ohne einen triftigen Grund nicht zur Arbeit gehen. Schon gar nicht, ohne sich vorher abzumelden.
Sie sah zu ihrer Großmutter. Nonna Nina saß ihr mit steinerner Miene gegenüber. Ihre grauen, langen Haare, die sie ansonsten immer streng zu einem Knoten geflochten trug, hingen ihr wirr ins Gesicht. So wie heute hatte Sophia ihre Nonna noch nie wahrgenommen. Alt war sie geworden. Die Lachfältchen waren verschwunden und tiefen Sorgenfalten gewichen. Im Gegensatz zu Sophia hatte ihre Oma bisher keine einzige Träne vergossen. Überhaupt hatte Sophia Nonna noch nie aus Kummer weinen gesehen. Wenn da gelegentlich schon einmal Tränen flossen, dann aus Freude. Viel gesprochen hatte die alte Frau heute ebenfalls nicht. Doch Sophia glaubte zu ahnen, was in ihrem Kopf vorging. Vermutlich das Gleiche wie in ihrem eigenen.
Sie hatte keine Ahnung, wie lange sie beide bereits auf dem Flur des Krankenhauses hockten und auf eine Nachricht der Ärzte hofften, die seit Stunden um das Leben ihres Papas kämpften.
Draußen war es bereits lange dunkel geworden. Laut der Uhr auf ihrem Handy war es kurz nach dreiundzwanzig Uhr. Sophia war seit kurz vor fünf Uhr morgens auf den Beinen. Sie hatte die erste Fähre von der Insel genommen, war mit dem Zug nach Bremen und von dort weiter mit dem Flugzeug nach Neapel. Ein anstrengender Tag, der mittlerweile seinen Tribut zollte. Trotz der Sorge um ihren Papa und der Anspannung kam langsam die Müdigkeit. Doch so wie es war, würde sie nicht schlafen können oder wollen. Was, wenn sie wegduselte und ausgerechnet dann einer der Ärzte mit der erlösenden Nachricht kam? Ja, sie glaubte zu wissen, dass alles wieder gut würde. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Ihr Papa würde nicht sterben. Niemals. Zu sterben war keine Option für einen Antonio Berlutschi.
Am Ende des Ganges, dort, wo es zu den Aufzügen ging, nahm sie nun eine Bewegung wahr. Die große Flügeltüre war aufgeschwungen, und zwei Personen kamen eilig auf sie zu.
„Marcello“, flüsterte sie kaum hörbar, sprang auf und lief ihrem Bruder entgegen.
„Ciao Sophia … gibt es etwas Neues?“, erkundigte sich der und drückte sie an sich.
Sie schüttelte den Kopf.
„Nein, sie operieren scheinbar immer noch“, antwortete sie und begann zu weinen.
Nina fühlte sich irgendwie wie ein Eindringling oder Fremdkörper in dieser Klinikszenerie. Ganz so, als gehörte sie nicht hierher. Zum ersten Mal seit Sarikas Anruf am Vormittag und den schlechten Nachrichten aus Neapel kam es ihr in den Sinn, dass es ein Fehler gewesen sein könnte, mit Marcello nach Neapel geflogen zu sein. Doch jetzt stand sie hier auf diesem Krankenhausflur. Da waren Bruder und Schwester, die sich um ihre Eltern sorgten, und sie fühlte sich neben den beiden wie das fünfte Rad am Wagen. Sie sah zu der alten Frau, die in einiger Entfernung auf einem der Stühle im Wartebereich saß und sie musterte. Was wohl gerade im Kopf von Signora Berlutschi vorging? Zwar kannte Nina die Mutter ihres Bruders vom Sehen, dennoch war die Frau ihr fremd. Guten Tag, Hallo und Auf Wiedersehen waren bisher die einzigen Dinge, die sie jemals mit ihr gesprochen hatte. Vermutlich, so war es Nina bereits bei ihrem letzten Aufeinandertreffen in den Sinn gekommen, sah die Alte in Nina eine Art Schande oder Verrat an ihr selbst. Sie, Nina Moretti, war die Tochter von Nina Berlutschis großer Liebe. Ninas Papa hatte die Frau vor über fünfzig Jahren schwanger hier in Neapel sitzen lassen, war nach Deutschland gegangen und hatte dort eine neue Familie gegründet. Sie beide trugen nicht zufällig den gleichen Vornamen. Nein. Marcello Moretti hatte seiner deutschen Tochter den Vornamen seiner italienischen Geliebten gegeben, die er Zeit seines Lebens nie wiedersah. Als Kind hatte Nina es nie verstanden, warum ihr Papa sich immer gegen eine Reise in seine Heimatstadt gewehrt hatte. Hunderte Male hatte ihre Mama Inge ihm eine Urlaubsreise oder einen Besuch bei den Verwandten vorgeschlagen. Doch er hatte immer abgelehnt. Erst als er starb, auf dem Sterbebett, musste Nina ihm versprechen, ihn nach seinem Tod in neapolitanischer Erde zu bestatten. Sie hatte ihm diesen Wunsch erfüllt. Gemeinsam mit Mama Inge hatten sie seine Urne, auf dem Rücksitz ihres geliebten VW Käfer, in die Stadt seiner Geburt gebracht und ihn hier bestattet.
„Solange die Ärzte Antonio noch operieren, ist nichts verloren“, hörte sie sich sagen und wandte ihren Blick von der alten Frau ab und den beiden Geschwistern zu.
Marcello nickte stumm, während seine Schwester schluchzte. Dass Sophia ein Kind erwartete, hatte Nina gewusst, obgleich sie so gar keinen Kontakt mit der Tochter ihres Halbbruders pflegte. Sophia war ein verschlossenes, ruhiges Mädchen. Im Grunde das genaue Gegenteil von Nina. Dass sie ein Baby erwartete, hatte Antonio ihr im Spätsommer bei ihrem letzten Besuch hier in Neapel erzählt. Stolz war der werdende Großvater gewesen.
„Nina, stell dir vor, ich werde Opa“, hatte er ihr total begeistert berichtet. Nun blieb es zu hoffen, dass er sein Enkelkind überhaupt noch kennenlernen konnte. Ein Gedanke, für den Nina sich schämte. Nein, so durfte sie nicht denken. Natürlich würde Antonio wieder aufwachen.
Nina bemerkte, wie die alte Frau sich erhob und auf sie zukam. Marcello trat vor und nahm seine Oma in den Arm. Diese erwiderte die Umarmung und flüsterte ihm etwas zu, das Nina nicht verstehen konnte. Dann löste sie sich, kam zu Nina, fasste sie an den Schultern, zog sie an sich und drückte sie ebenfalls.
Es war eine Geste, mit der Nina so nicht gerechnet hatte und von der sie auch nicht wusste, wie sie sie genau deuten sollte. Wie bereits gesagt, kannte sie die frühere Freundin, Geliebte, Verlobte oder wie immer man die Ex ihres Papas auch nennen sollte, gar nicht.
„Ciao Signora Berlutschi“, stammelte Nina, da sie keine Ahnung hatte, was sie der Alten ansonsten sagen sollte.
„Danke, Nina. Danke, dass du gekommen bist und den Kindern, mir und Antonio beistehst“, sagte sie leise, aber mit fester Stimme.
„Ähm … Keine Ursache … das ist doch selbstverständlich“, erwiderte Nina, immer noch von dem innigen Empfang verunsichert.
„Nein, Nina, ist es nicht. Es ist nicht selbstverständlich“, antwortete die Ältere mit fester Stimme, und Nina hatte keine Ahnung, wie sie diese Worte deuten sollte.
Die Schiebetür mit den Milchglasscheiben, hinter der sich der Aufschrift nach der OP-Bereich befand, öffnete sich, und ein Mann in blauer OP-Kleidung und einem weißen Kittel darüber kam heraus.
„Familie Berlutschi?“, fragte er.
„Was ist mit Papa? Wie geht es ihm?“, polterte Sophia sofort los, während Nina bereits versuchte, den ernsten Gesichtsausdruck des Mannes zu deuten.
„Mein Name ist Doktor Pinelli. Ich habe das OP-Team geleitet, welches Ihren Vater operiert hat. Fürs Erste ist er stabil, aber noch nicht über den Berg. Wir konnten die Kugel in der Brust entfernen und die Blutung in seinem Schädel stoppen. Doch alles andere liegt nun in der Hand des Allmächtigen“, antwortete er, und Nina schöpfte zum ersten Mal seit ihrem Aufbruch in Deutschland wieder richtig Hoffnung. Stabil hörte sich doch erst einmal gut an. Und das mit: „Er ist noch nicht über den Berg“, sagten diese Ärzte doch immer. Oder nicht?
„Können wir zu ihm? Ist er ansprechbar?“, erkundigte sich Marcello.
„Nein, er schläft. Wir mussten ihn in ein künstliches Koma versetzen, damit er absolut ruhig liegt. Ihr Vater benötigt absolute Ruhe. Es würde jetzt nichts bringen, wenn wir Sie zu ihm lassen. Gehen Sie nach Hause, ruhen Sie sich aus und beten Sie für ihn. Wenn sich in den nächsten Stunden an seinem Zustand etwas ändern sollte, werden wir Sie sofort informieren. Vielleicht kann ich Ihnen morgen Vormittag mehr sagen“, sagte der Arzt leise, aber bestimmt, empfahl sich, drehte sich um und ging.
Signora Berlutschi bekreuzigte sich, während Nina ihm hinterherblickte, bis sich die Milchglasscheibe des OP-Bereiches hinter ihm wieder schloss.
„Wo ist eigentlich Mama? Hast du sie mittlerweile erreicht? Hat sie sich gemeldet?“, erkundigte sich Marcello bei Sophia.
„Nein. Sie meldet sich nicht. Sie geht nicht an ihr Telefon, und hier auf der Arbeit war sie heute auch nicht, obwohl sie eigentlich Dienst gehabt hätte“, antwortete sie.
Nina mochte ihre Schwägerin Michaela. Die hübsche Zahnärztin stammte gebürtig aus der Region Gummersbach. Sie und Antonio hatten sich kennen- und lieben gelernt, als er einige Jahre während seines Studiums in Köln lebte. Ohne zu zögern, war sie ihm nach Neapel gefolgt und arbeitete seit dieser Zeit in genau diesem Klinikum. Soweit Nina wusste, war sie zwischenzeitlich sogar Chefärztin der Kieferchirurgie. Michaela Berlutschi war das deutsche Pflichtbewusstsein in Person. Zumindest hatte Nina bisher immer diesen Eindruck von der Schwägerin gehabt. Die würde nicht einfach abhauen, unentschuldigt ihrer Arbeit fernbleiben oder Antonio und ihre Kinder im Stich lassen. Nina hatte auch in all den Jahren niemals den Eindruck gehabt, dass es zwischen den Eheleuten irgendwelche Spannungen gäbe. Die hatten noch im Spätsommer bei Ninas Besuch herumgeturtelt wie frisch verliebt. Natürlich waren Paare, die so lange zusammenlebten, nicht immer einer Meinung. Auch bei ihr und Klaus flogen gelegentlich die Fetzen. Man stritt sich, er lenkte dann irgendwann ein, und am Ende des Tages war alles wieder gut.
Nein, dass Michaela sich nicht meldete und wie vom Erdboden verschluckt schien, war nicht gut. Irgendetwas war hier im Argen.
„Was sagen denn die Kollegen deines Vaters, gibt es Anhaltspunkte bezüglich der Identität des oder der Täter?“, wurde Nina sachlich.
Sophia hob die Schultern.
„Ich rufe Onkel Enzo an und frage nach. Eventuell kann er mir etwas sagen“, entschied Marcello, zog sein Mobiltelefon aus der Jackentasche und wählte eine eingespeicherte Nummer. Nina hatte keine Ahnung, wer dieser Onkel Enzo war, doch auch dies würde sie vermutlich noch erfahren.
Draußen vor dem Fenster schien es, außer den Lichtern der Stadt, noch immer dunkel, als Nina aus einem unruhigen Schlaf aufschreckte. Es dauerte einen Moment, bis es ihr wieder in den Sinn kam, wo sie war und warum es sich bei diesem Ort nicht um ihr heimisches Schlafzimmer handelte. Sie befand sich in Neapel. Genauer gesagt mitten in der Altstadt, im Vico Cinquesanti, in der Wohnung von Nina Berlutschi, der Mutter ihres Halbbruders Antonio.
Nina tastete nach ihrem Mobiltelefon, wurde direkt neben ihrem Kopf auf dem Nachtschrank fündig und blinzelte auf die Ziffern der Uhr des Gerätes. Sechs Uhr zweiundzwanzig. Eindeutig nicht ihre Zeit. Sie sank zurück in die Kissen, schloss noch einmal für einige Sekunden die Augen und überflog dann die Benachrichtigungen auf dem kleinen Handydisplay. Klaus hatte erst vor einigen Minuten geschrieben und ihr einen guten Morgen gewünscht. Sie erwiderte den Gruß, legte das Gerät wieder beiseite, schaltete das Licht an, schwang sich aus dem Bett und torkelte zum Fenster, um die Vorhänge beiseitezuschieben. Die schmale gepflasterte Gasse vor dem Fenster war menschenleer. Da sich die Wohnung der Signora Berlutschi in der unteren Etage befand, zog sie den Vorhang lieber wieder zu. Nina hatte keine Lust, dass jeden Moment eine Gruppe asiatischer oder deutscher Touristen vor dem Fenster auftauchte und ihr beim Ankleiden zusah. Nein, das musste nicht sein.
Als sie Sekunden später zur Toilette über den Flur schlurfte, vernahm sie eine leise Stimme aus der Küche. Es war eindeutig die von Nonna Berlutschi. Nina blieb stehen und lauschte. Die ältere Frau schien zu telefonieren. Um was es genau ging, war nicht zu verstehen. Nina vermutete, dass Antonio das Thema der Konversation war. Wie es schien, gab es aber nichts Neues.
Nina setzte ihren Weg ins Bad fort. Dabei drehte sich bereits wieder ihr Gedankenkarussell. Noch in der Nacht hatte Marcello mit Onkel Enzo, einem Kollegen und Freund von Antonio, telefoniert. Tatsächlich gab es Hinweise auf den Täter, beziehungsweise die Täterin. Die Polizei hatte am Tatort die Pistole sichergestellt, aus der die Schüsse auf Ninas Bruder abgegeben worden waren. Bei der sichergestellten Waffe handelte es sich eindeutig um Antonios Dienstwaffe. Eine Beretta 92. Darauf, neben seinen eigenen, auch die Fingerabdrücke seiner Frau Michaela. Sonst keine. Ein Umstand, der den Schluss zuließ, dass Michaela auf ihren Mann geschossen haben könnte.
„Das würde sie nie tun“, hatte Marcello daraufhin gemeint, während Nina sich da nicht so sicher war. Wenn sie nämlich eines in den Jahren als Polizistin gelernt hatte, dann war es dies, dass man menschliche Reaktionen in Stresssituationen unmöglich vorhersagen konnte. Unter Stress, mit dem Rücken an der Wand, wurden aus Menschen wieder primitive Säuger, Raubtiere, die unberechenbar waren.
„Nina, du kannst den Menschen immer nur bis vor die Stirn sehen“, war eine der Lieblingsweisheiten ihres ehemaligen Kollegen Hans Peter Thiel.
Eine Aussage des alten Bullen, der Nina uneingeschränkt zustimmte. Auf den ersten Blick waren Antonio und Michaela das perfekte Paar. Alles in Ordnung. Friede, Freude, Eierkuchen, wie man so schön sagte. Doch war dem auch wirklich so oder brodelte da unter der Oberfläche vielleicht doch ein Supervulkan? Die Antwort darauf kannten vermutlich nur Michaela und Antonio selbst.
Dennoch fiel es auch Nina gerade sehr schwer, an die These zu glauben, dass Michaela auf Antonio geschossen haben könnte.
Der Umstand, dass von ihr jede Spur fehlte, gab Nina allerdings schon zu denken.
„Guten Morgen, Signora Berlutschi“, grüßte Nina die Hausherrin, als sie nur Minuten später, immer noch barfuß, aber zumindest bereits mit einer Hose und einem T-Shirt bekleidet, die Küche betrat.
„Guten Morgen, Nina“, antwortete die Ältere und schien den Umständen entsprechend gut gelaunt.
„Gibt es etwas Neues aus der Klinik? Haben die Ärzte sich gemeldet?“, erkundigte sich Nina daher.
Die Seniorin wackelte mit dem Kopf.
„Nein, nicht direkt. Aber ich habe vorhin mit Angela Conti, einer Kollegin und Freundin von Michaela, telefoniert. Antonio ist weiterhin stabil.“
„Okay, das ist gut“, bestätigte Nina, obwohl sie sich nicht sicher war, ob dem so war. Bevor Antonio nicht aufgewacht und ansprechbar war, war gar nichts gut.
Nina ließ sich auf einen der sechs Stühle sinken und blickte sich in der Küche um.
Sie war zuvor noch nie in der Wohnung von Antonios Mama gewesen. Doch was sie bisher davon gesehen hatte, war wirklich hübsch. Frau Berlutschi besaß, wie es schien, ein Faible für alte Möbel. Nina glaubte zu wissen, dass es sich bei den Stühlen mit den hohen, verschnörkelten, in Gold gehaltenen Lehnen um Rokoko handelte. Die Sitzflächen waren mit dunkelrot gemustertem Stoff bezogen, durch den sich ebenfalls goldene Fäden zogen. Schon irgendwie hübsch, aber nicht wirklich Ninas Ding. Von außen hatte das mehrstöckige Haus keinen wirklich guten Eindruck gemacht. Farbe und Putz der Fassade hatten schon wesentlich bessere Zeiten gesehen. Ein Phänomen, das Nina allerdings von vielen neapolitanischen Gebäuden kannte. Von außen pfui, von innen hui. In Deutschland erlebte sie dies oft genau umgekehrt. Da gab es äußerlich top gepflegte Anwesen, bei deren Betreten einen dann angesichts des vorherrschenden Chaos der Schlag traf.
„Einen Cappuccino?“, fragte die Ältere und stellte die Tasse bereits, ohne dass Nina auch nur die Chance gehabt hätte, abzulehnen, vor ihr ab. Cappuccino, das wusste Nina von ihrem Papa, trank der Neapolitaner nur vor zehn Uhr am Morgen. Danach bevorzugte man dann eher einen Espresso oder etwas in der Art. Kaffee im Allgemeinen gab es hier ansonsten viel und rund um die Uhr.
„Danke schön. Auch dafür, dass ich bei Ihnen übernachten durfte“, antwortete Nina, wobei es ihr fast lieber gewesen wäre, in ein Hotel zu gehen. Sie wurde einfach das Gefühl nicht los, hier ein Eindringling zu sein.
Signora Berlutschi hatte allerdings darauf bestanden, dass Nina in ihrem Gästezimmer nächtigte. Wobei es sich bei diesem, wie Nina glaubte, um das ehemalige Jugendzimmer ihres Bruders handelte. Die Urkunden und Bilder an den Wänden waren da sehr eindeutig. Bisher hatte sie gar nicht gewusst, dass Antonio früher so erfolgreich Fußball gespielt hatte. Überhaupt wusste sie wenig über den jugendlichen Antonio. Sie und ihr Bruder waren sich zum ersten Mal 2014 bei einem gemeinsamen Fall im Westerwald begegnet. Damals wurde ein junger Italiener ermordet, und ihr Bruder war ihr als italienischer Ermittler zugeteilt worden. Er hatte gewusst, wer sie war, als sie ihn am Flughafen Köln-Bonn abholte. Sie hatte keine Ahnung, dass es da überhaupt einen Bruder gab. Antonio war sieben Jahre älter als Nina und hatte ihren gemeinsamen Vater nie kennengelernt. Wobei er Nina einmal gestanden hatte, dass er während seines Studiums in Köln sogar zweimal vor dem Haus in Betzdorf-Bruche gestanden habe, um ihn aufzusuchen, sich aber dann doch nicht getraut habe, aus dem Wagen zu steigen.
Nina fragte sich oft, wie ihr Papa wohl reagiert hätte, wenn Antonio den Mut aufgebracht und doch plötzlich vor der Haustüre gestanden hätte. Eigentlich war sie sich sicher, dass er sich über den Besuch gefreut hätte. Andererseits war da aber auch wieder diese Sache, dass man den Menschen nur bis vor die Stirn schauen konnte. Selbst dem eigenen Vater. Vielleicht wäre der Sohn aus einem früheren Leben ihrem Papa auch peinlich gewesen. Vielleicht hätte er ihn verleugnet, da er nicht in die neue, feine, heile deutsche Welt passte. Sie würde es niemals mehr erfahren. Papa Moretti war 2011 viel zu früh gestorben. Scheiß Krebs!
„Nina, du musst dich nicht bei mir bedanken. Du gehörst hierher genau wie Antonio, die Kinder und Michaela. Ihr alle seid meine Familie. Deshalb möchte ich auch, dass du mich bitte Nina oder wegen mir auch Mama oder Nonna nennst. Alles, nur nicht Signora Berlutschi“, sagte die alte Frau, während sie sich auf den Stuhl neben Nina sinken ließ.
Nina nickte.
„Gerne … Aber, wo du gerade Michaela erwähnt hast … kannst du dir vorstellen …“
„Nein, Nina! Nein! Michaela würde niemals auf Antonio schießen“, fuhr die Ältere ihr ziemlich barsch über den Mund.
„Vielleicht wurde sie dazu gezwungen? Was, wenn sie selbst bedroht wurde?“, äußerte Nina einen Verdacht, auf den Klaus sie in der letzten Nacht gebracht hatte. Mit ihm hatte sie noch bis kurz vor Mitternacht erst geschrieben und später, als ihr das Tippen über WhatsApp zu blöd wurde, telefoniert.
„Nein. Auch dann würde Michaela niemals auf Antonio schießen. Bevor sie ihm etwas zuleide täte, würde sie lieber selbst sterben“, wiegelte Antonios Mama entschieden ab.
Eine, wie Nina fand, sehr seltene Ansicht einer Schwiegermutter, die sie so bisher noch nie erlebt hatte. Die meisten Schwiegermütter, denen Nina bisher begegnet war, hatten eine eher nicht so hohe Meinung von den Ehefrauen ihrer Söhne. Wobei Nina sich da jetzt über die Mutter ihres Mannes Klaus auch nicht wirklich beschweren konnte. Nina und sie hatten schon immer ein gutes Verhältnis zueinander gehabt. Fraglich war nur, ob die auch noch so gut auf Nina zu sprechen wäre, wenn der Verdacht eines versuchten Mordes an ihrem Jungen bestünde.
„Aber, wenn Michaela es nicht war … Wo steckt sie dann?“, erkundigte sich Nina.
Die ältere Dame sah zur Tür und beugte sich dann zu Nina.
„Ich glaube nicht, dass Michaela einfach nur geflohen ist. Irgendetwas muss ihr passiert sein“, flüsterte sie besorgt und äußerte damit einen weiteren von Ninas Gedankenansätzen. Ja, es könnte durchaus sein, dass Michaela gerade heftig in der Klemme steckte. Dass irgendwer sie festhielt oder sie … Nein, daran, dass Michaela bereits längst nicht mehr lebte, wollte Nina gar nicht denken.
Kapitel 2
Montag, 15. Dezember 2025, 7:33 Uhr Kriminalinspektion Friedrichstraße, Betzdorf/Westerwald
Kriminaloberkommissar Kübler stand am Fenster seines Büros und sah auf das kleine Flüsschen Heller, das direkt hinter dem Parkplatz der Polizeiwache entlangfloss und derzeit ordentlich Wasser führte. Wie so oft hier unten im Tal regnete es, während es bei ihm zu Hause auf den Höhen des Westerwalds schneite, als gäbe es keinen Morgen mehr.
Thomas mochte den Winter im Westerwald. Zumindest den oben auf den Hügeln. Dem kahlen Nasskalt hier unten in Betzdorf konnte er hingegen nichts abgewinnen.
Der Anruf von Nina war gestern um die Mittagszeit gekommen. Sie benötigte dringend ein paar freie Tage, um einige familiäre Dinge in Neapel zu klären. Um was es genau ging, hatte sie nicht gesagt. Nur, dass sie Marcello mitnehmen würde und dieser daher ebenfalls nicht zur Arbeit kommen konnte. Das Gespräch hatte keine halbe Minute gedauert. Eine Nachfrage war seinerseits nicht möglich gewesen. Es blieb also wieder einmal alles an ihm hängen, und er wusste noch nicht einmal wirklich, warum dem so war.
Nun gut. Derzeit war nicht viel los. Keine ungeklärten Todesfälle. Kein Mord und Totschlag. Zum anderen war da, falls sich dies ändern würde, ja auch noch Hauptkommissarin Heike Friedrichs in der Abteilung. Wobei diese ja offiziell nur eine Halbtagsstelle besetzte.
Thomas seufzte. Neapel, da wäre er jetzt auch lieber. Obwohl er den Winter auch gerne mochte. Am Mittelmeer war es schon schön. Das letzte Mal waren er, Alex und die Kinder vor etwas länger als zwei Jahren im Oktober dort gewesen, als Marcello und Sarika heirateten. Okay, die Stadt an sich war schon ein wenig abgerockt. Die Häuser und Straßen in einem Zustand, den sich die meisten deutschen Nörgler noch nicht einmal in ihren wildesten Fantasien vorstellen könnten. Dazu der allgegenwärtige Müll, der Geruch nach Diesel gemischt mit dem von frisch gebackener Pizza und nicht zu vergessen die italienische Mafia. Wobei man als Tourist von der ja nicht unmittelbar etwas mitbekam. Aber egal. Thomas hatten die Stadt und das Umland irgendwie schon gefallen.
Er ging zurück an seinen Schreibtisch, ließ sich in seinen Chefsessel plumpsen, griff sein Handy und googelte nach dem derzeitigen Wetter in Neapel. Das Ergebnis war ernüchternd. Heute acht Grad, stark bewölkt, stürmisch und Regen. Okay. Da konnte er auch zu Hause bleiben.
Dennoch fragte er sich gerade, welche dringenden Familienangelegenheiten seine Kollegen Nina Moretti und Marcello Berlutschi vor Ort zu regeln hatten.
Kurz überlegte er, welche seiner Quellen er da am besten anzapfen könnte, um diese Wissenslücke zu schließen. Klaus war vermutlich gerade in der Schule und unterrichtete. Sarika könnte an der Uni sein. Die studierte ja immer noch Jura. Blieben also noch Inge Moretti oder der alte Bulle Hans Peter Thiel. Thomas entschied sich für Letzteren.
Nach dem ersten Frühstück, das aus eher süßem Gebäck und noch zwei weiteren Cappuccinos bestand, waren Nina und Marcello mit dem Leihwagen, den sie gestern am Airport gemietet hatten, in die Klinik gefahren. Es goss an diesem Morgen wie aus Eimern. Vom Vesuv, der ansonsten übermächtig und über eins Komma zwei Kilometer hoch oberhalb der Stadt thronte, war vor lauter Wolken nichts zu sehen.
Nina staunte nicht schlecht, als sie den uniformierten Polizisten vor dem Eingang zur Intensivstation entdeckte.
Bei ihm befand sich ein älterer Herr im Anzug, den Marcello ihr als den bereits erwähnten Enzo Moretti vorstellte.
„Nina Moretti? Du bist also die deutsche Tochter von Onkel Marcello Moretti. Mein Papa und deiner waren Brüder“, wusste auch er sofort, wer Nina war.
Sollte der tatsächlich ein Verwandter sein? Nina hatte bei der Erwähnung „Onkel“ mehr so an einen Nennonkel gedacht. Ihr Papa hatte nie über seine Geschwister gesprochen. Außer, dass er wohl welche gehabt hatte, wusste Nina nichts über die Familie. Damals, als sie Papa hier in Neapel beerdigten, war gerade einmal eine Handvoll der Verwandten anwesend gewesen. Erinnern konnte sich Nina an keinen mehr von denen, da sie die Leute in ihrer Trauer noch nicht einmal richtig wahrgenommen hatte.
Wie sich im Verlauf des Gesprächs herausstellte, handelte es sich bei Enzo um ihren ältesten Vetter. Einem von vielen Verwandten. Der neapolitanische Zweig ihrer Familie schien riesig zu sein. Wirklich interessieren tat es Nina aber auch nicht. Auch wenn diese Leute mit ihr blutsverwandt waren, fühlte sie sich nicht so, als wären die ihre Familie. Familie war eben mehr als nur Blutsverwandtschaft. Familie waren die Menschen, die einen mochten und mit denen man sich verbunden fühlte. Alex, Thomas und Thiel waren ihr da wesentlich näher als die Sippe ihres verstorbenen Vaters in Italien.
Enzo Moretti war, wie sich herausstellte, ebenfalls Polizist. Doch nicht wie Antonio oder Marcello bei den Carabinieri, sondern bei der Polizia di Stato. Anders als in Deutschland gab es nämlich in Italien zwei Polizeiorganisationen, die im Grunde die gleichen Aufgaben wahrnahmen. Die Unterschiede waren dabei nicht nur die Farben der Uniformen und der Streifenwagen. Nein, die Sache war etwas komplizierter. Die Polizia di Stato unterstand, ähnlich wie die Polizei in Deutschland, dem Innenministerium, während die Carabinieri neben Heer, Marine und Luftwaffe zumindest theoretisch als vierte Teilstreitkraft dem Verteidigungsministerium unterstanden. Im Prinzip handelte es sich bei Antonio und Marcello also um Soldaten, die aber ganz normalen Polizeidienst auf Weisung des Innenministeriums versahen. Wirklich verstanden hatte Nina diese Konstellation noch nie. Das Ganze hatte sich wohl irgendwer einmal ausgedacht, als es auf dem heutigen Staatsgebiet von Italien noch mehrere Königreiche gab. Was aber auch egal war und gerade nichts zur Sache tat.
„Hat sich Michaela bei euch gemeldet?“, wollte Enzo wissen, den Nina auf bereits jenseits der sechzig schätzte. Der Polizist war von der Rente vermutlich nicht mehr weit entfernt. Wobei sie keine Ahnung hatte, wie lange man hier in Italien Dienst schieben musste, bis Vater Staat einen in den Ruhestand entließ.
„Nein, hat sie nicht. Aber sag mir lieber, dass ihr auch in andere Richtungen ermittelt“, knurrte Marcello, dem es ganz und gar nicht zu passen schien, dass die Polizei nach seiner Mutter als möglicher Täterin fahndete. Der Junge war, das hatte er während des Frühstücks noch einmal überdeutlich gemacht, von Michaelas Unschuld überzeugt. Seine Schwester Sophia hatte sich zu Ninas Verwunderung gar nicht zu dem Thema geäußert. Die hatte einfach nur dagehockt und ihren Tee geschlürft. Zu viel Kaffee würde dem Baby schaden, hatte sie nur gemeint und damit ein verständnisloses Kopfschütteln ihrer Nonna geerntet. Nina vermutete eher, dass Sophia schon zu lange auf ihrer friesischen Insel lebte und mittlerweile mehr eine Ostfriesin als Italienerin war. Land und Leute färbten gerade im Norden Deutschlands schnell ab. Die Teebeutel und Kluntje hatte die Schwangere sich aus ihrer neuen Heimat selbstverständlich mitgebracht.
„Selbstverständlich ermitteln wir auch in andere Richtungen“, entgegnete Enzo und schien von Marcellos Frage pikiert.
„In welche?“, hakte Marcello, den Nina noch nie so aggressiv wie heute erlebt hatte, nach. Seine Worte waren messerscharf. Im Gegensatz zu Nina übernahm Marcello bei ihren sonstigen Befragungen immer eher den ruhigeren Part. Der Junge blieb locker und sachlich, auch wenn der zu Befragende Nina schon zur Weißglut gebracht hatte. Ja, sie beide waren, obgleich sie dies zuvor nie geglaubt hätte, ein tolles Team. Der Typ war ein cooler Hund, der, wenn es sein musste, aber auch mal zupacken konnte.
„Das kann ich dir nicht sagen. Das sind Polizeiinterna, die dich nichts angehen“, antwortete Enzo.
„Ach so. Die gehen mich also nichts an? Ich denke eher, du willst nichts sagen, weil du es nicht weißt … weil ihr ansonsten gar keine Spuren habt“, äußerte der Junge seine Vermutung.
„Nein, Marcello. Ich kann dir nichts sagen, weil es dich schlicht und einfach nichts angeht. Kümmere dich um deine Schwester, Nonna Nina und eure Besucherin aus Deutschland und überlass die Ermittlungen uns“, verschärfte sich auch Enzos Ton nun deutlich.
„Warum sitzt euer uniformierter Kollege hier vor der Tür zur Intensivstation?“, mischte Nina sich nun ein. „Glaubt ihr, dass es nötig ist, dass jemand Antonio bewacht?“
Enzo nickte und schien beinahe dankbar über den Themenwechsel.
Für Marcello, das sah sie ihm an, war das Thema noch nicht beendet. Die zum Boden gerichtete geballte Rechte sprach deutliche Worte. Dennoch sagte er nichts mehr.
„Anhaltspunkte, dass es noch einmal jemand versuchen könnte, haben wir nicht. Aber solange wir den Täter oder die Täterin noch nicht gefasst haben, ist es auf alle Fälle sicherer“, antwortete Enzo, was Nina bereits vermutet hatte.
Nina sah zu Mama Berlutschi, deren Miene steinern wirkte und die kein Wort sagte. Dass sie Enzo, aus welchem Grunde auch immer, nicht mochte, war offensichtlich. Nina hatte nach dem Tod ihres Papas erfahren, dass die Berlutschis und die Familie Moretti sich nicht sonderlich gemocht hatten. Angeblich wegen irgendeines Vorfalls, der bereits Jahrzehnte zurücklag. Eine Familienfehde, die in einer modernen Welt und unter vernünftigen Menschen nichts mehr zu bedeuten hatte. Zumindest sollte man dies meinen. Der Auslöser für die Flucht ihres Vaters aus Neapel war wohl dessen Liebschaft mit einer Tochter aus der Familie der Berlutschis gewesen. „Wenn er nicht geflohen wäre, hätten sie ihn vermutlich umgebracht“, hatte Ninas Mama Inge ihr irgendwann einmal erklärt. Für Nina war das Bullshit. Da musste noch irgendetwas anderes vorgefallen sein, was die Flucht ausgelöst hatte. Ansonsten hätte ihr Vater ja immer noch die Möglichkeit gehabt, seine schwangere Freundin mit nach Deutschland zu nehmen. Warum war er gegangen und sie zurückgeblieben? Vielleicht würde Nina sie das, wenn die Sache mit Antonio wieder in Ordnung war, einmal fragen. Ihr Bruder Antonio hatte jedes Mal, wenn sie diese Frage stellte, getan, als wüsste er ebenfalls nichts Genaues. Was sie ihm allerdings genauso wenig abnahm. Irgendetwas war da im Jahr 1974 vorgefallen, über das niemand reden wollte. Zumindest war dies Ninas Eindruck.
Mama Berlutschi marschierte nun zielsicher zu einem Klingelknopf neben der Tür zur Intensivstation und betätigte ihn. Nur Sekunden später öffnete sich die Tür und eine Krankenschwester erschien.
Hätte Nina nicht gewusst, dass es sich bei dem Mann in dem Krankenbett hinter der Glasscheibe um ihren Bruder handelte, dann hätte sie ihn nicht erkannt. Da nur zwei Personen zu ihm durften, waren Nina und Marcello draußen auf dem Gang vor dem Zimmer geblieben, während Sophia und Antonios Mama zu ihm hineingegangen waren. In steriler OP-Kleidung und mit Mundschutz hielt Sophia nun Antonios Hand, während Mama Berlutschi am Fußende des Bettes verharrte und zu beten schien.
Dass die ältere Frau sehr gläubig war, war Nina bereits in deren Wohnung aufgefallen. Unzählige Bilder und Kreuze in allen Räumen zeugten davon.
Mit Ninas Glauben war es nicht so weit her. Ja, sie war katholisch getauft und zahlte sogar brav ihre Kirchensteuer, würde sich aber dennoch nicht wirklich als gläubig bezeichnen. Sie war davon überzeugt, dass es zwischen Himmel und Erde irgendeine unsichtbare Macht gab. Aber ob es jetzt die Christen, Juden, Hindus oder gar die Jedi-Ritter waren, die die Weisheit mit Löffeln gefressen hatten, wagte sie zu bezweifeln. Ihre Eltern hatten dies anders gesehen. Vielleicht, weil sie noch in einer anderen Zeit aufgewachsen waren. Was aber nun auch nichts zur Sache tat.
„Was denkst du?“, erkundigte sie sich bei Marcello, dessen Gesicht sich in der Glasscheibe neben dem ihren spiegelte.
„Ich denke, dass wir den finden müssen, der Papa das angetan hat“, antwortete er.
„Mit WIR meinst du wen genau?“, hakte sie nach, obgleich sie sicher war, die Antwort zu wissen. Dass die Polizei Marcello nach dem Auftritt von Enzo an ihren Ermittlungen teilhaben ließ, war eher fraglich.
Er drehte seinen Kopf einige Millimeter und betrachtete ihr Spiegelbild.
„Na ja, Nina, hier ist außer dir kein Mensch, dem ich vertraue. Außer natürlich den beiden da. Aber die werden uns vermutlich keine große Hilfe sein“, flüsterte er und deutete mit einem Kopfnicken in Richtung seiner Schwester und der Großmutter.
„Du vertraust mir also. Gut zu wissen. Wo genau fangen wir denn an zu suchen?“, erkundigte sie sich.
„Ich würde vorschlagen, am Tatort. Im Haus meiner Eltern in Ercolano.“
Nina nickte zustimmend. Genau dies wäre auch ihr Vorschlag gewesen.
„Ich würde sagen, wir warten, bis Sophia und die Nonna fertig sind, und setzen die beiden noch an der Via Anticagila ab“, sagte er, wandte sich ab und ging Richtung Ausgang.
Nina blieb stehen und betrachtete Antonio und die beiden Frauen bei ihm noch eine Weile. Während Sophia immer noch schluchzend Antonios Hand hielt, bewegten sich unhörbar die Lippen der Älteren. Es blieb zu hoffen, dass die göttliche Macht, zu der sie sprach, sie auch tatsächlich erhörte.
Marcello fühlte sich hilflos wie lange nicht in seinem Leben. Dieses Gefühl machte ihn wütend. Wütend auf sich selbst, auf seinen Vater, seine Mutter und die Menschen, die Antonio dies angetan hatten. Noch schlimmer als den gesundheitlichen Zustand seines Vaters fand er im Moment nur noch die Ungewissheit über den Verbleib seiner Mutter. Seine Mama war keine Mörderin. Sie war Ärztin. Eine Frau, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Leben zu retten und anderen Menschen zu helfen. Das, was Enzo und seine Kollegen von der Polizei ihr vorwarfen, war so nicht geschehen. Michaela hätte Antonio niemals niedergeschossen und ihn verbluten lassen. Sie würde auch nicht ohne einen triftigen Grund einfach so von der Bildfläche verschwinden. Nein, je mehr er darüber nachdachte, umso mehr kam er zu dem Resultat, dass ihr irgendetwas zugestoßen sein musste. Ein Gedanke, über den er nicht mit seiner Nonna und schon gar nicht mit seiner Schwester reden konnte. Noch dazu in ihrem Zustand. Auch Marcello würde im nächsten Sommer Vater werden. Wann genau es so weit war, wussten er und Sarika noch gar nicht. Der Termin beim Gynäkologen war erst am kommenden Donnerstag, weshalb er auch noch niemandem davon erzählt hatte. Bisher gab es lediglich einen positiven noch nicht bestätigten Schwangerschaftstest.
Marcello war froh, dass Nina bei ihm war. Nicht weil es sich bei ihr um seine Tante handelte und er sich seelischen Beistand von ihr erhoffte. Nein, Nina war eine ausgezeichnete Polizistin, die zwar gelegentlich zu Überreaktionen neigte, auf die er sich aber blind verlassen konnte. Marcello könnte sich keine andere Dienstpartnerin als sie vorstellen. Außer vielleicht noch den alten Bullen Hans Peter Thiel. Onkel Enzo war eine hinterlistige Natter, drei Monate vor dem Ruhestand. Der würde sich in diesem Fall nicht mehr die Hände schmutzig machen wollen. Außerdem war er ein Moretti. Marcello hatte nie verstanden, warum sein Papa und Enzo sich dennoch immer so gut verstanden hatten. Nun gut, die beiden waren trotz der unterschiedlichen Namen Vettern. Verbunden durch eine Liaison, die keine der beiden Familien gewollt hatte. Wirklich akzeptiert hatten die Morettis Antonio und Nonna Nina Berlutschi nie. Auch Nina Moretti gehörte nicht zur neapolitanischen Familie Moretti. Dies zeigte schon die Tatsache, dass Ninas Papa, als Inge und sie ihn vor vierzehn Jahren in Neapel bestatteten, auf einer Wiese im äußersten Winkel des Friedhofs verscharrt und nicht, wie es sich gehörte, in der pompösen Familiengruft der Morettis beigesetzt wurde. Für Marcello ein Schlag ins Gesicht der deutschen Familie, die ihn und seine Frau Sarika als einen der ihren aufgenommen hatte. Zum Glück verstanden Inge und Nina nicht, wie entwürdigend dieser Umstand war.
„Hast du mal eine Zigarette für mich?“, erkundigte er sich bei dem uniformierten Polizisten, der draußen auf dem Stuhl vor der Intensivstation saß und in einer Zeitschrift blätterte. Obwohl er den Mann wie selbstverständlich duzte, war er dem Kollegen von der Polizia di Stato noch nie zuvor begegnet.
Der Mann, der in etwa in Marcellos Alter war, nickte, zog eine bereits arg zerknitterte Schachtel aus seiner Jackentasche und hielt sie Marcello hin. Er nahm eine Zigarette heraus, gab ihm das Päckchen zurück und bedankte sich.
„Keine Ursache. Du bist Marcello, der Sohn des Generale di Corpo Berlutschi?“, fragte der Polizist, als Marcello sich bereits zum Gehen abwenden wollte.
Marcello hielt inne und drehte sich verwundert wieder zu ihm um.
„Kennen wir uns?“, erkundigte er sich.
„Nein, ich hatte nur gehört, dass du seit drei Jahren bei der Kriminalpolizei in Deutschland arbeitest. Das klingt spannend“, schien der Uniformierte bestens informiert.
„Ja. Das sind jetzt tatsächlich schon über drei Jahre“, wunderte er sich nun selbst.
„Und vermisst du Neapel?“
Marcello überlegte kurz.
„Nein. Gar nicht“, antwortete er sicher, schüttelte dann den Kopf, drehte sich um und ging in Gedanken versunken hinaus.
Nein, er vermisste Neapel nicht. Er hatte im Westerwald den Ort gefunden, an den er gehörte. Er hatte Freundschaften geschlossen und eine neue Familie gefunden. Der einzige Grund für ihn, irgendwann vielleicht zurück nach Neapel zu ziehen, waren bisher immer seine Eltern und die Großmutter gewesen. Wenn Antonio das hier nicht überlebte und seine Mama nicht mehr wäre … nein, daran wollte er nicht denken. Auf dem Weg ins Freie zog er sein Handy aus seiner Tasche und wählte die Nummer von Sarika.
„Hallo Marcello“, meldete sie sich bereits nach wenigen Augenblicken.
„Hallo Sari … ich musste nur mal deine Stimme hören“, flüsterte er und wischte sich mit dem Ärmel seines Mantels eine Träne von seiner Wange.
Die Wege in Neapel waren lang und holprig. Weshalb es bereits später Vormittag war, als Nina und Marcello mit dem gemieteten Fiat Panda in den Corso Umberto I bogen.
„Meine Güte. Die Straßen hier sind echt das Letzte“, stöhnte Nina angesichts der mit großen Steinquadern gepflasterten Gassen.
Zum ersten Mal, seit sie ihn gestern getroffen hatte, lächelte Marcello.
„Glaub mir, Nina, in diesem Viertel sind nicht nur die Straßen das Letzte“, antwortete er, während sie ihren Blick über die heruntergekommenen Häuser schweifen ließ. Es war ihr schleierhaft, warum ihr Bruder Antonio ausgerechnet in einem so heruntergekommenen Stadtteil wie Ercolano lebte. Noch dazu, wo der so abgelegen vom Zentrum war. Nina war davon überzeugt, dass Antonio und Michaela beide ordentlich verdienten und sich locker etwas anderes auf einem der Hügel unmittelbar an der Küste leisten könnten. Da gab es wahrlich wunderschöne Anwesen mit einem traumhaften Ausblick auf das Meer.
„Uns gefällt es hier halt“, hatte Antonio ihr lediglich geantwortet, als sie ihn bei ihrem ersten Besuch in Neapel darauf ansprach.
„Da steht Mamas Fiat Panda“, meinte Marcello, als sie sich dem Haus der Familie bis auf wenige Meter genähert hatten, und deutete auf einen kleinen grauen Flitzer mit rotem Stoffdach schräg gegenüber der Einfahrt.
Nina nickte. Den Schuhkarton auf Rädern war sie im Herbst bei ihrem letzten Besuch auch bereits mehrfach selbst gefahren. Michaela war also schon einmal nicht mit ihrem Auto unterwegs.
„Fährt Antonio immer noch diesen dunkelblauen Lancia?“, erkundigte sie sich und hielt bereits nach der Limousine Ausschau.
„Ja. Also, das glaube ich zumindest“, war Marcello sich unsicher.
Nina entdeckte den Lancia nirgends. Auch nicht auf dem Stellplatz direkt vor dem Haus. Sollte Michaela also mit dem Wagen ihres Mannes unterwegs sein? Möglich war es.