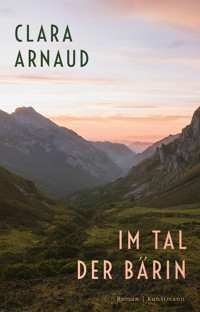
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alma erforscht am Zentrum für Biodiversität in Arpiet, einem Ort in den Pyrenäen, das Verhalten der hier wieder angesiedelten Bären; sie will herausfinden, wie ein Zusammenleben zwischen den Wildtieren und dem Menschen besser funktionieren kann. Nach vielen Jahren in Spanien und Alaska und einer schmerzhaften Trennung hat sie hier einen Neuanfang gewagt. Gaspard ist nach einem Studium in Paris in die heimatlichen Berge zurückgekehrt und zieht nun jeden Sommer mit seinen Schafen auf die Hochalm. Die Angriffe einer Bärin auf seine Tiere wecken in Gaspard jedoch traumatische Erinnerungen an den Tod seiner jungen Kollegin im Vorjahr, dessen Umstände noch immer nicht geklärt sind. Und die anderen Schäfer der Gegend fürchten mehr und mehr um ihre Herden. Urängste werden wach, in diesem Tal, in dem die Bärendressur einst Tradition war und junge Männer Bärenbabys aus ihrer Höhle stahlen, um sie abzurichten und damit ihr Glück zu suchen. Almas Arbeit gerät immer mehr in die Kritik, sie erhält Drohungen, selbst ihre Kollegen stehen nicht mehr hinter ihr. Als plötzlich Schüsse fallen, droht die Situation außer Kontrolle zu geraten…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Clara Arnaud
IM TAL DER BÄRIN
Roman
Aus dem Französischen
von Sophie Beese
Verlag Antje Kunstmann
Die plumpen Aehnlichkeiten, die er mit den Menschen zu haben scheinet, machen ihn aber nur noch ungestallteter, und geben ihm vor andern Thieren kein sonderliches Ansehen.
Buffon, Naturgeschichte
INHALT
I EIN NEUER AUFSTIEG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
II DIE WILDNIS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
III DIE ORDEN DER NACHT
1
2
3
4
5
6
7
8
DANK
I EIN NEUER AUFSTIEG
»Wir lebten in Frieden wie unsere Berge
Ihr kamt gestürmt wie wilde Winde. …«
1
langsam entfernt sie sich, ihr Gang ist nach der Winterruhe behäbig, fast lethargisch. Obwohl sie in ihrem winterlichen Halbschlaf wenig gefressen und einiges an Gewicht verloren hat, wirkt sie noch genauso groß und stattlich wie vor einem Jahr, als er sie das erste Mal gesichtet hat, der mächtige Kopf wiegt sich im Rhythmus ihrer Schritte und dem Rollen ihrer pelzigen Schultern. In den ersten Frühlingswochen sind sie noch träge und schwach, hat ihm der alte Marcel erklärt, der richtige Zeitpunkt, um sich ihnen gefahrlos zu nähern – der Alte hat viele Bären gejagt, er kennt sich aus.
Jules hält die Luft an, er versucht, ganz stillzuhalten, und hofft inständig, dass sein Geruch von dem der Erde überdeckt wird, dass sie ihn nicht wittert, er betet, dass alles nach Plan gehen und so ablaufen möge, wie er es sich erträumt hat. Ein Windstoß aus der falschen Richtung würde schon reichen. Jetzt ist sie aus seinem Sichtfeld verschwunden. Er wartet einige Minuten – nur die Vögel, ein Windhauch in den Bäumen und die Zweige, die bei jedem Atemzug unter seinem Oberkörper knistern, durchbrechen die Stille.
Er wartet noch ein wenig länger, stellt sich vor, wie sich die Bärin gemächlich entfernt, sich am Stamm eines toten Baumstamms reibt und genüsslich Insektenlarven vertilgt.
Dann ist der Moment gekommen, er spürt es. Vorsichtig, Zentimeter für Zentimeter richtet er sich auf, schaut nach rechts und links und steuert auf den Eingang der Höhle zu, als würde eine fremde Macht, ein Instinkt ihn antreiben und keine rationale Entscheidung. Er hat sich diese Szene so oft vorgestellt, dass es ihm jetzt vorkommt, als habe er sie in einem früheren Leben schon einmal erlebt und würde sie jetzt nur nachahmen.
Bei jedem Schritt hört er das Rascheln der Blätter und das Knirschen der matschigen Schneereste, denen die Vorboten des Frühlings noch nicht den Garaus gemacht haben, und eine tiefe Furcht ergreift ihn. Das kleinste Geräusch scheint in den Wald zu dringen und bis ans Ohr der Bärin zu gelangen. Er darf nicht zu viel nachdenken, er muss handeln, das tun, was er in Gedanken schon so viele Male durchgespielt hat.
Er steht vor der Höhle, die Bärin ist unterwegs, jetzt ist der Moment, sein Moment, jetzt oder nie.
Na los, nur Mut. Plötzlich ist ihm ganz flau im Magen, sein Puls rast, seine Hände zittern. Er nimmt einen tiefen Atemzug und kriecht rasch in den engen Erdkorridor, der dem Tier als Eingang dient, er robbt so schnell er kann vorwärts, nimmt die Ellenbogen zu Hilfe. Er atmet schnell, ist sich der Gefahr nur allzu bewusst und spürt eine nie gekannte Anspannung. Wenn sie früher als gedacht wiederkommt, ist das sein Todesurteil. Wenn sie wiederkommt. Er schnauft, sammelt sich. Die wenigen Meter bis zur Kammer der Bärin scheinen unendlich. Sein Hemd ist zerrissen und die offene Jacke scheuert über seinen Oberkörper, am Bauch spürt er den Boden und die Wurzeln, die das Tier durchtrennt hat, um dieses Loch zu graben. Seine Haut ist aufgeschürft, das Erdreich um ihn herum, dieser Raubtiergeruch und er auf allen vieren, als wäre er selbst ein Tier. Sie kennt diesen Ort in- und auswendig, er befindet sich auf unbekanntem Terrain. Er atmet schneller, hört nur noch, wie sein Körper sich an diesem Stollen reibt, umschlossen von Finsternis.
Er sieht und hört nichts mehr von der Welt da draußen. Die Vögel und der Wind in den Bäumen sind verstummt, es ist stockdunkel: Er ist im Herzen der Berge, in der Höhle. Vielleicht ist es auch nur ein Traum. Nein. Die Erde, die Angst, der Schweiß, der ihm von der Stirn rinnt, sind ganz real.
Da öffnet sich der Gang zu einem Hohlraum. Tastend hebt er eine Hand über den Kopf, richtet sich halb auf, berührt, was eine Decke wäre, rechts eine Wand, denn es ist sehr wohl ein Zuhause, in das er da eindringt. Als Dieb. Er zittert. Einatmen, ausatmen, er versucht sich zu sammeln. Konzentration. Jetzt die Kerze herausholen. Er wühlt in der Tasche an seiner linken Hüfte, o Wunder, er hat sie nicht verloren, während er durch den Gang gerobbt ist. Und da ist die Streichholzschachtel, aber er hat Mühe, blind ein Holz herauszuziehen, es fällt runter, er nimmt ein neues. Sein Körper will ihm nicht gehorchen. Diese Angst, einatmen, ausatmen, dies ist sein Moment, er darf es nicht verpatzen.
Direkt neben sich hört er ein leises Knurren: Die Bärenjungen sind ganz nah, sie sind da, wirklich da. Vor Aufregung ist er ganz überwältigt. Stickig ist es in dieser Höhle. Da ist ja die Kerze. Und wenn sie zurückkommt? Nicht daran denken, sondern das Streichholz anzünden, es noch mal versuchen, nur ein Handgriff, wieder nichts. Jetzt, endlich brennt der Docht. Im fahlen Schein des Flämmchens kann er die gewölbten Wände mit den tiefen Kerben ausmachen, die Handarbeit der Bärin. Sie hat all das, diese Höhle, diesen Rückzugsort, mit ihren Pranken gegraben, denkt er, mit ihren Klauen. Sie hat hier geschlafen, geträumt, darauf gewartet, dass sich der Mantel aus Schnee lüftet, hat hier ihre Jungen zur Welt gebracht.
Alles geht ganz schnell, doch er hat das Gefühl, schon seit einer Ewigkeit keine frische Luft mehr geatmet zu haben. Vor seiner Nase liegt der Schatz: In einem Nest aus Stroh und Laub umklammern sich zwei Bärenjungen, die bei seinem Anblick erzittern. Er unterdrückt einen Aufschrei der Rührung. Da ist sein Bärenjunges! Jetzt ist es so weit, er muss es tun, und zwar schnell, bevor sie zurückkommt, die Kerze auf den Boden stellen, ohne dass sie erlischt, und den Sack herausholen. Jede Geste hat er durchdacht und eingeübt, so wie Marcel es ihm beigebracht hat, und alles läuft wie am Schnürchen.
Die beiden Bärenjungen starren ihn an, das größere richtet sich auf und stößt mit gesträubtem Fell eine Art Fauchen aus. Eins, zwei, drei, Jules stürzt sich auf das Tier, wirft ihm den großen Jutesack über und zieht diesen nach kurzem Ringen mit dem noch kleinen Tier fest zu. Die leisen Knurrgeräusche ignoriert er. Das andere Bärenjunge hat sich eingerollt.
Hastig kriecht Jules aus der Höhle, an sich gepresst den Jutesack, in dem das Tier strampelt und immer lauter knurrt. Er hat das größere genommen und hat jetzt ein lebendiges, atmendes Bärenjunges in seiner Tasche, das schreit und mit all der Kraft um sich tritt, die es in den ersten Lebensmonaten unter der Erde aus der fetten Muttermilch gewonnen hat. Dem entrissen zu werden ist brutal, aber bald wird es ein menschliches Zuhause haben. Das Bärenjunge hat, ohne es zu wissen, gerade das Tierreich verlassen.
Als Jules in der Höhle das Kleine an sich riss, hat er im Kerzenlicht die abgrundtiefe Angst im Blick des anderen Jungen gesehen, und er hat diesem Blick standgehalten. Er hat noch den strengen Geruch nach Bär in der Nase, spürt noch das Halbdunkel und die Klauen des Bärenjungen in seinem linken Arm, an dem sich jetzt Blut abzeichnet. Sein Herz klopft zum Zerspringen. Wenn sie jetzt kommt, wenn sie die Schreie ihres Jungen hört, wird sie ihn töten. Er presst das Messer in dem abgewetzten Lederetui an seinen rechten Oberschenkel. Oder er wird sie töten.
Wenn der Bär dich angreifen will, wartest du, bis er sich aufgerichtet hat und auf dich zukommt, hat ihm der alte Marcel, der sich mit Raubtieren auskennt, mit großen Gesten und entrücktem Blick erklärt. Bevor er dich packt, hebst du die Klinge auf Brusthöhe. Jules hat bereits vor Augen gehabt, wie der Bär ihn umklammerte, und ist erschaudert. Dann drückst du deinen Kopf gegen seinen Körper, damit er dir nicht ins Gesicht beißen kann. Die Klinge bohrt sich geradewegs in das Tier. Und während er das sagte, machte er eine rasche Bewegung mit der Hand, als ob er mit einem Messer zustoßen würde. Mach das nicht, wenn du nicht nah genug dran bist, sonst ist er nur verletzt, rasend vor Wut und bringt dich um. Eine Klinge setzt man im Nahkampf ein, hatte der einäugige Alte hinzugefügt, dessen Gesicht von einem Leben als Wilderer und Raufbold gezeichnet war.
Jules hat nie erfahren, ob Marcel diesen Kampf mit einem Bären, diese tödliche Umarmung je wirklich erlebt hat, aber er klammert sich an dieses Szenario. In Gedanken bereitet er sich darauf vor, sich zurückzuziehen, wenn die Mutter kommt, und – falls er keine Wahl hat – zum Gegenangriff überzugehen mit der gavinetta, dieser langen, spitzen Klinge der Bärenjäger, diesem Schatz, den ihm der Alte vermacht hat.
Trotz der morgendlichen Kühle rinnt ihm der Schweiß übers Gesicht. Er hastet zum Pfad unten am Hang, die Zweige peitschen ihm ins Gesicht. Er spürt die Klinge an seinem rechten Oberschenkel, das kleine Wesen zappelt in dem Sack an seiner linken Seite, knurrt und winselt so laut es kann. Er schlottert. Die Mutter kann nicht weit sein, außerdem haben Tiere einen sehr feinen Instinkt.
Als er den Pfad erreicht, rennt er so schnell ihn seine Füße tragen, versucht dabei aber, nicht so hart aufzutreten, um das Bärenjunge nicht zu sehr durchzuschütteln, doch er kann sich nicht bremsen, die Bärin könnte bis hier herunterkommen, um ihr Junges zu suchen. Und wenn sie kommt, gibt es ein Gemetzel. Aber daran darf er nicht denken. Nein, er muss sich konzentrieren, schneller nach unten gelangen.
Bald schon erreicht er die ersten Weiden, jetzt ist es nicht mehr weit. Seine Mutter und er leben im letzten Weiler vor dem Reich der Bären, dem höchstgelegenen im Tal, Arpiet, in unmittelbarer Nachbarschaft zu den majestätischen Gipfeln der Trois Reines. Er umkurvt die Obstwiesen vom alten Claude, läuft am Haus von Monique vorbei und erreicht schließlich sein eigenes. Er stürzt in die Küche, wo es finster ist, obwohl das Tal an diesem Aprilmorgen von Sonnenschein durchflutet ist. Die schmalen Türen und Fenster schützen sie im Winter vor der beißenden Kälte und rauben ihnen im Frühling das Licht.
Der Sack bewegt sich nicht mehr, obwohl das Bärenjunge noch darin ist. Rasch öffnet er ihn, vielleicht hat es nicht genug Luft bekommen, erstickt gerade? Er ist seinem Ziel, einen Bären, seinen eigenen Bären zu haben, so nahe. Der Gedanke an einen reglosen Körper lässt ihn erstarren. Er packt das kleine Wesen, das noch so verletzlich ist, und hebt es am Genick aus seinem Gefängnis aus Stoff.
Er betrachtet es – seine spitze Nase, seine wachen Augen, die Ohren, die das Dreieck des Gesichts vervollständigen, die nackte schwarze Haut an seinen Fußsohlen, dann seinen Bauch. Er lässt seinen Blick nach unten gleiten, um das Geschlecht des Tieres auszumachen. Ein Weibchen, es ist ein Weibchen! Er hätte nie gedacht, dass das größere der beiden Jungtiere eine Bärin sein könnte, aber das ist ganz gleich. Sie scheint kräftig, überaus groß für ihr Alter – zwischen drei und vier Monaten – und hat ein dichtes, glänzendes Fell, in das er seine Finger gleiten lässt, ohne sie dabei loszulassen. Plötzlich zuckt sie auf in einem Anfall von Zorn oder Panik, Jules weiß es nicht, sie atmet schnell, aber sie atmet. Bis auf den großen Fleck auf ihrer Brust und die hellere Halskrause ist ihr Fell pechschwarz, ein Schwarz, das sich von den Brauntönen aller Bärenjungen, die er bisher gesehen hat, unterscheidet. Natürlich ist sie wunderschön, sie ist seine Bärin! Endlich.
Er empfindet eine unermessliche Freude und Zärtlichkeit für dieses kleine Wesen, das in seinen Armen zappelt. Er umarmt sie, sie wehrt sich, aber sie wird schnell verstehen, dass ihr Schicksal nun an seines geknüpft ist, sie wird sich damit abfinden. Du hast auch keine andere Wahl, denn ich werde dich nicht mehr aus den Augen lassen, und wenn du groß bist, gehen wir beide nach Amerika und finden dort ein besseres Leben.
Seit Kindertagen kennt er die Bärenführer aus dem Tal, er hat sie nach jedem Fang besucht und sie angebettelt, die Bärenjungen sehen, anfassen und halten zu dürfen. Amüsiert von diesem Kind, das zum Schausteller berufen schien, haben sie ihm erlaubt, die Kleinen auf den Arm zu nehmen, vor allem der alte Marcel. Sie haben ihm gezeigt, wie er sie aus der Höhle holen, halten und füttern muss. Jetzt ist er dran, jetzt hat er seinen eigenen Schützling, seinen Begleiter.
Die Alten haben ihm von ihren Reisen durchs ganze Land und über seine Grenzen hinaus, über den Ozean, erzählt, und er selbst hat so manchen jungen Burschen aufbrechen sehen. Manchmal erreicht eine Nachricht das Dorf und der glückliche Empfänger beeilt sich, sie den anderen vorzulesen und so die abenteuerlichen Geschichten von Bärenführern in fernen Ländern zu verbreiten. Er hat diesen Erzählungen stets mit leuchtenden Augen gelauscht, wollte auch zu ihnen gehören. Jahrelang hat sein Vater gepredigt, dass er noch nicht so weit sei, dass er warten müsse, bis er »Flaum auf den Wangen« und die Volljährigkeit erreicht habe, dass ein Kind nicht mit einem wilden Tier durch die Welt tingle, aber eines Tages, warum nicht, wenn er unbedingt losziehen wolle, warum nicht. Aber er solle bloß nicht zu viel träumen, solle lieber Hausierer oder Briefträger werden, einen richtigen Beruf ergreifen … Wie der Mann von Monique, der mit seinen Destillierkolben und Likören durch die Weltgeschichte fahre. Inzwischen ist der Vater tot, Jules ist groß geworden und einige Bartstoppeln zieren sein hageres Gesicht. Die Mutter sagt nicht viel dazu, sie hat sich damit abgefunden. In dieser armen Gegend gibt es sowieso nicht genug für alle, manche müssen eben weggehen, sagt sie oft, fatalistisch, wie sie ist.
Er hat auf seinen Moment gewartet. Er hat diejenigen beobachtet, die jedes Jahr im Frühling zusammen mit ihren Tieren über den Pass ziehen. Sie machen etwas her, diese Männer und ihre Martins – so nennen sie ihre Bären, aber er wird einen originelleren Namen finden, erst recht für ein Weibchen. Sie reisen durch Spanien und kehren Monate später wieder zurück. Andere brechen zur Schneeschmelze nach Norden auf und kehren heim, wenn sich der Wald rot färbt. Sie begnügen sich mit Frankreich, mit Europa, das ist natürlich auch schon ein ziemliches Abenteuer, aber sie werden nicht so bewundert wie die großen Bärenführer, die den Atlantik überquert haben.
O ja, Amerika. Das ist weit weg und riesig, mehr weiß er nicht. Dort will er hin, zusammen mit der Bärin, denn sie wird wunderschön sein. Je länger er ihre robuste Statur und ihre Pranken, die für ihr junges Alter schon recht groß sind, betrachtet, desto mehr ist er davon überzeugt, dass er einen guten Riecher gehabt hat, diese Höhle aufzuspüren und sie mitzunehmen, einen wirklich guten Riecher.
Die Bärenmutter war ihm im Spätsommer des Vorjahres aufgefallen, als sie die Lawinenzüge durchstreifte. Er und Pierre hatten sie manchmal gesehen, wenn sie die Kühe auf die Weide trieben. Die Bärin beachtete sie gar nicht, erklomm die für Menschen unzugänglichen Höhenlagen und verschwand dann im Wald. Das Schwierigste war gewesen, in dem abgelegenen Dickicht, in das sie eintauchte, die Höhle ausfindig zu machen. Im Herbst war er dann die bewaldeten Hänge hochgekraxelt und oft erst bei Einbruch der Dunkelheit zurückgekehrt, das Gesicht völlig zerkratzt von den Sträuchern und Dornenhecken.
Das ist, wie eine Nadel im Heuhaufen zu suchen, hatte die Mutter wenig überzeugt gesagt. Seit dem Tod des Vaters war sie an die Dramen des Alltags gewöhnt – harte Winter, den Tod einer Kuh, den Mehltau. Sie glaubte nicht an das Vorhaben des Jungen, aber ließ ihn gewähren. Sie hatte sich damit abgefunden, dass er tagelang in den Bergen verschwand, was zulasten seiner täglichen Aufgaben ging, dem Einmachen der Konserven, dem Holzhacken, das doch so wichtig war, um über den Winter zu kommen, der Versorgung der beiden Kühe und der Arbeit am Haus – in der finsteren Hütte gab es immer irgendetwas zu reparieren. Träum nicht zu viel, sagte sie, wenn er sich Richtung Höhle aufmachte, in der absurden Hoffnung, eines Tages den richtigen Moment abzupassen, um sich eines der Bärenjungen schnappen zu können.
Träum nicht zu viel.
Er hatte die Höhle rein zufällig kurz vor Wintereinbruch gefunden, als er an einem Novembertag in der Morgendämmerung auf der Lauer lag. Nach vielen Stunden erspähte er die Bärin, wie sie durchs Unterholz streifte. Sie wirkte riesig und behäbig durch das Winterfett, das sie sich angefressen hatte, sodass sie gebären und auf den Frühling warten konnte, bis sie wieder Nahrung finden würde. Sie schien gelassen und beachtete Jules, der ihr folgte, gar nicht. Ihr Gang war geschmeidig und lautlos, behäbig, aber bestimmt. Unvermittelt blieb sie stehen und stellte sich auf die Hinterbeine, um die Früchte einer Esche zu erreichen. Sie war ein beeindruckendes Geschöpf. Nach einer Weile drehte sie sich um und verschwand in den Eingeweiden der Erde. Sie war vor seinen Augen in ihre Höhle gekrochen.
Seit diesem Tag hatte er unaufhörlich und voller Unruhe an den kommenden Frühling gedacht, das würde sein Jahr werden, mit der unerwarteten Chance auf einen Fang. Sobald der Schnee zu schmelzen begann, hatte er sich auf die Lauer gelegt. Ein Bärenjunges zu holen, ohne die Mutter zu töten, war ein gefährliches Unterfangen, sodass viele orsalhers sie lieber jagten. Aber für Jules war es undenkbar, Bären zu töten, wo er sie so verehrte, er wäre dazu einfach nicht in der Lage gewesen. Ein Bärenjunges zu rauben hingegen bedeutete, zu warten, bis die Mutter nach der Winterruhe kurz die Höhle verließ, einen dieser Ausflüge zu nutzen und damit das Risiko einzugehen, erwischt und getötet zu werden. Das ist die edle Variante, hatte Marcel gesagt, der in seinem langen Leben auch die andere gewählt hatte.
Auf dem Boden kauernd, träumte er von Amerika, ohne genau zu wissen, was dieses Wort eigentlich bedeutete, dieses unendliche, reiche Land, das ihn so faszinierte. Alles, was hinter den heimatlichen Bergen lag, war unbekanntes Terrain. Manchmal, wenn ihm ein Sonnenstrahl den Rücken streichelte und wärmte, döste er ein, manchmal, im Frühjahrsregen, zitterte er vor Kälte. Es gab Tage, da konzentrierte er sich auf das Insektengewusel vor seiner Nase und ließ sich vom Geruch des Erdreichs betören, in der Hoffnung, er möge seinen eigenen überdecken. Manchmal vergaß er die Zeit, träumte, mit dem Boden und dem Wald zu verschmelzen, um nicht mehr sichtbar zu sein. Er wartete Tage, Nächte, ganze Wochen in dem Wald dort oben, damit er heute zur rechten Zeit am rechten Ort hatte sein können.
Die kleine Bärin zappelt noch immer und verdreht die Augen. Mit einer Hand hat er sie am Nacken gepackt, mit der anderen hält er ihr Hinterteil fest. Sie windet sich, versucht zu entwischen, stößt kleine Schreie aus, atmet zu laut und zu schnell. Er drückt sie an sich. Sie wehrt sich noch mehr. In ihren Augen liegt Panik. Du hast Angst, aber alles wird gut, alles wird gut, wiederholt er. Er will an Amerika, an den Ruhm glauben. Ihr dichtes Fell ist samtig und warm. Die Entführung war brutal. Jetzt muss er sich um das kleine Wesen kümmern, damit es überlebt, heranwächst und stark wird. Die Alten haben ihm gesagt: Am Anfang Kuhmilch, und nur aus der Flasche, das Junge muss im Warmen schlafen, nah am Herd. Und dann, wenn es ein wenig größer ist und kräftiger wird, gibst du ihm Früchte, Brotsuppe und Mais. Aber kein Fleisch, niemals, sonst lecken sie Blut.
Also setzt er die kleine, fauchende Bärin in seine Umhängetasche und steht auf, um etwas Milch zu holen. Er taucht den Finger in den Krug und hält ihn an das Maul des kleinen Tiers, das sich wehrt. Willst du etwa nichts? Einstweilen weigert sie sich. Er ist beleidigt, insistiert, die Bärin grollt. Sie weiß noch nicht, dass sie die Höhle nie wiedersehen wird. Irgendwann wird sie schon fressen, denkt Jules. Er gibt auf. Sie gewöhnen sich schnell an die Hand, aus der sie fressen, sagen die Alten. Sie hat sich resigniert zusammengekauert. Seine Bärin, er hätte so gern, dass sie bereits an ihn gewöhnt ist, dass sie zum Klatschen seiner Hände tanzt und sich an seiner Seite zu ihrer vollen Größe aufrichtet. Er sehnt sich nach dem Applaus und den neidischen Blicken der Nachbarn. Bald. Wie überrascht Mutter gleich sein wird, wenn sie aus dem Dorf zurückkommt. Sie wird sehen, wie er ein Bärenjunges mit dunklem Fell in den Armen hält. Sie wird stolz sein, die Mutter, stolz und beeindruckt. Amerika ist nun kein Traum mehr, sondern seine Bestimmung, das weiß Jules schon lange. Und an diesem Frühjahrstag des Jahres 1883 in Arpiet beginnt sein Schauspielerleben.
2
als gaspard aus arpiet aufbrach, schliefen die anderen noch. Die nackten, schwarzen, in Nebelschwaden gehüllten Berge glänzten vom Aprilregen. Der Schnee war geschmolzen und hatte die erd- und goldbraunen Schattierungen und das Geröll ihrer Hänge freigegeben, bald würde der Frühling mit chlorophyllener Wucht hereinbrechen und die Sommersaison beginnen, die fünfte seit seiner Rückkehr. Morgens erdrückten ihn manchmal die Vertikalität und die Abgeschiedenheit dieser Welt, die schmalen bewaldeten Täler, aus denen sich die Berge wie Wehrtürme erhoben. Sie boten nicht nur Schutz, sondern engten auch ein. Ein Refugium, das sich in ein Gefängnis verwandeln konnte.
Er erklomm schmale, steile Forstwege, gesäumt von Mauern aus aufeinandergestapelten Steinen, die dem Zahn der Zeit standgehalten hatten. Entlang der Pfade standen die Ruinen alter Schafställe und Kohlelager, auf ehemaligen Kuhweiden lagen verstreut moosbewachsene Steine. Die Menschen hatten diese Hänge einst besiedelt und wieder aufgegeben, dann hatte der Wald alles zurückerobert. Ihre Spuren und auch die der Tiere waren fast gänzlich verwischt, man musste ihre versteckten Zeichen lesen können, um die Geschichte dieses Orts zu begreifen. Gaspard beschleunigte seinen Schritt, Laufen beruhigte ihn. Die Hündin trottete hinter ihm her. Wenn die dichte Vegetation es zuließ, schaute er ins Tal, in das inzwischen ein paar Sonnenstrahlen fielen. Die Weiler Arpiet und Salausc schien der Wald verschluckt zu haben, und von Arbat, das weiter unten auf einer der wenigen Ebenen des Tals kauerte, sah er bald nur noch den Kirchturm.
Der Wiederaufstieg. Die Jahre zuvor hatte er ab Januar, Februar die Tage gezählt, war ganz euphorisch gewesen bei dem Gedanken, erneut aufzubrechen, dort oben zu sein. Nun meldete sich in ihm auch Angst. Gaspard seufzte. Etwas war kaputtgegangen. Der Winter war ihm vorgekommen wie eine Wüstendurchquerung. Tag und Nacht war er von Panikattacken heimgesucht worden. Er fühlte sich ausgelaugt und aus dem Gleichgewicht, benommen wie nach einem K.-o.-Schlag. Er würde sich wieder an das Leben auf der Hütte gewöhnen und lernen müssen, es als selbstverständlich hinzunehmen. Zum Schäfersein braucht es Charakter, sagte Jean. Bin ich dazu stark genug? Habe ich so was noch? Charakter? Um dort oben zu bestehen, musste er die bösen Geister loswerden, die ihn den ganzen Winter über in ihren Fängen gehabt hatten. Manchmal, wenn die Erinnerung an den Unfall hochkam, schnürte sie ihm derart die Luft ab, dass er schweißgebadet, keuchend und röchelnd aufwachte, um sich schlagend und strampelnd wie ein Tier, dem man die Kehle durchschneidet. Lucie hatte auf der Bettkante gesessen und gesagt: Du machst mir Angst. Manchmal hatte er sich mitten in der Nacht in die Küche gesetzt, an das gedacht, was geschehen war, und schwere, salzige Tropfen waren ihm über Wangen und Kinn gelaufen. Aber er musste weitermachen, für Lucie, für die Mädchen.
Es nieselte inzwischen, doch ein Sonnenstrahl mühte sich durch die tief hängenden schwarzen Wolken. Die Berge lechzten nach Regen. Die üppige Vegetation war nur Schein, denn Jahr für Jahr versiegten Quellen, stiegen die Temperaturen und wurden Hitzewellen Normalität. Die Alten hatten ihm von reißenden Flüssen erzählt, die sich irgendwann in Rinnsale verwandelt hatten, und vom Gras dort oben, das irgendwann spärlich geworden war. Noch überstanden die Schafe die Trockenperioden. Sie mussten nichts oder nur sehr wenig trinken und nahmen über den Morgentau auf den Wiesen genug Flüssigkeit auf. Aber die Kühe, Pferde und Menschen waren dazu nicht in der Lage. Ihnen blieb nur, auf Regen zu hoffen!
Er machte seine dicke Fleecejacke zu – im April konnte die Kälte noch beißend sein –, denn er würde gut zwei Stunden brauchen, um den dichten Wald hinter sich zu lassen und die Höhenlagen zu erreichen. Er fühlte sich erschöpft. Schau dich an, hatte Lucie gesagt, wenn du ein Lamm wärst, würde es heißen, du bist nicht überlebensfähig. Dann war sie sanft mit der Hand über seine hervorstehende Wirbelsäule gefahren. Er hielt kurz inne, um sich den Schnürsenkel neu zu binden, und schaute sich um. Alles drang nur gedämpft zu ihm durch. Die Vertikale um ihn herum, an die er vor ein paar Jahren seine Träume gehängt hatte, erzeugte nach wie vor ein Ziehen in seiner Brust, aber jetzt hatte sich die Möglichkeit des Absturzes in seinem Körper festgesetzt und eine mit groben Stichen vernähte Narbe zurückgelassen. Er hatte diese Tragödie überlebt, war daraus als Hirte auferstanden, aber als Hirte mit Höhenangst. Kann ich die Tiere überhaupt noch schützen? Und steckt die Erinnerung an jene Nacht noch in der Herde? Er schritt langsam voran und stellte sich dabei immer wieder dieselben Fragen, auf die es keine Antwort gab.
Weiter ging es durch Altwälder mit dichten Buchenhainen. Da und dort drang das Licht durch die Baumkronen bis ins Unterholz und zauberte goldene Flecken auf den mit Blättern bedeckten Boden und das hypnotisierende Grün der jungen Grashalme. Überall standen jahrhundertealte Buchen, einige Eschen, Ulmen und Birken, zu deren Füßen Hyazinthen, Osterglocken und Orchideen, die Vorboten des Frühlings, blühten. Dort war auch die alte, knorrige und mächtige Eiche, die anzeigte, dass er die Hälfte des Weges geschafft hatte. Allenthalben brachen an den Bäumen die Knospen hervor und trotzten der Frostgefahr. Entlang der Bäche sprossen von einem Tag auf den anderen lila Büschel Verborgener Schuppenwurz. Sie sind ganz nackt, so ohne Blätter, dachte Gaspard, der sich hingekniet hatte, um sie zu betrachten. Man nennt sie Parasiten, weil sie sich über ein Netz aus Rhizomen ernähren, das die Wurzeln des Wirtsbaums überwuchert. Er ging weiter und überließ den lila Teppich einigen frühen Nektarsammlern.
Er stapfte voran, der federnde Boden schmatzte unter seinen Füßen. Er ging schneller, stolperte und fing sich wieder, das Moos am Wegesrand wurde dichter, zottiger, dunkler, der Pfad wurde schmaler, Ranken verfingen sich in seinen Kleidern, Äste griffen nach ihm, alles hielt ihn zurück. Hier konnte man sich leicht verlaufen … Der Wald hatte seine Umrisse verloren, war lebendig, dehnte sich aus und atmete. Gaspard rannte jetzt fast.
In Gedanken fasste er kurz zusammen, was die anderen vor dem Almauftrieb wissen mussten: Am Clos du Lac liegt eine Esche quer über dem Weg und muss zersägt werden, bei den Ruinen am Steilhang gehört ein bisschen Gestrüpp entfernt – diese Hindernisse konnten den Pferden gefährlich werden.
Am Lac Vert riss die Wolkendecke plötzlich auf. Pause. Er rauchte eine Zigarette. An der Wasseroberfläche schwammen scharenweise Erdkröten, eine wurde von einem winzigen Frosch bedrängt, der sich in einem verzweifelten Versuch von zwischenartlicher Paarung an ihr Bein klammerte. Allenthalben fröhliches Begatten. April bedeutete die Aussicht auf Grün, Licht und Wärme, aber auch die letzten Ausläufer des Winters in Gestalt des Firns, der ihm immer noch den Weg versperrte, und Temperaturen, die verrücktspielten. So langsam mussten sie weiter, los, Luna! Bald war er wieder unter freiem Himmel, überschritt noch einen Grat. Die Sonne stand hoch. Endlich sah er die Weiden, ausladende grüne Flächen, und drum herum die dicht stehenden, bis in die Wolken ragenden Berge mit ihren dunklen, mit Schnee gesprenkelten Hängen, schwindelerregenden Graten und weiß gekrönten Häuptern. Er füllte seinen Brustkorb und seine Lungen mit Sauerstoff. Noch eine Stunde. Er befand sich nun westlich der Alm, das Gatter an dieser Seite hinderte die Kühe und Pferde der benachbarten Weide daran, allzu leicht in seine einzudringen. Viele Pfähle mussten neu aufgestellt werden, er musste Patrick, dem Kuhhirten, Bescheid geben.
Noch vor Mittag erreichte Gaspard die Hütte. W.G. Escobas – private Sommerhütte. Trotzdem war die Tür nie abgeschlossen, eine Marotte von Jean. Das könnte sich jetzt ändern, wo der Alte nicht mehr der Weidegenossenschaft aus vier Züchtern vorstand. Diese Entscheidung hatte er getroffen, nachdem die anderen den dreitägigen Almauftrieb – eine bunte Karawane aus Schafen, Pferden, Eseln und Hunden, die vierzig Kilometer durch Dörfer und über steile Pfade trabte – abgeschafft hatten. Der rituelle Kraftakt war verkürzt worden, die Züchter fuhren die Tiere jetzt mit dem Lkw bis zu einem Parkplatz, in den ein Forstweg mündete und von dem aus es nur noch gute fünf oder sechs Stunden Fußweg bis zur Alm waren. So ließ sich der Auftrieb an einem Tag bewältigen. Jean hatte sich gegen diese Entscheidung gesträubt. Die anderen – Yves, Marco und Kevin – hatten sich auf die mühsam einzuholenden Genehmigungen für die Durchquerung der Dörfer und die Risiken für die Tiere – man verlor immer eins oder zwei – berufen, es sei eine unnötige Tortur. Jetzt, wo wir die Lkws haben, werden wir sie doch auch nutzen, hatte Yves argumentiert. Jean hatte erwidert: Ein echter Schäfer bringt seine Schafe zu Fuß auf die Weide, über mehrere Tage, sie müssen die Entfernung spüren. Alm und Motorkraft passen nicht zusammen! Umsonst. Jean hatte Wochen gebraucht, um diesen Schlag zu verdauen. Wir haben eine andere Sicht auf die Welt, hatte er zu Gaspard gesagt. Ich jage keinen GAP-Zuschüssen hinterher. Ich bin Schäfer, Hirte. Gaspard hatte nicht mitreden dürfen, er war nur angestellt. Er hatte die gewaltige Wanderbewegung auch geliebt, die Abende, an denen der Alkohol in Strömen floss, den langsamen Aufstieg, diese drei der Zeit entrissenen Tage, die dem Beruf seine nomadische Dimension zurückgaben. Doch selbst auf einen Tag verkürzt, hatte der Almaufstieg etwas von einem Ritual. Es galt, sich von dem Haus in Arpiet loszureißen, um ein neues Leben als freier Mensch zu beginnen. Als relativ freier Mensch, denn auch an die Tiere war man gebunden und die Berge waren keine Einsiedelei. Jean hatte ihn bei ihrer ersten Begegnung gewarnt: Glaub bloß nicht, dass du dir auf der Alm eine Geliebte nehmen kannst, mein Guter. Deine Frau würde sofort Wind davon bekommen! Du denkst, dass du da oben allein bist, aber alle wissen alles, wie viel Wein du trinkst, wer vorbeikommt und dass eines deiner Lämmer gestorben ist – und zwar bevor du den Leichnam gefunden hast! Irgendwer beobachtet dich immer von irgendeinem Gipfel aus mit dem Fernglas.
Gaspard öffnete die Tür und trat ein, um sich umzuschauen. Die Hütte war spartanisch eingerichtet, eine Schlafecke, eine rudimentäre Küche, ein Holzofen, ein rustikaler Tisch, ein paar Stühle und alte Bücher auf einem Regal, das mit Raubvogelfedern geschmückt war. Durch das Fenster sah man diesen unglaublichen Horizont mit den Gipfeln der majestätischen Berge. Sie entschädigten für jede Unannehmlichkeit. Offenbar waren diesen Winter Besucher da gewesen. Die Blödmänner hatten kein Holz nachgelegt. Vielleicht hatten sie auch in der Not Zuflucht gesucht, wer weiß. Alles war von einer feinen Staubschicht überzogen. Die Spinnen und Spitzmäuse hatten es sich gut gehen lassen. Ein zurückgelassenes Päckchen Reis war geplündert worden, nicht ein einziges Korn war mehr übrig. Wenigstens ließen sie nichts verkommen. Die Bettdecken waren mit Mäusedreck übersät. Er seufzte, hier musste gründlich sauber gemacht werden. Er öffnete eine der beiden großen Truhen. Zuerst würde er die verbliebenen Nahrungsmittel und Medikamente für die Tiere durchgehen und dann ein bisschen Holz hacken, das zumindest wäre schon mal erledigt, wenn er mit den Tieren heraufkäme. Eines der Fenster war gesprungen, er musste es abmessen, um es zu ersetzen. Das Letzte, was man hier gebrauchen konnte, war ein kaputtes Fenster, das nachts die Kälte hereinließ. Die Alm war immer für eine Überraschung gut, und alles, was sich im Voraus einplanen ließ, sollte man dabeihaben.
Als er wieder nach draußen trat, stand die Sonne im Zenit. Sein Körper war noch aufgeheizt von den über tausend erklommenen Höhenmetern und dem einstündigen Herumräumen in der Hütte, dem Hämmern, Zählen und Aussortieren. Der Schweiß lief ihm von der Stirn und der salzige Geschmack im Mund machte ihn hungrig. Sein Magen ließ denn auch ein merkwürdiges Knurren verlauten. Er hatte tatsächlich seit Sonnenaufgang nichts mehr gegessen, aber zuerst würde er ein eiskaltes Bad nehmen! Er zog sich aus und lief zum Gebirgsbach hinunter. Die Disteln und Steine setzten seinen vom Winter zarten Füßen zu. Auf der Alm lief er abends oft barfuß umher, sodass ihm über die Monate eine dicke Hornhaut wuchs, der Lucie im Herbst verbissen zu Leibe rückte, eine erzwungene Wiedereingliederung in die Zivilisation, gegen die er sich sträubte. Er erreichte den Bach, der von der letzten Schneeschmelze auf dem Gipfel stark angeschwollen war.
Gaspard legte sich nackt auf die Steine im Wasser. Sofort packte ihn die Kälte, er spürte, wie sich seine Haut zusammenzog, ein Schmerz durchzuckte seinen Kopf, seinen Hintern und seinen Oberkörper. Er betrachtete seinen Penis, der ganz verschrumpelt von der Kälte im Wasser trieb. Er ließ sich noch ein wenig vom Bach umspülen, die Kälte machte ihn ganz klar – oder vielleicht lag es auch daran, dass er zurück war auf dieser Alm, auf der er die schönsten und schrecklichsten Momente seines Lebens gehabt hatte. Würde es ihm gelingen, diesen Ort ohne sie zu bewohnen, die Erinnerung an ihr Gesicht aus seinem Kopf zu bekommen? Das Wasser ließ seine Füße und Beine taub werden. Würde er wieder auf den Kamm steigen und die Augusthütte bewohnen können, ohne von Erinnerungen heimgesucht zu werden? Erholt man sich von so etwas? Die Kälte zog an seinem Bauch, die Strömung massierte seine Schultern. Den ganzen Winter über hatte er an sie gedacht – es war zum Wahnsinnigwerden, zum Eingehen vor Kummer. Er stieg aus dem Wasser, die Kälte war nicht mehr auszuhalten. Alles schmerzte, aber es tat auch gut, er fühlte sich lebendig. Er schüttelte sich wie ein Hund. Du bist dran, Lunita! Die Hündin warf sich ins Wasser, kam schnell wieder heraus, schüttelte sich und rannte hysterisch japsend im Kreis. Er lief auch los und schrie, seine Stimme prallte gegen die Steinwände des Talkessels. Plötzlich fing er an zu lachen, sein Körper war ganz gerötet, halb erfroren und voller Energie nach diesem Bad im Bach, dem ersten des Jahres.
Er setzte sich auf die Bank vor der Hütte rechts neben der Holztür, um ein Stück Brot mit Käse zu essen und dabei die Aussicht zu genießen. Um die Hütte herum hatten die Spitzmäuse seine Abwesenheit dazu genutzt, um Tunnel über Tunnel zu graben. Dies war auch ihr Reich, und das Zusammenleben erforderte eine strenge Organisation. So musste er alle Lebensmittel in verschließbaren Behältern aufbewahren. Fallen stellte er nur auf, wenn es nicht mehr anders ging, damit die Nagetierpopulation ihm nicht zu sehr auf der Nase herumtanzte. Er dachte erneut an den Weg, es gab nur ein paar Baumstämme wegzuräumen, der Auftrieb sollte ohne allzu viele Hindernisse erfolgen können. Es blieben noch zwei oder drei Stunden Tageslicht, er musste die Bestandsaufnahme abschließen und würde dann hier übernachten. Er spürte die Freude auf die Berge in sich aufsteigen, er lächelte und versenkte seine Finger in Lunitas weichem Fell. Diese Saison musste gut laufen, unbedingt. Mit Lunita und La Rousse würde er in guter Gesellschaft sein.
Der Alte hatte ihm seine letzte Pyrenäenschäferhündin anvertraut. Sie war fast zehn und nicht mehr ganz so ausdauernd wie in ihren jungen Jahren, aber sie war noch fit. Nimm diese Saison La Rousse mit, hatte Jean an einem Märzabend zu ihm gesagt. Du wirst doch nicht mit einem einzigen Treibhund raufziehen! Natürlich kannst du sie nicht zu sehr strapazieren. Aber du hast ja Lunita. Gaspard hatte lächelnd genickt. La Rousse kam ganz nach dem Alten, sie war lebhaft und stur. Pyrenäenschäferhunde habe ich lieber als Border Collies, hatte Jean hinzugefügt. Sie haben ihren eigenen Kopf, sind keine Marionetten. Eure Hunde heute arbeiten wie Algorithmen. Bei einem Pyrenäenschäferhund braucht man Jahre, um ihn richtig in den Griff zu bekommen, er überrascht dich immer wieder. Vielleicht bin ich der letzte Vertreter einer langsamen Welt.
Indem er ihm La Rousse anvertraute, setzte Jean fort, was er vor vier Jahren, als er beschloss, nicht mehr auf die Alm zu ziehen, begonnen hatte: die Übergabe. Am Ende der gemeinsamen Saison hatte er gesagt: Ich habe vierunddreißig Jahre durchgehalten, jetzt gehören diese Berge dir. Ich komme mal nach dem Rechten schauen, aber den Tieren hinterherzurennen, damit ist Schluss! Und meine Berge würde ich nie einfach irgendwem überlassen. Verstehst du? Du hast es in dir, du wirst es packen. Damals hatte Gaspard im Auto zurück nach Arpiet geheult. Er hatte anhalten müssen, um sich zu sammeln, bevor er zu Hause ankam. Er hatte den röchelnden alten Citroën, der kurz vorm Auseinanderfallen war, am Flussufer geparkt und sein Glück zu fassen versucht. Der Alte hatte ihm seine Tiere, die Schlüssel für die Hütte, die Geheimnisse der Berge und jetzt auch noch seine letzte Hündin anvertraut. Auch wenn Jean eher mürrisch war und nie von Liebe gesprochen hätte, war klar, dass sie einander zutiefst verbunden waren.
Mitten in der Nacht überkam ihn wieder die Panik. Es fühlte sich an, als ob sich ein Arm um seinen Hals legte. Schweiß, Zittern. Plötzlich war sein Kopf wie leer gefegt, war da nur noch die uralte Angst vor der Nacht. Er ging hinaus und stolperte dabei fast über die Hündin. Schau mich nicht an, als wäre ich verrückt. Weg da! Er atmete so ruhig wie möglich, füllte jedes Lungenbläschen mit Luft. Ganz ruhig. Er blickte in den Himmel. Der Mond schien riesig, rund und tiefrot. Die Mondfinsternis. Davon hatte ein schlauer Typ im Radio erzählt und nebenbei auch das Datum der nächsten erwähnt: Dezember 2029. Mit jedem Atemzug verblasste der Albtraum mehr. Sie wird spektakulär, hatte der Astrophysiker erklärt, bald ist es so weit. Bald. Dezember 2029. Für jemanden, der sich ein Lichtjahr vorstellen konnte, waren sieben Jahre gar nichts, für ihn selbst war es eine Ewigkeit. Er atmete regelmäßiger. Ein kalter Schweißtropfen rann über seine Stirn und ließ ihn erschaudern. Das große, dunkle Himmelszelt schien zum Greifen nah und zugleich war der Kosmos so unbegreiflich, eine riesige Ansammlung von Materie, Nichts und Zeit. Er betrachtete den glühenden Himmelskörper und die unwirkliche Silhouette der Berge in dessen rotem Schein noch eine Weile. Dass er zufällig genau in dem Moment aufgewacht war, in dem sich der Mond im Schatten der Erde befand, faszinierte ihn. Er war sich nicht sicher, ob das feurige Gestirn ihm bedeuten wollte, dass die Berge ihn willkommen hießen, oder ob es ein schlechtes Omen war. Er blieb vor der Tür der Hütte sitzen, drehte sich einen Joint und rauchte in der Kühle des Frühlings unter dem verfinsterten Mond.
3
alma lief die strasse am Fluss entlang, schlängelte sich zwischen den vielen Schlenderern und alten Frauen mit Einkaufstrolleys hindurch. Alle Bergbewohner – zottelige, verlotterte und elegante – kamen am Markttag in den Ort, dachte sie lächelnd, überall gab es Umarmungen, Begrüßungen, ein kurzes Nicken. Dazwischen tobten Dutzende Hunde, die sich nicht um die Menschen scherten, sondern mit sich und ihrer tierischen Geselligkeit beschäftigt waren. Sie begrüßte die bekannten Gesichter mit einem Nicken und bahnte sich einen Weg durch die summende Menge und die engen Gassen. In den Schlangen vor dem Gemüsestand und dem, wo es Toms Roggenbrot gab, traten alle von einem Fuß auf den anderen, um die Kälte abzuwehren. Das Brot sei das beste in der Region, hatte man ihr gesagt, und sie konnte nur zustimmen, denn der schwere, dunkle und duftende Leib aß sich wie Kuchen und hielt in den Bergen zehn Tage. Vor dem kleinen Stand mit dem Ziegenkäse von Léonora blieb sie stehen. Zwei mit Asche bitte. Sehr gern, besonders gereift, ganz nach deinem Geschmack. Danke Léo. Wie geht es den Tieren? Alles prima … Alma fröstelte, der Markt lag noch im Schatten der Gletscherkronen, die das Nachbartal überragten. Es war nicht so sehr die Kälte, die ihr in die Knochen kroch, sondern die Feuchtigkeit, die der dichte Tannen- und Buchenwald speicherte. Eigentlich fand Alma sie aber auch ziemlich beruhigend in einer Welt, in der alles vertrocknete und verbrannte, in der Flüsse versiegten und Wälder abstarben. Eines Tages würden diese abgeschiedenen Berge und ihre grünen Steilhänge ein begehrter Rückzugsort sein.
Sie ging weiter. Auf dem Boden stapelte sich alles, was in der Region wuchs und hergestellt wurde, nicht nur Gemüse, Käse und Obst, sondern auch unzählige Kräuter, Pilze und Wildpflanzen, gesammelt von Eigenbrötlern, die sich in die Berge geflüchtet hatten, dazu Beeren, Tees und andere Erzeugnisse, die abgekocht, gepresst, getrocknet, gepflückt und fermentiert worden waren. Alles war selbst gemacht. Alma hatte schnell begriffen, dass dies nicht nur ein Verkaufsargument war, sondern eine Haltung, fast schon eine Weltanschauung. Seitdem belächelte sie die selbst gehäkelten Babysachen nicht mehr, denn in dem Wort »Handarbeit« schwang eine reale Utopie mit. Mit Liebe gezüchtet, fügte Andy hinzu, als er ihr den Korb mit frischem Gemüse reichte. Sie lächelte zurück, ganz bestimmt steckte in diesem Gemüse nicht nur Arbeit. Sie ging weiter, den Korb gefüllt mit geliebten Möhren, Pastinaken, Kartoffeln, Kopfsalat und Rüben. Damit kann ich die winterlichen Exzesse wiedergutmachen, dachte sie. Die ersten beiden Monate des Jahres erforderten Schokoladenorgien, denn im tiefsten Winter, wenn sie selten in die Berge kam, half nur Zucker gegen die Melancholie.
Alma drängte sich weiter, betrat schließlich das Café de la Place, stellte ihren schweren Korb ab und setzte sich an den Tresen, dem strategisch günstigsten Ort. Sie kam regelmäßig hierher, denn sie wusste, dass sich ihre Integration auch hier entschied, in diesem zu großen und altmodischen Café mit seinem alten Flipper und der zusammengewürfelten Deko, einer Mischung aus über die Jahre zusammengetragenen und inzwischen eingestaubten Gegenständen, die niemand sich anzurühren traute, in dieser Agora, in der sich alle einfanden, Alte, Junge, Frauen, Männer, Einheimische, Zugezogene und Leute auf der Durchreise. Für die Leute von hier war sie immer noch eine Fremde. Inzwischen wehrte sie sich nicht mal mehr dagegen. Eines Abends hatte Max, der Wirt, sie herausfordernd gefragt:
– Sag mal, wo kommst du eigentlich her?
– Das ist kompliziert …
– Hätte mich sonst auch gewundert!
– Die Kurzfassung ist: Mein Vater war Franzose, meine Mutter ist Spanierin, ich bin im Ausland aufgewachsen, habe in Paris, Alaska und Spanien gelebt … im Moment aber komme ich von hier…
– Von hier, haha, hatte er ausgerufen, aber Püppi! Von hier wirst du nie sein. Selbst deine Kinder …, er hatte wieder gelacht. Weißt du, was mein Alter immer gesagt hat? Du kommst nur von hier, wenn du drei Generationen hier beerdigt hast … so sieht’s aus! Aber wir mögen die von außerhalb, manche zumindest …
– Ich sehe mich sowieso als Nomadin, hatte sie verletzt zurückgegeben.
– Nomadin! Warum nicht gleich Zigeunerin? Könntest du glatt sein, so dunkelhäutig wie du bist. Oder, Flavio, unsere Intellektuelle hier ist doch ziemlich dunkelhäutig, was? Aber ich necke dich nur, du siehst wahnsinnig gut aus … Flavio, noch ein Gläschen?
Der andere nickte, er leerte ein Glas nach dem anderen, ließ den Abend und sein Leben vorbeiziehen, die Ellenbogen auf den Tresen gestützt wie ein Fossil.
– Immer doch, und schenk der Zigeunerin auch eins ein!
Alma hatte sich bremsen müssen, um nichts zu erwidern, um nicht zu erklären, warum diese starren Identitätsraster zu vereinfacht waren. Sie besaß einen Doktortitel in Verhaltensbiologie und das entsprechende Fachvokabular. Sie hatte die ganze Nordhalbkugel – von Kamtschatka bis Alaska – bereist, um Bären zu beobachten. Max hatte nicht unrecht, sie war nicht von hier, das war nicht nur eine Frage der Vorfahren. Die Kluft war viel größer. Dieser Schlagabtausch hatte die Frage nach ihrem Platz in der Welt wieder hochkommen lassen, die sie oft beschäftigte. Sie hatte nie das Gefühl gehabt, irgendwo hinzugehören, sie passte sich überall an. Sie war als Kind oft umgezogen worden und als junge Erwachsene für ihre Feldforschung viel unterwegs gewesen, hatte überall auf der Welt Wurzeln geschlagen, sich wieder davon losgerissen, und so hatte sie nach und nach ein Netz aus vertrauten Orten an den entgegengesetzten Enden der Welt gestrickt. Sie war im 20. Arrondissement in Paris genauso zu Hause wie im wissenschaftlichen Basislager im McNeil-Reservat in Alaska oder in ein paar kantabrischen Bergdörfern. Im Laufe der Jahre, die in ihrer Erinnerung ineinanderflossen, hatte sie Menschen lieb gewonnen und wieder aus den Augen verloren und begriffen, dass ihr Rückgrat, ihr Anker kein Ort war, sondern in der Art bestand, wie sie die Welt durchquerte, beobachtete und mit ihr verschmolz.
Wenn du irgendwo gar nicht mehr auffällst, hast du gewonnen, hatte sie einmal einem Freund erklärt, der sie gefragt hatte, wie sie diese ständigen Ortswechsel verkraftete. Seit sie vor zwei Monaten nach Arbat gezogen war, besuchte sie also beharrlich das Café. Sie kam frühmorgens, um ein paar starke Espresso zu kippen, abends auf ein Bier und tagsüber, um in einer Ecke neben dem Ofen zu schreiben. Wenn sie ankam, warf sie ihre Tasche auf die hellbraune Lederbank oder hängte sich manchmal mit gespitzten Ohren an die Theke. Man lästerte über diesen und jenen, kommentierte die jüngsten Gerüchte und Neuigkeiten aus der Gegend oder aus ganz Frankreich, nicht jedoch darüber hinaus oder nur so vage, dass sie den Eindruck hatte, dass der Rest der Welt für viele hier nur eine diffuse Masse war, ein unscharf abgegrenzter Raum. Nur der Ausbruch des Ukraine-Kriegs wurde ein wenig kommentiert, als die Auswirkungen auf die Getreidepreise auch im Tal zu spüren gewesen waren.
Bei jeder Unterhaltung stellte Alma wieder fest, dass alle hier überzeugte Bewohner dieses Tals waren, egal, ob sie hier geboren waren oder es zu ihrer Wahlheimat erklärt hatten. Diese Berge schienen eine so starke Anziehungskraft zu haben, dass sich viele Durchreisende hier niederließen. Einige Einheimische ätzten mit großem Vergnügen gegen alles, was aus der Stadt kam, aus Toulouse, aus Paris oder von noch weiter her, über die Entscheidungen, die ihnen von außen aufgezwungen wurden, und diese Ökos aus den großen Städten, die ihnen das Leben erklären wollten. Die Zuzügler brüsteten sich damit, dass sie in den Bergen einen Freiraum gefunden hätten, der von der Logik des Marktes verschont geblieben sei, dass sie sich in den letzten Grauzonen entfalten konnten, in denen die ständige Erreichbarkeit noch nicht Standard war – die Glasfaserkabel hatten es nie bis an die Ausläufer des Bärenterritoriums geschafft. Hinter der inszenierten Lagerbildung verbargen sich unendlich viele Arten, an diesem Ort zu leben, und trotz der vorgeblichen Zwietracht zwischen Einheimischen und Neulingen verband die meisten hier ihre Unbeugsamkeit. Alma war dafür empfänglich. Könnte sie auch eines Tages an diesem eingekesselten Fleckchen Erde Wurzeln schlagen? Würde sie jeden Stein, jeden Winkel des Waldes, die Pilzgründe, die von den Karten verschwundenen Pfade, die Quellen und Bärenhöhlen kennen und mit den Legenden und Geschichten der Alten ebenso vertraut sein wie mit dem Namen jedes Passes, jedes kleinsten Gipfelgrats? Und doch packte sie regelmäßig das Fernweh.
– Na, Schönheit, darf’s ein Espresso sein? Alles klar bei dir?
Max riss sie aus ihrer Träumerei. Er war so gutmütig, dass sie ihm selbst das etwas deplatzierte »Schönheit« durchgehen ließ. Jenseits des Tresens verband sie nichts, aber sie mochte ihn gern.
– Einen schwarzen Kaffee, bitte. Oder nein, einen Milchkaffee, einen großen Milchkaffee, heute ist schließlich Sonntag! Und ein Croissant.
– Gut so, wir müssen dich ein bisschen aufpäppeln. So, wie du da überall rumkraxelst, ist kaum noch was an dir dran. Kein Wunder, dass dich die Bären in Ruhe lassen.
Als er mit dem Tablett in der einen Hand um sie herumging, legte er die andere auf ihre Schulter, streifte ihren Nacken. Wie er sie behandelte, war immer ein wenig grenzwertig, aber bis zu einem gewissen Punkt ließ sie es zu. Eines Abends – sie hatte etwas getrunken – hatte er nach Schankschluss ihre Hand genommen und sie hatte sie vorsichtig weggezogen.
Neben ihr plauderten zwei Bauern, einer war Rinderzüchter. Das Thema »Bär« hatten sie schon besprochen. Wie die meisten Leute hier hatten sie nichts gegen die Tiere, aber … Denn es gab immer ein »Aber«, aus dem all die Zwiespältigkeit sprach, die das wilde Tier verursachte, diese Mischung aus Faszination und Urangst, die mit zunehmender Zermürbung in Hass umschlagen konnte. Ein »Aber«, in dem alle Spannungen und niederen Impulse enthalten waren, die ganz plötzlich hervorbrechen konnten, um aus einer banalen Unterhaltung eine Hasstirade zu machen. Selbst der friedfertigste Züchter ließ sich dazu plötzlich hinreißen. Dann kamen blutige Erinnerungen hoch, der Hunger und die Angst, die die Bergbewohner einmal gekannt hatten. Alma wusste, dass sie sich auf dünnem Eis bewegte. Mehrere Jahrzehnte lang hatte es keine Bären mehr in der Region gegeben und man hatte verlernt, mit ihnen zusammenzuleben. Jetzt, wo die Landwirte mit immer strikteren Auflagen zu kämpfen hatten und die GAP ihnen mit einem Arsenal an Maßnahmen zu Gesundheitsschutz und Sicherheit auf den Leib rückte, hatten sie sich gegen einen neuen Feind zusammengetan: die Bürokratie. Wie man mit Bären umgeht, hatten sie vergessen.
– Und, die Dame, pirschst du immer noch diesen Biestern hinterher?
– Ganz genau, jetzt fange ich mit der Datenerhebung für die neue Saison an.
– Du wirst also dafür bezahlt, dass du durch die Berge spazierst.
Sie lachten, Max stand wieder hinter dem Tresen.
– Zwei Schoppen Weißen, Jungs, oder seid ihr noch beim Kaffee?
Er hatte schon flink damit begonnen, die Gläser zu füllen. Der Betrieb an den Markttagen glich einem Marathon, starker Kaffee floss durch seine Adern, was sich in seinen hektischen Gesten zeigte.
– Na los, schieb rüber, ist ja immerhin fast Mittag, nickte einer der Männer, ein gewisser Christian.
Seinen Namen hatte sich Alma gemerkt, den seines Kumpanen nicht. Eines Abends hatte er ihr gegenübergesessen, sein Atem roch unangenehm nach Schnaps, und hatte mehrmals wiederholt: Christian, ich heiße Christian, und du?
– Ich bin an der Beobachtung der Bären hier vor Ort beteiligt. Ich arbeite für das Nationale Biodiversitätszentrum, sagt Ihnen das was?
– Das CNB? Und ob uns das was sagt … die lassen erst die Bären frei und kommen dann zur Bestandsaufnahme, wenn die deine Tiere verputzt haben … Danke Leute, echt, danke!
– Wir sind ja nicht prinzipiell dagegen, ergänzte sein Kollege mit dem langen wallenden Bart, aber wir haben einfach schon genug um die Ohren. Früher war der Bär ein Schädling, man hat ihn abgeknallt. Und plötzlich soll man den roten Teppich vor ihm ausrollen. Dabei kann er uns echt gestohlen bleiben!
– Jetzt sind sie ja aber nun mal da, versuchte Alma zu beschwichtigen.
Sie nahm einen großen Schluck lauwarmen Kaffee. Ihre Nachbarn am Tresen hatten ihr zweites Glas schon fast geleert. Der Bärtige haute mit der Hand auf die Theke.
– Ja klar, aber sie wurden ja früher aus gutem Grund abgeschossen. Uns ging’s prima ohne die Viecher. So’n Öko-Geschwafel brauchen wir nicht. In Paris kann man leicht öko sein. Wer lebt denn das ganze Jahr mit seinen Tieren? Wer bekommt alle zwei Wochen irgendwelche neuen Zuchtvorschriften um die Ohren gewaffelt? Es reicht uns langsam!
Er hatte die Stimme erhoben. Niemand beachtete sie, am Tresen wurde es immer laut.
– Wir haben es satt, immer für dumm verkauft zu werden, fügte Christian hinzu.
– Ich will euch nicht überzeugen, sagte Alma, ich sammle nur Daten, die das Zusammenleben erleichtern sollen. Ich arbeite auch für euch, ob ihr’s glaubt oder nicht. Gerade beobachte ich gezielt eine Alm, auf der was Schlimmes passiert ist …
– Escobas … murmelte der Bärtige.
– Ja, letztes Jahr gab es dort einige Angriffe, vor allem von einem Weibchen …
– Dieses Scheißbiest, wegen dem die Schafe abgestürzt sind? Das von dem Unfall?, brauste Christian plötzlich auf.
– Wir wissen nicht genau, was in dieser Nacht passiert ist, antwortete Alma vorsichtig. Wir versuchen, ihre Bewegungsmuster nachzuvollziehen, um das Risiko zu reduzieren …
Mit dieser Unterhaltung hatte sie sich wider besseren Wissens auf Glatteis begeben, denn über den Unfall sprach niemand offen. Und trotzdem wussten alle, was damit gemeint war.
– Was für ein Quatsch, das Risiko reduzieren, rief Christian. Ginge es hier um einen Menschen, wäre der längst im Knast, es ist aber ein Bär, deshalb bezahlen wir dafür, dass seine Bewegungsmuster untersucht werden! Das darf doch nicht wahr sein! Er nahm einen großen Schluck. Der Schäfer hat sich nicht davon erholt. Der Typ ist den ganzen Winter rumgelaufen wie ein Gespenst.
– Ja, ich habe ihn getroffen. Wir haben ein bisschen geredet. Er schien traurig.
– Traurig? Meine Fresse, man ist nach so was nicht traurig, man ist völlig am Boden! Und trotzdem zieht er wohl wieder rauf. Mut hat er. Da oben mit diesem Biest abzuhängen, dabei hat er zwei Kinder und ’ne Frau zu Hause sitzen. Wie gesagt, ich hab nichts gegen Bären, aber wenn sie angreifen, kann sich schon mal ein Schuss lösen, wenn du weißt, was ich meine. Wenn die sich an meine Kühe ranmachen, verteidige ich mich!
Alma erwiderte nichts. Die Tragödie vom letzten Sommer hatte alles verändert, ein Dialog schien quasi unmöglich. Keine Chance, diese beiden auch nur ansatzweise zu überzeugen. So eine Unterhaltung endete oft mit großem Geschrei, vor allem nach drei Gläsern Wein. Sie trank ihren Kaffee aus. Selbst am Sonntag auf dem Markt konnte sie ihre Rolle als Bärenverteidigerin nicht ablegen. Sie versuchte sich abzugrenzen, vermied bestimmte Themen, etwa die mögliche Auswilderung von Tieren aus dem Osten, die für die genetische Durchmischung unerlässlich war. Sie wusste, zu welchen Polemiken die Wiederansiedlung von Bären schon geführt und was für einen Aufruhr sie im ganzen Land verursacht hatten. Mit Bären verband man jahrhundertealte Mythen und tief sitzende Ängste. Bei der Diskussion ging es nicht nur um ihre Anwesenheit, sondern um das Zusammenspiel von Zivilisation und Wildnis, und um deren Unberechenbarkeit. All das ließ sich nicht am Tresen klären. Sie wusste auch, mit wie viel Verachtung und Verkennung der Umstände die Bären hier wieder angesiedelt worden waren. Manche hatten das nie verkraftet und sträubten sich vehement gegen diese neue Situation und die dauerhafte Rückkehr der Bären in ihre Berge.
Trou de l’Ours, Vallée des Montreurs d’Ours oder Port des Ours – das Bärenloch, das Tal der Bärenführer oder der Bärenpass, die Namen der Orte hier zeugten jedoch von ihrer Präsenz. Der Bär war da, er war ihr Nachbar und ein Teil dieser Täler, das sagte Alma sich oft. Sie wusste, dass ihre Faszination für dieses Tier vielleicht ein bisschen simpel wirkte. Teddybären zu schützen, bravo meine Gute, da hast du dir ja was einfallen lassen. Da ist es ja origineller, sich für den Skarabäus oder ein Nagetier zu begeistern, oder vielleicht für Quallen. Sohlengänger verdienten, nicht mehr verteidigt zu werden als jede andere gefährdete Art, und doch konnte man, indem man sie schützte, ein ganzes Ökosystem bewahren. Der Bär war Teil einer enggliedrigen Kette, die zahlreiche Pflanzen, Vögel, Säugetiere und Amphibien, aber auch den Menschen und sein Vieh umfasste. Alma konnte solche Überzeugungen oder Debatten nicht am Tresen ausfechten, wo kein Platz für Grautöne war, also schwieg sie und dachte an die Berge.
Gestern etwa war sie den ganzen Tag unterwegs gewesen. Im Laufe der Jahre, in denen sie der Spur der Bären gefolgt war, hatte sich ihre Sicht auf die Berge verändert, ihr Blick hatte sich geschärft. Die Felsen und die Bäume suchte sie nach den Fellbüscheln eines Sohlengängers ab, der sich daran gerieben hatte, auf dem Boden versuchte sie, Spuren zu ertasten, an einem Strauch konnte jeder abgebrochene Zweig ein Indiz sein, genauso wie Exkremente und manchmal die Überbleibsel eines weichen Nests, das als Nachtlager gedient hatte. Immer hoffte sie, auf eine Höhle zu stoßen. Doch nicht nur ihr Blick, auch ihre Bewegungen hatten sich verändert. Sie kraxelte nicht mehr immer höher, immer schneller Richtung Gipfel, wie sie es in ihren Zwanzigern getan hatte. Sie schielte nicht mehr unaufhörlich nach den Kämmen und Gipfeln, sie tastete sich eher vor, bewegte sich mit kleinen Schritten und wachen Sinnen durchs dichte Unterholz und Gebüsch, den Bären auf den Fersen, versuchte, ihre Spuren zu lesen und anhand winziger Zeichen zu verstehen, wie sich jedes einzelne Tier in dem Gebiet bewegte. Während der langen Tage des Ansitzens und Aufspürens schien die Welt um sie herum zu erwachen. Die Berge wirkten beseelt von einer Kraft, die die Wälder dichter und das Grün satter machte und die Bäume und Bäche wieder zum Singen brachte. Sie hatte dann das Gefühl, die im Licht changierenden Farben der Felsen, der Blumen und des Himmels stärker wahrzunehmen. Gestern früh hatte sie gespürt, dass die Bärin ganz in der Nähe war.
Letztes Jahr war sie ihr mehrfach begegnet. Das erste Aufeinandertreffen hatte sich im Frühling am Fuß der Geröllhalde und der Lawinenkorridore ereignet. Hier suchten die Bären, sobald sie ihre Höhlen verließen, Aas, das der schmelzende Schnee freigab, um ihr während der Winterruhe verlorenes Gewicht wieder zuzulegen. Dieser Halbschlaf faszinierte die Wissenschaft: Die Körpertemperatur der Bären sank um mehrere Grad, sie fuhren alles herunter, aßen und tranken nichts mehr, verwerteten ihren Urin und brauchten ihre Fettreserven auf. Mit dem Frühlingsbeginn setzte sich ihr Stoffwechsel wieder in Gang. Dann verließen auch die Bärenjungen wie bei einer zweiten Geburt zum ersten Mal die Höhle. Die ausgehungerten Sohlengänger waren leichter zu beobachten, wenn sie in der noch spärlichen Vegetation auf Nahrungssuche waren. Seit ein paar Jahren waren manche Winter allerdings so mild, dass die Bären das ganze Jahr über, wenn auch deutlich langsamer, aktiv blieben.





























