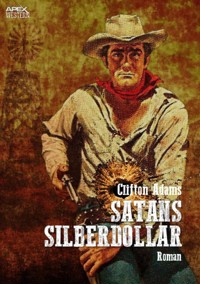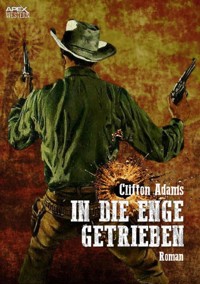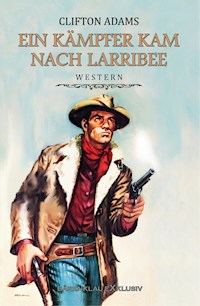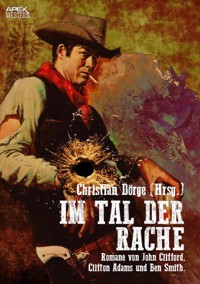
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwei Männer hatten Davids Vater in den Tod getrieben und seine Schwester erschossen. Nun war der Tag der Rache gekommen...
Shade hatte den Auftrag, einen Verbrecher zu fassen, der seit Monaten die Gegend terrorisierte. 10.000 Dollar waren dafür ausgesetzt, und viele wollten sie sich verdienen. Frank Shade stieß wie alle anderen auf eine Mauer des Schweigens...
Es war ein langer Weg für Vance Hartley – vom Rio Grande in Texas bis nach Montana. Hartley kam schweigend wie eine dunkle Wolke und schlug dann mit der Wildheit und der Kraft eines Blizzards zu. Aber er richtete keine Verwüstungen an – er brachte den Frieden ins Tal von Sugar Springs...
Die von Christian Dörge zusammengestellte und herausgegebene Sammlung Im Tal der Rache enthält drei ausgesuchte und klassische Spitzen-Romane US-amerikanischer Autoren, perfekten Lesestoff also für alle Western-Fans und Leser der Reihe APEX WESTERN: Auf die Stirn gebrannt von John Clifford, Kopfprämie für Mr. Brown von Clifton Adams sowie Das Tal der Rache von Ben Smith.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
CHRISTIAN DÖRGE (Hrsg.)
Im Tal der Rache
Drei Romane in einem Band
Apex Western, Band 29
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
John Clifford: AUF DIE STIRN GEBRANNT (The Shooting Of Storey James)
Clifton Adams: KOPFPRÄMIE FÜR MR. BROWN (The Grabhorn Bounty)
Ben Smith: DAS TAL DER RACHE (The Texas Twister)
Das Buch
Zwei Männer hatten Davids Vater in den Tod getrieben und seine Schwester erschossen. Nun war der Tag der Rache gekommen...
Shade hatte den Auftrag, einen Verbrecher zu fassen, der seit Monaten die Gegend terrorisierte. 10.000 Dollar waren dafür ausgesetzt, und viele wollten sie sich verdienen. Frank Shade stieß wie alle anderen auf eine Mauer des Schweigens...
Es war ein langer Weg für Vance Hartley – vom Rio Grande in Texas bis nach Montana. Hartley kam schweigend wie eine dunkle Wolke und schlug dann mit der Wildheit und der Kraft eines Blizzards zu. Aber er richtete keine Verwüstungen an – er brachte den Frieden ins Tal von Sugar Springs...
Die von Christian Dörge zusammengestellte und herausgegebene Sammlung Im Tal der Rache enthält drei ausgesuchte und klassische Spitzen-Romane US-amerikanischer Autoren, perfekten Lesestoff also für alle Western-Fans und Leser der Reihe APEX WESTERN: Auf die Stirn gebrannt von John Clifford, Kopfprämie für Mr. Brown von Clifton Adams sowie Das Tal der Rache von Ben Smith.
John Clifford: AUF DIE STIRN GEBRANNT
(The Shooting Of Storey James)
Erstes Kapitel
Die kalten Luftmassen schoben sich über den Höhenzug und prallten mit einer im Süden aufsteigenden Warmluftfront zusammen, die heftigen Widerstand leistete. Gleißende Blitze und tosende Donnerschläge wälzten sich den Missouri River entlang. Doch eine Strecke weiter westlich - über der grünen Prärie von Kansas - hatte der eisige Wind endgültig den Sieg davongetragen. Die beißende Kälte drang unter die Haut eines Mannes, der keine Jacke, sondern nur ein Hemd trug, weil er sich von den knospenden Sträuchern und dem strahlenden Blau des Himmels hatte täuschen lassen.
David Haviland biss die Zähne zusammen, damit sie nicht vor Kälte klapperten, aber der eisige Hauch kroch durch seinen ganzen Körper. Seine Beinmuskeln in den dünnen Levishosen zogen sich zusammen, als würden sie plötzlich in eiskalten Blechröhren stecken. Selbst das Sattelleder knisterte und fühlte sich merkwürdig steif an. Er ließ seinen Fuchs im leichten Trab gehen, um das Blut auf diese Weise ein wenig in Wallung zu bringen.
Im östlichen Gebiet von Kansas war der jähe Kälteeinbruch einer kleinen Katastrophe gleichzusetzen. Die Saat würde wohl zum Teil vernichtet werden, doch hier - David blickte über den meilenweiten Teppich Präriegras - gab es nicht viel zu verlieren.
David nahm an, dass er diese Strapazen genauso gut in Kauf nehmen könne wie jeder andere; aber er empfand alles intensiver als die meisten. Und er beachtete Dinge, die andere einfach übersahen.
Er legte die Handflächen auf das raue Fell des Fuchses und spürte die Wärme der sich bewegenden Muskeln. Mehr als einmal blickte er zurück, nur um den Trail entlangzusehen, der die Prärie durchschnitt. Es war eine jener breiten natürlichen Straßen, deren sich dieser Staat rühmte - ein Kratzer in einem Gemälde, auf dem nur Wolken und grünes Gras zu sehen waren. Betrachtete man die Radspuren von weitem, so schienen sie so geradlinig zu verlaufen wie ein Eisenbahngleis.
David zog unwillkürlich die Bauchmuskeln ein, als seine Haut den kalten Stahl des Revolvers berührte, der in seinem breiten Gürtel steckte. Dieses Gefühl lenkte seine Gedanken in andere Bahnen.
Bis nach Larkspur war es nicht mehr allzu weit. Er konnte noch am Vormittag eintreffen. Zwar rechnete er nicht damit, konnte es sich aber trotzdem gut vorstellen, dass er den Abend möglicherweise nicht mehr erleben würde.
Er widerstand dem Verlangen, seinen Revolver zurechtzurücken, um sich zum hundertsten Male innerhalb von fünf Tagen zu vergewissern, dass die Waffe sich genau am richtigen Platz befand. Diesmal blieb er eisern und tastete nicht nach dem Knauf.
Wenn es an der Zeit war, später am Tag, würde er rasch genug ziehen - oder auch nicht. Schwer zu sagen, wovor er sich am meisten fürchtete...
Es war schon gegen Mittag, als er die Weidensträucher am Fluss vor sich auftauchen sah. Vor einer Stunde hatte er die westliche Biegung des Arkansas hinter sich gebracht; jetzt schwenkte der Trail nach Südwesten und tauchte in einen kleinen Bach ein. Tausende von Wagen hatten zu beiden Seiten der Furt die Uferböschungen eingekerbt. Der milde, trockene Winter hatte das Wasser vom Ufer zurücktreten lassen, und der Fuchs konnte den Bach mühelos durchqueren.
Am anderen Ufer lenkte David das Pferd flussaufwärts und ritt über die trockene Morastfläche. Hinter der nächsten leichten Biegung - er konnte von der Furt aus nicht mehr gesehen werden - hielt er an, hob mit einer steifen Bewegung ein Bein über den Rücken des Pferdes und stieg ab. Er schnallte den Schlafsack ab, lockerte den Sattelgurt und ließ sein Pferd zur Tränke gehen.
Die schlanken Weidenruten bewegten sich im Wind, aber kein Rascheln war zu hören, weil noch nicht genügend Blätter vorhanden waren. In dem schattigen Flussbett schien der Morgen noch kälter zu sein, als er es ohnehin schon war. Trotzdem begann David sein Hemd aufzuknöpfen.
Er wusste, dass dies die Stelle war, obwohl er sie zum ersten Mal sah. Auch die Tageszeit war richtig. Der Bach mit den Weidensträuchern am Ufer und die steile Anhöhe im Westen - alles entsprach der Beschreibung. Von hier aus bis Larkspur war es ein Ritt von weniger als zehn Minuten.
Er zog sein Hemd aus, und als er in das eisige Wasser trat, schien sich sein ganzer hagerer Körper in harte Muskelknoten zu verwandeln. Er bekam eine Gänsehaut, die sich derart spannte, dass er glaubte, keinen Schritt mehr machen zu können. Er bückte sich, benetzte seine Brust und legte sich dann der Länge nach ins Wasser.
Er rieb seinen Körper mit dem feinen Kiessand des Flussbodens, spülte sich ab, tauchte den Kopf unter und sprang aus dem Wasser.
Zum Abtrocknen benutzte er sein großes rotes Halstuch, erspähte eine sonnige Stelle, die zwar nicht windgeschützt war, und beeilte sich, so gut es ging.
Seine Zähne klapperten immer noch, als er saubere Unterwäsche und ein Paar Baumwollsocken aus dem Schlafsack zog. Er zog die Hose mit dem Fischgrätenmuster an. Den Anzug hatte er sich vor zwei Jahren in Topeka gekauft. Er dachte auch an das Jackett, fand aber, dass es um die Schultern herum zu straff saß und seine Bewegungen hemmte. Er besaß zwei saubere Hemden, und das braune Wollhemd war am wärmsten.
Mit dem roten Halstuch wischte er den Staub von seinen kniehohen Stiefeln. Sie hatten einmal seinem Vater gehört und waren ihm eine Kleinigkeit zu groß, aber er trug sie gern.
Ihm fiel ein, dass er möglicherweise auf einen Behelfsverband angewiesen sein würde; also spülte er das rote Halstuch gründlich aus, warf es sich locker um den Hals und verknotete zwei Zipfel miteinander.
Dann inspizierte er seinen Revolver, einen klobigen Colt mit abgefeiltem Korn. Abgesehen von der Staubschicht auf den eingeölten Teilen war er nach wie vor sauber. Er beseitigte den Staub auf einfache Weise: mit seinem Hemdzipfel.
Aus einer Satteltasche holte er eine kleine hölzerne Schachtel Patronen, Kaliber 45. Auf dem Deckel, unter dem Namen des Herstellers, las man das Versprechen: Absolut zuverlässig. Wegen der häufigen Fehlzündungen der alten Patronen war David schon mehr als ein Feldkaninchen entwischt. Doch die aufgedruckte Beschriftung Absolut zuverlässig war etwas, das David für bare Münze nahm.
Er lud den Revolver mit den Spezialpatronen, schob ihn wieder in den Hosenbund zurück und hatte ein unbegrenztes Vertrauen zu seiner Waffe.
Ob er sich noch rasch rasieren sollte? Er blickte in den Spiegel des klaren Flusswasser und stellte fest, dass sich der drei Tage alte blonde Bart in seinem jungen Gesicht so gut wie gar nicht bemerkbar machte. Er packte alles wieder zusammen und sagte entschuldigend zu seinem Pferd: »Nur noch ein Stückchen weiter, dann hast du Ruhe und bekommst Futter so viel du willst.«
Als er zur Furt zurückritt, in Richtung der steilen Anhöhe, fühlte er sich sauber, erfrischt und in jeder Hinsicht gefechtsbereit Er dachte nicht lange darüber nach, was ihn zu diesem etwas unbequemen Bad getrieben hatte. Er wollte nur sauber sein, weiter nichts. Keiner sollte ihn für einen ungewaschenen Vagabunden halten - auch der Leichenbeschauer nicht, falls dieser dazu Gelegenheit bekam.
Die Anhöhe fiel auf der anderen Seite steil ab, so plötzlich, dass sein Pferd den Kopf zurückriss, einen Satz zur Seite machte und stehenblieb.
David blickte in ein flaches Talbecken. Der Fluss hinter ihm schlängelte sich um die Anhöhe herum und kam im Süden wieder zum Vorschein. Er floss nach Südwesten und kurvte sanft auf den Arkansas zu. Die Schienen der Santa-Fé-Eisenbahn kamen von Norden, verschwanden in dem wirren Häuserhaufen von Larkspur und verliefen dann, parallel zum Fluss, in südwestliche Richtung.
David fand, dass Larkspur den Eindruck erweckte, als habe es die Hand eines Riesen einfach neben den Schienenstrang geworfen, wobei vereinzelte Häuser über die Landschaft gestreut wurden.
In einiger Entfernung ein paar Hütten, deren Dächer mit Grassoden gedeckt waren, dann ein Ring von Häusern aus Baumstämmen und Schalbrettern und schließlich die massiveren Gebäude rechts und links der Hauptstraße. Eine langgestreckte, schmale Ansiedlung, die sich von Norden nach Süden erstreckte und deren Häuser sich hauptsächlich östlich der Eisenbahnschienen befanden. Auf der westlichen Seite hatte man einige hundert Morgen Prärie in Rinderkorrals verwandelt, doch im Augenblick waren nirgendwo Rinder zu sehen.
David war am Ziel. Er blieb noch eine Weile reglos im Sattel sitzen, gab dann seinem Fuchs die Sporen und lenkte ihn ins Tal hinunter. Irgendwo zwischen diesen Häusern hielt sich der Mann auf, den er suchte, verschwendete kostbare Minuten und wusste nicht, dass seine Uhr jeden Augenblick abgelaufen sein konnte...
Im einzigen Hotel von Larkspur reckte sich ein großer dunkelhaariger Mann. Seine Bewegungen erinnerten an die Geschmeidigkeit einer großen Raubkatze. Er klopfte sich zufrieden auf den Bauch und rückte seinen Stuhl vom Esstisch zurück.
Storey James bezahlte sein Frühstück, kaufte noch Tabak und Zigarettenpapier und schlenderte zur Veranda des Hotels. Die Luft unter dem Dach war frisch, doch der schwarze Kaffee, den er eben getrunken hatte, breitete in seinem ganzen Körper Wärme aus.
Sechs Männer lehnten am Geländer der Veranda und genossen die Strahlen der Mittagssonne. Sie beobachteten den aus östlicher Richtung kommenden Reiter. Alle sechs drehten sich nach Storey um. Zwei von ihnen nickten ihm zu, aber die anderen blickten gleich wieder weg, als wäre er ihnen fremd, was allerdings nicht stimmte.
Storey kümmerte sich nicht darum. Den meisten von ihnen hatte er im vergangenen Winter eine Kostprobe seiner Macht gegeben. Aber er hatte es nicht gern, von jemanden mit Missachtung gestraft zu werden.
»Morgen, Gentlemen!«
Seine tiefe Stimme veranlasste jeden der sechs Männer, seinen Kopf zu wenden. Er blickte einen nach dem anderen an, bis jeder genickt und den Gruß erwidert hatte. Dann kehrten sie ihm wieder den Rücken zu und schwiegen sich einige Zeit aus.
Storey nahm unter dem schattigen Verandadach auf einem der Stühle Platz und drehte seine erste Zigarette des Tages. Die Männer vor dem Geländer fuhren in ihrer Unterhaltung fort.
»Keine Ahnung, was das für ein Pferd ist«, sagte einer.
»Kommt wohl nicht aus Texas«, meinte ein anderer.
»Anscheinend einer aus dem Osten.«
Storey beugte sich ein wenig vor und blickte die Straße hinauf.
Der Reiter, ein schlanker Bursche auf einem großen Fuchs, das Gesicht im Schatten der breiten Krempe seines flachen Hutes, kam langsam auf das Hotel zugeritten. Von weitem betrachtet, konnte man nichts Bemerkenswertes an ihm entdecken, es sei denn, dass sein schwarzer Hut gerade auf dem Kopf saß und dass er genau in der Mitte der von Radspuren zerfurchten Straße ritt.
Storey feuchtete mit der Zunge das Zigarettenpapier an, rollte den Tabak ein und stellte fest, dass er keine Streichhölzer hatte.
Er stand auf, ging hinein, nahm eine Handvoll Streichhölzer aus der auf dem Rauchtisch stehenden Schachtel und zündete seine Zigarette an. Als er wieder im Türrahmen stand, war der Reiter nur noch drei Häuser weit entfernt. Storey konnte das junge Gesicht des Reiters deutlich sehen.
Er trat einen Schritt zurück und stellte sich hinter die Wand. Dann sah er plötzlich seine Zigarette auf dem Fußboden liegen und merkte, dass seine Hand mit gespreizten Fingern an der rechten Hüfte ruhte. Er trug keinen Revolver, doch seine überstürzte Art, danach zu greifen, erschreckte ihn.
Er sah sich um. Der kleine Vorraum war noch immer leer; der Bedienstete unterhielt sich draußen mit den anderen.
Storey hätte ganz von der Tür verschwinden können, aber etwas in ihm sträubte sich dagegen. Er trat nur mit der Stiefelsohle die Zigarette aus und blieb stehen, wo er stand.
Die gedämpften Hufschläge auf der Straße verrieten ihm, dass der Reiter sein Pferd auf die Leute vor der Veranda zu lenkte. Der Kopf des Pferdes kam in Sicht und bewegte sich nicht mehr weiter. Storey hätte den Reiter - wäre er nur fünfzehn Zentimeter nach rechts getreten - sehen können. Aber dann hätte ihn auch der Reiter sehen können. Deshalb blieb er stehen und beobachtete die spitzen Ohren des Fuchses.
»Gibt’s hier einen Mann namens Skinner Bill?«
Es war eine jugendliche Stimme, doch sie klang so energisch und selbstbewusst wie die eines Erwachsenen.
Keiner antwortete.
Storey begann zu hoffen, dass die Leute draußen seinen Freund Bill Clemmens nicht unter dem alten Namen kannten.
Dann ließ ein Oldtimer namens Roucus seine Stimme vernehmen und sprach; »Er meint anscheinend Bill Clemmens, den Spieler. Der hat mal ’nen Rekord im Büffelenthäuten aufgestellt. Das war vor sechs Jahren. Darum wurde er einige Zeit Skinner genannt.«
»Dann meinen Sie wohl Bill Clemmens?«, fragte der Hotelbedienstete.
»Wo kann ich ihn finden?«
»Im Sergeant, im Dollar Sign, im Sam, der Teufel - in welchem Saloon er sich eben zur Zeit aufhält.«
Wieder abwartendes Schweigen.
Das Pferd machte einen Schritt zur Seite, und Storey konnte sich vorstellen, dass der Reiter die Aushängeschilder und Tafeln der Saloons entlang der Straße betrachtete. Er rechnete schon damit, dass der junge Mann die Frage Gibt’s hier auch einen Mann namens Storey James? stellen würde. Kannte er schon den einen Namen, so kannte er möglicherweise auch den anderen.
Doch der Kopf des Pferdes verschwand aus seinem Blickfeld. Er spürte, wie seine Spannung merklich nachließ. Dann stieß »Rotbart« Evans sich von dem Verandapfosten ab und rief: »Wo kommst du her?«
Der Reiter hielt nicht an, und Rotbart bellte: »Kannst du nicht antworten?« Das Pferd trabte langsam weiter. Rotbart schrie: »Hast du Bohnen in den Ohren?« Die kleineren Männer um ihn herum lachten leise.
»Verdammter Lümmel, dich soll doch gleich...« Rotbart fand nicht die passende Formulierung, benutzte seine fleischigen Hände als Schalltrichter und rief hinter dem Jungen her: »Nimm die Bohnen aus deinen dreckigen Ohren - verstanden?!«
Storey hatte den wütenden Impuls, den großen Ochsen der Länge nach auf die Straße zu schmettern. Aber das Pferd trottete weiter und bestätigte Storey das, was er schon lange vermutet hatte: David Haviland hatte ein bestimmtes Ziel vor den Augen, und nichts würde ihn in eine andere Bahn lenken können, zumal er diesem Ziel schon sehr nahe war.
Storey durchquerte mit langen Schritten den Vorraum und ging durch ein kleines Magazin auf die Hintertür zu. Sie hatte ein Vorhängeschloss, doch die Haspe war nicht groß. Er packte den Türgriff, ruckte zweimal heftig daran und hatte die kleinen Nägel aus dem Holz gerissen.
David Haviland war in nördliche Richtung geritten und würde wahrscheinlich in den bekanntesten Saloons dieser Straßenseite nach ihm suchen. Doch es war möglich, dass Clemmens sich in einer Bar auf der Westseite aufhielt.
Storey eilte eine mit Müll übersäte Gasse entlang auf die erste Seitenstraße zu. Dort bog er in westliche Richtung ab, kam an der Bank von Larkspur vorbei, überquerte die Planken des Bürgersteiges und die fünfzig Fuß breite Center Street.
Einige Wagenspuren waren fast einen Fuß tief, so dass er aufpassen musste, wo er mit seinen Reitstiefeln hintrat. Er blickte die Straße entlang, sah aber nichts von dem Reiter mit dem schwarzen Hut. Ein Einspännerwagen und zwei gesattelte Pferde standen vor den Saloons in der Nähe von McDonalds Gemischtwarenladen, doch das hatte nicht viel zu sagen.
Hinter den Häusern auf der westlichen Straßenseite lagen die Schienen der Eisenbahn. Obwohl die Saloons und Läden direkt an der Hauptstraße standen, konnten sie die unmittelbare Nachbarschaft des Güterbahnhofs und der Korrals nicht verleugnen. Auf der Hofseite einiger Häuser befand sich ein zweiter Eingang, und das freie Gelände zwischen Häusern und Eisenbahngleis diente als Zufahrtstraße. Auf der anderen Seite waren dann die Korrals, die Verladerampen und - schon in der offenen Prärie, ein paar Hütten.
Storey ging durch ein Spalier leerer Bierfässer und betrat den düsteren Hinterraum des ersten Saloons Er sah, dass die Stühle aufgestapelt waren. Felix, der Berufssäufer der Stadt, lag schlafend auf einem Billardtisch. Der Barkeeper im vorderen Raum war allein.
Mit den nächsten beiden Saloons war es dasselbe: ein Barkeeper und ein, zwei Gäste.
Von Saloon zu Saloon spürte Storey, wie seine Unsicherheit immer stärker wurde. Und etwas nagte in ihm - ein Feind, gegen den er sich immer heftiger zur Wehr setzen musste: die Unentschlossenheit.
Er hatte sich verändert. Einen gefassten Entschluss blitzschnell in die Tat umsetzen, die Situation erfassen und sich entsprechend verhalten, sehen, was zu tun war, und es ausführen - das war die alte Methode.
Aber jetzt war das alles nicht mehr so einfach.
Er ging an einer geschlossenen Bar vorbei und auf den Sergeant zu. In der Hinterstraße war alles ruhig, er hörte nur seine eigenen Schritte. Die glitzernden Eisenbahnschienen erstreckten sich nach Norden zu und verschwanden in der leeren Prärie.
Es war noch Zeit... Wurde irgendwo in der Stadt ein Schuss abgefeuert, würde er es wissen.
Und wenn er Bill Clemmens antraf, bevor der Schuss gefallen war?
Er konnte ihm raten, sich aus dem Staub zu machen, ihn auf Trab bringen, wenn das möglich war.
Aber wenn es zum Davonlaufen zu spät war - was dann?
Ja, dann war es eben zu spät.
Die Doppeltüren, die während der Wintermonate geschlossen blieben, waren noch nicht entfernt worden. Er zog an einer der beiden Türen. Sie öffnete sich einen Spaltbreit, weiter nicht. Drinnen war ein eiserner Querbalken vorgelegt. Storey sah sich nach einer Hebestange um.
Er fand eine einzelne Fassdaube, schob sie zwischen die beiden Türen und versuchte, den Querbalken anzuheben. Aber er musste seinen Ellenbogen als Hebelstütze benutzen, was wiederum die Hebekraft der Fassdaube verringerte. Der Schweiß drang ihm vor Anstrengung aus allen Poren, und der kalte Wind jagte ihm einen Schauer über den Rücken.
Er warf die Fassdaube weg, trat von der Tür zurück und hob - nur mit einem Arm und unter Aufwendung seiner ganzen Kraft - den schweren Balken aus der Lagerung. Er krachte zu Boden, und die Türen öffneten sich von allein.
Der Hinterraum war leer. Die Tür zur Bar hing schief im Rahmen, und er konnte durch einen Spalt sehen, dass sie von innen abgeriegelt war. So wandte er sich nach links und stieg die Hintertreppe zum Balkon hinauf.
Er fürchtete, dass er sich wieder geirrt hatte und nur kostbare Zeit verschwendete. Er trat auf den Balkon hinaus, der von zwei Seiten über den Barraum hinausragte.
Er brauchte kurze Zeit, um seine Augen an das trübe Dämmerlicht zu gewöhnen. Die Lampen brannten noch nicht, außerdem gab es in dem langen Raum keine Seitenfenster. Das einzige Licht sickerte durch das kleine Fenster und die geöffnete Vordertür. Dann konnte Storey den Raum deutlich erkennen und wusste, dass er endlich den richtigen Saloon entdeckt hatte.
Und er wusste auch, dass er zu spät gekommen war.
Zweites Kapitel
Von dem dunklen Balkon aus konnte Storey den Hinterkopf von Bill Clemmens sehen. Er saß mit fünf anderen Männern an einem Pokertisch. Zwei von ihnen blickten noch in Richtung der Hintertür. Die von Storey verursachten Geräusche hatten sie aufmerksam gemacht. Doch Clemmens hatte sich nicht umgedreht.
Der Junge war gerade durch die Vordertür eingetreten und stellte dem Barkeeper eine Frage. Die untere Partie seines Körpers war von der Ecke der Bar verdeckt. Während Storey noch beobachtete, deutete der Barkeeper gleichgültig mit dem Zeigefinger auf Bill Clemmens, sagte etwas und polierte wieder seine Gläser.
Der große Revolver war erst dann zu sehen, als der Junge von der Bar zurücktrat. Er steckte genau in der Mitte seines Hosenbundes.
Der Junge sah Clemmens frei heraus an.
Es ist soweit, dachte Storey, jetzt entscheidet sich alles von selbst. Er wollte Bill Clemmens warnen, noch war Zeit dazu, aber er blieb unsichtbar stehen und bewegte sich nicht.
Plötzlich wusste er, dass er nichts damit zu tun hatte. Er war weder Ankläger noch Richter, sondern nur ein Beobachter. Er sah nur zu und überließ einer anderen Macht die Entscheidung über die Schicksale der beiden Männer.
Dreißig Sekunden lang war außer dem Klicken der Chips kein Laut zu hören. Die Spieler kümmerten sich nicht um den neuen Gast.
Der Junge trat vor und blieb drei Schritte vom Tisch entfernt stehen. Seine Augen waren von der Krempe seines großen glatten Hutes verdeckt, der rechtwinklig auf seinem Kopf saß.
Der neben Clemmens sitzende Mann griff nach einer Karte und blickte auf. Seine Hand erstarrte. Die anderen sahen ihn fragend an und blickten dann in die Richtung des Jungen. Keiner machte eine Bewegung.
Dann zog Bill Clemmens scheinbar zufällig die Hand zurück und bewegte den Ellenbogen so, dass er dabei den Rockaufschlag zur Seite schob, bis er über das Halfter an seiner linken Seite hinweggeglitten war. Der Nussbaumknauf seines Revolvers war griffbereit.
Weil der Junge seinen Blick auf Clemmens gerichtet hatte, sagte niemand ein Wort.
»Wollen Sie etwas?«, fragte Bill Clemmens.
Die Stimme verriet Storey alles. Es waren keine Bedenken darin. Clemmens wusste, wer David Haviland war und was er hier wollte. Gab es keine andere Möglichkeit, würde Clemmens den Jungen erschießen, falls er dazu kam. Und Storey glaubte, dass er es fertigbringen würde.
Wäre es umgekehrt gewesen, hätte Clemmens den Jungen gestellt, würde Storey eingegriffen haben. Aber der junge Haviland machte das Spiel selbst und musste die Karten stechen, wie sie kamen.
»Sind Sie Skinner Bill?« Die Stimme des Jungen hallte laut durch den Raum.
»Der bin ich.«
»Dann geben Sie Ihren Freunden den Rat, aus dem Weg zu gehen.«
Stühle wurden vom Tisch zurückgeschoben, ehe David Haviland den Satz noch ausgesprochen hatte. Ein Stuhl kippte um, ein Mann stolperte darüber hinweg und stützte sich an der Wand. Die fünf Männer standen mit den Rücken zu der hellrot und gelb geblümten Tapete. Nur Clemmens war am Tisch sitzengeblieben.
»Wollen Sie wissen, was das zu bedeuten hat?«, fragte jetzt der Junge.
»Nein!« Clemmens sagte es fast zu schnell. »Behalte deine Weisheit für dich.«
Storey beobachtete den Jungen, konnte aber keine Spur von Nervosität feststellen. Er musste wissen, dass Clemmens mit einem Revolver umgehen konnte, aber er hatte keine Angst. Er war höchstens ein wenig blass.
Es ist ihm egal, dachte Storey überrascht; er kümmert sich nicht darum, ob er am Leben bleibt oder stirbt.
Clemmens zog den linken Fuß zurück. Er schien noch immer zu sitzen, hatte aber schon sein Körpergewicht nach vorn verlagert, so dass er sprungbereit war.
»Stehen Sie auf!«, sagte der Junge.
Clemmens beugte sich leicht vor und zog, während er sich aufrichtete seinen Revolver.
Zwei Schüsse peitschten fast gleichzeitig durch den Raum. Glas splitterte auf dem Regal hinter der Bar. Clemmens’ Hüfte ruckte zurück. Er kippte in die Rauchwolke hinein, die sein Revolver verursacht hatte, stürzte zu Boden und lag still.
Der Junge stand reglos da. Sein Colt deutete durch den Pulverqualm auf die Stelle, wo Clemmens gestanden hatte. Der dicke Qualm stieg in die Höhe und wurde dann von einem leichten Luftzug nach hinten geweht.
Ein merkwürdig einsames Gefühl ergriff Besitz von Storey James. Er starrte von oben auf den leblosen Körper Bill Clemmens’. Ihm war, als habe dieser Körper eine schwere Last getragen und sie nun auf ihn abgewälzt. Jetzt trug er die ganze Last allein.
Er hatte sich nicht bewegt, spürte aber, dass ihn jemand ansah. Es war der Barkeeper. Der so gut wie kahlköpfige Mann blickte zu ihm hinauf. Storey verzog keine Miene. Er erwiderte den verwunderten Blick des Barkeepers, bis der Mann wieder den Kopf senkte. Dann machte er kehrt, ging langsam die Treppe hinunter und durch die Hoftür hinaus.
Die Rampenstraße war leer, das Eisenbahngleis lag kalt und schweigend da. Ohne Eile ging Storey den gleichen Weg zurück, den er gekommen war. Er entfernte sich vom Schauplatz der Handlung.
Als die Sonne den Stern auf der Klappe seiner Hemdtasche blitzen ließ, fiel ihm ein Lichtreflex ins Auge. Er schob die Klappe in die Tasche. Auf diese Weise störte ihn der Stern nicht so sehr.
Wie würde der Junge reagieren, wenn er entdeckte, dass seine nächste Beute ein Mann des Gesetzes war? Storey wusste es nicht. Er wusste überhaupt nichts von den Gefühlen David Havilands.
David fühlte sich im Augenblick elend.
Er sah das Blut unter dem Mann hervorlaufen, den er getötet hatte. Der beißende Pulvergeruch hatte sich langsam verflüchtigt. Und David stand noch immer da und kämpfte gegen eine aufsteigende Übelkeit an.
Seine angespannten Nackenmuskeln schmerzten. Er schob den warmen Lauf seines sechsschüssigen Colts in den Hosenbund zurück und rieb sich den Nacken.
Er spürte die Blicke der an der Wand stehenden Männer. Er hatte das Trappeln rascher Schritte draußen auf dem Plankengang gehört und wusste, dass sich noch andere Blicke auf ihn konzentriert hatten. Trotzdem konnte er sich nicht vom Fleck bewegen.
Er hatte für diesen Kampf seine ganze Kraft, seinen ganzen Hass und seine ganze Entschlossenheit mobilisiert. Zwei donnernde Schüsse waren die Folge gewesen. Sie hatten ihn wie erstarrt zurückgelassen.
Er blickte auf die leichte Schramme an der Kante der Mahagonibar. Die Kugel eines Mannes, der, als er abdrückte, praktisch schon tot gewesen war, hatte eine Rille in das schwarze Holz gezogen. Abergläubische Männer würden in Zukunft vermeiden, sich über diese Stelle zu beugen. Und wenn sich ein paar alte Freunde nach Skinner Bill erkundigten, würde der Barkeeper nur schweigend auf diese Rille deuten.
David hatte Mühe, den Brechreiz zu unterdrücken. Er machte kehrt und ging in der eisigen Stille auf die Tür zu. In die Männer hinter ihm kam ebenfalls Bewegung, und sie versammelten sich um den Toten. Nicht ausgeschlossen, dass jemand auf die Idee kam, eine Kugel hinter ihm herzujagen, aber das spielte keine Rolle. Wichtig war, dass niemand sehen konnte, wie blass David Havilands Gesicht geworden war.
Draußen starrten ihn weitere Gesichter an, doch die kalte Luft war alles, was er jetzt nötig hatte. Sein Magen schien einen jähen Satz nach oben zu machen, aber er hielt ihn unter Kontrolle. Die Männer ließen ihn vorbei und gingen hinter ihm auf die Tür des Saloons zu.
Oberhalb der Straße nahm ein Mann die Schürze ab, warf sie zur Seite und kam angelaufen. Zwei andere Männer kamen aus nördlicher Richtung auf ihn zugelaufen; einer von ihnen war der Marshal.
David betrachtete den kleinen, untersetzten Mann mit dem Stern auf der Lederweste. Für einen plumpen Mann rannte er erstaunlich rasch. Sein Revolver mit dem Elfenbeinknauf schien für ihn zu lang zu sein, doch die flinken Bewegungen beim Laufen zerstreuten diese Bedenken. David befand sich in ernster Gefahr - er wusste es in dem Augenblick, als er den Stadtmarshai von Larkspur aus der Nähe betrachtete.
»Queen ist jetzt da!«, rief einer der Männer aus dem Türrahmen.
David blickte aus einem Augenwinkel zu dem Mann hinüber, der anscheinend froh war, nicht in seinen Stiefeln zu stecken.
Der Marshal hatte einen hohen braunen Derbyhut auf dem Kopf. Seine große Nase war mindestens schon einmal gebrochen und notdürftig wieder zusammengeheilt.
Seine Augen konzentrierten sich sofort auf David, den Fremden. Er trat so nahe an David heran, dass seine Lederweste fast Davids Hemd berührte. »Haben Sie auf einen geschossen?«
David antwortete nicht.
»Auf wen?«
Ein Mann hinter David sagte: »Bill Clemmens.«
Für einen flüchtigen Moment sah David die Verwunderung in den Augen des Marshals, aber er konnte sich geirrt haben.
Ehe David noch wusste, wie ihm geschah, hatte sein Colt den Besitzer gewechselt. Aber der flinke Griff verriet dennoch eine wunde Stelle des Marshals - es war die Bewegung eines Mannes, der nicht so selbstsicher war, wie er sich den Anschein gab. Dann spürte David den Revolverlauf in der Magengrube.
»Haben Sie etwas dagegen?«
David blickte furchtlos in das buschige Gesicht mit der gebrochenen Nase. Dann schüttelte er den Kopf.
»Bleiben Sie stehen und rühren Sie sich nicht. - Hat jemand Storey gesehen?« bellte er. Als er keine Antwort bekam, zog er seinen eigenen Revolver, blickte herum und gab ihn einem großen rotbärtigen Mann. David erinnerte sich, den Rotbart bereits vor dem Hotel gesehen zu haben. »Wenn er von dieser Planke tritt, Rotbart, dann schießen Sie.«
Rotbart nahm den Revolver und richtete dessen Lauf auf David. Alle anderen folgten dem Marshal hinein. David und sein Bewacher blieben zurück.
»Hast du jetzt keine Bohnen mehr in den Ohren?«, fragte Rotbart.
Es war die gleiche spöttische Betonung, die der Mann schon früher in seine Stimme gelegt hatte, doch wenn das spaßig gemeint war, so konnte David nicht darüber lachen. Redewendungen, die bei anderen Männern als Witze galten, beeindruckten David meistens nicht, und er hatte es aufgegeben, darüber nachzudenken. Darum sagte er auch kein Wort.
Ein verhutzelter kleiner Mann kam über die Planken geschlurft. Er blieb stehen und sah die beiden Männer mit blutunterlaufenen Augen an. Davids Bewacher hatte etwas gegen seine Anwesenheit und sagte: »Geh hinein, Felix. Du versoffener Tölpel!« Er versetzte ihm einen Tritt, der Felix auf die Saloontür zu stolpern ließ.
Wieder stand David mit Rotbart allein auf der Straße.
Rotbart machte mit dem Revolverlauf kreisförmige Bewegungen, als halte er etwas Lebendiges in der Hand. Das Recht, auf einen Mann zu schießen, der eine verdächtige Bewegung machte, führte ihn offenbar in Versuchung. Der Marshal hatte eine kluge Wahl getroffen. David bewegte sich keinen Millimeter von der Stelle.
Die blauen Augen des großen Mannes schimmerten feucht, und seine Zunge benetzte die Oberlippe unter seinem dünnen Bart.
»Los, verschwinde«, zischte er leise. »Ich schieße nicht.«
Die impulsive Blutgier dieses Mannes jagte David einen Schauer über den Rücken.
»Los, verschwinde«, wiederholte Rotbart in seiner tollpatschigen Art. »Ich bin kein Sheriff. Mir egal, was du machst. Überlege nicht lange. Du hast nichts zu verlieren. Ich werde sagen, dass ich auf dich geschossen, aber nicht getroffen habe.«
Und während der ganzen Zeit ließ er dicht vor Davids Magengrube den Revolverlauf kreisen. David atmete erst wieder normal, als die Männer aus dem Saloon kamen.
Drittes Kapitel
Das Gefängnis war ein rechteckiger Raum. Die Wandhölzer wurden durch Stahlklammern zusammengehalten. Auf der Nordseite führte eine Außentreppe zum Büro des Marshals. Das Büro erinnerte an eine auf das Dach gesetzte Hütte; es befand sich an einer Ecke und hatte einen guten Blick auf die Straßen.
Eine Handvoll Männer war neugierig gefolgt, doch Marshal Queen ließ keinen hinein. Er nahm hinter dem zerkratzten Schreibtisch Platz. David blieb stehen. Kein Zweifel, der Marshal wirkte irgendwie unsicher.
Er öffnete Davids Revolver und drückte fünf Patronen und eine leere Hülse heraus.
»Haben Sie immer eine volle Ladung in dieser Pistole?«, grunzte er verwundert.
Die meisten Leute nannten alle Handfeuerwaffen noch immer Pistolen. David nickte.
»Sechs Schüsse«, sagte der Marshal ungeduldig. »Wissen Sie noch nicht einmal, dass aus Sicherheitsgründen eine leere Hülse unter den Hammer gehört?«
»Ich drücke den Hammer nicht mit dem Daumen zurück«, erklärte David. »Ich halte ihn fest, bis ich den Abzug durchziehe.«
Der Marshal gab einen Schnauflaut von sich und sprach: »Wollen wir doch mal sehen.« Er prüfte mit seinem Daumen die Funktion des Hammers. »Mein Gott, der klemmt ja wie ein verrostetes Eisentor. Ein Greenhorn.« Seine grauen Augen blickten verächtlich. »Ein verdammtes Greenhorn. Ich wusste doch, dass etwas faul daran ist. Ein Junge fordert einen Burschen wie Clemmens heraus, ein verdammtes Greenhorn... Aber Sie kennen es wohl nicht besser.«
»Besser als was?«, fragte David ruhig.
Der Marshal schnaufte wieder und sagte: »Sie haben nicht die leiseste Ahnung von Pistolen und wissen nicht einmal, wie am raschesten gezogen und abgedrückt wird. Diese Pistole ist so steif wie nur irgendetwas.«
»Ich habe sie immer gründlich eingeölt.«
Der Marshal griff nach Clemmens’ Revolver und leerte die Trommel: drei Patronen, zwei leere Hülsen. Wortlos reichte er den Revolver David.
In Davids Handfläche fühlte sich der Revolver wie sein eigener an, aber er funktionierte federleicht. Sein Daumen drückte den Hammer zurück, der sofort zuschnappte, kaum, dass er den Abzug berührt hatte. Er hatte damit gerechnet, war aber dennoch überrascht.
»Ich habe von Stechschlössern gehört«, sagte er. »Sie sind in jedem Fall gefährlich. Damit kann man sich das Bein abschießen.«
»Würde ich meinen Revolver im Hosenbund tragen wie Sie, wäre ich auch auf kein Stechschloss erpicht«, entgegnete Queen. Seine Brust wölbte sich in einem plötzlichen Gelächter, doch seine Fröhlichkeit behauptete sich nicht lange. Er krauste wieder die Stirn. »Wo haben Sie gelernt, mit einem Revolver umzugehen?«
»Ich habe mein ganzes Leben lang gejagt und geschossen.«
»Aber nicht diese Art von Schießerei, wie?«
»Nein«, gab David zu. »Einen Mann habe ich noch nie erschossen.«
»Und wenn wir diese Unterhaltung beendet haben, mein Freund, dann wird es sehr lange dauern, bis Sie Gelegenheit haben, den nächsten zu erschießen. Das hier ist kein unzivilisiertes Land mehr, und wer in meiner Stadt einen Menschen erschießt, ist ein Mörder.«
»Ich habe ihm eine reelle Chance gegeben und...«
Queens klobige Faust donnert auf den Schreibtisch. »Lassen Sie dieses Gerede! Das hat hier keinen Sinn mehr.« Das Kinn schob sich unter dem buschigen Bart hervor. »Wie ist das passiert? Zeugen behaupten, die Karten seien gleichmäßig verteilt gewesen. Also, wie kann ein Greenhorn wie Sie einen Mann wie Bill Clemmens niederschießen?«
»Ich war eben schneller und...«, setzte David an.
Queen sprang so rasch auf die Beine, dass der Sessel hinter ihm umkippte. »Machen Sie sich nicht über mich lustig!«, brüllte er.
David nahm instinktiv seine Fäuste hoch, doch der Marshal kam nicht auf ihn zu und ließ stattdessen die rechte Hand auf seinem Halfter ruhen.
»Wer in dieser Stadt einen Vertreter des Gesetzes angreift«, sagte er, »der kann sein Testament machen.«
Doch David glaubte das nicht ganz. Der Marshal sagte harte Worte, aber etwas an ihm verriet David, dass er auf keinen unbewaffneten Mann schießen würde. Aus diesem Grund war seine Furchtlosigkeit echt, und der Marshal musste das spüren.
Einen Augenblick später richtete Queen den Schreibtischsessel auf und nahm so ruhig wieder Platz, als habe er sich nie aufgeregt.
»Entweder haben Sie Nerven oder Sie sind ganz einfach ein Dummkopf. Ich weiß nicht, was bei Ihnen zutrifft.«
Er nahm einen Bleistiftstummel und ein Blatt Papier aus der Schublade.
»Name?«
»David Haviland.«
»Noch nie etwas von Ihnen gehört. - Wo kommen Sie her?«
»Warakusa. Ich habe dort ein wenig Land.«
»Das ist in Kansas.«
»Südlich von Topeka.«
»Ich weiß, wo es liegt. - Wie schreibt sich der Name?«
»Was?«
»Der ganze Name!«
David buchstabierte das Wort und Marshal Queen setzte den Bleistiftstummel in Bewegung.
»Wie alt?«
»Zwanzig.«
Der Marshal wollte das Alter aufschreiben, brach aber die Bleistiftspitze ab und ließ es dabei bewenden. Er überflog noch einmal den geschriebenen Text und kam zu der Erkenntnis, dass er seiner Pflicht vollauf Genüge getan hatte.
»Reicht für einen Grabstein...«
Die Außentür wurde geöffnet. Ein schmalgesichtiger Mann mittleren Alters steckte vorsichtig den Kopf ins Office.
»Kommen Sie herein, Doktor«, brummte der Marshal. »Haben Sie irgendwo Storey gesehen?«
Der Arzt schüttelte den Kopf, trat ein und zog behutsam die Tür hinter sich zu.-Was er tat, das tat er vorsichtig, so als lege er Wert darauf, keinerlei Aufsehen zu erregen.
»Wo, zum Teufel, steckt der Mann?«, grunzte der Marshal.
»Vielleicht ist er auf der Farm, nach seinem Vieh sehen.«
»Nein, er ist in der Stadt. Ich habe ihn schon gesehen. - Was haben Sie festgestellt?«
Der Arzt hatte einen Zeichenblock in der Hand von der Art, wie ihn Schulkinder benutzen. Er schlug ein Blatt um und las: »Das Opfer starb um 11.55 Uhr mittags. Großkalibriger Einschuss in Herznähe. Plötzlicher Tod. Loch hat die Größe eines Silberdollars.« Er blickte zum Marshal auf. »Haben Sie ihm den Revolver aus der Hand genommen?«
»Ja - das heißt, nein, der Revolver war nicht in seiner Hand. Aber Bill hat geschossen. - Haben Sie die Rille in der Mahagonibar gesehen?«
Der Arzt nickte und berichtete mit sanfter Stimme weiter: »Sechs Zeugen. Sergeant, Dick Smith, Herrn und so fort. Alles in allem die gleiche Geschichte. Der Junge hat angefangen. Warum, das hat keiner gehört. Er gab Bill seine Chance. Drei Leute sagen, dass der Junge zuerst gezogen hat, drei behaupten das von Bill. Muss ungefähr jeder die gleichen Chancen gehabt haben.«
David sah den Blick des Marshals auf sich gerichtet.
»Wie dem auch sei«, sagte Queen, »Sie haben einen Menschen umgebracht. Vor zwei Jahren - vielleicht noch im vergangenen Jahr - wären Sie mit einem blauen Auge davongekommen. Heute nicht mehr.«
Der Arzt nickte und vermied es, David anzusehen.
»Ich denke, Sie können es Totschlag nennen - kommt natürlich darauf an, was dahintersteckt.«
Queen krauste die Stirn.
»Kann nichts dahinterstecken, was nicht im Gesetzbuch steht.«
»Ich wäre gern dabei gewesen«, sagte der Arzt. »Ich hätte nie geglaubt, dass es hier oben im Norden jemand mit Bill Clemmens aufnehmen könnte. Auch Sie und Storey nicht. Ich erinnere mich noch, als...«
Marshal Queen fiel ihm ins Wort und sagte: »Das steht jetzt nicht zur Debatte. Ausschlaggebend ist, dass ihn dieser Fremde hier erschossen hat. Ich habe eine Regel auf gestellt, die seit einem Jahr nicht mehr gebrochen wurde. Wenn hier geschossen wird, so ist das eine Angelegenheit der Hüter des Gesetzes. Dieser Junge hat gegen die Regel verstoßen. Storey und ich behandeln die Raufbolde der Stadt nicht gerade sanft, und darum sind wir nicht sehr beliebt. Jeder Nichtsnutz, der sich in der Stadt aufhält, soll sehen, was ich mit dem Jungen anstelle. Ich werde dafür sorgen, dass er verurteilt wird - mindestens zu drei Jahren!«
David fühlte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss. »Nicht ins Gefängnis«, sagte er. »Kein Haviland wird jemals ins Gefängnis gehen.«
Die beiden älteren Männer starrten ihn an. Der Arzt machte ein verdutztes Gesicht und der Marshal schien wieder hochspringen zu wollen.
»Kein Haviland?«, schrie Queen. »Was ist denn ein Haviland? Eine besondere Menschenrasse? Bilden Sie sich ein, über dem Gesetz zu stehen?«
»Ich gehe nicht ins Gefängnis«, entgegnete David.
»Das wollen wir doch mal sehen. Abwarten! Wenn dieses Greenhorn ein geübter Revolverschwinger ist, dann bin ich ein Maulesel! Ich glaube nicht mal, dass er etwas von Bill Clemmens’ Ruf gewusst hat.« Er beugte sich über den Schreibtisch und redete David sein Kinn entgegen. »Haben Sie Bill Clemmens schon früher einmal schießen sehen?«
David fühlte das kalte Gewicht eines Bleiklumpens in seinem Magen. Er öffnete den Mund, um zu antworten, nickte dann aber nur mit dem Kopf.
»Auf wen hat er geschossen?«, erkundigte sich der Marshal.
Und David sagte: »Auf meine Schwester.«
Das Schweigen in dem winzigen Büro war erdrückend.
Der Arzt schien nicht zu wissen, wohin er blicken sollte, und das Gesicht des Marshals sah betroffen aus. Nach einer Weile fragte er steif: »Können Sie das beweisen?«
David suchte in seiner Tasche nach und brachte ein«! vergilbten Zeitungsausschnitt zum Vorschein. Queen las ihn schweigend und murmelte: »Keine Namen genannt... Es geht nur daraus hervor, dass dieses Mädchen von zwei unbekannten Reitern niedergeschossen wurde. Wer behauptet, dass einer von diesen beiden Reitern Bill gewesen ist?«
»Er war es«, sagte David. »Als ich ihn beim Namen nannte, war es deutlich in seinem Gesicht zu lesen.«
Queen schüttelte den Kopf und fragte: »Wie haben Sie ihn gefunden?«
»Ich bekam die Nachricht, dass er sich hier aufhielt.«
Der Arzt kratzte sich das Genick und meinte: »Einige behaupten ja, dass Bill zuerst gezogen hat, aber...«
Der Marshal brachte ihn mit einem kurzen Blick zum Schweigen. »Sie waren nicht dabei, Doktor.«
Er gab David den Zeitungsausschnitt zurück und machte eine ruckartige Kopfbewegung zur Tür hinter sich.
»Gehen Sie da hinein, Haviland.«
David trat in einen Raum, der nicht einmal doppelt so breit war wie die Pritsche, die darin stand. Queen schloss ihn ein, aber die windschiefe Tür ließ jedes Geräusch hindurch. Er hörte die Unterhaltung des Arztes mit dem Marshal so deutlich, als wäre er mit ihnen im gleichen Raum.
Der Arzt räusperte sich nervös und sagte: »Nun?«
»Gefällt mir nicht«, brummte der Marshal, »gefällt mir ganz und gar nicht.«
»Er hat Ihnen einen Riegel vorgeschoben, Jim.«
»Und wenn die ganze Geschichte nicht wahr ist?«
»Sie haben noch nicht alles gehört«, sagte der Arzt. »Warten wir ab. - Wie viele unverheiratete Mädchen gibt es jetzt in Larkspur? Zwei? Drei, wenn man die neue Witwe, Mrs. Clemmens, mitzählt.«
»Die habe ich vergessen.«
»Drei«, sagte der Arzt mit seiner sanften Stimme. »Nicht einmal ein paar hübsche Frauen sind noch hier - sie alle haben sich grünere Weideplätze ausgesucht. Nur verkorkste Männer in der Stadt. Da hat es keinen Sinn, dem Jungen mit einer derartigen Geschichte den Prozess zu machen. Die würden einen Helden in ihm sehen.«
»Nicht dann, wenn er die Geschichte erfunden hat, nicht, wenn wir der Sache nachgehen und es sich herausstellt, dass alles ganz anders gewesen ist.«
Es folgte eine längere Pause - als suche jemand vergeblich nach Worten. Dann ließ der Arzt seine Stimme vernehmen.
»Sam der Teufel ritt gestern Nacht aus der Stadt. Ich weiß es, denn er hat mich vorher aufgesucht. Ich gab ihm Hämorrhoiden-Salbe. Er sollte eigentlich nicht reiten, tat es aber doch.«
»Sam muss einen Dollar gerochen haben.«
»Er hat Geld gewittert, ganz richtig... Kommt auf vier Beinen angetrappelt, das Geld.«
Ein Stuhl kratze über den Fußboden, und David konnte sich vorstellen, dass Marshal Queen so plötzlich wie vorhin aufstand. »Trifft eine Herde ein?«
»Das ist vertraulich. Ich weiß nicht einmal genau, ob...«
»Zum Teufel, wir haben erst den fünften April. Wissen Sie es mit Sicherheit?«
»Sam der Teufel wusste es.«
»Wie groß?«, fragte Queen.
»Mehr weiß ich nicht, das sagte ich schon. Aber Sam ist allen anderen Käufern voraus, und wenn die Herde hier eintrifft, wird sie ihm vielleicht schon gehören. Die Sache ist die, Jim, dass die Stadt von Viehtreibern wimmeln wird. Vielleicht schon heute Abend. Wie dem auch sei, jedenfalls noch bevor Sie dem Jungen den Prozess gemacht haben.«
»Das fehlt mir gerade noch!« Eine Faust fiel schwer auf den Schreibtisch. »Ja, das fehlt mir gerade noch!«
»Ich denke, Sie können ihn genauso gut laufen lassen.«
»Nein«, sagte Queen starrköpfig.
»Nun ja, er hat Bill eine Chance gegeben. Wenn seine Schwester niedergeschossen worden ist, dann hätte er das nicht einmal nötig gehabt.« Der Arzt dämpfte seine Stimme und fragte zögernd: »Wenn Sie nun Bill Clemmens wegen Mordes an einem Mädchen eingesperrt hätten und die Stadt voller Cowboys wäre, die seit Monaten keine Frau mehr gesehen haben?«
Der Laut, den David hörte, konnte ein Seufzer von Marshal Queen sein.
»Sagen Sie den Texanern, dass die Ehre einer Frau auf dem Spiel steht, Jim... Mehr brauchen Sie wirklich nicht zu tun.«
Diesmal seufzte Queen mit Sicherheit, denn er sagte: »Ich weiß, ich weiß.«
Die Unterhaltung verstummte. Schritte kamen näher. Die Zellentür wurde geöffnet.
»Kommen Sie ins Office«, grunzte Marshal Queen. Und als David an ihm vorbeiging: »Ich nehme an, dass Sie jedes verdammte Wort gehört haben.«
Der Arzt nahm seinen Zeichenblock auf und ging zur Tür. Er war jetzt voller nervöser Energie. »Ich trommele die Zeugen zusammen. Wollen Sie Richter Mason Bescheid sagen? Sieht aus, als wäre es Notwehr gewesen. Die übliche Fünfundzwanzigdollarstrafe.« Er wartete auf das bestätigende Kopfnicken des Marshals und ging hinaus.
David und der Marshal waren wieder allein.
Der Widerwille in Queens Augen war echt und unverkennbar. Es war jetzt seine persönliche Angelegenheit. David begriff die Haltung des Marshals nicht ganz - der Ruf, den Queen bei den ungezügelteren Elementen der Stadt genoss, schien in diesem Augenblick ohne Bedeutung zu sein. David konnte das Problem des Marshals nur annähernd ergründen.
Die Unterhaltung war beendet. Queen nahm einen gewaltigen Schlüssel von einem Nagel in der Wand und machte eine Kopfbewegung. David verstand, ging ihm voraus und die Treppe zum Gefängnis hinunter.
Merkwürdigerweise war David vollkommen ruhig. Es sah so aus, als würde er bald wieder frei sein. Schon dachte er über den Komplicen von Skinner Bill nach...
Ungefähr zur gleichen Zeit, als Marshal Queen den Gefangenen einschloss, trat sein Stellvertreter auf die Veranda eines kleinen Fachwerkhauses.
Storey James klopfte, nahm seinen Hut ab und wartete. Eine junge Frau öffnete die Tür und machte aus ihrer Verwunderung keinen Hehl.
»Guten Tag, Mrs. Clemmens.«
Sie erwiderte seinen Gruß und trat zögernd zur Seite. »Kommen Sie herein, Mr. James.«
Storey trat ein und zog die Tür hinter sich zu. Mrs. Clemmens rollte die Ärmel ihres Kleides herunter. Er sah ihre glänzenden Hände und wusste, dass sie Butter geknetet hatte. Anna Clemmens blickte forschend zu ihm auf. Sie war knapp neunzehn Jahre alt, wirkte aber ein paar Jahre älter. Sie hatte ein jung und glatt aussehendes Gesicht, aber in ihren Augen spiegelte sich das reife Wissen einer Frau.
Storey kam ohne Umschweife auf den Grund seines Besuches zu sprechen. »Ich bin gekommen, um es Ihnen persönlich zu sagen. Vorhin gab es eine Schießerei, und Bill kam bei dieser Gelegenheit ums Leben.«
»Bill...?« Ihre Lippen öffneten sich, das ganze Gesicht nahm einen fassungslosen Ausdruck an. Dann kehrte sie ihm plötzlich den Rücken zu, und es dauerte eine Minute, bis sie endlich sagte: »Hat er gespielt? Ist es deshalb geschehen?«
»Er hat gespielt, aber - nun ja, er hat gespielt.«
Sie sah ihn wieder an, und ihre Augen waren noch immer trocken.
»Warum sind Sie gekommen?«
»Ich hielt es für einfacher«, sagte Storey. »Auf diese Weise brauchen Sie nicht zu weinen.«
Ihre Gestalt straffte sich.
»Warum sagen Sie so etwas?«
»Ich weiß es schon seit drei Jahren. Sie haben sich nicht die Bohne um ihn gekümmert.«
»Und Sie?«
»Ich war ja nicht mit ihm verheiratet.«
»Sie haben recht.« Sie machte ein paar Schritte und rieb mit der Handfläche ihre weichen Wangen. Dann sank sie auf das harte schwarze Sofa mit dem Kunstlederbezug. »Er ist tot - einfach tot. Und ich kann nichts empfinden. Es tut mir leid, sehr leid, aber es lässt mich einfach kalt.«
Storey überließ sie ihren eigenen Gedanken und wartete. Nach einer Minute fiel ihm auf, dass er ihr braunes Haar betrachtete. Sie hatte es auf dem Kopf zusammen gerafft, aber es musste mächtig lang sein, wenn sie es gekämmt hatte. Sie hatte auch eine hübsche Figur. Ihr Gesicht war ein wenig schmal, doch in einer Gegend wie hier waren die Frauen rar, und so konnte man Anna Clemmens schon als auffallende Schönheit bezeichnen.
»Als ich ihn heiratete, war ich sechzehn«, sagte sie. »Das war in St. Louis. Sie haben uns dort zweimal besucht - erinnern Sie sich noch?«
Storey nickte.
»Sechzehn«, wiederholte sie. »Der romantische Mann aus dem Wilden Westen, dachte ich, ein Mann von der Sorte, wie er in Harper’s Weekly geschildert wird. So ein Mann.« Sie blickte zögernd zu Storey auf. »Ich war noch keine zwei Wochen mit ihm verheiratet, da wusste ich, was für ein Mann er wirklich war. Gemein, betrunken, die billigen Manieren eines Spielers, der in seinem ganzen Leben noch nie etwas Gutes getan hatte. Sie haben ihn länger gekannt als ich. Wissen Sie, ob er jemals etwas Gutes getan hat?«
»Zweimal«, sagte Storey bewusst schroff. »Einmal hat er den ganzen Tag an meiner Seite ausgehalten, während ich in einer Büffelsuhle lag und eine Indianerkugel im Bein hatte. Er hätte verschwinden können, tat es aber nicht. An jenem Tag war er auch nicht freundlich, aber ich hatte einen guten Eindruck von ihm.«
Anna Clemmens nickte nur. »Ich könnte Ihnen nun sagen, dass ich nichts davon wusste, dass er nie davon gesprochen hat. Doch er sprach davon. Sehr oft sogar. Sie hatten uns schon lange nicht mehr besucht. Er regte sich darüber auf, erzählte immer wieder diese Geschichte und hob hervor, was Sie ihm verdankten. Er machte alles größer als es war. Er wollte an jenem Tag sogar vier Comanchen getötet haben.«
»Das stimmt.«
Zum ersten Mal machte Anna einen wirklich erschütterten Eindruck. »Oh...!« Sie biss auf ihre Unterlippe. »Und was war das andere?«
»Er hat niemandem etwas von seiner Frau erzählt.«
Storey bereute sofort, dass er das gesagt hatte. Sie weinte noch immer nicht, fühlte sich aber verletzt. Warum musste er das sagen? Weil er sich selbst schuldig fühlte? Weil er nichts unternommen hatte, um Bill Clemmens das Leben zu retten? Jetzt versuchte er, Bills schlechten Ruf ein wenig zu mildern, jemanden zu veranlassen, seinetwegen ein paar Tränen zu vergießen. Er hatte keinen Grund, diese Frau oder irgendeinen anderen Menschen zu verletzen.
»Mrs. Clemmens - Anna -, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Ich habe auch meine Fehler. Bill war für Sie kein Mann zum Heiraten, und ich weiß es genau.«
»Ich glaube, ich verstehe Sie. Er war - früher einmal - Ihr Freund.«
»So ist es.« Storey blickte zur Tür und war bereit, sich zu verabschieden. Doch er hatte noch nicht das ausgesprochen, was ihn hauptsächlich zu Mrs. Clemmens geführt hatte.
»Was werden Sie jetzt tun? Nach St. Louis zurückkehren?«
Sie zuckte die Achseln.
»Vermutlich ja. Was soll ich noch hier?«
»Es gibt noch eine Menge guter Männer in dieser Gegend«, sagte Storey, »und nicht sehr viele Frauen.«
Anna stand auf und strich mit einer Hand über ihr Kleid. »Sie sagen einfach, was Sie denken, nicht wahr?«, fragte sie. »Mit einer Frau, die eben erst Witwe geworden ist, sollte man doch anders sprechen.«
»Vielleicht bin ich nicht sehr feinfühlend.«
»Oh, doch, Storey.« Die leichte Veränderung in ihrer Stimme veranlasste ihn, sie sich näher anzusehen. »Sie - Sie sind aufrichtig. Ich habe Sie in der Stadt schon oft beobachtet, und Sie... Für eine
Frau ist es nicht immer leicht, so aufrichtig zu sein. Und nicht nur das...«
Storey wartete benommen. Sie zitterte, er konnte es deutlich feststellen.
»Sie gehören zu den Männern, die niemals über das sprechen, was ihnen eine Frau im Vertrauen erzählt hat. Aber es ist schwer, wenn man...« Ihre plötzlich heisere Stimme sprach den Satz nicht zu Ende. »Sie wissen nicht, was Einsamkeit bedeutet. Dieses Gefühl lässt sich nicht so leicht verbannen...«
»Anna.« Er streckte instinktiv seine Hand aus und legte sie auf ihre Schulter. Sie senkte ihren Kopf und presste ihre Wange auf seinen Handrücken. Sie schluchzte nicht, aber er spürte ihre Tränen auf seiner Hand, spürte auch ein merkwürdiges Zusammenziehen seiner Kehle. Auch er war einsam gewesen und hatte sich nach einer begehrenswerten Frau gesehnt. Doch sein Instinkt verdrängte seinen Sinn für Aufrichtigkeit. Er zog seine Hand zurück. »Tut mir leid, Anna.«
Sie strich mit den Fingern über ihre Augen. Storey stand verlegen da und drehte den Hut in seinen großen Händen. Er wusste nicht, was all diese Gefühle ausgelöst hatte.
»Mir tut es auch leid«, murmelte sie heiser. »Nun werde ich nie mehr eine Gelegenheit haben, es auszusprechen.«
Er war zu verwirrt, um ihre Worte zu begreifen. »Was wollten Sie aussprechen, Anna? Wenn Sie noch etwas über Bill sagen wollen...«
Sie schüttelte den Kopf und sagte nur: »Es war sehr freundlich von Ihnen, mich aufzusuchen, Mr. James.«
Storey nahm diese Abschiedsworte dankbar zur Kenntnis, öffnete die Tür und sagte: »Ich werde dafür sorgen, dass alles erledigt wird.«
Sie drehte sich nach ihm um und ihre Augen suchten die seinen. »Ich sehe, dass Sie und Bill wirklich gute Freunde gewesen sind«, sagte sie. »Ich wollte, Sie wären in der Nähe gewesen und hätten diese Schießerei verhindert...«
Storey ging wortlos hinaus und schloss die Tür. Düsteren Gemüts kehrte er ins Büro des Marshals zurück.
Viertes Kapitel
Während Storey zusah, fischte Marshal Jim Queen eine leicht verbogene Zigarre aus seiner Westentasche, richtete sie leidlich gerade und blickte dabei seinen eben eingetroffenen Stellvertreter an, der ihm am Schreibtisch gegenübersaß.
»Wir erwarten Ärger, Storey, direkten Ärger - und Sie tragen nicht einmal Ihren Revolver.«
Storey bewegte seine Schultern und entgegnete: »Ich habe heute Morgen schon genug Leute erschossen, Marshal, und ich werde den ganzen Nachmittag brauchen, um ihnen das Fell abzuziehen.«
»Na, wenn das kein Witz ist«, brummte Queen. »Vielleicht haben Sie noch nicht gehört, was passiert ist.«
»Ich habe es gehört.«
»Aber Sie haben ziemlich lange gebraucht, um hier zu erscheinen.« Queens Augenbrauen zogen sich nachdenklich zusammen. Nach einer Minute sagte er, was er dachte. »Als wir damals alle auf der Büffeljagd waren, da waren Sie doch mit Clemmens ziemlich dick befreundet, nicht wahr?«
»Während einer Saison hat er die Büffel für mich enthäutet.«
Der Marshal schürzte seine Lippen, schob die Zigarre dazwischen und rollte sie behutsam herum, um das Mundstück anzufeuchten.
»Das war doch irgendwie merkwürdig. Sie und ich waren auf der Jagd, und er zog den Büffeln das Fell ab. Dabei konnte er besser schießen als wir beide zusammen.«
»Mit Pistolen vielleicht, aber nicht mit einem schweren .50er.«
Queen reckte seinen Arm über den Schreibtisch hinweg und stieß mit dem feuchten Mundstück der Zigarre zweimal gegen Storeys weißes Hemd. Sie machte zwei Flecken, bevor Storey die Hand zur Seite geschoben hatte.
»Sehen Sie, das will ich damit sagen. Bei einer Saloon-Schießerei zählen nur Pistolen. Und im Gefängnis haben wir einen Jungen sitzen, der schneller ist, als es Clemmens war.« Der Marshal schob die Zigarre wieder in den Mund. »Und ich habe das Gefühl«, fuhr er fort, »dass es einer von uns mit ihm aufnehmen muss.«
Storeys düsterer Blick schien Queen zu befriedigen.
»Es ist nur so ein Gefühl«, sprach er weiter. »Ein merkwürdiger Junge... Hat nicht die leiseste Erfahrung, muss aber von Natur aus eine verdammt rasche Hand haben - und jemand muss ihm beigebracht haben, sie zu benutzen. Er ist ruhig. Nach allem, was ich gehört habe, ist er auf Clemmens zugegangen wie ein Prediger, der Kollekte sammelt.«
Storey wunderte sich. In der letzten Zeit hatte er eine Veränderung an seinem Vorgesetzten festgestellt. Auch alte Füchse konnten ihre Nerven verlieren, doch bei Jim Queen hielt er so etwas einfach nicht für möglich.
»Sie machen sich doch sonst nicht so viele Gedanken wegen eines Mannes, Jim.«
»Kann schon sein. Aber dieser Mann hat etwas zu erzählen - und er kommt mit dieser Geschichte an einem sehr schlechten Tag daher. Vielleicht werde ich alt und ängstlich, aber ich möchte, dass Sie Ihren Revolvergürtel umschnallen und ihn ein paar Tage lang nicht abnehmen.«
Storey ging zu der mit Eisen beschlagenen Holztruhe in der Ecke. Er war froh, Jim Queen für einen Moment den Rücken zeigen zu können. Er fragte sich, wieviel der Junge wirklich wusste. Was hatte er dem Marshall schon erzählt? Irgendwie stimmte seine Reaktion nicht. Jim wollte, dass er sich bewaffne und auf sich achte, doch das musste noch einen anderen Grund haben, über den Jim kein Wort verlor. Storey fuhr mit der Handfläche über sein Kinn. Trotz des kühlen Wetters war sein Gesicht feucht.
Er öffnete die Truhe und nahm den Revolver heraus, den er im Office aufzubewahren pflegte: einen .44er mit Ebenholzknauf in einem gelben Lederhalfter.
Als Storey den Gürtel umschnallte, betrachtete Queen die Waffe. Alle betrachteten sie. Das lag an der Farbkombination von schwarz und gelb. Storey trug selten diese Aufmachung, doch nie, ohne sich darüber zu wundern, wie sehr sein Leben sich gewandelt hatte.
Er hatte den Revolver vor einer Zeit gekauft, die ihm wie eine Ewigkeit vorkam. Wenn er in jenen Tagen zur Stadt ritt, dann dachte er an Whisky, Pokertische und Frauen. Es war immer ein schönes Gefühl, sich als Büffeljäger zu zeigen und großspurige Reden zu schwingen. In jenen Tagen trug ein Präriebewohner das Haar lang und hatte ins Auge fallende Waffen.
Doch jetzt war dieses bunte Leben verblasst, und die grellen Farben von Revolver und Halfter wirkten übertrieben. Er war ein Vertreter des Gesetzes geworden, das waren auch Jim Queen und eine Reihe anderer Büffeljäger, die er kannte - in Dodge, Newton, Ellsworth...
Kaum zu glauben, dass dieser Revolver noch keine fünf Jahre alt war.
Der Marshal warf seinen Zigarrenstummel in den Spucknapf und griff nach seinem Derbyhut. »Ich werde den Doktor und den Richter heranholen. Kümmern Sie sich mal um das Pferd des Jungen drüben in Henrys Mietstall. Ich möchte, dass der Gaul noch vor Anbruch der Dunkelheit marschbereit ist.«
»Warum die Eile?«
»Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber der Junge muss noch heute von hier verschwinden.«
Storey blieb stehen, wo er stand und hörte die Treppenstufen knarren, als der Marshal nach unten ging. Dann drehte er sich bedächtig eine Zigarette.
Vielleicht erledigte sich alles von allein. David Haviland kam wieder frei - möglich, dass er von seiner Schwester gesprochen hatte. Der stellvertretende Marshal hatte keinen Grund, bei dem Verhör zugegen zu sein. Storey konnte sich um das Pferd des Jungen kümmern und dann zu der Hütte hinausreiten, die er sich auf seinem Weideland gebaut hatte. Kam er abends oder am nächsten Morgen wieder in die Stadt, dann würde der Junge weggeritten sein.
Doch während Storey noch überlegte, wusste er schon, dass er heute in der Stadt bleiben würde. Sicher brauchte ihn der Marshal. Etwas anderes als der Junge machte Jim Queen Sorgen.
Abgesehen davon würde wohl auch David Haviland in der Stadt bleiben und sich nach dem zweiten Mann Umsehen. Storey war von dieser unglückseligen Tatsache fest überzeugt.
Der farbige Waisenjunge, der in Henrys Mietstall wohnte und arbeitete, zeigte Storey das Pferd. Das Tier hatte einen langen Weg hinter sich, war aber sorgfältig gepflegt worden und noch immer gut bei Kräften. Abel, der Negerjunge, hatte von der Schießerei gehört und wollte mehr darüber erfahren. Dann sprudelte er hervor: »Ich wusste doch, dass er was vorhatte. Er gab mir nur Namenlos und sagte: Kümmere dich um ihn. Fünf Minuten später hörte ich es knallen.«
»Nannte er sein Pferd so - Namenlos?«
»Nein, ich nenne es so. Er hat ihm anscheinend keinen Namen gegeben. Ich fragte: Wie heißt Ihr Pferd?, und er sagte: Mein Vater gibt Tieren keine Vornamen. Haben Sie so etwas schon mal gehört?« Der Junge deutete mit einem dünnen Arm auf die Box, in der ein großer Brauner stand. »Diese Stute heißt Whisky und hat auch keinen Vornamen.«
Storey lächelte über das Geplapper eines zwölfjährigen Jungen.
»Ich denke, sein Vater hat etwas merkwürdige Vorstellungen, Abel. Füttere das Pferd schon früher ab; der Marshal will, dass es noch vor Anbruch der Dunkelheit unterwegs ist.«
Abel machte große Augen.
»Dann wird er nicht aufgehängt?«
Storey überhörte diese Frage und ging den Gang entlang auf eines seiner eigenen Pferde zu. Tausende von Hufen hatten den Futterhafer in den gestampften Lehm gedrückt und eine elastische Unterlage geschaffen. Er blieb bei dem kalifornischen Pony stehen, das er sich vor zwei Monaten für fünfzig Dollar gekauft hatte in der Hoffnung, dass es sich zu einem guten Renner entwickeln würde. Abel folgte ihm besorgt.
»Das wird Gerede geben, Mr. James. Die Männer saßen den ganzen Winter hier um den Ofen herum und sprachen darüber, dass Sie und Mr. Queen die Peitsche schwingen. Ich hörte, wenn jemand einen Schuss abfeuert oder eine Schlägerei anfängt, sollen Sie ihn gleich einsperren. Und wenn die Leute aus Texas wiederkommen, dann...«
»...wird ihnen dasselbe blühen«, sprach Storey den Satz zu Ende. »Das heißt, wenn wir sie noch einmal sehen.«
Er bückte sich neben dem Pferd und betrachtete eines seiner Fesselgelenke. Ein Pferdeschweif schlug gegen die Wandverschalung, und der Präriewind pfiff durch die Ritzen und Astlöcher.
Abel fragte ernst: »Glauben Sie, dass es in dieser Stadt keinen Aufruhr mehr geben wird, Mr. James?«
»Ich glaube, die Stadt ruht sich nur aus«, antwortete Storey. »Früher war sie einmal - vor deiner Zeit, meine ich - nur so was ähnliches wie eine Abdeckerei. Als die Eisenbahn kam, wurde eine Sammelstelle für Häute aus ihr. Während der letzten drei Jahre - im vergangenen Jahr vielleicht nicht so sehr - war sie eine Verladestation für Texasrinder. Ich denke, jetzt gewöhnt sie sich daran, dass sie nur eine Stadt ist und nichts weiter.«
»Seit vergangenem Sommer sind eine Menge Leute von hier weggezogen.«
»Ja, das stimmt. Die meisten Leute zogen nach Dodge, Abel, aber die Geschäftsleute und Ladenbesitzer sind noch da. Das ist ein gutes Zeichen für eine Stadt.« Storey richtete sich auf und tätschelte die Hinterbacke des Pferdes. »In dieser Gegend wird’s noch viel Arbeit geben.«
»Nicht für einen Negerjungen.«
Storey zog einen Silberdollar aus der Tasche und sagte: »Kümmere dich weiter so gut um dieses Rassepferd, Abel. Eines Tages werde ich mehrere davon haben und dich zum Aufseher ernennen.«
Der Junge grinste breit. »Ich werde den Dollar behalten und auf Ihr Pferd setzen, sobald es zum ersten Mal läuft.«