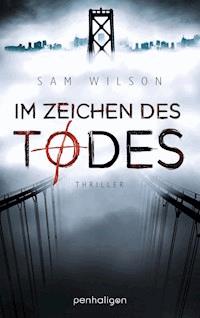
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mit jedem Opfer wird seine Fährte blutiger ...
Es ist ein gnadenloses System, in dem die Geburtsstunde darüber entscheidet, ob man ein Leben in Reichtum oder Armut und Elend führt. Niemand schafft es aus eigener Kraft. Die Sterne sind Gesetz. Und sie bringen den Tod … Als eine Mordserie von unvergleichlicher Brutalität die Stadt erschüttert, ruhen alle Augen auf Detective Jerome Burton und Profilerin Lindi. Der eine glaubt an seinen Jagdinstinkt, die andere an die Macht der Sterne – und beide wissen, dass sie es mit dem gefährlichsten Verbrecher zu tun haben, den die Stadt je gesehen hat. Doch sein Plan ist so finster, dass er alles Vorstellbare übersteigt …
- Feuer, Wasser, Erde, Luft – welcher Tod ist dir vorherbestimmt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch:
Es ist ein gnadenloses System, in dem die Geburtsstunde darüber entscheidet, ob man ein Leben in Reichtum oder Armut und Elend führt. Niemand schafft es aus eigener Kraft. Die Sterne sind Gesetz. Und sie bringen den Tod … Als eine Mordserie von unvergleichlicher Brutalität die Stadt erschüttert, ruhen alle Augen auf Detective Jerome Burton und Profilerin Lindi. Der eine glaubt an seinen Jagdinstinkt, die andere an die Macht der Sterne – und beide wissen, dass sie es mit dem gefährlichsten Verbrecher zu tun haben, den die Stadt je gesehen hat. Doch sein Plan ist so finster, dass er alles Vorstellbare übersteigt …
Autor:
Sam Wilson wurde in London geboren und zog noch als Kind in seine neue Heimat Zimbabwe. Seinen Studiengang, Kreatives Schreiben, schloss er mit Auszeichnung ab. 2011 wurde er unter den Top 200 der vielversprechendsten Südafrikaner gelistet. Heute arbeitet er als Regisseur in Kapstadt. Im Zeichen des Todes ist sein Debüt.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
SAM WILSON
IM ZEICHEN DES TODES
Thriller
Deutsch von Andreas Helweg
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Zodiac« bei Penguin Books LTD, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage
Copyright der Originalausgabe © 2016 by Sam Wilson
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2016 by Penhaligon in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Sigrun Zühlke
Umschlaggestaltung: © www.buerosued.de
Umschlagmotiv: © Getty Images/David Madison; Getty Images/Sandra Herber; www.buerosued.de
KW · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-19511-3V002
www.penhaligon.de
Für Tony, Diana und Kerry
Willkommen in San Celeste …
22. Dezember – 19. Januar
♑
Steinbock Erde
Sie mögen die kleinste Gruppe der Stadt sein, doch die Wahren Steinböcke sind ihre hellsten Sterne und kontrollieren den Großteil des Geldes und der Institutionen. »Neo-Böcke« – Kinder, deren Eltern anderen Tierkreiszeichen angehören – werden mit Fug und Recht von den Wahren Steinböcken verachtet.
20. Januar – 18. Februar
♒
Wassermann Luft
Liberale Hipstertypen: Kreative, Designer, Architekten, Freiberufler mit Laptop-Tasche und Schallplattensammlung. Obwohl sie nützliche Mitglieder der Gesellschaft sind, halten sie gern Abstand zum Mainstream.
19. Februar – 20. März
♓
Fische Wasser
Hippies und gelegentlich produktive »Freigeister«. Viele sind Künstler, Süchtige oder selbsternannte Hellseher. Sie gelten nicht als gute Angestellte, verfügen aber über gut funktionierende Familiennetzwerke.
21. März – 19. April
♈
Widder Feuer
Die Unterschicht der Stadt: gewalttätig, unkontrollierbar und als Arbeitskräfte unbrauchbar. Sie leben vor allem in dem großen, gefährlichen Slum namens Ariesville (nach dem lateinischen Wort für Widder: Aries).
20. April – 20. Mai
♉
Stier Erde
Loyal, verlässlich und bodenständig – sie halten die Stadt in Gang. Eine große Zahl arbeitet in öffentlichen Institutionen und bei der Polizei.
21. Mai – 20. Juni
♊
Zwillinge Luft
Die Yuppies von San Celeste: Sie sprechen schnell und leben ebenso schnell. Mit ihrer Redegewandtheit und ihrer moralischen Flexibilität verdienen diese typischen Großstädter das große Geld in Werbung und Handel.
… wo die Sterne immer funkeln.
21. Juni – 22. Juli
♋
Krebs Wasser
Die größte Gruppe der Gesellschaft. Sensible Menschen, die den Status quo aufrechterhalten und in vielen verschiedenen Managementpositionen zu finden sind, da man sie für von Natur aus vertrauenswürdig hält.
23. Juli – 22. August
♌
Löwe Feuer
Hört sie brüllen! Eine kleine, aber lautstarke Gruppe, die sich stark den Krebsen verbunden fühlt. Ebenfalls konservativ. Sie übernehmen gern die Rolle von Entertainern, Politikern und Experten.
23. August – 22. September
♍
Jungfrau Erde
Häufig introvertiert und zwanghaft. Typische Berufe sind Ingenieur und Systemadministrator. Sie pflegen eine breitgefächerte Science-Fiction- und Fantasy-Kultur.
23.September – 22. Oktober
♎
Waage Luft
Bekannt als »Menschen für Menschen«. Sie arbeiten überwiegend im Dienstleistungssektor. Jede Stelle, bei der ein Lächeln wichtiger ist als aggressive Verkaufstechniken, wird mit einer Waage besetzt.
23. Oktober – 21. November
♏
Skorpion Luft
Könnten Skorpione die neue Elite werden? Gerissener und hungriger als die Steinböcke und bekannt für ihr Streben nach Kontrolle, häufen sie schnell Status und Macht an.
22. November – 21. Dezember
♐
Schütze Feuer
Gemeinsam mit Wassermann bilden sie die zum linken Spektrum neigende Mittelschicht. Sie sind überwiegend im Bildungs- oder Wohlfahrtsbereich tätig und behaupten, ein Herz aus Gold zu haben.
Wahre Zeichen – wahre Harmonie ®
1
Rachel würde an ihrem ersten Arbeitstag zu spät kommen, aber dafür konnte sie nichts. Der Waschsalon an der Gull Street öffnete erst um acht Uhr morgens, und der Manager von JiffyMaids bestand auf einer tadellosen Erscheinung, auch wenn jede Putzfrau nur eine Garnitur Arbeitskleidung gestellt bekam. Gestern hatte sie bis spät in die Nacht auf dem vierzigsten Geburtstag eines Schützen in West Skye gearbeitet, wo sie ein betrunkener Gast angebaggert und ihr versehentlich Guacamole auf die saubere weiße Schürze geschmiert hatte.
»Gut, dass Sie die anhaben«, hatte der Mann gesagt, um seine Verlegenheit zu überspielen. Er wusste nicht, dass sie sich am nächsten Tag auf keinen Fall mit einem Fleck auf der Schürze bei einem neuen Kunden blicken lassen konnte. Nachdem sie vier Stunden unruhig geschlafen hatte, war sie kurz vor Öffnung des Waschsalons aufgewacht und dorthin geeilt, um ihre Uniform in die Schnellwäsche zu stecken. Sie hatte vor der Maschine gesessen und beobachtet, wie sich die Trommel drehte. Die Zeiger rückten beständig auf neun Uhr vor, auf den Zeitpunkt, zu dem sie bei dem neuen Kunden erscheinen sollte.
Sie wartete so lange wie möglich, dann unterbrach sie den Trockenvorgang und zog sich in der Toilette die Uniform an. Wie nass die Kleidung noch war, bemerkte sie erst, als sich die verbliebene Hitze verflüchtigt hatte. Das karierte blaue Kleid klebte ihr kalt und feucht an den Beinen. Sie steckte ihre anderen Sachen in eine Plastiktüte und stieg in den Bus nach Conway Heights, einem nördlichen Bezirk von San Celeste. Während der Fahrt kontrollierte sie ständig die Uhrzeit auf ihrem Telefon. Kurz vor neun – sie war noch immer nicht angekommen – wurde ihr endgültig flau im Magen. Sie wollte niemanden verärgern. Schließlich war sie eine Waage.
Conway Heights war ein nobler Stadtteil im Norden der Stadt. Abwesend starrte Rachel aus dem Fenster auf Bäume, Tennisplätze und Villen im toskanischen Stil. Alles sah so hell und sauber aus, und sie fühlte sich wie ein Eindringling.
An der Morin Road stieg sie aus. Die Plastiktüte mit der trockenen Kleidung schlug gegen ihr Bein, während sie drei Blocks hügelaufwärts zum Eden Drive hetzte. Die Häuser hatten ordentliche Vorgärten mit gepflegten Blumenbeeten.
Das breite, eingeschossige Haus ihres Kunden war beige gestrichen und das Dach flach. Als sie mit fieberhaften Schritten über den mit Ziegelsteinen gepflasterten Weg zum Eingang ging, legte sie sich eine Entschuldigung zurecht. Ihr Finger lag schon auf der Klingel, doch dann sah sie, dass die Tür einen Spalt offen stand.
Sie drückte sie ein wenig weiter auf.
»Hallo?«, rief sie. »JiffyMaids!«
Keine Antwort.
Auf halber Höhe stand ein Holzspan vom Rahmen ab. Rachel berührte ihn zaghaft. Der Span war so lang wie ihr Finger und ragte aus einer Bruchstelle. Allem Anschein nach war die Tür eingetreten worden.
»Hallo?«, rief sie noch einmal und drückte auf die Klingel. Irgendwo im Haus ertönte ein Summen, doch sie bekam keine Antwort.
Rachel zitterte in ihrem feuchten Kleid. Sie machte einen Schritt zurück in die Sonne und blickte die Straße rauf und runter. Nichts. Nur der Verkehr und ein paar bellende Hunde.
Mit zusammengepressten Lippen holte sie ihr rosarotes Handy aus der Plastiktüte.
Der Anruf wurde nach dem zweiten Klingeln entgegengenommen.
»Polizeinotruf. Was möchten Sie melden?«
»Hallo?«, sagte Rachel unsicher. »Ich stehe vor … äh … 36 Eden Drive in Conway Heights. Ich bin gerade erst angekommen. Die Tür ist eingetreten, und niemand reagiert auf mein Rufen.«
Sie hörte das leise Klicken einer Tastatur, dann meldete sich die Telefonistin wieder.
»Gut, ich schicke Ihnen einen Streifenwagen. Wie heißen Sie, bitte?«
Die Frau klang freundlich und gelassen. Ihr Waage-Trällern hatte etwas Beruhigendes.
»Rachel Wells.«
»Wohnen Sie dort?«
»Nein«, erklärte Rachel. »Ich arbeite für JiffyMaids. Ich soll hier putzen.«
»Okay, Rachel. Es dauert ungefähr acht Minuten, bis die Kollegen eintreffen. Bis dahin muss ich Ihnen noch ein paar Frage stellen, in Ordnung, meine Liebe?«
Meine Liebe. Definitiv eine Waage.
»Natürlich, klar«, erwiderte sie.
»Okay. Beschreiben Sie mir bitte, wie Sie aussehen, damit die Kollegen Sie erkennen können.«
»Ich bin ungefähr eins achtundsiebzig groß, habe blondes Haar und trage ein blaukariertes Kleid mit einer weißen Schürze. Reicht das?«
Sie wartete, bekam aber keine Antwort.
»Hallo?«, fragte sie.
Einen Moment lang dachte sie, die Verbindung sei abgebrochen, aber da war diese Stimme … Sie nahm das Handy vom Ohr. Ja, tatsächlich. Irgendwo in der Nähe sprach ein Mann.
Links vom Haus befand sich eine von blühenden Kletterpflanzen überwucherte Gartenmauer mit einem schmiedeeisernen Tor, dessen weiße Farbe abblätterte. Wieder diese Männerstimme. Tiefe Erleichterung durchflutete sie. Der Kunde saß im Garten, deshalb hatte er nicht auf ihr Rufen reagiert. Alles in bester Ordnung. Sie ging zum Tor und drückte den Riegel nach unten. Als es aufschwang, trat sie hindurch und vergewisserte sich, dass sich ihr Pferdeschwanz nicht gelockert hatte.
»Hallo?«, rief sie. »Mr. Williams?«
Sie folgte einem Weg an einem Blumenbeet vorbei und durch einen geflochtenen Bogen, der mit sterbenden Weinranken überzogen war. Man hatte das Haus an einem Hügel gebaut, der Rasen führte einen Hang hinab und gab den Blick auf die Stadt frei. Die Aussicht war beeindruckend und teuer. Sie konnte bis zum WSCR-Tower sehen.
Gleich hinter dem Haus befand sich ein leerer Swimmingpool. Im Boden daneben war ein Graben ausgehoben, und die Pflasterplatten hatte man an der hinteren Wand des Hauses gestapelt.
»Hallo? Rachel?« Die Stimme der Telefonistin. Rachel hob ihr Handy wieder ans Ohr.
»Entschuldigung, ich dachte, ich hätte etwas gehört.«
»Im Haus?«
»Nein, im Garten. Ich dachte, da wäre jemand, aber hier ist nichts zu sehen.«
»Rachel, hören Sie zu«, sagte die Telefonistin. »Gehen Sie bitte wieder vors Haus, damit die Kollegen wissen, dass sie richtig sind.« Ihre Stimme klang bestimmt, doch Rachel, die eine gute Menschenkenntnis hatte, hörte noch etwas anderes heraus. Angst vielleicht.
Sie warf einen letzten Blick in den Garten und drehte sich abrupt um, als sie ein Geräusch hörte. Es klang wie ein gequältes Röcheln, gerade eben hörbar. Sie erstarrte. Nach einigen Sekunden hörte sie es erneut, der Laut kam aus dem Graben am Pool.
»Da ist jemand«, rief sie panisch.
»Rachel«, erwiderte die Telefonistin scharf, »gehen Sie bitte sofort zurück zur Straße.«
Aber Rachel war bereits zum Graben geeilt.
»Oh Gott«, stammelte sie, »oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.«
»Rachel?«
Der Mann im Graben war ungefähr fünfzig Jahre alt. Er hatte kurzes weißes Haar, trug eine schwarze Hose und ein langärmeliges weißes Hemd, das hinten voller Erde und vorne voller Blut war. Er konnte sie gerade noch ansehen, ehe sich seine Augen verdrehten. Über seinem Mund pappte Klebeband, und aus einem Nasenloch rann Blut. Rachel ließ ihre Plastiktüte fallen.
»Ich brauche einen Krankenwagen!«, schrie sie. »Oh Gott, schnell, einen Krankenwagen!«
Die Telefonistin blieb die Ruhe selbst. »Gibt es einen Verletzten, Rachel?«
»Einen alten Mann. Sein Bauch ist aufgeschlitzt. Seine Eingeweide, oh Gott, ich kann seine Eingeweide sehen, ich dachte, das wäre ein Schlauch oder so was. Die liegen da in der Erde …«
Ein fauliger Geruch stieg ihr in die Nase. Sie würgte. Die Gedärme des Mannes waren durchlöchert. Sie trat einen Schritt zurück und holte tief Luft. Bislang hatte sie immer gedacht, durchaus in der Lage zu sein, mit einem Notfall klarzukommen. Schließlich wusste sie, was Vorrang hatte. Menschen zuerst. Sie inhalierte die frische Luft und trat wieder einen Schritt vor. Der Mann unter ihr krümmte sich und schien kaum Luft zu bekommen. Seine Hände und Beine waren mit Klebeband gefesselt.
»Hallo! Bleiben Sie bitte am Apparat, ja?«, sagte die Telefonistin jetzt.
»Ich bin noch da«, antwortete Rachel, die versuchte, sich zusammenzureißen. »Er ist gefesselt und geknebelt. Und da ist überall Blut.«
»Okay, sprechen Sie einfach weiter mit mir, ja? Ich helfe Ihnen da durch. Wir müssen die Blutung stoppen, bis die Sanitäter kommen.«
»Ich habe eine Tüte mit Kleidung dabei.«
»Ist die sauber?«
»Nein, aber die Schürze, die ich trage, habe ich gerade erst gewaschen …«
»Perfekt, die können wir nehmen. Am besten, Sie falten Sie zu einem langen Streifen. Ich sage Ihnen, wo Sie ihn anlegen müssen. Der Krankenwagen ist in Kürze da, aber Sie müssen die Blutung unbedingt stoppen.«
Rachel band ihre Schürze los und zog sich den Träger über den Kopf. Aus dem Augenwinkel nahm sie eine Bewegung wahr. Im Inneren des Hauses war es vollständig dunkel, aber es sah aus, als würde hinter dem cremefarbenen Vorhang an der Schiebetür jemand stehen. Sie erstarrte.
»Oh Gott.«
»Was ist los, Rachel?«
»Ich glaube, da ist jemand im Haus.«
Die Telefonistin schwieg. Man hörte nur das Knistern der Verbindung.
»Hallo?«, fragte Rachel.
In der Leitung knackte es, als hätte die Telefonistin mit jemandem gesprochen und sich erst jetzt wieder mit ihr verbunden.
»Rachel, Sie müssen zurück zur Straße.«
»Aber der Mann …«
»Sofort!«
Rachel hörte es im Haus poltern und blickte auf. Ein Mann in brauner Jacke zog eine Glasschiebetür auf. Er trug eine Baseballkappe und verbarg die untere Hälfte seines Gesichts hinter einem schwarzen Tuch. Rachel ließ ihre gefaltete Schürze fallen und rannte los.
»Er folgt mir!«, schrie sie ins Telefon. »Oh Gott …«
Das Gartentor war zugefallen. Sie zerrte daran, doch es bewegte sich nicht. Der Mann war nur wenige Schritte hinter ihr. Sie ließ das Handy fallen und riss mit beiden Händen daran. Endlich löste sich der Riegel, das Tor schwang auf. In letzter Sekunde rannte sie hindurch und schlug es hinter sich zu. Einen Augenblick lang standen sie sich direkt gegenüber. Seine Augen waren hellblau. Sie drehte sich auf dem Absatz um und rannte. Fast im gleichen Augenblick hörte sie das Quietschen des Riegels und wie das Gartentor hinter ihr wieder aufschwang.
Ein schwarzer Wagen kam die Straße herunter. Mit erhobenen Händen jagte sie darauf zu. Das Auto wurde langsamer, bremste und blieb stehen. Am Steuer saß ein Mann mittleren Alters in einem eleganten Jackett.
»Helfen Sie mir!«, rief sie. »Bitte, lassen Sie mich rein!«
Hinter ihr die Schritte ihres Verfolgers. Der Fahrer musterte sie kurz, sah die herbeieilende Gestalt und drückte auf einen Knopf in der Tür. Die Zentralverriegelung sprang mit einem Klicken auf.
Rachel warf sich auf die Rückbank. Der Mann hatte sie erreicht, packte den Türgriff und hielt ihn fest. Ausgestreckt auf dem Sitz liegend, trat Rachel mit dem Fuß nach seiner Hand.
»Nun fahren Sie schon!«, schrie sie. »Fahren Sie los!«
»Schsch!«, machte der Fahrer. Sie blickte auf und starrte in den silbernen Lauf seiner Waffe.
»Keinen Laut, verstanden?«, sagte er.
Rachel erstarrte. Der Mann mit dem Tuch vorm Gesicht schob ihre Beine vom Sitz, rutschte neben ihr in den Wagen und zog die Tür hinter sich zu.
»Hast du das Band?«, fragte der Fahrer, während er die Waffe noch auf Rachel gerichtet hielt.
»Ja«, erwiderte er.
»Dann fessele ihr die Hände.«
In der Ferne heulten näherkommende Sirenen. Rachel schöpfte Hoffnung.
»Mist«, sagte der Fahrer. »Halt mal.«
Er reichte dem Mann mit dem Tuch seine Waffe. Rachel trat erneut zu, doch ihr Gegner war zu flink und drückte ihr die Mündung an den Kopf.
»Na na«, sagte er.
Rachel erstarrte erneut.
Als der Wagen losfuhr, hielt der Mann die Waffe unablässig auf sie gerichtet. Mit der anderen Hand griff er in seine Jacke und holte ein metallisch glänzendes Klebeband heraus. Er zog sich den Schal bis knapp über den Mund herunter und riss mit den Zähnen zwei Stücke ab.
»Handgelenke zusammen«, sagte er.
Rachel rührte sich nicht. Der Mann mit dem Schal ließ das Klebeband fallen, beugte sich blitzschnell vor und schlug zu. Vor Schreck traten ihr Tränen in die Augen.
Ich muss hier raus.
Sie legte die Handgelenke aneinander und hielt ihm die Arme hin. Der Mann packte fest zu und legte die Waffe in seinen Schoß, um sie mit dem Klebeband zu fesseln.
Draußen wurden die Sirenen lauter, und der Ton wurde tiefer, als der Rettungswagen an ihnen vorbeijagte. Rachel sah ihm nach, doch der Fahrer machte keine Anstalten, das Tempo zu drosseln. Sie hatten Rachel nicht gesehen, und die Notruftelefonistin sprach vermutlich immer noch mit dem Handy, das sie fallen gelassen hatte.
Rachel war auf sich allein gestellt.
2
Das Gesicht von Polizeichef Peter Williams war schmaler, als Burton es in Erinnerung hatte, und von seinen Augen gingen strahlenartige, feine Fältchen aus. Sie waren ihm nie aufgefallen, wenn Williams vor einem Raum voller Cops am Pult gestanden hatte. Über seinem Mund klebte ein langer Streifen Silbertape, der über die Wangen bis zu den feinen Härchen in seinem Nacken reichte. Hände und Füße waren mit der gleichen Art Klebeband gefesselt. Der Bauch war quer über den Nabel aufgeschnitten worden, und aus der Wunde quoll der Darm des Polizeichefs.
»Scheiße, was für eine Sauerei«, sagte Detective Kolacny. Burton sah auf und schirmte seine Augen vor der Morgensonne ab. Sein Kollege stand am Rand des Grabens und biss sich auf die Unterlippe. Er trug eine Sonnenbrille.
»Haben Sie was gefunden?«
»Noch nicht«, erwiderte Burton. »Aber wenn der Mörder das Klebeband mit den Zähnen abgerissen hat, gibt es vielleicht DNA-Spuren.«
Kolacny rümpfte die Nase. Es stank entsetzlich. Der Darm des Chiefs war durchlöchert, und sein Inhalt hatte sich auf den Boden des Grabens ergossen. Wer immer ihn aufgeschlitzt hatte, hatte dafür gesorgt, dass er um nichts in der Welt mehr zusammengeflickt werden konnte.
»Vergessen Sie nicht, sich die Füße abzutreten«, sagte Kolacny.
Burton musterte ihn kalt. An Tatorten bekam man es häufig mit schwarzem Humor zu tun, solange keine Zivilisten in der Nähe waren. Es mochte die Arbeit erträglicher machen, aber hier ging es immerhin um den gottverdammten Polizeichef persönlich.
Kolacny nahm seine Sonnenbrille ab und blickte beschämt zu Boden.
»Entschuldigung«, sagte er.
»Schon gut. Sie sind neu. Haben Sie Anweisungen gegeben, den Rasen zu fotografieren?«
»Nein, warum?«
Burton kletterte aus dem Loch und deutete auf die Grünfläche, wo in einem Kreis von ungefähr zwei Metern Durchmesser Erde verstreut lag. Das meiste davon hatte sich zwischen den Halmen verteilt und war kaum zu erkennen.
Kolacny ging auf ein Knie, um sich die Sache genauer anzusehen. »Wer war das? Ist das von einer Schubkarre gefallen oder so?«
»Kann ich mir nicht vorstellen.«
Burton stellte sich in die Mitte des Kreises, streckte den rechten Arm aus und drehte sich um die eigene Achse, um eine Streubewegung zu simulieren. Die Bewegung passte zu der Kreisform auf dem Boden.
»Sonderbar.« Kolacny runzelte die Stirn. Er beugte sich vor. »Sieht aus, als wäre hier und hier noch mehr.«
Das hatte Burton gar nicht gesehen – zwei Linien von ungefähr dreißig Zentimetern Länge ragten aus dem Kreis und bildeten einen Winkel von etwa fünfundvierzig Grad.
»Glauben Sie, das ist wichtig?«, fragte Kolacny.
»Keine Ahnung«, meinte Burton. »Könnte jemand gewesen sein, der über den Kreis gelaufen ist. Aber sagen Sie den Fotografen trotzdem Bescheid. Gibt es schon eine Spur von der Putzfrau?«
»Nichts«, antwortete Kolacny. »Ich habe bei der Reinigungsfirma angerufen. Die haben mir die Adresse und die Telefonnummer von ihrer Mutter gegeben.«
»Und, schon angerufen?«
»Hatte noch keine Gelegenheit.«
»Dann beeilen Sie sich mal lieber, bevor sie es durchs Fernsehen erfährt.«
Vor dem Haus drängten sich Reporter. Die Polizisten, die den Tatort sicherten, warfen ihnen böse Blicke zu. Kein Cop mochte es, wenn Journalisten die sensationslüsternen Nasen in ihre Angelegenheiten steckten. Viele von ihnen, darunter auch Burton, hatten Williams persönlich gekannt.
»Moment«, sagte Kolacny. »Da drin ist noch was, das Sie sich ansehen sollten.«
Er führte Burton durch die Glasschiebetür ins Wohnzimmer, das drei Stufen tiefer lag als der Rest des Hauses. Burtons Augen brauchten einen Moment, bis sie sich an das Dämmerlicht gewöhnt hatten. Es kam ihm vor, als stünden weniger Möbel herum als bei seinem letzten Besuch kurz vor der Scheidung des Chief.
Kolacny ging mit ihm die Stufen hinauf, durch einen kurzen Flur und zur eingetretenen Haustür. Er deutete auf das zersplitterte Holz, wo die Tür offensichtlich aufgebrochen worden war.
»Das dürfte ziemlich Radau gemacht haben«, sagte er.
»Haben wir schon mit den Nachbarn gesprochen?«, fragte Burton.
»Kallis und McGill sind gerade dabei.«
Burton stieß die Tür auf und sah nach draußen. Fahrzeuge der großen Sender bauten ihr Equipment auf, und Korrespondenten sprachen, das Haus im Hintergrund, in ihre Kameras. Auf der anderen Seite der Straße stand sein uniformierter Kollege McGill, der sich mit einer Gruppe neugieriger Nachbarn unterhielt.
Ein Zoomobjektiv neben einem der Nachrichten-Vans richtete sich auf Burton.
Als er sich abwandte, entdeckte er oben am Türrahmen ein kleines Plastikrechteck, einen Magnetstreifen, der zur Alarmanlage des Hauses gehörte.
»Was glauben Sie, warum der Alarm nicht ausgelöst wurde?«, fragte er an Kolacny gewandt.
»Vielleicht, weil er nur nachts aktiviert war.«
Burton folgte der Leitung, die oben an der Flurwand entlangführte. Der Verteiler befand sich in einer Nische – ein Nummernpad mit einem UrSec-Logo und eine Metallbox samt am Boden liegender Batterie. Das Kabel dazwischen war durchtrennt. Kolacny blickte über Burtons Schulter.
»Mist«, sagte er.
»Kannst du laut sagen«, erwiderte Burton.
Aus dem Wohnbereich drang ein Klappern zu ihnen hinüber – die Kollegen von der Spurensicherung in ihren weißen Overalls. Kolacny verwies auf die Haustür und das durchgeschnittene Kabel. Mit wenigen Griffen puderten die Männer alles ein und suchten nach Fingerabdrücken und DNA-Spuren, während Burton den Rest des Hauses erkundete.
Interessanterweise hatte sich Williams nach seiner Beförderung zum Polizeichef entschieden, in seinem Haus wohnen zu bleiben. Es war groß, aber durchaus nicht das größte in der Gegend, und Williams wie die meisten Cops Stier. Veränderungen mochte er nicht.
Im Schlafzimmer herrschte Ordnung, genau wie im Wohnzimmer. Es war karg möbliert und das Bett sorgfältig gemacht, was ein wenig überraschte, da Williams ja eigentlich einen Reinigungsdienst für derlei Tätigkeiten beauftragt hatte. Wahrscheinlich gehörte er zu den Menschen, die extra saubermachten, bevor die Putzfrau kam, um keinen schlechten Eindruck zu machen. Von makelloser Sauberkeit konnte trotzdem keine Rede sein. Unter dem Bett lag Staub, und auf einem Stapel Bücher auf dem Nachttisch stand ein alter Laptop.
Burton warf einen Blick in die Wandschränke. In der einen Hälfte hingen Williams’ Uniformen und seine Freizeitkleidung ordentlich auf Bügeln, der Rest war leer, als habe er Platz gelassen für den Fall, seine Exfrau könne zurückkommen. Vielleicht hatte er aber auch einfach alles so lassen wollen, wie es immer gewesen war.
In einer Ecke des Schlafzimmers, hinter der Tür, entdeckte Burton einen Notrufschalter, an der Wand dahinter ein paar Blutspritzer. Er rief die Spurensicherung.
Während die Kollegen fleißig fotografierten und Proben nahmen, durchsuchte Burton den Rest des leblos wirkenden Hauses. Der einzige Raum mit ein bisschen Farbe war das zweite kleine Schlafzimmer mit den lila Wänden und den Boy-Band-Postern, wo Williams’ Tochter Ashleigh schlief, wenn sie zu Besuch kam. Sie musste inzwischen zehn oder elf Jahre alt sein. Als Burton sie zum letzten Mal gesehen hatte, war sie drei gewesen.
Damals hatte es ihm viel bedeutet, vom Captain des Morddezernats zum Abendessen eingeladen zu werden. Er und Kate waren frisch verheiratet gewesen und hatten nur eine beengte Wohnung zur Verfügung gehabt. Williams’ Leben hatte wie eine verheißungsvolle Zukunftsvision gewirkt. Trotzdem war es ein unangenehmer Abend gewesen. Williams hatte Kate regelrecht ausgefragt und intensiv gemustert, und sie hatte voller Unbehagen geantwortet. Abgesehen davon hatte er ein paar Witze zu viel auf Kosten seiner Frau gerissen. Dennoch, Burton und Kate hatten einen guten Eindruck hinterlassen wollen, und Williams hatte ihnen Single Malt eingeschenkt. Am Ende hatten sie so laut geredet, dass Williams’ Tochter verschlafen heruntergekommen war und gesagt hatte, sie sollten alle »mal die Luft anhalten«, worüber sie in lautes Gelächter ausgebrochen waren.
Viele Jahre lag das inzwischen zurück.
Das Haus war schon vor Williams Ermordung halbtot gewesen. Sollte Burton eine solche Zukunft erwarten – wenn er weiter mit Kate stritt zum Beispiel oder ihre Tochter im falschen Tierkreiszeichen geboren und ihre Ehe in die Brüche gehen würde – bezweifelte er, dass er sein Leben so gut im Griff behalten würde, wie der Chief es getan hatte.
3
An dem Tag, als Daniel Lapton erfuhr, dass er eine Tochter hatte, hätte er eigentlich in einem Meeting sein sollen. Der Vizepräsident für Asien und Australien hatte ein Treffen mit potenziellen koreanischen Investoren organisiert, und obwohl Daniel dort nicht unbedingt gebraucht wurde, hatte man ihm zu verstehen gegeben, welch großen Eindruck es machen würde, wenn ein Lapton anwesend wäre. Daniel wusste, dass es an der Zeit war, sich mehr in das Familienunternehmen einzubringen. Seit sein Vater vor einem Jahr gestorben war, lief die Firma wie auf Autopilot.
Am Tag des Meetings wachte er viel zu spät auf. Fünfzehn Minuten starrte er an die Holzdecke, bevor er zum Hörer griff, die Sekretärin des Vizepräsidenten anrief und etwas von einem »unvorhersehbaren medizinischen Notfall« murmelte. Er konnte sowieso niemandem etwas vormachen – jeder in der Firma wusste, dass er so gar nicht nach seinem Vater kam.
Er streifte sich einen seidenen Morgenmantel über und ging in die Küche. Ausnahmsweise wartete dort kein gedeckter Frühstückstisch auf ihn. Die Dienstboten hatten bezahlten Urlaub bekommen. Er wollte eine Zeit lang einfach keine Menschen sehen. Daniel durchsuchte die Speisekammer, wo er einigermaßen frisches Brot auftrieb, und stippte es in eine Schale Taramosalata, die er in einem der Kühlschränke entdeckte.
Danach schlurfte er ins Entertainment-Zimmer im unteren Stockwerk, ließ sich auf eine schwarze Couch fallen und sah sich eine Kriegsdokumentation an. Nach und nach stellten sich Schuldgefühle ein. Wäre sein Vater noch am Leben, würde er ihm einen Vortrag darüber halten, dass die Welt voller erfolgshungriger, ehrgeiziger Menschen sei, die sich durch sein Imperium bohren würden wie Holzwürmer durch die Familienvilla. Echte Steinböcke überließen ihre Entscheidungen keinen Untergebenen. Sie waren reich, weil sie es verdient hatten. Und ganz sicher waren sie keine Drückeberger.
Nach dem Tod seines Vaters hatte Daniel den Familienwohnsitz hinter sich gelassen, war um den Globus gejettet und dabei in sämtlichen Lapton-Hotels abgestiegen. Lapton Europa. Lapton Pacifica. Lapton Afrique. Er hatte sich wie ein Märchenprinz gefühlt, wenn er sich als normaler Gast ausgab, um die unverstellten Abläufe dort kennenzulernen. Doch er machte sich nichts vor: Er bekam immer die besten Suiten, und es hätte ihn verwundert, wenn die Zentrale nicht jeden einzelnen Betrieb klammheimlich über seine Ankunft informiert hätte.
Im Grunde inspizierte er sein Imperium nicht, sondern er lief vor ihm davon. Aber es gab kein Entkommen. In seinem Alter konnte er die ausgetretenen Pfade nicht mehr verlassen. Er würde nicht mehr mit Basejumping anfangen, in keinem Dschungel mehr Ayahuasca trinken und auf keinem staubigen Klosterboden mehr schlafen. Überhaupt würde er sich auf nichts Neues mehr einlassen, weder auf Dinge noch auf Menschen. Nach einer zehnmonatigen Reise war er nunmehr ins gemachte Nest zurückgekehrt, mittelalt und noch immer nicht flügge. Es gab keinen anderen Platz für ihn. Er überlegte, zu einer Astrotherapeutin zu gehen, aber es steckte immer noch genug Lapton in ihm, um jeder Form von Therapie zu misstrauen. Seine Probleme gehörten ihm, und nur er hatte das Recht, sie zu kennen und zu lösen.
Er wanderte durch die Flure seines Heims, das er immer noch als das Haus seines Vaters betrachtete, vorbei an Antiquitäten und Schmuckgegenständen – an Billardtischen, Astrolabien, Barometern in Eichenrahmen und Regalen voller Lederbände. Einer Eingebung folgend, bog er in den Gang mit den schwarzweißen Bodenfliesen ab, der zum ehemaligen Arbeitszimmer seines Vaters führte – in seiner Kindheit eine Tabu-Zone, die er trotzdem oft heimlich erkundet hatte. Auch jetzt überkam ihn wieder das ungute Gefühl, verbotenes Terrain zu betreten.
Der kleine Raum war unverändert. An der gegenüberliegenden Wand stand ein Schreibtisch, davor ein antiker Drehstuhl mit Lederpolstern und hölzernen Armlehnen. In den Regalen darüber stapelten sich Bücher, rechts davon hatten zwei große Aktenschränke Platz gefunden. Die Wände und der Teppich waren in Dunkelbraun gehalten. Alles in allem ein Zimmer, das bei Tageslicht keine rechte Wirkung entfaltete. Daniel schaltete die Schreibtischlampe an und entdeckte einen Stapel Papiere, der aussah, als hätte ihn seit dem Tod seines Vaters niemand mehr angerührt. Neugierig blätterte er darin herum und sortierte die einzelnen Blätter auf zwei Stapel: Angelegenheiten, mit denen man sich zeitnah befassen sollte, und Unterlagen, die direkt geschreddert werden konnten. Im Prinzip hätte er das auch einem Anwalt der Firma oder den ehemaligen Assistenten seines Vaters überlassen können, doch irgendwie sah er darin eine Chance, seinen alten Herrn besser zu verstehen.
In den Aktenschränken lagen unendlich viele Dokumente: Verträge, Steuerformulare sowie jahrzehntealte und fast bis zur Unlesbarkeit verblasste Ausdrucke von Nadeldruckern.
Er entdeckte einen Ordner mit alten Zeitungsausschnitten und politischen Satiren, die sich allesamt um seinen Vater drehten. Als Kind war er zornig geworden, wenn sich jemand über seine Familie lustig gemacht hatte. Sein Vater arbeitete hart und hatte solche Respektlosigkeiten nicht verdient. Erst als Jugendlicher hatte Daniel angefangen, ihn als Person in Frage zu stellen.
Er legte den Ordner auf den »Aufbewahren«-Stapel und nahm sich den nächsten vor. Er enthielt einen Briefwechsel zwischen seinem Vater und dem Chef der Sicherheitsfirma der Hotelkette und stammte aus der Zeit, als Daniel ungefähr siebzehn gewesen war und bei seiner Mutter auf der anderen Seite des Landes gelebt hatte. Seine Eltern hatten sich scheiden lassen, als er sechs war, doch ihr Leben und ihre Geschäfte waren dennoch eng miteinander verknüpft geblieben. Zu jener Zeit hatte sich seine Mutter gerade an einem Restaurant-Projekt versucht. Das »Greenhouse« war ein umgebautes Penthouse in einem der Familienhotels gewesen, im Lapton Celestia. In der verglasten Lounge wurden Cocktails und Tapas serviert, und man hatte einen einzigartigen Blick über den Hafen. Leider war es bei den Gästen nicht gut angekommen und hatte kaum ein Jahr später schließen müssen, woraufhin seine Mutter ein neues Betätigungsfeld in der Mode gefunden hatte.
Daniel wollte den Ordner gerade auf den »Schredder«–Stapel legen, als ihm ein Name ins Auge sprang.
Mr. Lapton,
bezüglich unseres Telefonats wegen Penny Scarsdale letzte Woche: Wir waren in der Geburtsklinik des Krankenhauses, wo ein Vaterschaftstest mittels Fruchtwasseruntersuchung vorgenommen wurde, der ihre Behauptung stützt. Das Geburtsdatum des Kindes wird auf die ersten Märztage prognostiziert, es kommt also vermutlich im Sternzeichen Fische zur Welt, weshalb die Familie ihr Erstgebot ablehnt und das Kind selbst behalten will.
Ich habe Ihr zweites Angebot übermittelt, und momentan sieht es so aus, als würden sie es annehmen. Ich habe mit Dennison gesprochen, er arbeitet die Verträge aus. Sobald sie fertig sind, wird er sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
TYRESE B. COLEMAN, WEST COAST REGIONAL MANAGER, URSEC GROUP.
Der Rest des Ordners war voll medizinischer Berichte und dichtbedruckter Seiten in Juristensprache. Daniel blätterte alles durch und fing dann wieder von vorne an, um jedes einzelne Wort zu lesen. Nach ungefähr der Hälfte begannen seine Hände zu zittern, doch er merkte es kaum.
Er hatte eine Tochter.
4
Burton versuchte, Rachel Wells’ Mutter Angela zu erreichen, doch sie ging weder an ihr Mobiltelefon noch an ihren Festnetzanschluss. Sie lebte in Westville, nicht weit vom Polizeirevier San Celeste Central entfernt. Auf dem Rückweg vom Tatort machte er einen kleinen Umweg, um bei ihr vorbeizuschauen.
Die Straßen in Westville waren schmal, aber sauber. Waagen gehörten zur unteren Mittelschicht und lebten für gewöhnlich in den gleichen Gegenden wie Krebse, die einen ähnlich gearteten Lokalpatriotismus aufwiesen. Es gab keine Vorgärten, und die Erdgeschossfenster waren durchgehend vergittert, aber immerhin waren die meisten Gebäude sauber gestrichen und frei von Graffiti-Verzierungen.
Falls es zum Äußersten käme und seine Familie nach der Geburt seiner Tochter umziehen müsste, würde es sich hier ganz gut leben lassen. Auch der Fischmarkt, den Kate sonntagmorgens gelegentlich besuchte, war in der Nähe. Es könnte schlimmer sein.
Er parkte seinen alten ziegelroten Kombi vor Angela Wells’ Wohnblock und stieg in den zweiten Stock hinauf. Er klopfte an die lackierte Kiefertür und hörte ein leises Schlurfen auf der anderen Seite. »Wer ist da?«, fragte eine Stimme.
»Detective Jerome Burton, SCPD. Sind Sie Angela Wells? Ich muss mit Ihnen über Ihre Tochter sprechen.«
Die Tür öffnete sich einen Spalt weit, und die Gestalt einer Frau erschien. Ihr Haar war dunkelorange gefärbt, sie trug ein Blumenkleid und beäugte Burton misstrauisch.
»Ich kenne Sie«, sagte sie. »Sie waren mal in den Nachrichten, oder?«
»Möglich«, räumte Burton ein.
»Und warum?«
»Weil ich einen Mordfall gelöst habe«, erwiderte er. Weitere Details wollte er ihr nur zu gern ersparen.
Angela schien die Antwort zu genügen. Sie löste die Kette und öffnete die Tür.
»Kommen Sie rein.«
Er betrat einen kleinen Wohnraum, in dem eine Mischung verschiedener Gerüche hing. Zwei Sessel mit Häkeldecken waren auf einen kleinen Fernseher ausgerichtet. In einem saß ein alter, kuscheliger Hund und kläffte Burton an. Um richtig zu bellen, schien ihm die Kraft zu fehlen.
»Humphrey, aus!«, rief Angela energisch. Der Hund wandte sich ab und leckte sich übers Fell.
Im Fernsehen lief eine Realityshow, in der Angehörige aller Zeichen zusammen in einem Haus wohnten. Um den Zuschauern deutlich zu machen, wer welchem Tierkreiszeichen angehörte, trugen sie verschiedenfarbige Shirts. Angela schaltete das Gerät ab.
»Was wollen Sie von meiner Tochter?«, fragte sie. »Sie ist bei der Arbeit, wollte aber gegen drei zurück sein.«
Burton suchte nach den passenden Worten. Dafür zu sorgen, dass sich die Nadel zwischen Verzweiflung und falscher Hoffnung einpendelte, war eine schwierige Aufgabe.
»Mrs. Wells, ich fürchte, Ihre Tochter könnte in ein Verbrechen verwickelt worden sein.«
Er erklärte ihr die Lage so ruhig er konnte. Währenddessen wanderte Angela Wells’ Blick ziellos durch den Raum, überallhin, nur nicht in seine Augen.
»Wir wissen nicht, wo sie ist«, sagte er. »Aber wir tun alles, was in unserer Macht steht, um sie zu finden. Falls Sie etwas von ihr hören – ganz gleich was –, rufen Sie mich bitte an. Ja?«
Er gab ihr seine Karte, die sie wortlos entgegennahm, während sie aus dem Fenster starrte und den Hund am Kopf kraulte.
»Mrs. Wells?«
»Hm?« Sie wirkte irritiert, dass er noch da war. »Ach, ja. Tut mir leid«, fügte sie dann hinzu. Das ist schon ein ziemlicher Schreck.«
»Ich weiß, Ma’am. Tut mir leid.«
»Rachel ist ein gutes Mädchen«, fuhr sie ernst fort. »Natürlich sagt das jede Mutter, aber bei ihr stimmt es wirklich. Ich bin pensioniert und bekomme eine kleine Zusatzrente wegen meiner Arthritis, die hinten und vorne nicht reicht. Und deshalb arbeitet sie bei diesem …«
Ihre Stimme versagte. Vor einigen Jahren hätte Burton ihr den städtischen Beratungsdienst empfohlen, doch aufgrund diverser Kürzungen waren die Richtlinien für potenzielle Trauma-Patienten inzwischen deutlich strenger. So blieb ihm nur ein erneutes: »Tut mir leid.«
»Tja«, erwiderte Angela und lächelte Burton tapfer an. »Danke, dass Sie vorbeigekommen sind.«
»Dafür bin ich da, Ma’am«, sagte er. »Und falls Sie etwas brauchen, rufen Sie mich an. Ich werde tun, was ich kann.«
»Danke.«
Sie brachte ihn zur Tür und schob den Riegel und die Kette wieder vor. Für einen Moment verharrte Burton im Hausflur, doch er hörte keine weiteren Geräusche aus der Wohnung. Auch der Fernseher wurde nicht wieder eingeschaltet.
5
Das Polizeirevier San Celeste Central gehörte zu den ältesten Gebäuden der Stadt. Im Laufe der Jahre hatte es sich über einen ganzen Block ausgebreitet. Um den ursprünglichen Backsteinbau verzweigten sich Betonflügel im Stil des Brutalismus. Für gewöhnlich herrschte hier starker Verkehr, und während Burton mit seinem Wagen die letzten Blocks entlangkroch, rief er über die Freisprechanlage bei der Sicherheitsfirma von Chief Williams an, erklärte dem Empfang die Situation und bat darum, mit jemandem verbunden zu werden, der sich mit den technischen Details der Alarmanlage auskannte. Er wurde von einer Stelle zur nächsten vermittelt, und er hörte die Angst in den Stimmen seiner Gesprächspartner, wann immer sie begriffen, dass es um den Mord an einem Prominenten ging. Burton blieb geduldig, bis man ihn endlich zu einem Ingenieur durchstellte, der nach Jungfrau klang und eindeutig instruiert worden war, keinerlei Fehler zuzugeben.
»Wenn die Leitung durchtrennt wird, arbeitet das System nicht«, sagte der Ingenieur. »Aber dafür muss man schon im Haus sein, also fällt das vermutlich in die Verantwortlichkeit des Hausbesitzers.«
»Wollen Sie damit sagen, dass der Polizeichef absichtlich seine eigene Alarmanlage kaputtgemacht hat?«
»Sorry«, sagte der Ingenieur. »Ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Aber man kann das Kabel halt nicht kappen, solange man nicht im Haus ist.«
»Wissen Sie was? Rufen Sie mich doch einfach zurück, wenn Sie sich ernsthaft überlegt haben, was passiert sein könnte«, sagte Burton und beendete das Gespräch mit dem Kerl am anderen Ende der Leitung, der allem Anschein nach um seine Stelle fürchtete.
Er parkte in der Tiefgarage, fuhr mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock und folgte den Fluren durch das Überfalldezernat zum Morddezernat. Es befand sich in einem langgestreckten Raum mit hohen Fenstern, der Burton immer an eine Bahnhofshalle erinnerte und wo es stets nach Kaffee und Reinigungsmitteln roch. Er ging zwischen den aufgereihten weißlackierten Schreibtischen zu seinem Büro. Kolacny erwartete ihn bereits mit einem großen Briefumschlag in der Hand.
»Hallo«, sagte Burton. »Wie sieht’s aus, haben Sie Williams’ Ex informiert?«
»Noch nicht«, entgegnete Kolacny. »Aber sie hat es vermutlich längst in den Nachrichten gesehen. Wir haben seinen Bruder angerufen, seinen offiziell nächsten Verwandten.«
»Kommen Sie, Lloyd«, sagte Burton. »Sie ist die Mutter seines Kindes. Da hat sie wenigstens einen Anruf verdient.«
»Ist ja gut, ich kümmere mich darum«, knurrte Kolacny und reichte Burton den Umschlag.
»Was ist das?«
»Von der Spurensicherung. Das Blut im Schlafzimmer stammt mit großer Wahrscheinlichkeit von Williams. Es war frisch. Ach, und Mendez sagt, er möchte Sie sehen.«
»Mendez? Was will er denn?«
Keiner von ihnen kam gut mit Captain Ernesto Mendez, dem Leiter des Morddezernats, zurecht. Er war Ende vierzig, hatte pockennarbige Haut und schwarzes Haar, das vom Style her an einen Politiker erinnerte. Er war in vielerlei Hinsicht ein guter Polizist – fähig, effizient und motiviert –, aber den ihm unterstellten Beamten machte er in einer Tour die Hölle heiß und zwar nur, weil er es konnte. Natürlich musste jeder Cop mal Dampf ablassen und seiner Wut Ausdruck verleihen, doch darum ging es Mendez nicht. Ihm machte so was einfach Spaß.
Burton schlurfte in den zentralen Flur zurück und über die Treppe ins oberste Stockwerk hinauf. Mendez’ Büro wurde von einem Polizisten in Zivil bewacht, der Burton von oben bis unten musterte.
»Name?«
»Detective Jerome Burton. Mord. Und Sie?«
»Special Investigation Services. Was wollen Sie?«
»Captain Mendez möchte mich sehen. Was ist denn hier los?«
Der Cop in Zivil öffnete die Tür. Drinnen unterhielt sich Mendez mit zwei Männern. Bei dem einen handelte es sich um Deputy Chief Killeen, Leiter des Dezernats für Raub und Körperverletzung. Der andere war Bruce Redfield, der Bürgermeister von San Celeste.
Den Bürgermeister kannte Burton bislang nur aus dem Fernsehen. Er war größer als er selbst, dürr wie ein Windhund, trug das mittellange Haar zurückgekämmt und sah aus, wie sich Burton einen Violinisten oder einen Kunsthändler vorstellte. Elegant und ein bisschen schmierig. Als Mendez Burton bemerkte, winkte er ihn herein und unterbrach das Gespräch.
»Burton!«, rief Mendez freundlich. »Wie geht es unserem Star-Detective?«
»Gut, besten Dank«, erwiderte Burton vorsichtig. In Mendez’ Komplimenten schwang für gewöhnlich eine gehörige Portion Sarkasmus mit.
»Bürgermeister«, sagte Mendez, »das ist der Detective, von dem ich Ihnen erzählt habe. Burton hat die Ermittlung beim Mord an Senator Cronin geleitet und den Täter damals gefasst.«
»Davon habe ich gehört«, sagte Bürgermeister Redfield und bot Burton lächelnd die dünne Hand an. »Gute Arbeit.«
»Danke, Sir.«
Der Griff des Bürgermeisters war fest und kühl.
»Ich habe gehört, dass Sie Williams persönlich kannten.«
»Ja, Sir«, sagte Burton. »Als ich Detective wurde, war er mein erster Captain.«
Der Bürgermeister nickte. »Ich kannte ihn auch. Er war ein guter Mann. Ein Diener der Stadt und ein enger Freund von mir. Wenn ich Ihnen irgendwie bei den Ermittlungen helfen kann, lassen Sie es mich wissen.«
»Wir nehmen diese Angelegenheit durchaus persönlich«, mischte sich der Deputy Chief ein. »Wir dürfen nicht zulassen, dass das SCPD als leichtes Ziel wahrgenommen wird.«
»Genau«, sagte der Bürgermeister. »Zeigen wir der Stadt, wie schnell und effektiv wir in der Lage sind, Recht und Ordnung wiederherzustellen.«
»Wir sind schon auf einer vielversprechenden Spur«, sagte Mendez. Offensichtlich wollte er die Gelegenheit beim Schopf packen, um vor seinen Vorgesetzten gut dazustehen. »Im Gras neben der Leiche hat Burton ein Symbol entdeckt. Das Stier-Zeichen.«
»Ist das wahr?«, fragte der Bürgermeister an Burton gewandt.
Burton runzelte die Stirn. Das Symbol war kaum zu erkennen gewesen. Es hätte sich genauso gut um zufällig verstreute Erde gehandelt haben können. Doch jetzt war beileibe nicht der richtige Augenblick, um seine Unsicherheit zu zeigen.
»Ja, richtig«, sagte er. »Ein Kreis, aus dem zwei Linien ragen.«
Der Bürgermeister sah Mendez an.
»Dann könnte die Tat also in Zusammenhang mit einem Tierkreiszeichen stehen?«
Mendez nickte. »Wir ermitteln in diese Richtung, Sir. Ich würde sagen, wer auch immer Chief Williams getötet hat, gehört zur Widder-Front, die uns mit dem Zeichen zum Narren halten wollen.«
Die Widder-Front, eine militante Bürgerrechtsgruppe, kämpfte gegen den so genannten Zodiakismus, der ihrer Ansicht nach das gesamte Justizsystem durchsetzt hatte. So gehörten beispielsweise neunzig Prozent der Polizeibeamten zum Sternzeichen Stier, die Verhafteten wiederum überproportional oft zu den »niederen« Tierkreiszeichen wie Widder und Fische. Die Aktivisten gab es schon seit Jahrzehnten, doch in den letzten Monaten war ihr Bekanntheitsgrad nach einer angeblichen Welle brutaler Polizeiübergriffe erheblich gestiegen. Zum Ärger der hier Anwesenden war ihr Anführer, Solomon Mahout, schon beinahe regelmäßig im Fernsehen zu sehen.
»Scheißkerle«, fluchte der Bürgermeister. Wenn seine Politikermaske mal fiel, enthüllte er eine überraschende Gehässigkeit. »Verfickte Tiere sind das. Wie können wir die nur zur Strecke bringen?«
»Burton bekommt die volle Unterstützung unserer Abteilung für Raub und Überfall«, sagte Mendez.
»Richtig«, fiel der Deputy Chief ein. »Diese Ermittlung hat oberste Priorität. Und ich sorge dafür, dass ein vertrauenswürdiger Astrologe hinzugezogen wird.«
Burton wollte protestieren. Er hatte nicht viel Erfahrung mit Astrologen, und der Zeitpunkt erschien ihm denkbar ungünstig, um jemand Neues an Bord zu holen. Mendez schien seine Miene bemerkt zu haben, denn er sagte: »Wir brauchen eine Verurteilung, Burton. Und ein zuverlässiger Astrologe als Kronzeuge könnte wichtige Lücken füllen.«
Burton ärgerte die Andeutung, es könne ihm womöglich nicht gelingen, den Fall wasserdicht abzuschließen, andererseits verstand er den Einwand. Er hatte schon gesehen, wie Verdächtige den Gerichtssaal als freie Leute verließen, weil die Jury parteiisch gewesen war. Astrologen konnten eine Jury sehr gut auf Linie bringen. Jahrzehntelang übertragene Fernsehserien über astrologische Profiler und forensische Astrologen hatten die Öffentlichkeit davon überzeugt, dass sie vertrauenswürdigen Beistand im Kampf gegen das Verbrechen leisteten.
»Haben Sie schon jemanden im Sinn?«, fragte der Bürgermeister an den Deputy Chief gewandt.
»Ja, Sir. Lindiwe Childs. Sie führt auf der ganzen Welt bei den verschiedensten Agenturen Sicherheitstrainings durch und bringt den Leuten bei, wie man das Gefahrenpotenzial eines Reisenden anhand seines Geburtsdatums abschätzen kann. Im Augenblick arbeitet sie für das Flughafenamt in San Celeste. Ich schicke Burton ihre Nummer.«
»Hervorragend«, sagte der Bürgermeister und reichte Burton erneut die Hand. Während Burton sie schüttelte, packte ihn der Bürgermeister nachdrücklich am Unterarm.
»Schnappen Sie sich das Schwein, Detective«, sagte er. »Wir zählen auf Sie.«
6
Es klingelte genau in dem Moment, als Lindi in ihrer Küchennische Kaffee aufsetzte. Sie ging zur Tür und zog den Gürtel ihres Morgenmantels enger. Draußen auf dem Flur stand ein ernst dreinblickender Mann, groß, glattrasiert, blondes Haar. Er trug einen Anzug und ein Hemd ohne Krawatte.
»Guten Morgen. Lindiwe Childs?«
»Lindi, bitte. Und Sie sind?«
»Detective Burton.«
»Natürlich! Hi.«
Als sie ihm die Hand schüttelte, fürchtete sie, der Knoten ihres Morgenmantels könne sich lösen. Zwar war sie nicht nackt, sondern trug Shorts und ein weißes Tanktop darunter, das sie in einem Duty-Free-Shop in Spanien erstanden hatte, aber das war irgendwie eine Frage des Anstands.
»Ich störe doch nicht?«, fragte Burton. »Sie haben gesagt, nach zehn Uhr.«
Richtig, habe ich, dachte Lindi. Mist.
»Kein Problem, kommen Sie rein«, sagte sie und trat zur Seite. Sie war noch von der letzten Nacht benommen. Megan, ihre einzige Freundin in San Celeste, hatte sie ausgeführt, um ihr ein paar neue Leute vorzustellen und sie in die Homosexuellenszene einzuführen. Sie hatte ein paar interessante Frauen kennengelernt, doch insgesamt war die Szene viel stärker aufgespalten als in den meisten Städten, die sie kannte. Selbst in Kapstadt hatte Sexualität über Rasse, Religion und Sternzeichen triumphiert, doch die Clubs, die Megan ihr in San Celeste gezeigt hatte, wurden fast ausschließlich von den professionell kreativen Zeichen Wassermann, Schütze und Zwillinge besucht, und sogar die bildeten untereinander noch eigene Cliquen. Lindi hatte Megan angefleht, sie irgendwo hinzubringen, wo es etwas entspannter zuging, und so waren sie schließlich in einer Hardcore-Löwen-Lesbenbar gelandet. Als sich die Stammgäste beim Billard über Megans Hipster-Tattoos lustig gemacht hatten, war Lindi einverstanden gewesen, es für diese Nacht gut sein zu lassen. Den Cop hatte sie völlig vergessen.
»Ich habe Sie hoffentlich nicht geweckt«, sagte er.
»Nein, nicht wirklich«, sagte Lindi. Sie zeigte auf ihren Morgenmantel. »Tut mir leid. Den trage ich immer beim Schreiben. Ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet.«
Ihr Apartment war nicht auf Besucher vorbereitet. Überall im Wohnzimmer lagen Bücher zur Recherche und lose Notizblätter verteilt. In der Küchennische stapelte sich Geschirr, und auf der Couch lag noch eine zerwühlte Decke von ihrer Fernsehorgie vor einigen Tagen. Sie war erst kürzlich eingezogen und hatte bisher nur ihre Bücher und ihre Spielzeugsammlung in die Regale geräumt. Auf dem Schreibtisch neben dem Laptop lagen ein Plastik-Astrolabium und ein Kartenspiel, das sie »Emoji-Tarot« nannte. Auf den einzigen Bildern, die sie bislang aufgehängt hatte, waren Cartoon-Figuren abgebildet, die düstere, unanständige Dinge taten, zum Beispiel auf der Straße betteln oder vor einem Regierungsbüro anstehen. Lindi mochte die Zeichnungen, sie erinnerten sie an ihre Graffiti-Künstler-Freunde aus Barcelona. Burton würde sie vermutlich albern finden. Sie nahm einen Stapel Papier von einem Stuhl.
»Kaffee?«, fragte sie. »Ich habe gerade welchen gemacht.«
»Nein, danke.«
»Okay. Einen Moment nur.«
Sie ging zu ihrer Küchennische, goss sich einen Becher ein und gab Milch und zwei Stück Zucker dazu. Als sie ins Wohnzimmer zurückkam, betrachtete Burton die japanischen Plastikfiguren, die sie in ihren Zwanzigern gesammelt hatte. Wie erwartet blieb seine Miene todernst.
»Also gut, Detective«, sagte sie und setzte sich aufs Sofa. »Worum geht es?«
Er ließ sich auf einem Holzstuhl nieder und legte die Hände auf die Knie. Er war ein seltsamer Stier, hoch konzentriert und fast ein bisschen verklemmt. Es hätte sie nicht überrascht, wenn er Aszendent Jungfrau gewesen wäre.
»Ich leite die Ermittlungen in einem Mordfall«, sagte Burton, »und es gibt eine astrologische Spur. Man hat mir geraten, Sie hinzuzuziehen, mir aber auch gesagt, dass Sie nur zusagen würden, wenn wir uns vorher treffen. Darf ich erfahren, wieso?«
»Ja, sicher, tut mir leid«, sagte sie. »Ich muss mich einfach vergewissern, dass wir kompatibel sind. Sagen Sie mir Ihr Geburtsdatum und Ihre Geburtszeit?«
Burton gab die gewünschte Auskunft. Lindi drehte den Laptop zu sich herum und öffnete ihr Astrologieprogramm.
»Und was kann ich für Sie tun?«, fragte sie.
»Mir bei der Ermittlung helfen«, sagte Burton. »Sie würden ein erhöhtes Beratungshonorar bekommen. Wir glauben zu wissen, wer hinter der Tat steckt, aber wir brauchen Sie, um unsere These astrologisch zu untermauern und vor Gericht auszusagen, sollte es hart auf hart kommen.«
Lindi tippte seine Daten ein, um eine Synastrie zu erstellen. Sie checkte das Horoskop, das vor ihr auf dem Bildschirm erschien, einen Aspekt nach dem anderen. Es sah nicht gut aus. Zwischen ihnen beiden gab es etliche negative Aspekte und zudem eine recht ungünstige Planetenkonstellation. Sie klappte den Laptop zu und schüttelte den Kopf.
»Tut mir leid«, sagte sie. »Momentan habe ich leider überhaupt keine Zeit. Ich muss dieses Handbuch abschließen. Das Flughafenamt braucht standardisierte Verfahren, um Reisende zu screenen und potenzielle Terroristen zu identifizieren.«
Sie nahm den Entwurf des besagten Inhaltsverzeichnisses von einem Stapel Ausdrucke:
1) Einleitung
2) Indikatoren für Gewalt
2a) Die Sonne oder der Aszendent Widder
2b) Die Position von Mars in einem Geburtshoroskop
2c) Negative Aspekte mit Jupiter
3) Saturn als positiver oder negativer Indikator
4) Häuser
4a) Tod: das 8. Haus
4b) Verborgene Geheimnisse: das 12. Haus
5) Stundenastrologie: Vorhersage von Gewalttaten
»Das ist noch eine Menge Arbeit«, erklärte sie. »Ich soll komplizierte astrologische Deutungen in einer Checkliste erfassen, damit ein Computer damit arbeiten kann, was lächerlich ist. Es gibt zu viele Variable. Ab irgendeinem Punkt muss ein Mensch die Sache deuten.«
»Sie haben also zu viel zu tun?«, fragte Burton, der sichtlich Mühe hatte, sich seine Verärgerung nicht anmerken zu lassen. Lindi fiel auf, dass er das Kinn vorschob.
»Mindestens den ganzen nächsten Monat. Tut mir leid. Ab Anfang Juni könnte ich Ihnen zur Verfügung stehen.«
»Okay«, sagte Burton und stand auf. »Tut mir leid, dass ich Ihre Zeit verschwendet habe.«
»Warten Sie«, sagte sie. »Nur eins noch: Um welchen Fall geht es überhaupt?«
Burton runzelte die Stirn. »Ich bin nicht befugt, Ihnen mehr zu sagen, als in der offiziellen Verlautbarung steht.«
»In welcher?«
»Der Polizeichef wurde in seinem Garten ermordet.«
»Ach darum geht es? Um Chief Williams?«
Lindi hatte von dem Mord gehört, aber keine großen Gedanken daran verschwendet. Ihrer Ansicht hatte es sich halt mal wieder um eins jener Ereignisse gehandelt, die in den sozialen Medien hohe Wellen schlugen.
Sie musterte Burton von Kopf bis Fuß. Sein Horoskop war ungünstig, aber …
»Okay«, sagte Lindi. »Passen Sie auf. Wenn ich mitmache, dann entweder ganz oder gar nicht. Ich brauche Zugang zu den Akten.«
»Nur, wenn Sie die Bedingungen für den Zugang zu geheimen und vertraulichen Informationen akzeptieren.«
»Einverstanden.«
»Also sind Sie dabei?«
Lindi biss sich auf die Unterlippe. Verdammt. Sie hatte versprochen, in zwanzig Tagen einen Entwurf für das Handbuch zu liefern. Aber da es ja nun um den Mord am Polizeichef ging … Was sollte das Flughafenamt dagegen einwenden? Und außerdem wurde ja auch noch nach einer jungen Frau gefahndet. Vermisstenfälle lagen ihr. Auch wenn sie normalerweise versuchte, Aufträge zu meiden, bei denen es vor allem ums Prestige ging, konnte dies hier wirklich eine große Sache werden.
»Okay.«
Sie klappte den Laptop wieder auf und zauberte ein neues Horoskop mit einer abstrakten Darstellung des Himmels auf den Bildschirm. Ein Speichenrad mit Glyphen an der Außenseite, die für die verschiedenen Planeten und Konstellationen standen. Für Nichteingeweihte sahen die Verbindungslinien planlos und wirr aus, für Lindi hingegen bargen sie eine große wundervolle Bedeutung.
»Sagen Sie mir alles, was Sie wissen«, sagte sie.
7
Penny Scarsdale war die jüngste unter den Angestellten von Daniels Mutter gewesen und hatte, wenn die Gäste fertig waren, die Holzbretter abgeräumt, auf denen das Essen serviert worden war. Daniel hatte sie vor seinem Studium kennengelernt, als er im Restaurant arbeitete. Er hätte damals überall hingehen und alles tun können, doch er hatte für seinen Lebensunterhalt arbeiten wollen, so wie andere Leute auch. Daraufhin hatte ihm seine Mutter diesen dämlichen Job als »Vorratsmanager« verpasst, und er hatte die Sommermonate damit verbracht, so zu tun, als trüge er tatsächlich Verantwortung. In Wirklichkeit war er einfach nur für die Nachbestellungen zuständig gewesen.
Sein Anruf beim Großhändler am ersten Tag dauerte keine fünf Minuten. Danach saß er ohne Beschäftigung fünf Stunden in seinem Büro herum, und da ihn niemand kontrollierte, ging er im Hotel auf Wanderschaft. Die hinteren Gänge, ein Labyrinth, das es zu erkunden galt, waren voller Ungeheuer wie dem Reinigungspersonal oder den Wachleuten, vor denen er in Deckung gehen musste, da sonst schreckliche Strafen seitens seines Vaters drohten. In seinem Leben gab es weder Gefahren noch Wunder. Daniel kannte jeden Gang und jeden einzelnen Raum. Er ging zum hinteren Treppenhaus, um sich unten im Foyer eine Zeitschrift zu besorgen, überlegte es sich dann jedoch anders. Einem Impuls folgend, stieg er nach oben und entdeckte einen Notausgang, der zum Dach hinaufführte.
Dort oben war es laut und wunderschön. Metallische Klebebandstreifen zogen sich kreuz und quer über einen dunkelgrauen, schwammweichen Belag. Riesige silberne Auslässe von Lüftungsanlagen endeten hier, die wie Flugzeugtriebwerke donnerten. Dazwischen klobige Gebilde, bei denen es sich offensichtlich um die Fahrstuhlmotoren und die Klimaanlage handelte. Der Himmel leuchtete hellorange. Über dem Meer ging gerade die Sonne unter.
Daniel blickte sich um. An einem der Gebilde erblickte er eine behelfsmäßige Umzäunung. Vier große, schwarzlackierte Metallgitter, die man zusammengekettet hatte und die allerlei skurrile Dinge enthielten: Weihnachtsbäume, ausgebleichte Plastikbanner sowie die Überreste eines riesigen Styropor-Truthahns, der zu Thanksgiving im Hotelfoyer gestanden hatte. Fast alles in dem Käfig war mit Glitter bedeckt. Als Kind hätte er sich über eine solche Entdeckung riesig gefreut, doch mit fast zwanzig sah er darin nur noch Abfall und Müll.
Er ging um den Käfig herum und strich über die Gitter. Auf der anderen Seite saß Penny Scarsdale auf der Dachkante, blickte zum Meer hinaus und hielt eine halb gerauchte Zigarette in der Hand. Sie hatte sich rote Strähnen ins blonde Haar gefärbt. Ihr Gesicht war rund und hatte prominente Wagenknochen. Daniel hatte sie noch nie gesehen, doch er erkannte ihre Kellnerinnen-Uniform – die schwarze Hose mit der dunkelgrünen Bluse –, die zur Dekoration des Restaurants passte.
Sie musste ihn aus den Augenwinkeln bemerkt haben, denn sie drückte ihre Zigarette aus. Eigentlich hätte sie gar nicht auf dem Dach sein dürfen, und er hätte bei seiner Mutter Pluspunkte sammeln können, wenn er sie zur Arbeit angetrieben hätte. Das hätte man von ihm erwartet. Stattdessen setzte er sich ein Stück entfernt neben sie, ließ die Beine über der beängstigenden Tiefe baumeln, lächelte sie an und blickte aufs Meer hinaus.
Sie sprachen kein Wort. Das Dröhnen der Klimaanlage hätte es sowieso unmöglich gemacht. Doch trotz des Lärms war es ein friedvoller Augenblick. Gemeinsam blickten sie in den Sonnenuntergang. Als die Sonne weg war, kam ein kalter Wind auf. Penny erhob sich, um zurück in die Küche zu gehen, und schenkte Daniel im Vorbeigehen ein Lächeln.
Den Rest des Abends konnte er an nichts anderes mehr denken.
Am nächsten Abend saß er wieder auf dem Vorsprung. Als er eine halbe Stunde gewartet hatte, kam sie herauf und rauchte ihre Zigarette. Zurück im Restaurant, wechselten sie endlich die ersten Worte.
Sie war Sternzeichen Fische. Daniel wusste, was alle wussten – das waren Hippies, Spirituelle, Faulenzer. Er hatte Fische-Filme im Fernsehen gesehen, in denen bärtige, ewig zugedröhnte Idioten auftraten und auch die Frauen in einer Tour high waren. Dumme Witze wurden gerissen, es gab keine zusammenhängende Handlung, und nicht mal die simpelsten Plotregeln wurden eingehalten. Doch Penny war nicht blöd, und nachdem Daniel sich erst mal an ihre schleppende Fische-Sprechweise gewöhnt hatte, fand er sie überraschend einfühlsam.
Eines Abends nach der Arbeit, während sie noch im Restaurant aufräumte und er die Einnahmen zählte, erkundigte er sich nach ihren Zukunftsträumen und riet ihr, sich für einen Job bei der Bank oder auf dem Immobilienmarkt ausbilden zu lassen. Eben für die Art Job, mit dem Steinböcke reich wurden.
»Wie kommst du darauf, dass ich wie ein Bock werden will?«
»Na das wollen doch alle«, erwiderte er, als wäre das die klarste Sache der Welt.
Sie sah ihn amüsiert an.
»Du bist ganz schön von dir selbst eingenommen, was? Ob du’s glaubst oder nicht: Nicht jeder hat Lust, permanent unter Antistress-Medikamenten zu stehen und auf dem Börsenparkett an einem Herzinfarkt zu sterben. Die meisten wollen einfach nur glücklich sein und das Leben führen, das sie sich ausgesucht haben.«
Sie lächelte ihn an. Daniel fühlte sich nicht ernst genommen. Seine Wangen brannten. Er verstand noch nicht, dass Penny es nicht böse meinte. Fische waren einfach nicht so statusversessen wie Steinböcke.
»Willst du lieber dein Leben lang Teller abräumen?«, fragte er.
Sie lachte ihn aus.
»Das sind zwei Extreme, dazwischen gibt’s aber noch einen gewissen Spielraum, oder?«, sagte sie. »Ich arbeite hier, weil ich muss. Das betrachte ich nicht als meine Karriere.«
An jenem Abend und noch bis weit in den nächsten Morgen hinein war Daniel sauer auf Penny. Er hatte das Gefühl, als wollte sie ihn ärgern und sich über ihn lustig machen. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass sie einfach nur ehrlich gewesen war. Er war so sehr an seine Statusspielchen gewöhnt, dass ihm gar nicht in den Sinn kam, wie das auf andere Leute wirken musste.
Glücklicherweise hatte sie Geduld mit ihm.
Am nächsten Abend entschuldigte er sich. »Du denkst vermutlich, für mich würde nur Geld zählen.«
»Naja, wir können ja nicht alle gleich denken, oder? Sonst würden wir alle die gleichen Fehler machen.«
Sie lächelte. Und Daniel begriff, dass er am besten für eine Weile nichts sagte. Er brauchte einfach nur zuzuhören.
Penny erzählte ihm von ihrem Alltag, von der Mühe, die es sie und ihre Mutter kostete, die große Familie über Wasser zu halten. Zuerst hatte Daniel ihr erklären wollen, dass ihre Familie sie nur ausnutzte. Sie sei zu großzügig und ihre Verwandten, die sich ständig auf sie verließen, zu eigennützig. Sie würde gut daran tun, an erster Stelle immer an sich selbst zu denken. Doch Penny sprach mit einer solchen Zuneigung über ihre Verwandten, so voller Schmerz über ihre Verluste und so voller Stolz über ihre Erfolge, dass Daniel unsicher wurde. Seine Weltsicht mochte den Weg zu Macht und Erfolg ebnen, aber das machte sie wohl nicht zur alleingültigen Wahrheit.





























