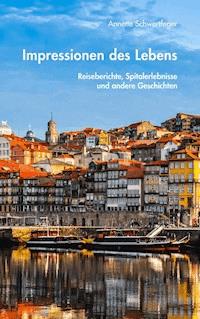
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autorin gelingt es, Alltagssituationen in eine bildhaft präzise Sprache zu fassen und mit einem Augenzwinkern zu versehen. Die Erlebnisse einer älteren Generation, die nicht immer im Fahrtwasser der Wertschöpfenden mitzieht, stellt sie auf eine erfrischende Art dar. Ihre Geschichten schärfen den Blick auf die Umgebung und zeigen, wie der Austausch zwischen Generationen, Geschlechtern oder Kulturen manchmal gelingen, aber auch misslingen kann. Es sind Geschichten, in denen sich viele wiedererkennen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 136
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Buch
Der Autorin gelingt es, Alltagssituationen in eine bildhaft präzise Sprache zu fassen und mit einem Augenzwinkern zu versehen. Die Erlebnisse einer älteren Generation, die nicht immer im Fahrtwasser der Wertschöpfenden mitzieht, stellt sie auf eine erfrischende Art dar. Ihre Geschichten schärfen den Blick auf die Umgebung und zeigen, wie der Austausch zwischen Generationen, Geschlechtern oder Kulturen manchmal gelingen, aber auch misslingen kann. Es sind Geschichten, in denen sich viele wiedererkennen werden.
– Dorothe Zürcher, Autorin
Die Autorin
Annette Schwertfeger, geboren im Aargau in der Schweiz, studierte an der Universität Fribourg französische, englische und deutsche Literatur. Sie unterrichtete an diversen Oberstufen in den Kantonen Aargau, Zürich und Luzern. Später studierte sie an der Universität Zürich Psychologie und schloss mit dem Lizentiat ab. Sie nahm mehrmals an Schreibwerkstätten im Aargauer Literaturhaus in Lenzburg teil, wo bekannte Schriftsteller/-innen ihr Know-how weitergaben. Annette Schwertfeger hat zwei erwachsene Söhne.
Dieses Buch ist all jenen Menschen gewidmet, die sich an meinen realen und erfundenen Geschichten erfreuen.
Inhalt
Hüte dich vor Schnee Romantik auf den Strassen
November
Weihnachten in Salzburg
Krapfen oder Karpfen an Weihnachten
Hals, Nase und Ohren sind seine Lieblinge
Der Abt und das Millionengeschäft
Ein besonderer Freund
Zwei simultane Operationen
Lebensbilanz
Zürich – Lisboa – Porto
Knieoperation
Rehabilitation am Thunersee
Spitex – am besten mit Humor
Missverständnis auf Ostanatolisch
Bücher im Himmel
Verwirrung im Zug
Zwiegespräch unter neuen Nachbarn
Im Spital Muri
Gedichte um des Reimes Willen
Aar-Reha Schinznach
Entführung auf der Excellence Queen in Amsterdam
Boswil Goes China
Knie-, Hüfte- oder Schulteroperation?
Boston 2006
Gespenster gibt es nicht – oder doch?
Der Tag an dem mein rechtes Bein luxierte
Hüftrevision in der Universitätsklinik Bern
Art-Rose oder Arthrose
Rehaklinik Schinznach Again
Beethoven
Musik im Altersheim
Viniterra –Vocisterra
Die Spritze der Erlösung
Sehr kurze Geschichten
Überlingen am Bodensee
Abschied vom Thermalbad Baden
Gartenzaun-Philosophie
Gastro-Koloskopie
Am Rande einer kleinen, kleinen Stadt
Der Früchte-Zauber
Tödlicher Tumor im Kopf meines Hundes
Hüte dich vor Schnee Romantik auf den Strassen
Heute, am 26. Januar 2015, haben zwei, vielleicht drei Schutzengel mein Steuerrad gelenkt.
Am frühen Abend wollten mich die dichten Schneeflocken einlullen, einschläfern; ich fuhr mit meinem silbernen Freund zwischen Bremgarten und Eggenwil auf einer geraden, übersichtlichen Strasse, auf der ich meistens eine Weile in Gedanken abdriften kann. Dass genau dies verboten ist auf einer glitzernden Schneedecke, bei null Grad Celsius, dessen wurde ich mir erst bewusst, als mein treuer Ford Fiesta mich über die ganze Strassenbreite hin und her schlingerte, als hätte er über 0,5 Promille Alkohol getrunken.
Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Verkehr zu verhindern, griff ein Schutzengel in mein Steuerrad und lenkte das Auto über den rechten Strassenrand, quer über die Wiese und den Fussgängerweg die Böschung hinauf. Ich wartete wie gelähmt darauf, dass sich mein Schlitten auf vier Gummirädern seitlich überschlägt. Doch nein – ein zweiter Schutzengel, etwas fahrtüchtiger als der erste, riss das Steuerrad nach links, so dass der Ford wieder die Böschung hinunterfuhr. Und der dritte Schutzengel brüllte autoritär: «Stopp! Jetzt reicht die Lehre für Annette!»
Das Auto kam zum Stehen, in der ursprünglichen Richtung Eggenwil, allerdings neben der Autostrasse, auf dem Fussgängerweg. Ich erwachte wie aus einem bösen Traum, als eine Fahrerin neben mir anhielt, das Fenster herunterkurbelte und mich fragte: «Kann ich Ihnen helfen?»
«Nein danke, ich komme jetzt wieder auf ihre Fahrbahn!», sagte meine Stimme und ich fuhr wie fremd gesteuert, als ob ich dies schon öfters getan hätte, wieder auf die Strasse, genau vor die freundliche Autolenkerin, die vermutlich auch Flügel unter der Winterjacke trug. Sie hatte das Schauspiel meines Schlittens beobachtet – ich meine nicht den vulgären Ausdruck für alte Autos.
Mit adäquaten dreissig Stundenkilometern, wie sich’s gehört bei glitzernder Fahrbahn, auf der Autos eigentlich nichts zu suchen haben, trottete ich dann die restlichen vier Kilometer im Tempo eines Haflinger Pferdes heimwärts. Ich hatte nun genügend Zeit, um das Tempo der anderen Autolenker zu beobachten; sie alle krochen wie Schnecken, aus der Sicht der sonst rasenden Autofahrer.
Bevor ich ins Schleudern gekommen war, hatte ich das langsame Tempo der anderen Autofahrer plötzlich bemerkt und dann die Geschwindigkeit zu schnell reduziert, ohne an die Folgen zu denken. Der langen Rede kurzer Sinn: Der Mensch ist nicht so anpassungsfähig wie der Pinguin.
November
November
I remember,
Da geh’ ich nie schlendern,
Schon eher schlemmen
In Emmen.
November
In der Sonne das leuchtende Gelb,
Im Walde ich schwelg’.
Dann kommen sie, die Nebelschwaden.
Über sie kann ich nur klagen.
Ich spür’ sie bis in den Magen.
Sie schleichen zwischen die Eichen,
Versuchen alles zu bleichen und anzugleichen.
Bleibt die Hoffnung, dass sie bald entweichen,
Die leichenbleichen.
November in Bremgarten. Tosend stürzen sich die Wasser ins tiefer gelegene Flussbett im Mittellauf – Tummelplatz der Wildwassersportler in sommerlichen Monaten – um sich unter der Holzbrücke mitreissen zu lassen.
Die Bahn hat soeben den Viadukt mit kreischender Geleisemusik passiert.
Über das sonnenerwärmte Gemäuer des Schlossgartens neigen sich mir rosafarbene Rosen entgegen, zum Gruss auf meinem November-Spaziergang. Eine Biene ist bei ihnen zu Besuch, auch im Spätherbst. Wäre ihr nicht zu kalt, würde sie summen: «Ihr seid die schönsten hier!»
Wir sind einander verwandt. Bin ich nicht auch eine Herbstschönheit? Dieser Gedanke bringt mich zum Lachen. Herbstsonnenlicht bringt das Wasser zum Funkeln, hinter gelben Eichenblättern, die golden an Ästen über dem Fluss hängen.
«Wir sind die grössten und ältesten hier neben mittelalterlichen Stadttürmen!», flüstern sich die Platanen zu, stolz auf ihre mächtigen Baumkronen auf dem Schulhausplatz vor dem postkartenblauen Himmel posierend.
Das Licht im November fasziniert mich jedes Jahr von neuem. Ist es das Bewusstwerden, dass die spätherbstlichen Sonnenstrahlen bald von den trüben wolkenbedeckten Tagen fortgejagt werden? Es ist wie mit den Dingen und Menschen, die wir erst in dem Augenblick zu schätzen wissen, wenn wir im Begriff sind, sie zu verlieren.
Kurz nach vier Uhr nachmittags steht die Sonne schon tief, aber noch über der Horizontlinie. Mein Blick wird angezogen von der Brücke, hinter der stolze Schwäne in einer Selbstverständlichkeit dahingleiten, als wüssten sie, dass sie Teil der Reusslandschaft in Rottenschwil sind. Meine Augen können sich an den Spiegelbildern der Weiden nicht satt sehen, die eine magische, verschwommene, impressionistische Welt von Baumkronen auf dem gekräuselten Wasserspiegel kreieren. Diese Impression wäre ein Gala Diner für Claude Monet. Er hat sie schon gemalt, diese Spiegelbilder im Fluss. Nun ist es an mir, sie zu besingen.
Erst wenn sie nie mehr aufgeht, die Sonne, müssen wir sterben. Sie ist untergegangen, in weissem, blendendem Licht. Kein Abendrot hat sie hingezaubert, dafür die Horizontlinie der Berge mit einem Silberstreifen eingefasst, einer Brokatbordüre vergleichbar.
Weihnachten in Salzburg
Ade, Wolfgang Mozart, ich komme wieder! Auch wenn du Salzburg den Rücken kehrtest, um dich in Wien freier zu fühlen. Der Fürsterzbischof Colloredo in Salzburg konnte dich in der Hauptstadt der Musik, in Wien, nicht mehr behandeln wie einen seiner Lakaien, unter denen du mit den andern Bediensteten in der Küche zu speisen hattest.
Das Konzert im Mozarteum, am Weihnachtstag, gab mir mit deiner Kirchensonate in C-Dur eine Ahnung von deinem musikalischen Genius. Georg Friedrich Händel versuchte, dich im gleichen Konzert zur Seite zu drängen mit seinem langen Oratorium «Messias», obwohl er drei Jahre nach deiner Geburt starb.
Das festliche Weihnachtskonzert mit einem Chorklang, rund wie eine Weihnachtskugel, gesungen von hundert Stimmbändern der Knaben und Mädchen des Salzburger Doms, zusammen mit der Jugendkantorei, begleitet von den Streichern und Bläsern der Dom-Musik, war ein Highlight.
Die Reiseteilnehmerinnen, mit denen ich den Bus der Königsklasse und das Hotel Arcotel Castellani teilte, verwandelten mit ihren Krankengeschichten das Vier-Sterne-Hotel in eine Rehaklinik, was die Gespräche betraf. Ich befand mich auf dieser Salzburgreise unter Meinesgleichen.
Beim Frühstück, am ersten Tag, erzählte eine Frau lachend, sie werde jetzt vom Universitätsspital Zürich ferngesteuert. Dabei tastete sie ihre Herzgegend ab auf der Brust und meinte: «Mir kann in Salzburg nichts passieren. Ein zweiter Herzinfarkt ist nicht mehr möglich, weil mein Herz nun konstant ärztlich und technisch überwacht wird.»
Eine andere Salzburg-Begeisterte zeigte mir ihren linken Arm, dem der plastische Chirurg Muskelgewebe entnommen und in die linke Gesichtshälfte transplantiert hatte. In diesem Gesichtsfeld hatte der Onkologe Tumore rausgeschnitten. Sie hätte zehn Stunden Vollnarkose überstanden vor drei Monaten. Diese Frau lud mich Gehbehinderte ein, mich ihr und ihrem Ehemann anzuschliessen für den Rundgang durch die Stadt Innsbruck. Deren bunte Häuserfront am Inn strahlte südeuropäische Wärme aus im kalten Monat Dezember. Meine zweite künstliche Hüftpfanne, armiert mit drei Schrauben und einem Haken, erlaubte nur den langsamen Gang eines Pinguins. Es war auf der Heimreise, im malerischen Innsbruck, genauer im Café Apfelstrudel, dort erklärte sie, weshalb sie Mühe hätte beim Essen. In der linken Gesichtshälfte war der Muskel taub, sie hatte keine Empfindung mehr seit den Haut-Transplantationen.
Im Schloss Hellbrunn, dessen weihnächtlich beleuchtete Wasserbecken und Wasserspiele eine Reise wert waren, hörte ich die Horrorgeschichte einer anderen Frau in unserer Reisegruppe. Sie trage draussen und drinnen ihren wollenen Hut, um ihre Löcher im Kopf zu schützen. Nach der Hirnoperation seien die Schädelknochen nicht mehr zusammengewachsen. Ihr Kopf sei nun, ähnlich wie bei den Neugeborenen, offen. Sie verabschiedete sich nach der Heimfahrt herzlich von mir in der Tiefgarage der Endstation unseres Reisebusses, wo sie und ich im eigenen Auto weiterfuhren.
Am ersten Abend stiessen wir, die zusammen gewürfelten Reiseteilnehmer/-innen, mit einem Glas Rotwein auf eine gute Ferienzeit an. Eine einzige Frau musste darauf verzichten. Ich nahm an, der Grund dafür wären Medikamente, die sie einnehmen musste. Einen Tag später, im Foyer des Mozarteums, wo wir am Weihnachtstag auf das Konzert warteten, erzählte diese Frau ihre Krankengeschichte. Sie überlebe seit zehn Jahren trotz einer Leberzirrhose.
Meine Tischnachbarin erzählte und erzählte von ihren zahlreichen Reisen in Afrika. Ganz nebenbei erwähnte sie den Grund ihres schwachen, stets eingebundenen Handgelenkes. Ein Schlaganfall hätte das Bewegungszentrum in Mitleidenschaft gezogen und damit ihre linke Hand zum Teil gelähmt.
Auf der Heimfahrt glaubte ich, der Chauffeur wolle mit seinem schwarzen Humor uns Fahrgäste unterhalten. Doch nein, seine Worte hatten mit Realität zu tun.
«Wir fahren jetzt zu einem Friedhof spezieller Art – ich pflege immer Lebendige dorthin zu bringen. Ein Sammler von uralten Grabsteinen mit zuweilen lustigen Inschriften, Wünschen für die Verstorbenen, bietet diese zur Besichtigung an.»
Dass der Chauffeur mit seinem schwarzen Humor die bösen Geister herausforderte, ahnte er nicht. Auf eben diesem Friedhof ereignete sich ein Unfall. Ich war als Einzige im Bus geblieben, da die vereiste Strasse mich warnte vor einem dritten Spitalaufenthalt in diesem unheilvollen Jahr. Eine Frau stürzte auf dem eisglatten Boden so, dass sie nicht mehr gehen konnte auf einem Bein. Für den Chauffeur mit dem Körper eines Wrestling Kämpfers war es ein Leichtes, die ältere verletzte Dame die steile Treppe im Bus hochzutragen und Stunden später in Kloten wieder aufs Trottoir zu setzen. Für Touristen mit sechzig, siebzig Lebensjahren auf dem Buckel war der gut gemeinte Rat des Chauffeurs schwer umzusetzen: «Seien Sie vorsichtig auf dem eisglatten Boden!» Kommt ein Fuss ins Rutschen, kann der alte Mensch sein Gleichgewicht nicht ausgleichen ohne seine brüchigen Knochen zu strapazieren.
Die vom Schicksal in der Gesundheit getroffenen Reiseteilnehmerinnen begleiteten meine Gedanken noch länger; sie hatten Salzburg, die Stadt der Musik, besuchen wollen, um an Weihnachten, dank Mozarts Klängen, die Krankheit zu vergessen, zu ertragen.
Krapfen oder Karpfen an Weihnachten
Krapfen mit Quittenmarmelade gefüllt,
Karpfen aus dem Bio-Teich auf dem Weihnachtsteller,
Kraken, die du im Meer besser meidest, bevor sie dich mit Tinte bespritzen,
Kakerlaken, die deine Küche ungeniessbar machen,
allesamt beginnen sie mit K, und schleichen sich als Alliteration, als Stabreim, in meine Gedanken, die sich ursprünglich nur um das Gebäck der Krapfen drehten.
Hals, Nase und Ohren sind seine Lieblinge
Der erste Tag ist der Tag der Untersuchungen, der Besprechungen. Die Aufnahme ist wie ein erster Arbeitstag in einer neuen Firma, in einem neuen Schulhaus: Termine, fremde Türen und fremde Gesichter.
Viele Fragen werden mir, der Patientin, gestellt, aber nicht: «Wo haben Sie früher gearbeitet, unterrichtet?», sondern: «Waren Sie schon einmal bei uns?»
«Ja, ich kenne das Inselspital aufgrund von drei erlittenen Operationen. Da war die Knie Operation, dann das künstliche Daumengelenk, dann die Zyste an der Wirbelsäule…»
«Ach ja, dann kennen Sie unsern Betrieb.»
Diesmal ist der Leidensdruck nicht so immens wie damals mit den unsäglichen, monatelangen Schmerzen im Bein, von einer versteckten Zyste, die auf einen Nerv drückte, verursacht.
Deshalb hätte ich heute der Ärztin, die mich die Operationsrisiken unterschreiben liess, am liebsten gesagt: «Ich habe es mir anders überlegt, ich brauche die Nasenoperation nicht, ich gehe wieder heim!»
Die Risiken dieser Operation sind ein Horrorszenario: Ein Loch im Septum, das heisst in der Nasenscheidewand, Erblindung, die Hirnflüssigkeit läuft aus… mir graut vor meiner Zukunft!
Die junge hübsche Assistenzärztin lächelte verständnisvoll, als ich sie aufmerksam machte auf den Horror, den ich zu unterschreiben hätte. Sie meinte beiläufig: «Alles Routine!» «Ja für die Versicherung und den Arzt, nicht für mich.» kommentierte ich mutlos.
Die zweite Krankenschwester, körperlich übergewichtig, dafür menschlich, fragt mich: «Haben Sie etwas gegen die Angst vor der Operation?»
«Ja einen Kopfhörer mit MP3-Player.»
«Welche Musik mögen Sie denn?»
Selbst diese Frage stellt sie mit Einfühlung trotz ihrer Alltagsroutine eines blutsaugenden Vampirs mit Spritze.
Herr Professor Dr. Schmid will seine Operation gründlich durchführen, alle verstopften Nebenhöhlen reinigen. «Ach wär’ ich doch eine Höhlenbewohnerin, die nichts weiss von Spitälern!» Das Septum, die Nasenscheidewand, will er begradigen. Das klingt wie Flusslaufkorrektur – oder bekomme ich eine künstliche Nase, wie vor Jahren ein künstliches Daumengelenk?
All dies erklärt mir der HNO-Spezialarzt vor einer mich angaffenden Gruppe von Medizinern in Ausbildung. Doch nie zuvor bin ich als Patientin in die Überlegungen eines Chirurgen miteinbezogen worden, indem er alle meine Fragen beantwortete.
Wäre da nicht der nebensächliche Effekt für die Operation, nämlich meine Sympathie für diesen HNO-Doktor, der mir seit der ersten Konsultation mit seiner menschlichen, bescheidenen Art gefiel, wäre nicht diese Sympathie, ich hätte noch mehr Angst vor dem chirurgischen Eingriff, mitten in meinem Gesicht.
Der Narkosearzt, der mich jederzeit ins Jenseits befördern könnte, dem ich mit Haut und Haar ausgeliefert bin, ist ein netter Mann mittleren Alters. Er erklärte: «Ich platziere den Schlauch ausnahmsweise mit einer Kamera, ohne ihren Kopf zu sehr nach hinten zu beugen, schonend also.» Er hat mir gut zugehört, als ich meine chronischen Nackenschmerzen bekanntgegeben habe.
Das Labyrinth im Inselspital, überirdisch, unterirdisch, so viele Gänge mit Kurven, Schildern, ist ähnlich angelegt wie alle Strassen und Verkehrsschilder der Stadt Bern zusammen, nur in verkleinertem Massstab, zusammengeschrumpft auf die Fläche dieses Universitätsspitals – dieser Dschungel macht mir nicht mehr Angst.
In der Etage A macht eine sanfte Pflegefachfrau ein EKG von mir, in einem Zimmer, so klein wie eine Gefängniszelle. Hier in diesem Spital leben sie, das medizinische Personal, auch die Ärzte, auf kleinstem Raum, als wären es chinesische Verhältnisse. Nur die Patienten geniessen Spitalzimmer mit ausreichend Quadratmetern. Ich staune über den freundlichen Ton in dieser hektischen Arbeitswelt, fern jeglichen Luxus’ – von Hightech-Geräten abgesehen – dem wir in jeder Schweizer Bank begegnen.
Im Untergeschoss, wohin mich ein Kalabrischer Krankenpfleger mit blauen Augen begleitet, während er sich über die Hitze Kalabriens beklagt, lege ich mich auf eine fahrbare Liege, die mich nicht in einen SBB-Tunnel, sondern in einen Ring um den Kopf schiebt, damit von meinem Schädel eine Computer Tomographie entsteht. Ohne Widerrede oder skeptische Fragen beisse ich auf eine leere Spritze, die mir ein junger deutscher Arzt zwischen die Zähne schiebt, mit einer Erklärung zu meinem Gebiss im Zusammenhang mit dem CTI, was ich bis heute nicht verstanden habe.
In meinem Spitalzimmer, im neunten Stockwerk, öffne ich das Fenster. An lebensmüde Patienten hat man hier nicht gedacht. Wer seine Nase operieren lässt, will noch weiterleben. Nach so viel Zuwendung hier im Spital habe ich mit Tränen zu kämpfen.
Vor zwei Stunden schien mir das Warten allein in diesem Spitalzimmer – das Bett nebenan ist nicht belegt – ebenso sinnlos wie mein Leben ohne Lebensgefährten. Hier in diesem riesigen Spital gäbe es so viele Männer. Aber die sind wohl alle versorgt mit einer Frau. Eine Umfrage zu dieser Statistik – «Haben sie eine Partnerin?» – steht mir nicht zu, es sei denn, ich tarne mich als Journalistin. Eine Idee, eine verrückte. Zuerst müsste ich von einer Zeitung engagiert werden; wenn ich mich fiktiv als Journalistin vorstellte, könnte der Betrug auffliegen.





























