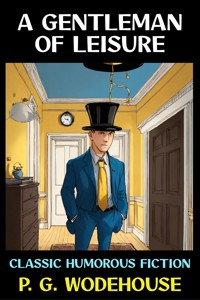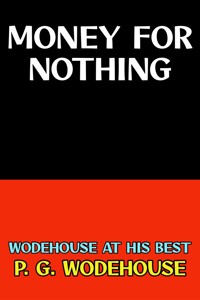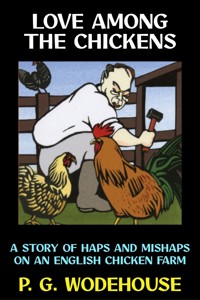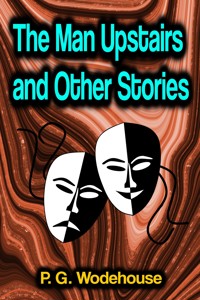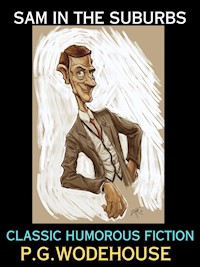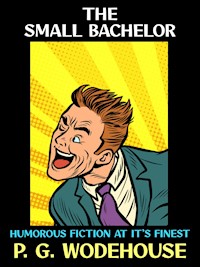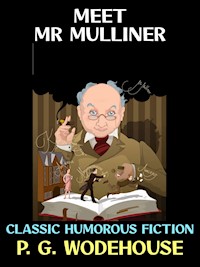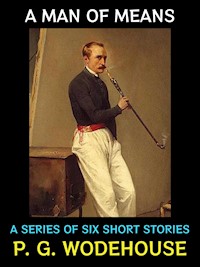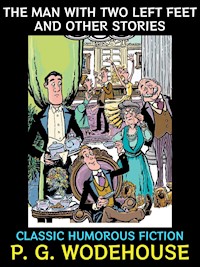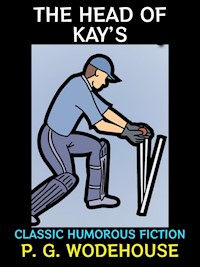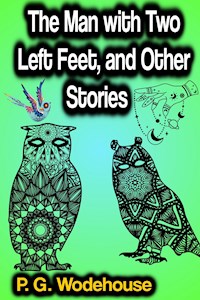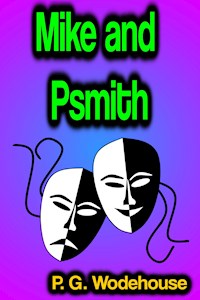8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Mr. Peters, ein rastloser amerikanischer Millionär und Sammler altägyptischer Skarabäen, sucht Entspannung auf Schloß Blandings, dem englischen Landsitz von Lord Emsworth. Nebenbei versucht er seine lebenslustige Tochter unter die Haube zu bringen, standesgemäß, versteht sich. Sie soll Lord Emsworth’ nichtsnutzigen Sohn, heiraten, was nicht ohne Hindernisse abgeht, denn die zukünftigen Verlobten sind schon anderweitig amourös gebunden. Schließlich kommt dem Millionär das kostbarste Stück seiner Skarabäensammlung abhanden, die Jagdsaison auf Schloß Blandings ist eröffnet. „P.G. Wodehouse’ Bücher lesen sich, als wären die literarischen Gesellschafts-Sittenbilder von Jane Austen und die Spass-Guerilla-Truppe Monty Python durch den Fleischwolf gedreht worden.“ Profil
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 352
Ähnliche
Mr. Peters, ein rastloser amerikanischer Millionär und Sammler altägyptischer Skarabäen, sucht Entspannung auf Schloß Blandings, dem englischen Landsitz von Lord Emsworth. Nebenbei versucht er, seine lebenslustige Tochter unter die Haube zu bringen, standesgemäß, versteht sich. Sie soll Lord Emsworth’ nichtsnutzigen Sohn heiraten, was nicht ohne Hindernisse abgeht, denn die zukünftigen Verlobten sind schon anderweitig amourös gebunden. Schließlich kommt dem Millionär das kostbarste Stück seiner Skarabäussammlung abhanden, die Jagdsaison auf Schloß Blandings ist eröffnet.
P. G. Wodehouse, geboren 1881 in Guildford, Surrey, starb 1975 in Long Island, NY. 1902 veröffentlichte er seinen ersten Roman, 95 weitere folgten. Er hat »nicht ein einziges Buch geschrieben, das kein Vergnügen bereiten würde« (Philipp Blom, Neue Zürcher Zeitung).
Im Suhrkamp Verlag sind bisher erschienen: Jetzt oder nie! (st 3774), Onkel Dynamit (st 3775), Ohne mich, Jeeves! (st 3838), SOS, Jeeves! (st 3839), Sein und Schwein (st 3944), Monty im Glück (st 3945), Reiner Wein (st 4104), Wo bleibt Jeeves? (st 4105).
P. G. Wodehouse
In alter Frische
Ein Blandings-Roman
Aus dem Englischen von Thomas Schlachter
Suhrkamp
1. Kapitel
I
Anmutig legte sich der Sonnenglanz eines schönen Frühlingsmorgens auf die Londoner Innenstadt. In Piccadilly schien die erquickende Wärme sowohl den motorisierten Verkehrsteilnehmern wie auch den Fußgängern neuen Schwung zu verleihen: Omnibusfahrer rissen Scherze, und selbst Chauffeure entkräuselten die Lippen zu einem gar nicht mal unfreundlichen Lächeln. Polizisten pfiffen auf ihrem Posten, Angestellte auf ihrem Arbeitsweg, und Bettler packten die Aufgabe, wildfremden Menschen die Kosten für ihre Lebensführung aufzubürden, mit jener schneidigen Zuversicht an, die so viel ausmacht. Kurzum: Es war einer jener glücklichen Vormittage.
Um Punkt neun ging die Haustür der Arundell Street 7A, Leicester Square, auf. Ein junger Mann trat ins Freie.
Kein Flecken in London, den man als »gottverlassen« bezeichnen kann, hat diesen Begriff so verdient wie die Arundell Street, Leicester Square. Schlendert man von der Nordseite des Platzes in Richtung Piccadilly, so nimmt man kaum Notiz von dem engen Durchgang, der in diese winzige Sackgasse führt.
Tag und Nacht tosen die Menschenströme achtlos vorbei. Die Arundell Street ist keine vierzig Meter lang, und auch wenn zwei Hotels daran liegen, sind es keine sehr vornehmen Hotels. Der Ort ist schlicht und einfach gottverlassen.
Von der Form her sieht die Arundell Street exakt wie einer jener flachen Steingutkrüge aus, in denen italienischer Wein der preisgünstigeren Sorte aufbewahrt wird. Der schmale Hals, der vom Leicester Square wegführt, geht unvermittelt in einen kleinen Innenhof über. Zwei Seiten werden von den Hotels beansprucht, und die dritte bietet einer möblierten Unterkunft für mittellose Menschen Platz. Diese Herberge sieht sich unentwegt der Gefahr ausgesetzt, im Namen des Fortschritts abgerissen zu werden und einem dritten Hotel zu weichen. Sie entgeht diesem traurigen Los aber immer wieder und wird wohl noch in Jahrzehnten dort stehen.
Die Absteige verfügt über lauter knapp bemessene Einzelzimmer, in denen das Bett tagsüber sittsam hinter einem ramponierten Paravent verschwindet. Außerdem befinden sich darin ein Tisch, ein Sessel, ein Stuhl, ein Sekretär sowie eine runde Blechwanne, welche wie das Bett in der Versenkung verschwindet, sobald sie ihren Zweck erfüllt hat. Und jedes dieser Zimmer kann man für ein Pfund pro Woche mieten – Frühstück inklusive.
Genau dies hatte Ashe Marson getan. Er hatte das Vorderzimmer im zweiten Stock der Nummer 7A gemietet.
Sechsundzwanzig Jahre bevor diese Geschichte beginnt, war dem Gottesmann Joseph Marson und seiner Frau Sarah, wohnhaft in Much Middlefold, Shropshire, ein Sohn geschenkt worden. Diesen tauften sie auf den Namen Ashe, um einem wohlhabenden Onkel zu willfahren, der die beiden später schmählich übertölpelte, indem er sein ganzes Geld für wohltätige Zwecke wegschenkte. Der zum Mann gereifte Ashe begann in Oxford Theologie zu studieren. Traut man den historischen Quellen, so hielten sich seine theologischen Studien allerdings in engen Grenzen. Hingegen gelang es ihm, die Meile in viereinhalb Minuten (und die halbe Meile entsprechend kürzer) zu laufen. Zudem sicherte ihm sein Interesse an der Kunst des Weitsprungs die Bewunderung seiner Zeitgenossen.
Er trat für seine Universität bei Leichtathletikwettkämpfen an und erfreute Tausende, indem er sowohl die Meile wie die halbe Meile zwei Jahre hintereinander gegen Cambridge im Londoner Queen’s Club gewann. Aufgrund dieser dringenden Verpflichtungen versäumte er es aber leider, auch nur einen Schlag Arbeit zu tun, und so war er, als es Abschied zu nehmen galt, in höchstem Maße ungeeignet für eine akademische Karriere. Da er jedoch eine Art Diplom erworben hatte, das es ihm erlaubte, sich Bakkalaureus zu schimpfen (und da er zudem der festen Überzeugung war, daß die Welt betrogen werden will), bewarb er sich mit Erfolg um eine Reihe von Hauslehrerstellen.
Nachdem er mit dieser grauenvollen Tätigkeit etwas Geld auf die hohe Kante gebracht hatte, zog er nach London und versuchte sein Glück als Journalist. Nach zwei mäßig einträglichen Jahren setzte er sich mit der Mammoth Publishing Company in Kontakt.
Die Mammoth Publishing Company, die mehrere große Zeitungen, einige Wochenblätter sowie ein paar weitere Titel herausbringt, spuckt keineswegs auf das Kleingeld der Bürogehilfen und Lehrlinge. Zu den zahlreichen lukrativen Publikationen gehört nämlich eine broschierte Reihe mit Kriminal- und Abenteuergeschichten. Und genau in dieser fand Ashe sein Betätigungsfeld. Die bei einem Teil der Leserschaft äußerst beliebte Reihe »Ermittler Gridley Quayle« stammte aus seiner Feder. Bis zum Auftauchen von Ashe und Mr. Quayle war die »Bibliothek der britischen Bravour« das Werk verschiedenster Beiträger gewesen, die die Abenteuer verschiedenster Helden ausmalten, doch in Gridley Quayle erblickten die Eigentümer das Ziel all ihrer Bestrebungen, und Ashe erhielt den Auftrag, die gesamte »Bibliothek der britischen Bravour« (monatlich) in Eigenregie zu besorgen. Mit dem kümmerlichen Gehalt, das ihm die Plackerei eintrug, hielt er sich seither über Wasser.
Und deshalb war Ashe an diesem Maimorgen in der Arundell Street, Leicester Square, anzutreffen.
Er war ein großer, gut gebauter, athletischer junger Mann mit leuchtenden Augen und einem markanten Kinn. Und jetzt, da er die Haustür hinter sich zuzog, sah man auch, daß er einen Pullover und eine Flanellhose sowie gummibesohlte Turnschuhe trug. In der einen Hand hielt er zwei Keulen, in der anderen ein Springseil.
Zunächst atmete er die Morgenluft mit jener feierlichen Gemessenheit ein und aus, die ein eingeweihter Beobachter augenblicklich als jene »wissenschaftlich erprobte Atemtechnik« erkannt hätte, die heute so populär ist. Alsdann legte er seine Keulen nieder, griff zum Seil und begann zu hüpfen.
Bedenkt man, mit welchem Abscheu London und andere Großstädte auf jede körperliche Betätigung blicken, die kein praktisches und unmittelbar einsichtiges Ziel verfolgt, so konnte man nur staunen über die Gelassenheit, mit der dieser junge Mann sein Werk verrichtete. Was die Leibesertüchtigung angeht, gelten in London strenge Regeln: Man darf rennen, falls man einem Hut oder einem Omnibus nachhetzt; man darf hüpfen, falls man dadurch einem Taxi auszuweichen versucht oder gerade auf eine Bananenschale getreten ist. Doch falls man rennt, weil man seiner Lunge etwas Gutes tun will, oder hüpft, weil dies der Leber zuträglich ist, bekommt man Londons ganzen Hohn zu spüren. Die Stadt eilt herbei und zeigt mit dem Finger auf einen.
An diesem Morgen nahm die Arundell Street das Schauspiel jedoch hin, ohne mit der Wimper zu zucken. Westwärts stand der Besitzer des Hotels Previtali gegen sein Gästehaus gelehnt und schien mit offenen Augen zu träumen. Nordwärts stützte sich der Besitzer des Hotels Mathis gegen seine Raststätte und war offenbar in Gedanken meilenweit weg. In den Fenstern der beiden Hotels bekam man die obere Hälfte diverser Zimmermädchen zu sehen, von denen kein einziges auch nur eine Sekunde in der Arbeit innehielt, um ein Schmähwort hinunterzuwerfen. Selbst die kleinen Kinder, die sich im Innenhof herumtrieben, sahen von jeder Häme ab, und die Katze, die sich wie gewohnt am Zaun rieb, rieb ohne einen einzigen Seitenblick weiter.
Das Ganze beweist exemplarisch, was ein junger Mann mit Ausdauer und Geduld alles zu erreichen vermag.
Kaum hatte Ashe Marson vor drei Monaten das Vorderzimmer im zweiten Stock der Nummer 7A bezogen, wurde ihm klar, daß er entweder dem Frühsport, ohne den er kaum noch leben konnte, entsagen oder aber Londons ungeschriebenem Gesetz die Stirn bieten und den Spott seiner Bewohner ertragen mußte. Lange zögerte er nicht. Das körperliche Wohlbefinden ging ihm über alles. Beim Thema Gymnastik hörte für ihn der Spaß auf. Er beschloß, London die Stirn zu bieten.
Als er das erste Mal in Pullover und Flanellhose in die Arundell Street trat, fanden sich schon nach einem einzigen Keulenschwung folgende Zuschauer ein:
a) zwei Taxifahrer (wovon einer angetrunken)
b) vier Kellner des Hotels Mathis
c) sechs Kellner des Hotels Previtali
d) sechs Zimmermädchen des Hotels Mathis
e) fünf Zimmermädchen des Hotels Previtali
f) der Besitzer des Hotels Mathis
g) der Besitzer des Hotels Previtali
h) ein Straßenkehrer
i) elf nicht klassifizierbare Müßiggänger
j) siebenundzwanzig Kinder
k) eine Katze.
Sie alle lachten, die Katze inbegriffen, und kriegten sich kaum noch ein. Der angetrunkene Taxifahrer nannte Ashe »Sonnyboy«. Und Ashe schwang weiter seine Keulen.
Einen Monat später – Hartnäckigkeit zahlt sich aus! – war sein Publikum auf die siebenundzwanzig Kinder zusammengeschrumpft. Zwar lachten diese immer noch, aber ohne jenes schallende Selbstvertrauen, das ihnen der wohlwollende Beistand der Erwachsenen verliehen hatte.
Und nun, nach drei Monaten, hatte die Nachbarschaft Ashe und seine Frühgymnastik als Naturschauspiel zu akzeptieren gelernt und schenkte der Sache keinerlei Beachtung mehr.
An diesem Morgen betrieb Ashe Marson das Seilhüpfen mit noch mehr Elan als sonst, was daran lag, daß er mittels körperlicher Ermüdung eine leise Unzufriedenheit zu bannen suchte, die er in sich spürte, seit er aus dem Bett gestiegen war. Gerade im Frühjahr befällt uns die Sehnsucht, in die weite Welt hinauszuziehen, und dies war ein besonders lieblicher Frühlingsmorgen, jene Art von Morgen, an dem etwas in der Luft zu liegen scheint, weshalb man es für ausgeschlossen hält, daß alles in den alten, ausgefahrenen Gleisen weiterrollen wird, ein Morgen also, an dem man das ganz große Abenteuer unmittelbar vor sich wähnt. An einem solchen Morgen sieht man, wie wohlbeleibte ältere Gentlemen plötzlich mit dem Schirm einen übermütigen Schlenker vollführen. Und selbst im Gepfeife des Laufburschen, der plötzlich sieht, wie sich das pralle Leben vor ihm auftut, schwingt ein schriller Optimismus mit. Doch der Südwestwind des Frühjahrs bringt auch Reue mit sich. Wir wittern in der Luft einen Hauch von Unruhe und trauern unserer vertanen Jugend nach.
Bei Ashe jedenfalls verhielt es sich so. Noch als er mit dem Seil hüpfte, bedauerte er, daß er sich in Oxford nicht öfter auf den Hosenboden gesetzt hatte, auf daß er nicht als elender Lohnschreiber eines seelenlosen Verlagshauses ende. Nie war ihm so klargewesen wie jetzt, daß er den Trott, in den er gefallen war, gründlich satt hatte. Die Vorstellung, sich nach dem Frühstück hinsetzen und ein weiteres Abenteuer des Gridley Quayle fabrizieren zu müssen, lähmte ihn wie der zeitungsnotorische »Schlag mit einem stumpfen Gegenstand«. Der bloße Gedanke an Gridley Quayle widerstrebte ihm an diesem Morgen, da ihm die ganze Schöpfung zurief, daß es Sommer werde und dem Mutigen die Welt gehöre.
Die Hüpferei brachte keine Linderung. Er warf das Seil zu Boden und griff nach den Keulen.
Doch auch die Keulen ließen ihn kalt. Da fiel ihm plötzlich ein, daß er schon lange nicht mehr seine Larsen-Übungen gemacht hatte. Vielleicht würden ihm diese ja auf die Sprünge helfen.
Vor geraumer Zeit ersann ein Mann namens Larsen, Leutnant des dänischen Heeres, nach intensiver Beschäftigung mit der menschlichen Anatomie eine Reihe von Übungen, und heute verknäulen sich seine Jünger rund um den Globus gemäß den Bildlegenden seines vorzüglichen Buches zu allerlei Knoten. Von Peebles bis Baffin’s Bay schwingen tagtäglich Tausende von Armen und Beinen von Punkt A nach Punkt B, und schlaffe Muskeln erlangen die Zähigkeit von Kautschuk. Larsens Übungen sind auf dem Gebiet der Gymnastik der letzte Schrei. Sie bringen noch die hinterste Sehne des Körpers ins Spiel. Sie sorgen für angeregte Durchblutung. Und wer sie nur lange genug macht, erwirbt sogar die Fähigkeit, bei Bedarf Bäume auszureißen.
Würdevoll freilich sind sie nicht, und wird man ihrer ohne Vorwarnung zum erstenmal ansichtig, wirken sie ausgesprochen spaßig. Hätte Leutnant Larsen seine vortrefflichen Übungen nur etwas früher erfunden, so wäre ein gewisser König nie in die Verlegenheit gekommen, seine Tochter dem Dummling zur Frau zu geben, nur weil dieser sie zum Lachen gebracht hatte.
So selbstvergessen, so unbefangen, ja so unverschämt war Ashe in den drei Monaten geworden, die er gebraucht hatte, bis die Öffentlichkeit sein gesamtes Wirken mit mildem Auge betrachtete, daß ihm nie in den Sinn gekommen wäre, er tue etwas Lustiges, als er seinen Körper gemäß Larsens Instruktionen zu Übung Nummer eins unvermittelt in die Form eines Korkenziehers verdrehte. Und die Haltung der Anwesenden konnte ihn in dieser Ansicht nur bestätigen. Der Besitzer des Hotels Mathis betrachtete ihn mit steinerner Miene. Der Besitzer des Hotels Previtali hätte in Trance schweben können, so vollkommen entrückt wirkte er. Die Hotelangestellten gingen leidenschaftslos ihren Pflichten nach. Die Kinder hatten weder Augen noch Ohren für ihn. Die Katze gegenüber schärfte, seiner nicht achtend, am Zaun ihre Wirbelsäule.
Doch noch während er sich entknäulte und wieder eine normale Haltung annahm, zerriß unmittelbar hinter ihm ein glockenhelles Lachen die stille Morgenluft. Auf einer Brise wehte es zu ihm herüber und traf ihn wie ein Geschoß.
Vor drei Monaten hätte Ashe das Lachen als unvermeidlich hingenommen und sich davon überhaupt nicht aus dem Konzept bringen lassen. Doch das lange Ausbleiben allen Spottes hatte seine Standhaftigkeit angekratzt. Verstört schnellte er herum und lief schamrot an.
Aus dem vorderen Fenster im ersten Stock der Nummer 7A beugte sich eine junge Frau. Die Frühlingssonne spielte auf ihrem goldenen Haar und ließ ihre strahlenden blauen Augen aufblitzen, die ebenso gebannt wie amüsiert auf Ashes flanell- und pulloverumhüllte Gestalt starrten. Als er sich umdrehte, traf ihn ihr Lachen erneut.
Etwa zwei Sekunden lang sahen sich die beiden in die Augen. Dann verschwand die junge Frau im Zimmer.
Ashe war platt. Vor drei Monaten hätte eine Million junger Frauen über seine Morgengymnastik lachen können, ohne daß er ins Wanken gekommen wäre. Und jetzt brachte ihn eine Spottdrossel im Alleingang zur Strecke! Die Schwermut, von der Gymnastik schon fast vertrieben, schlug abermals über ihm zusammen. Er hatte nicht die Courage weiterzumachen. Betrübt packte er seine Siebensachen und kehrte ins Zimmer zurück. Selbst das kalte Bad, das er dort nahm, vermochte ihn nicht zu stimulieren.
Als Festmahl konnte man das (in der Miete inbegriffene) Frühstück, welches die Pensionswirtin, eine gewisse Mrs. Bell, zu servieren pflegte, schwerlich bezeichnen. Nachdem sich Ashe mit dem zerzausten Spiegelei, der lästerlicherweise als Kaffee benamsten Zichorienbrühe und dem verkohlten Speck abgegeben hatte, steckte er endgültig im Würgegriff des Trübsinns. Und als er sich zum Schreibtisch schleppte, um das neueste Abenteuer des Ermittlers Gridley Quayle auszuhecken, entrang sich seiner Brust ein tiefer Seufzer.
Das glockenhelle Lachen von vorhin noch im Ohr, wünschte er sich, daß er Gridley Quayle nie erfunden hätte, daß der niedere Stand der britischen Leserschaft diesen nie zum Helden erkoren hätte – und daß er, Ashe, mausetot wäre.
Die unheilige Allianz bestand seit gut zwei Jahren, und von Monat zu Monat spürte Ashe stärker, wie unmenschlich dieser Gridley im Grunde war. Er tat immer furchtbar selbstgefällig und hatte keinerlei Augen dafür, daß er nur dank aberwitzigster Zufälle überhaupt je die Chance bekam, irgend etwas herauszufinden. Sich seinen Lebensunterhalt mit Gridley Quayle verdienen zu müssen, war gleichbedeutend damit, an ein furchterregendes Ungeheuer gekettet zu sein.
Als Ashe an diesem Morgen so dasaß und auf seinem Füller herumkaute, erreichte seine Verachtung für Gridley einen neuen Höhepunkt. Er hatte sich beim Schreiben dieser Geschichten angewöhnt, zunächst einen guten Titel zu finden und diesem anschließend ein Abenteuer aufzupfropfen. Und in der vergangenen Nacht hatte er eine Eingebung gehabt und flugs diese Worte auf einen Briefumschlag gekritzelt:
DAS ABENTEUER DES TODESSTABS
Mit dem angewiderten Blick eines Vegetariers, der in seinem Salat gerade eine Raupe entdeckt hat, starrte er auf besagte Worte.
Der Titel hatte sich in der Nacht sehr vielversprechend ausgenommen, so voller kühner Möglichkeiten. Zwar verströmte er immer noch einen gewissen Reiz, doch stachen seine Mängel jetzt, da Ashe die Geschichte niederschreiben wollte, mehr und mehr ins Auge.
Was war ein Todesstab? Der Name klang ja ganz gut, doch bei Licht betrachtet stellte sich die Frage: Was mochte das nur sein? Man kann keine Geschichte über einen Todesstab schreiben, ohne zu wissen, was ein Todesstab ist. Umgekehrt kann man sich auch nicht einen solchen Prachttitel ausdenken und ihn im nächsten Moment über Bord werfen.
Ashe raufte sich die Haare und biß in den Füller.
Es klopfte an die Tür.
Ashe wirbelte herum. Das war ja zum Auswachsen! Nicht nur einmal, sondern bestimmt zwanzigmal hatte er Mrs. Bell eingeschärft, ihn am Morgen niemals und unter keinem auch noch so triftigen Vorwand zu stören. Daß seine Arbeitszeit in solcher Weise beschnitten wurde, war schlicht inakzeptabel. Im Geiste legte er sich bereits einige gepfefferte Einstiegsfloskeln zurecht.
»Herein!« brüllte er, gewappnet fürs Gefecht.
Eine junge Frau trat ein, die Frau aus dem Vorderzimmer im ersten Stock, die Frau mit den blauen Augen, die Frau, die über seine Larsen-Übungen gelacht hatte.
II
Verschiedene Umstände trugen zu der Jämmerlichkeit der Figur bei, die Ashe zu Beginn der sich entspinnenden Unterhaltung abgab. Erstens erwartete er die Pensionswirtin, die knapp einen Meter vierzig maß, so daß ihm angesichts einer Frau von einem Meter siebzig zunächst alles etwas unscharf erschien. Zweitens hatte er in Erwartung einer ins Zimmer tretenden Mrs. Bell eine äußerst grimmige Miene aufgesetzt, und es war gar nicht so einfach, aus dieser spontan ein wohlmeinendes Lächeln zu zaubern. Und drittens ist ein Mann, der seit einer halben Stunde vor einem Blatt sitzt, auf dem die Worte
DAS ABENTEUER DES TODESSTABS
stehen, und der sich darüber klar zu werden versucht, was ein Todesstab ist, nie ganz Herr seiner Sinne.
Dies führte dazu, daß sich Ashe eine halbe Minute lang recht närrisch aufführte. Er glotzte und wimmerte. Ein zufällig des Wegs kommender Nervenspezialist hätte seine Diagnose gestellt, ohne weiterer Abklärungen zu bedürfen. Es verging einige Zeit, bis Ashe auf die Idee kam, sich von seinem Stuhl zu erheben. Dies tat er, indem er mit einer halben Drehung hochsprang, was praktisch einer Larsen-Übung gleichkam.
Doch auch die junge Frau wirkte betreten. In einem entspannteren Moment hätte Ashe auf ihrer Wange gewiß jene Röte gesehen, die erkennen ließ, daß sie die Situation ebenfalls strapaziös fand. Da aber Frauen von Natur aus über größere Souveränität verfügen, ergriff sie als erste das Wort.
»Ach, Verzeihung, offenbar störe ich.«
»Aber nein«, erwiderte Ashe. »O nein, durchaus nicht, durchaus nicht, nein, o nein, durchaus nicht, nein«, sagte er und hätte das Thema bestimmt noch weiter ventiliert, wäre die Frau nicht fortgefahren.
»Ich wollte mich entschuldigen, weil ich so flegelhaft war, Sie auszulachen. Ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat, es war idiotisch. Bitte verzeihen Sie mir.«
Die Naturwissenschaft mag schon tausend Erfolge auf ihrem Konto verbucht haben, doch hat sie jene Antwort noch nicht gefunden, nach der ein peinlich betretener junger Mann hascht, den eine schöne junge Frau gerade um Verzeihung gebeten hat. Schweigt er, so wirkt er wie eine beleidigte Leberwurst. Spricht er dagegen, steht er da wie ein Volltrottel. Ashe, der zwischen diesen beiden Möglichkeiten schwankte, erblickte plötzlich das Blatt, über dem er schon so lange brütete.
»Was ist ein Todesstab?« fragte er.
»Wie bitte?«
»Ein Todesstab.«
»Ich kann Ihnen nicht ganz folgen.«
Die Absurdität des Gesprächs war zuviel für Ashe. Er prustete los. Im nächsten Augenblick schon folgte die junge Frau seinem Beispiel. Und zugleich verflüchtigte sich jede Peinlichkeit.
»Sie halten mich wohl für verrückt, wie?« fragte Ashe.
»Selbstverständlich«, antwortete die junge Frau.
»Ich wäre wohl tatsächlich verrückt geworden, wenn Sie nicht gekommen wären.«
»Und warum?«
»Weil ich eine Kriminalgeschichte zu Papier bringen muß.« »Ich habe mich schon gefragt, ob Sie Schriftsteller sind.«
»Wieso – schreiben Sie auch?«
»Ja. Lesen Sie je ›Neues aus der Gerüchteküche‹?«
»Niemals!«
»Dazu kann ich Ihnen nur gratulieren. Ein entsetzliches Käseblatt mit lauter Schnittmusterbögen sowie einem Kummerkasten für die Liebeskranken. Ich schreibe jede Woche unter verschiedenen Pseudonymen eine Kurzgeschichte. Ein Herzog oder ein Graf gehört zur Grundausstattung. Ich kann das Zeug nicht ausstehen.«
»Es schmerzt mich, von Ihren Nöten zu hören«, fuhr Ashe dazwischen, »aber wir kommen leider vom Thema ab. Was ist ein Todesstab?«
»Ein Todesstab?«
»Ein Todesstab.«
Die junge Frau runzelte nachdenklich die Stirn.
»Na, das ist doch der heilige Ebenholzstock, der aus dem indischen Tempel gestohlen wurde und angeblich für jeden, der ihn besitzt, den sicheren Tod bedeutet. Der Held bringt ihn an sich, und die Priester setzen ihm nach und schicken ihm Drohbriefe. Was sollte er sonst wohl sein?«
Ashe überschlug sich vor Begeisterung.
»Genial!«
»Aber nein.«
»Doch, schlicht genial! Ich sehe die Sache genau vor mir. Der Held engagiert Gridley Quayle, und dieser eingebildete Pinsel löst das Rätsel dank einer Reihe haarsträubender Zufälle. Und damit hätte ich meine Arbeit für einen weiteren Monat im Kasten!«
Sie betrachtete ihn mit Interesse.
»Sind Sie der Autor von ›Gridley Quayle‹?«
»Sagen Sie bloß nicht, Sie lesen das Zeug?«
»Ich lese das Zeug ganz entschieden nicht! Aber es erscheint im selben Verlag wie ›Neues aus der Gerüchteküche‹, weswegen mein Blick im Vorzimmer der Chefredakteurin manchmal auf eine Umschlagillustration fällt.«
Ashe kam sich vor wie ein Mann, der auf einer einsamen Insel einem Jugendfreund begegnet: So vieles verband ihn mit dieser Frau.
»Sie publizieren auch bei Mammoth? Dann sind wir ja Leidensgenossen – Sklaven auf derselben Galeere sozusagen. Wir sollten Freunde sein. Sollen wir Freunde sein?«
»Liebend gern.«
»Sollen wir uns die Hand geben, Platz nehmen und uns gemütlich austauschen?«
»Aber ich halte Sie doch vom Arbeiten ab.«
»Ein reiner Liebesdienst!«
Sie nahm Platz. Platz zu nehmen ist etwas furchtbar Simples, doch wie in vielem anderen zeigt sich darin der wahre Charakter eines Menschen. Ashe fand die Art, wie diese Frau es tat, überaus gewinnend. Weder setzte sie sich auf die äußerste Kante des Stuhls, so als wollte sie im nächsten Moment die Flucht ergreifen, noch fläzte sie sich in den Sessel, als gedächte sie, das ganze Wochenende zu bleiben. Sie bewältigte die außergewöhnliche Situation mit einem ungekünstelten Selbstvertrauen, das er nur bewundern konnte. Auf Etikette wurde in der Arundell Street nicht sehr viel Wert gelegt, doch hätte eine junge Bewohnerin des Vorderzimmers im ersten Stock durchaus erstaunt und zaghaft auf die Einladung zu einem vertraulichen Gespräch reagieren können, welche von dem jungen Bewohner des Vorderzimmers im zweiten Stock ausgesprochen worden war, einem Bewohner wohlgemerkt, den sie erst fünf Minuten kannte. Doch Menschen, die in großen Städten auf kleinem Fuß leben, bilden eine verschworene Gemeinschaft.
»Sollen wir uns vorstellen?« fragte Ashe. »Oder haben Sie meinen Namen schon von Mrs. Bell erfahren? Ach übrigens, Sie sind gerade erst eingezogen, stimmt’s?«
»Ich habe mein Zimmer vorgestern bezogen. Aber wenn Sie der Autor von Gridley Quayle sind, dann heißen Sie doch Felix Clovelly, oder nicht?«
»Gott bewahre! Sie glauben wohl nicht im Ernst, irgend jemand heiße Felix Clovelly? Nein, das ist nur der Mantel, den ich über meine Scham breite. In Wahrheit heiße ich Marson. Ashe Marson. Und Sie?«
»Valentine. Joan Valentine.«
»Wollen Sie mir zuerst Ihre Lebensgeschichte erzählen, oder soll ich mit meiner anfangen?«
»Ich glaube nicht, daß ich mit einer richtigen Lebensgeschichte aufwarten kann.«
»Nur nicht so schüchtern!«
»Nein, wirklich nicht.«
»Denken Sie scharf nach. Wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Sie wurden geboren?«
»Ja, soviel ist richtig.«
»Und wo?«
»In London.«
»Na also, die Sache nimmt langsam Form an. Ich wurde in Much Middlefold geboren.«
»Tut mir leid, der Name sagt mir nichts.«
»Seltsam, wo ich umgekehrt Ihren Geburtsort ziemlich gut kenne. Aber ich habe Much Middlefold ja auch noch nicht berühmt gemacht und bezweifle, ob ich dies je tun werde. Langsam dämmert mir nämlich, daß ich ein Versager bin.« »Wie alt sind Sie denn?«
»Sechsundzwanzig.«
»Sie sind sechsundzwanzig und nennen sich schon einen Versager? Sie sollten sich was schämen!«
»Und wie würden Sie einen Sechsundzwanzigjährigen nennen, dessen einzige Einkommensquelle Gridley-Quayle-Geschichten sind? Etwa den Gründer eines Weltreichs?«
»Woher wollen Sie wissen, daß das Ihre einzige Einkommensquelle ist? Warum versuchen Sie es nicht mit was ganz anderem?«
»Als da wäre?«
»Woher soll ich das wissen? Was immer Ihnen in den Schoß fällt. Gütiger Himmel, Mr. Marson, Sie leben in der größten Stadt der Welt, wo einem das Abenteuer aus sämtlichen Richtungen entgegenschreit …«
»Ich muß wohl taub sein. Mir schreit immer nur Mrs. Bell entgegen, wenn sie die Wochenmiete eintreibt.«
»Lesen Sie die Zeitung. Lesen Sie die Kleinanzeigen. Früher oder später werden Sie darin etwas finden. Lassen Sie bloß keinen Schlendrian einziehen! Suchen Sie das Abenteuer! Packen Sie die nächste Gelegenheit beim Schopf!«
Ashe nickte.
»Nicht aufhören!« sagte er. »Reden Sie weiter. Sie stacheln mich an.«
»Aber wieso wollen Sie von einer Frau wie mir angestachelt werden? London erledigt das doch ganz allein. Sie können jederzeit etwas Neues finden, oder? Hören Sie, Mr. Marson, vor fünf Jahren war ich plötzlich auf mich allein gestellt. Die Gründe sollen uns hier nicht interessieren. Seither habe ich als Verkäuferin gearbeitet, Schreibmaschine geschrieben, auf der Bühne gestanden, mich als Gouvernante und Kammerzofe verdingt …«
»Wie bitte? Als Kammerzofe?«
»Warum nicht? Es war eine wertvolle Erfahrung, und ich kann Ihnen versichern, daß ich das Leben einer Kammerzofe dem einer Gouvernante bei weitem vorziehen würde.«
»Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Ich war früher einmal Hauslehrer. Gouvernanten sind wahrscheinlich das weibliche Pendant. Oft habe ich mich gefragt, was General Sherman wohl über das Leben eines Hauslehrers gesagt hätte, wo er sich schon über Kinkerlitzchen wie den Krieg in derart markigen Worten ausließ. Hat Ihnen das Leben als Kammerzofe Spaß gemacht?«
»Ja, Spaß hat es durchaus gemacht und mir überdies Gelegenheit gegeben, den Adel in seinem natürlichen Habitat zu erforschen, wodurch ich in unserer Zeitschrift als unangefochtene Autorität gelte, wenn es um Herzoge und Grafen geht.«
Ashe holte tief Atem – nicht im Sinne der »wissenschaftlich erprobten Atemtechnik«, aber doch voller Bewunderung. »Sie sind ’ne Wucht!«
»’ne Wucht?«
»Ja, Sie haben so viel Mumm!«
»Ich gebe eben nicht gleich auf. Ich bin dreiundzwanzig und habe es noch nicht sehr weit gebracht, aber es würde mir nie einfallen, auf der faulen Haut zu liegen und mich eine Versagerin zu nennen.«
Ashe verzog das Gesicht.
»Schon gut, ich hab’s begriffen.«
»Das war ja auch der Zweck der Übung«, sagte Joan ruhig. »Hoffentlich habe ich Sie mit meiner Autobiographie nicht gelangweilt, Mr. Marson. Als leuchtendes Beispiel würde ich mich nicht bezeichnen, aber ich hab’s gern lebhaft und hasse jeden Stillstand.«
»Sie sind einfach wunderbar«, sagte Ashe. »Sie sind der fleischgewordene Fernkurs zum Thema Tüchtigkeit. Die Anzeigen für solche Kurse finden sich immer auf den hinteren Seiten gewisser Zeitschriften. Sie beginnen stets mit dem Satz ›Junger Mann, verdienen Sie genug?‹ und zeigen eine Illustration, auf der ein Lohnsklave den Sessel seines Chefs anschmachtet. Sie würden noch eine Qualle elektrisieren.« »Wo ich sogar Sie angestachelt habe …«
»Wahrscheinlich«, sagte Ashe versonnen, »war das schon wieder eine Beleidigung, aber ich habe es nicht anders verdient. Jawohl, Sie haben mich angestachelt. Ich fühle mich wie neugeboren. Es ist schon merkwürdig, daß Sie mir ausgerechnet in diesem Moment begegnet sind. So rastlos und unzufrieden wie heute morgen habe ich mich noch selten gefühlt.«
»Das liegt am Frühling.«
»Gut möglich. Ich würde mich am liebsten auf ein großes Abenteuer stürzen.«
»Na dann los! Auf Ihrem Schreibtisch liegt die Morning Post. Haben Sie sie schon gelesen?«
»Bloß überflogen.«
»Auch die Kleinanzeigen? Nein? Dann lesen Sie sie jetzt. Vielleicht findet sich darin genau die Gelegenheit, auf die Sie warten.«
»Na schön, versprochen, auch wenn ich stets die Erfahrung mache, daß es in solchen Kleinanzeigen von Menschenfreunden wimmelt, die anderen gegen einen bloßen Schuldschein eine beliebige Summe zwischen zehn und hunderttausend Pfund überlassen wollen. Aber gut, ich werde einen Blick hineinwerfen.«
Joan erhob sich und streckte die Hand aus.
»Auf Wiedersehen, Mr. Marson. Sie müssen jetzt Ihr Kriminalabenteuer zu Papier bringen, und ich sollte mir bis heute abend irgendeine Geschichte mit einem Grafen ausdenken.« Sie lächelte. »Wir haben uns ziemlich weit von unserem Ausgangspunkt entfernt, aber bevor ich Sie verlasse, möchte ich noch einmal darauf zurückkommen. Es tut mir leid, daß ich Sie heute morgen ausgelacht habe.«
Leidenschaftlich umklammerte Ashe ihre Hand.
»Mir überhaupt nicht! Kommen Sie mich auslachen, wann immer Sie wollen. Ich werde gern ausgelacht. Als ich mit meinem Frühsport angefangen habe, beehrte mich noch halb London und kugelte sich auf dem Asphalt. Inzwischen gelte ich nicht mehr als Attraktion und fühle mich entsprechend einsam und verlassen. Es gibt neunundzwanzig Larsen-Übungen, und Sie haben bloß einen kleinen Teil der ersten gesehen. Sie haben so viel für mich getan, daß es mich mit Stolz erfüllen würde, wenn Sie dank mir den jungen Tag jeweils mit einem Lächeln begrüßen könnten. Übung Nummer sechs ist komisch, ohne vulgär zu sein. Morgen früh werde ich mit ihr beginnen. Heiß empfehlen kann ich außerdem Übung Nummer elf. Die dürfen Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen.«
»Ich will’s mir merken. Auf Wiedersehen.«
»Auf Wiedersehen.«
Und verschwunden war sie. Ashe starrte, von eigenartigen Gefühlen übermannt, auf die Tür, die hinter ihr ins Schloß gefallen war. Er kam sich vor, als hätte ihn ein mächtiger Stromstoß aus dem Schlaf gerissen.
Eine wunderbare Frau … Eine erstaunliche Frau … Eine phantastische Frau …
Unmittelbar neben dem Blatt Papier, auf das er den nun hellleuchtenden und äußerst vielsagenden Titel seiner neuen Gridley-Quayle-Geschichte notiert hatte, lag die Morning Post, deren Kleinanzeigen zu durchforsten er der jungen Frau versprochen hatte. Daß er sich sogleich dahinterklemmte, war er ihr schuldig.
Sein Elan flaute rasch ab. Es war doch immer dasselbe: Ein gewisser Brian Mac Neill verkehrte zwar geschäftlich nicht mit Minderjährigen, war aber gern bereit, ja geradezu begierig, seine irdischen Reichtümer jedweder Person zu überschreiben, die den 21. Geburtstag hinter sich hatte und in einem finanziellen Engpaß steckte. Dieser noble Mensch legte keinen Wert auf Sicherheiten. Genausowenig taten dies die ihm an Generosität kaum nachstehenden Herren Angus Bruce, Duncan Macfarlane, Wallace Mackintosh und Donald McNab. Zwar ließen auch sie eine sonderbare Abneigung gegen geschäftliche Kontakte mit Minderjährigen erkennen, doch wer etwas reifer an Jahren war, durfte in ihr Büro spazieren und mit beiden Händen zugreifen.
Unterhalb dieser Annoncen stand die herzergreifende Bitte eines »Jungen Mannes christlichen Glaubens«, der unverzüglich tausend Pfund haben wollte, um seine Erziehung mit einer großen Bildungsreise abzurunden.
Ermattet warf Ashe die Zeitung weg. Er hatte ja gewußt, daß es zwecklos war. Das echte Abenteuer war tot, und unerwartete Dinge brachen kaum noch ins Leben ein.
Er griff nach seinem Füller und machte sich daran, das »Abenteuer des Todesstabs« niederzuschreiben.
2. Kapitel
I
In einem Schlafzimmer auf der vierten Etage des Hotels Guelph in Piccadilly saß der Honourable Frederick Threepwood mit angezogenen Knien im Bett und starrte weidwunden Blicks in die Welt. Zwar gebot er über sehr wenig Geist, doch was davon vorhanden war, litt Qualen.
Ihm war etwas eingefallen.
So ist das oft im Leben. Man wacht auf und fühlt sich springlebendig. Man schaut aus dem Fenster, erblickt die Sonne und dankt dem Himmel für den prächtigen Tag. Man plant ein opulentes Mittagsmahl mit ein paar Kumpeln, die man am Vorabend im National Sporting Club kennengelernt hat, und – rums! – fällt einem etwas ein.
»Verflixt und zugenäht!« rief der Honourable Freddie. Und nach kurzer Pause: »Und dabei war mir gerade so verflixt wohl!«
Einige Minuten sinnierte er trüb vor sich hin. Schließlich griff er hinüber zum Nachttisch, nahm den Hörer von der Gabel und ließ sich verbinden.
»Hallo?«
»Hallo?« kam die sonore Antwort vom anderen Ende.
»Sag mal, bist das du, Dickie?«
»Wer spricht da?«
»Ich bin’s, Freddie Threepwood. Hör mal, Dickie, altes Haus, ich muß da was satanisch Wichtiges mit dir bereden. Bist du um zwölf im Büro?«
»Na klar. Was gibt’s?«
»Das kann ich dir am Telefon unmöglich sagen, aber es ist verteufelt ernst.«
»Also schön. Ach übrigens, Freddie, herzlichen Glückwunsch zur Verlobung!«
»Danke, Alter. Schönen Dank et cetera, aber du vergißt doch nicht, um zwölf da zu sein? Gut, dann also bis später.«
Eilends legte er den Hörer auf und hüpfte aus den Federn, denn er hatte gehört, wie der Türknauf umgedreht worden war. Als die Tür aufging, spielte Freddie perfekt die Rolle eines jungen Mannes, der ohne Aufschub seine Morgentoilette in Angriff nimmt.
Ein älterer Herr mit schmalen Gesichtszügen, einem kahlen Schädel und einem liebenswürdig-zerstreuten Gebaren trat ein. Er betrachtete den Honourable Freddie mit einem gewissen Mißfallen.
»Stehst du erst auf, Frederick?«
»Grüß dich, Paps. Guten Morgen. Bin gleich soweit.«
»Du solltest seit zwei Stunden auf den Beinen sein. Herrliches Wetter heute.«
»Ich bin gleich soweit, Paps. Ich hüpf’ nur schnell in die Wanne und zieh mir was über.«
Er verschwand im Badezimmer. Sein Vater setzte sich auf einen Stuhl, legte die Fingerkuppen aufeinander und verharrte reglos in dieser Haltung, welche Unmut und unterdrückten Groll verriet.
Wie manch anderem Vater seiner Klasse bereitete dem Grafen von Emsworth jenes Problem Sorge, welches praktisch die einzige Fliege im Bernstein des britischen Adels ist: Was stellt man bloß mit den jüngeren Söhnen an? Der jüngere Sohn wird, da beißt die Maus keinen Faden ab, nicht benötigt. Wie lange man auch auf einen britischen Blaublütler einredet, wie überzeugend man ihm einerseits vor Augen führt, daß er sich in einer sehr viel komfortableren Lage befindet als der männliche Kabeljau, welcher sich Knall und Fall mit der Aufgabe konfrontiert sieht, für eine Million Nachkommen zu sorgen, und ihn andererseits daran erinnert, daß er mit jedem zusätzlichen Kind einen weiteren Stein im Brett des ehemaligen Präsidenten Theodore Roosevelt hat – aufzuheitern vermag man ihn damit nicht. Er hat keine Verwendung für den jüngeren Sohn.
Doch der Honourable Freddie war nicht nur ein jüngerer Sohn und als solcher eine grundsätzliche Plage. Darüber hinaus reizte er seinen Vater immer wieder auf ganz spezifische Weise. Der Graf von Emsworth war so veranlagt, daß ihn kein Mensch oder Ding je richtig in Harnisch bringen konnte, doch Freddie hatte es in dieser Hinsicht weiter gebracht als irgendwer sonst. Seine nervtötenden Hampeleien erfolgten mit einer Stetigkeit, die auf den friedsamen Edelmann einwirkte wie tropfendes Wasser auf einen Stein. Einzelne Belästigungen hätten niemals ausgereicht, seinen Seelenfrieden zu stören, doch Freddie hatte seit seiner Schulzeit in Eton ohn’ Unterlaß Bomben unter ihm gezündet.
Von besagter Schule flog er, weil er eines Nachts türmte und sich mit einem angeklebten Schnurrbart in den Straßen Windsors herumtrieb. In Oxford relegierte man ihn, weil er aus einem Fenster im zweiten Stock seines College Tinte auf einen Dozenten leerte. Und nicht einmal zwei kostspielige Jahre bei einem Einpauker in London reichten aus, ihm Aufnahme in die Armee zu verschaffen. Außerdem häufte er eine rekordverdächtige Summe an Wettschulden an und scharte en passant den halbseidensten (und mehrheitlich mit dem Pferdesport in loser Verbindung stehenden) Freundeskreis um sich, den ein Mann seines Alters je um sich geschart hat.
Solche Dinge strapazieren noch die Geduld des friedfertigsten Vaters, und schließlich hatte Lord Emsworth ein Machtwort gesprochen. Befeuert von einer über Jahre angestauten Erbitterung, handelte er zum erstenmal in seinem Leben wirklich entschlossen. Er strich seinem Sohn das Taschengeld, beorderte ihn zurück nach Blandings Castle und legte ihn so eisern an die Kette, daß Freddie bis zum Vortag, an dem die beiden im Nachmittagszug nach London gefahren waren, diese Stadt fast ein Jahr lang nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte.
Daß Freddie in diesem Moment ein mißtönendes Liedchen anstimmte, mochte an der Einsicht liegen, daß er ungeachtet aller an ihm nagenden Sorgen wieder in seiner geliebten Metropole weilte. Er planschte und trällerte gleichzeitig.
Lord Emsworths Miene verfinsterte sich noch mehr, und er trommelte ärgerlich mit den Fingerkuppen gegeneinander. Schließlich aber glättete sich seine Stirn, und ein seliges Lächeln huschte über die Lippen. Auch ihm war etwas eingefallen.
Lord Emsworths Einfall sah wie folgt aus: Im Spätherbst des vergangenen Jahres hatte ein gewisser Mr. Peters das unmittelbar neben Blandings Castle liegende Anwesen gemietet. Dieser Amerikaner hatte nicht nur ein Millionenvermögen und chronische Verdauungsbeschwerden, sondern auch eine hübsche Tochter namens Aline. Die beiden Familien hatten sich kennengelernt. Man hatte Freddie mit Aline zusammengebracht. Und vor wenigen Tagen war das Verlöbnis zwischen den beiden bekanntgegeben worden, was aus Sicht des Grafen den einzigen Makel tilgte, der diese beste aller Welten verunziert hatte.
Der Gesang im Badezimmer wurde immer lauter, doch nun lauschte ihm Lord Emsworth mit unbewegter Miene. Es ist schon erstaunlich, wie viel wohler einem Mann ums Herz ist, kaum leuchtet ihm die Aussicht, seinen jüngeren Sohn loszuwerden. Fast ein Jahr lang war der in Blandings eingekerkerte Freddie seinem Vater mit nie erlahmender Vehemenz auf die Nerven gegangen. Blandings war ein großes Schloß, doch nicht so groß, als daß sich Vater und Sohn nicht zuweilen begegnet wären, bei welchen Gelegenheiten das Märtyrergebaren des jungen Mannes seinen Vater furchtbar ergrimmte. Für Lord Emsworth waren die Parkanlagen von Blandings das sprichwörtliche Paradies auf Erden. Freddie aber rebellierte gegen den unfreiwilligen Aufenthalt und schlich mit einer Leichenbittermiene herum, die selbst in Sibirien Anstoß erregt hätte.
Jawohl, er war froh, daß Freddie Aline Peters versprochen war. Er mochte Aline. Er mochte Mr. Peters. Und so groß war seine Erleichterung, daß er sogar Freddie gegenüber so etwas wie Zuneigung empfand, als dieser nun, in einen rosaroten Mantel gehüllt, aus dem Badezimmer trat und freudig feststellte, daß sich der väterliche Unmut in Luft aufgelöst hatte und Friede auf Erden herrschte.
Dennoch kleidete er sich spornstreichs an. Vollkommen ungezwungen fühlte er sich in Gesellschaft seines Vaters nie und wollte deshalb möglichst schnell woanders weilen. So energisch sprang er in seine Hose, daß er sich beinahe selbst ein Bein stellte.
Und als er sich gerade freistrampelte, erinnerte er sich einer Sache, die ihm entfallen war.
»Ach, übrigens, Paps, ich habe gestern abend einen alten Kumpel getroffen und für die nächsten Tage nach Blandings eingeladen. Das ist doch in Ordnung so, oder?«
Lord Emsworths Freundlichkeit knickte leicht ein. Er hatte mit Freddies alten Kumpeln so seine Erfahrungen gemacht. »Und wer ist das? Vergiß bitte nicht, daß diese Woche Mr. Peters und Aline sowie praktisch all unsere Verwandten in Blandings weilen. Falls er einer von diesen …«
»O nein, keine Sorge. Ich schwöre hoch und heilig, er gehört nicht zur alten Clique. Sein Name ist Emerson. Ein hochrespektabler Bursche. Ist in Hongkong Polizist oder so was. Soll Aline recht gut kennen. Hat auf der Überfahrt nach England ihre Bekanntschaft gemacht.«
»Ich kann mich nicht erinnern, daß einer deiner Freunde Emerson heißt.«
»Genau genommen habe ich ihn erst gestern abend kennengelernt. Aber keine Sorge, er ist eine gute Haut und so weiter, da gibt’s nix.«
Lord Emsworth war zu wohltätig gesinnt, um irgendeinen der Einwände vorzubringen, die er in weniger sonniger Stimmung bestimmt appliziert hätte.
»Selbstverständlich darf er kommen, falls ihm danach ist.« »Danke, Paps.«
Freddie beendigte die Toilette.
»Na, Paps, hast du Pläne für heute morgen? Ich hätte Lust, zuerst ’nen Happen zu frühstücken und dann ein bißchen zu flanieren. Hast du schon gefrühstückt?«
»Vor zwei Stunden! Ich darf mich doch darauf verlassen, daß du im Laufe deiner Flaniererei bei Mr. Peters vorbeischaust und Aline deine Aufwartung machst? Ich gehe gleich nach dem Lunch dorthin. Mr. Peters möchte mir seine Sammlung zeigen … Na, was sammelt er schon wieder? Genau, Skarabäen, so nennt er die Dinger meines Wissens.«
»Klar schneie ich rein, keine Angst. Und falls ich es nicht tue, werde ich mit dem alten Knaben einen fernmündlichen Plausch halten. Tja, und jetzt mache ich mich besser auf die Socken und besorge mir den erwähnten Frühstückshappen, wie?«
Nach dieser kleinen Ansprache drängten sich Lord Emsworth gleich mehrere Kommentare auf. Erstens hieß er es nicht gut, wenn Freddie einen der großen Handelsfürsten Amerikas als »alten Knaben« titulierte. Und zweitens mutete ihn die Haltung seines Sohnes nicht als die Idealhaltung eines jungen Mannes gegenüber seiner Verlobten an. Es schien ihr an Wärme zu gebrechen. Doch da er nach längerem Sinnieren zum Schluß kam, daß wohl auch dies dem Zeitgeist geschuldet und jedenfalls seiner Sorgen nicht würdig war, behielt er die Kritik für sich. Und nachdem sich Freddie die Schuhe mit einem Seidentaschentuch abgeschlagen und dieses behutsam in den Ärmel gesteckt hatte, traten die beiden aus dem Zimmer, begaben sich in die große Hotelhalle und gingen von dort aus ihrer Wege: Freddie zu seinem Frühstückshappen, sein Vater zum ziellosen Herumstromern bis zum Mittagessen. London bedeutete für den Grafen von Emsworth stets eine harte Prüfung, denn auf einen eingefleischten Landbewohner wie ihn übte die Großstadt nicht den geringsten Reiz aus.
II
Auf einer der Etagen in einem der Gebäude in einer der Straßen, die vom Strand aus steil zum Thames Embankment abfallen, gibt es eine Tür, der ein neuer Anstrich nicht schaden könnte und auf der die vielleicht bescheidenste und schmuckloseste Mitteilung steht, die London in diesem Bereich zu bieten hat.
Die verrußte Mattglasscheibe ziert nämlich die Buchstabenfolge:
R. JONES
Nur dies – nichts weiter.
Sie liegt zwischen zwei Türen, auf deren erster die imposante Inschrift »Kautschukverarbeitende Industriewerke Sarawak und Neuguinea. Generaldirektor: John Bradbury-Eggleston« prangt, während die zweite den Rubinwerken Bhangaloo Inc. gehört. Dadurch wirkt sie fast wie ein Waldveilchen, das es sich unter den Orchideen gemütlich gemacht hat.
R. JONES
In ihrer Schlichtheit nimmt sich die Aufschrift fast urwüchsig aus. Beim Betrachten fragt man sich (falls man denn Zeit hat, solche Dinge zu betrachten und sich solche Fragen zu stellen), wer dieser Jones sein und welchen Geschäften er mit derart gezierter Zurückhaltung nachgehen mag.
Solche Spekulationen stellten übrigens auch jene argwöhnischen Männer von Scotland Yard an, die sich für diesen R. Jones eine Zeitlang brennend interessiert hatten. Doch abgesehen von der Erkenntnis, daß er Kuriositäten an- und verkaufte, sich in der Zeit der Flachrennen sporadisch als Buchmacher betätigte und dem Vernehmen nach hin und wieder Geld verlieh, fand man bei Scotland Yard nicht viel über Mr. Jones heraus und schenkte ihm keine weitere Beachtung. Nicht, daß Scotland Yard zufrieden gewesen wäre – das Wort »aufgeschmissen« würde die Haltung der Polizeibehörde besser beschreiben. Der Verdacht, daß dieser R. Jones unter anderem mit Diebesgut Handel trieb, war keineswegs vom Tisch, doch nachweisen konnte man ihm nichts.
Dafür sorgte R. Jones höchstpersönlich. Er ging so mancher Tätigkeit nach, war er doch einer der umtriebigsten Männer Londons, aber kaum etwas tat er so geschickt, wie dafür zu sorgen, daß man ihm nichts nachweisen konnte.