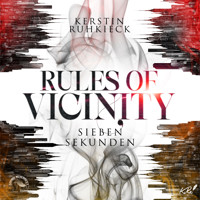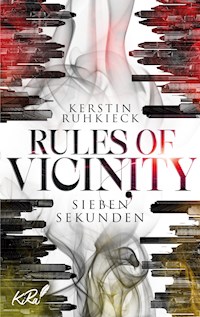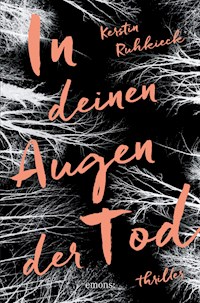
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein intensiver Slow-Burn-Thriller, der lange in Erinnerung bleibt. Nach einer tödlichen Geiselnahme kehrt Olivia Bloch schwer traumatisiert in das Dorf ihrer Kindheit zurück. Schnell bekommt sie die Ablehnung der Einwohner zu spüren, die die Gerüchte zu glauben scheinen, sie wäre die Komplizin der Geiselnehmer gewesen. Als sich die Anzeichen mehren, dass sie beobachtet wird und außer ihr noch jemand in ihrer Wohnung ein und aus geht, muss sie sich ihrer Vergangenheit stellen – bevor es zu spät ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, unter Verwendung eines Motivs von Hanka Steidle/Arcangel.com
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-915-0
Thriller
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch erzähl:perspektive,
Literaturagentur Michaela Gröner & Klaus Gröner GbR, München.
0
Hannover, 12.Juni
Es sind Entscheidungen, die unser Leben bestimmen. Darüber, welchen Pfad wir einschlagen und wohin uns dieser Weg führt. Studiere ich, oder mache ich eine Weltreise? Heirate ich, oder bleibe ich für immer Single?
Gehe ich heute Abend aus, oder bleibe ich zu Hause?
All diese Entscheidungen bilden Stationen, kleine, unscheinbare Punkte, die erst miteinander verbunden offenbaren, welches Bild wir von uns selbst zeichnen.
Behalte ich das Geheimnis für mich, oder erzähle ich es weiter?
Ist eine Entscheidung erst getroffen, gibt es kein Zurück mehr, völlig gleichgültig, wie überlegt oder unüberlegt sie getroffen wurde. Was folgt, ist eine Kausalkette weiterer Scheidewege, die zu dramatischen Wendepunkten führen – oder eben nicht. Die Verantwortung liegt bei uns, genau wie die Konsequenz. Denn wenn wir mit einer Entscheidung auf einen furchtbaren Wendepunkt zusteuern, ohne es zu ahnen, ist es dem Universum ziemlich egal. Auch wenn er unsere Welt zu zerstören vermag.
Keine Vorahnung, kein ungutes Gefühl hat mich gewarnt, als ich am 12. Juni eine kleine, unscheinbare Entscheidung traf. Ein Abend in einer Cocktailbar, zu dem mich eine Freundin überredete. Die Neuigkeiten über meinen Vater hatten Erinnerungen hervorgeholt, die mit ihrer Bittersüße an meinen Nerven zupften. Also sagte ich Ja zur Mission Ablenkung.
»Mission Ablenkung« nannte Svenja eine durchgemachte Nacht in einer kleinen Bar im Souterrain. In mir keimte nicht der geringste Zweifel, dass ihr Vorschlag, einmal auf der anderen Seite des Tresens zu stehen, eine gute Idee war. Das »Sternenhagel« war ein »Safe Space«, freitags arbeitete ich selbst dort, um mein BAföG aufzustocken. Ein Samstagabend voller gebrüllter Unterhaltungen, zu viel Alkohol und vielleicht einem One-Night-Stand, den ich am nächsten Morgen bereuen konnte, schien mir das zu sein, was meinen Kopf frei und meine angespannten Muskeln locker machen würde.
»Olivia, du hier? Hast du etwa Sehnsucht nach mir?«, begrüßte mich Dante, als ich an der Theke lehnte und ihn gut gelaunt angrinste.
Ich fühlte mich wohl, angenehm losgelöst von meinen Sorgen, die mit den achtlos aufs Bett geworfenen Alltagsklamotten zu Hause geblieben waren. Morgen würde ich mich darum kümmern, Ordnung ins Chaos zu bringen, aber darüber machte ich mir jetzt keine Gedanken. Das Ausgehoutfit – enge Jeans und ein schwarzes Spaghettiträgertop mit Spitzen-V-Ausschnitt, schlicht, aber elegant – weckte eine Seite in mir, die in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen war. Dieser Abend hätte so einfach sein können.
»Ich muss endlich den besten Blowjob der Stadt probieren. Enttäusch mich nicht, Mann«, rief ich zurück und hob keck eine Augenbraue.
Svenja neben mir blickte irritiert zwischen uns hin und her, dann grinste sie amüsiert. Es war offensichtlich, was sie dachte, aber sie lag falsch. Meine Kommilitonin gehörte nicht zum Sternenhagel-Team, sie konnte nicht wissen, dass Dantes sagenumwobener Blowjob ein Running Gag war, der nichts mit dem Austausch von Körperflüssigkeiten zu tun hatte.
Keine fünf Minuten später hielt ich das bauchige Glas mit dem Cocktail aus Baileys, Wodka und Sahne in der Hand, und Svenja verstand. Die nächsten Minuten lachte sie Tränen, vom Vorglühen alberner als sonst, während ich an meinem Getränk schlürfte. Tatsächlich war es der beste Blowjob, den ich je hatte.
Svenja und ich ließen uns ein paar Cocktails zu viel schmecken, um uns herum drängten sich immer wieder Gäste an den Tresen, um ihre unverständlichen Bestellungen aufzugeben. Das Sternenhagel war kaum größer als ein luxuriöses Wohnzimmer, und die hyperaktive Elektro-Easy-Listening-Musik pendelte im mittleren Lautstärkebereich. Der Geräuschpegel machte eine normale Unterhaltung unmöglich, aber dafür waren wir ja auch nicht hier. Der Abend fühlte sich an wie eine gute Entscheidung. In meinem Kopf entfaltete der Alkohol den ersten Dusel, alles war normal.
Eine halbe Stunde vor Mitternacht. Ein stiller Countdown, von dem ich nichts wusste, tickte über unseren Köpfen wie ein Damoklesschwert. Ich rechnete inzwischen nicht mehr damit, an diesem Abend noch angesprochen zu werden. Erst als Svenja auf die Toilette verschwand, hörte ich eine Männerstimme neben mir. Überrumpelt sah ich von meinem Mojito auf, zu dem ich gewechselt hatte, und fand ein Paar dunkler Augen in einem lächelnden Gesicht. Er hatte uns beobachtet, wer weiß wie lange, und auf eine Gelegenheit gewartet, mich allein zu erwischen, schlussfolgerte ich und war mir nicht sicher, ob ich geschmeichelt oder beunruhigt sein sollte. Aber so funktionierte das Balz-und-Aufreiß-Spiel junger Großstädter, also entschied ich, dass es okay war.
»Was?« Ich beugte mich vor, um ihn besser zu verstehen.
»Ich bin Miko.« Er streckte mir seine Hand entgegen.
»Olivia«, erwiderte ich und nahm sie.
Unsere Blicke verschmolzen miteinander, während wir unsere Hände hielten, ohne sie zu schütteln. Ich fühlte mich sofort zu ihm hingezogen.
»Freut mich sehr, dich kennenzulernen, Olivia«, sagte er über den Barlärm hinweg, der einige Atemzüge lang in den Hintergrund trat. Nur langsam trennten sich unsere Hände voneinander.
Ich erinnere mich an diesen Moment, in dem alles perfekt schien, spüre die wohlige Vorfreude, als wir einander ansahen und keine Worte nötig waren, um zu wissen, was wir wollten. Der Geschmack von Minze und Limette lag auf meiner Zunge, der kubanische Rum stieg mir in den Kopf, und ich leckte den klebrigen Rohrzucker von meinen Lippen.
Dann fielen die ersten Schüsse.
1
Obderwede, 22.Oktober
Letztendlich sind wir nichts weiter als das Produkt unserer Entscheidungen. Das weiß ich jetzt.
Als sich der Bus der Schicksalskurve nähert, halte ich die Luft an. Schon die gesamte Fahrt über kauere ich tief in meinen abgewetzten Sitz gepresst und konzentriere mich auf meine Atmung. Meine Panik darf nicht die Oberhand gewinnen, aber mein Serotoninabbauhemmer und ich sind Verbündete und stärker als sie. Noch. Denn sie lauert, seit ich vor zwei Stunden meine erste Mitfahrgelegenheit bestiegen habe.
Der Fahrer des Busses kennt die Strecke nicht, wird mir klar. Er fährt zu schnell, schneller als die erlaubten fünfzig Stundenkilometer. Er sollte wissen, dass die Kurve vor uns langsam zu nehmen ist. Um nicht Gefahr zu laufen, aus der Spur zu geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zu kollidieren, das sich für ihn noch unsichtbar hinter der Kurve befinden könnte. Oder eben nicht.
Ich schließe die Augen. Von meinem Platz in der hinteren Reihe kann ich ohnehin nichts sehen. Dennoch habe ich sie vor mir, die Erinnerung an eine Kurve mit leichtem Gefälle und dem Felsen, der die Sicht versperrt. Ich spüre die g-Kraft, wie sie meinen Körper zur Seite drückt, bemerke das ruckelige, hektische Abbremsen des Fahrers, als er begreift, dass er sich mit der Geschwindigkeit verschätzt hat. Die Reifen quietschen, ich bin mir sicher, dass wir uns nun auf der Gegenfahrbahn befinden, und warte auf den Aufprall. Auf das Bersten der Karosserie, das Splittern von Glas und dann die Schreie, hysterische Schreie vor Angst und Schmerz … Der Moment vergeht, und nichts davon geschieht. Keine Kräfte wirken mehr auf meinen Körper, die Fahrt geht auf gerader Strecke weiter. Ich öffne die Augen und schnappe nach Luft. Ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen – wieder einmal – und empfinde keine Erleichterung.
Mit genug Sauerstoff im Blut und einigermaßen beruhigten Nerven packe ich meine Sachen zusammen. An der nächsten Station werde ich aussteigen. Viel habe ich nicht bei mir, ein paar Kleidungsstücke, einen Laptop, mein Handy und diese ultraschicken kabellosen Kopfhörer, die beinahe vollständig im Ohr verschwinden. Meine Mutter hat sie mir aufgezwungen, obwohl ich sie nicht wollte. Nun benutze ich sie doch. Sie dämpfen den Lärm um mich, statt ihn in meine Ohren zu plärren und meine Wahrnehmung zu blockieren.
Mehr als diese Dinge brauche ich nicht. Es gibt nichts, was mir noch etwas bedeutet. Ich frage mich, was mich erwartet, sobald ich den Bus verlasse. Am Busbahnhof in Hannover meine ich jemanden bemerkt zu haben, der ein Foto von mir gemacht hat, ein junger Typ mit Sporthose und Goldkettchen. Vielleicht war es aber auch meine Paranoia, die mich Gespenster sehen lässt. Meine Paranoia, die ich nur deshalb habe, weil sie begründet ist. Paranoia, entstanden aus Erfahrung.
Als der Bus hält, spuckt er mich aus wie einen durchgekauten Kaugummi. Beinahe stürze ich, noch bevor meine Füße den Boden berühren, finde aber rechtzeitig mein Gleichgewicht wieder. Die frische Luft, die beim ersten Atemzug meine Lungenflügel flutet, lockert meine verkrampfte Brust. Bis ich es mit brachialer Wucht begreife.
Ich bin zurück.
Die Bushaltestelle ist verwaist, ein einsames Holzhäuschen an der unbefahrenen zweispurigen Hauptstraße, an der nur vereinzelt Häuser stehen, umgeben von unberührten Feldern aus Gräsern und Blumen. Obderwede ist so leblos und leer wie in meiner Erinnerung.
Das Haus ist nicht weit, ich kenne den Weg, als wäre ich ihn gestern zuletzt gegangen. Ich schultere meinen Rucksack, nehme meine Reisetasche und gehe los. In meinem Bauch regt sich eine vorfreudige Angst, die mich seltsam traurig macht, doch ich habe keine Zeit, hier länger zu stehen und darauf zu warten, dass mich jemand sieht. Der Dorffunk wird die Information über meine Ankunft schnell genug verbreiten.
Von früher weiß ich um die Schönheit, die der Herbst aus dem kräftigen Grün des Sommers erschafft. Jetzt jedoch habe ich keinen Blick dafür, Scheuklappen schränken meine unscharfe Sicht ein. Es ist, als würde ich unter der Last der Rückkehr immer langsamer werden, mein Herz pocht wild, und mir schnürt sich die Kehle zu. Eben noch konnte ich es kaum erwarten, aus der Enge des Busses zu entfliehen, nun fühle ich mich von der Weite des freien Himmels bloßgestellt.
Eine Biegung später erreiche ich das vertraute Haus und bleibe unentschlossen stehen. Den übertriebenen Bungalow hat mein Vater entworfen und bauen lassen, als er von der Schwangerschaft meiner Mutter erfuhr. Der Zementmischer war noch nicht einmal in Betrieb, als sie ihm mitteilte, dass sie sich von ihm trennen und ihr ungeborenes Kind – mich – allein großziehen würde. Aus der Not heraus korrigierte er seinen Entwurf und machte aus einem Bungalow zwei, direkt nebeneinander, in der Hoffnung, auf diese Weise zumindest Mutter und Kind in unmittelbarer Nähe zu haben. Als meine Mutter, deutlich jünger als er und mitten in der Selbstfindung, ihm an den Kopf knallte, dass sie sicher nicht an den »Arsch der Welt« ziehen würde, ließ er die zwei Häuser dennoch bauen. Für den Fall, dass sie es sich anders überlegte.
Lange Zeit hielt ich meinen Vater für ziemlich großartig. Bis zu dem Sommer, in dem ich erkannte, dass er es nicht war.
Fünf Jahre bin ich nicht hier gewesen. Der Schlüssel von damals passt trotzdem. Als hätte der alte Mann darauf gewartet, dass ich eines Tages zurückkomme, ihn in die Arme schließe und alles ignoriere, was vorgefallen ist.
Nun bin ich hier, aber er ist es nicht.
Zögerlich kehre ich heim, streife sämtliches Gewicht von meinem Körper. Der verwinkelte Flur, der den Blick nicht auf alle Türen preisgibt, liegt vor mir und scheint mit seinen Eingängen auf mich zu warten. Also wandere ich von Zimmer zu Zimmer, schon damals war das Haus zu groß für zwei Personen. Wie sich mein Vater in den letzten Jahren hier gefühlt haben muss, wie er es so lange allein ausgehalten hat, möchte ich mir nicht vorstellen. Einsam in einem Haus, das für eine Familie gemacht war. Vielleicht hat er genau das verdient.
Die Räume sind menschenleer, aber gefüllt mit Erinnerungen, die ich in ihnen eingesperrt habe, als ich damals gegangen bin. Der vertraute herbe Aftershavegeruch liegt wie eine schwere Decke über den Möbeln, steigt mir in die Nase und aktiviert in meinem Kopf undeutliche Bilder aus einer Zeit, als alles gut war.
Arbeits- und Schlafzimmer, sein Bereich, liegen auf der linken Seite. Nichts hat sich verändert, und ich halte es nicht lange darin aus, die Räume machen mich traurig, ich fliehe vor der unsichtbaren Präsenz meines Vaters.
Mit dem Wohnzimmer und der offenen Küche verbinde ich viele Geschichten. Der überdimensionierte Raum war stets das Zentrum unserer Gemeinsamkeit. Eine Flut an Erinnerungen droht mich zu erdrücken. Wie wir reden, essen, lachen. Es sind gute Erinnerungen, überlagert von einem dunklen Schatten, der mir einmal mehr vor Augen hält, was ich verloren habe. Damals, als ich ihm meine Anschuldigungen ins Gesicht schmetterte.
Es war nicht meine Schuld, ermahne ich mich, wie ich es mir selbst beigebracht habe, um überhaupt weitermachen zu können. Doch es ist, wie es ist, das Gefühl von fauligem Obst in meiner Brust straft mich Lügen.
Unendlich erschöpft, als würde mich dieses Haus sämtlicher Energie berauben, durchquere ich den Raum. Tränen verschleiern mir die Sicht, aber ich weine nicht, dafür bin ich zu müde. Als wäre sie mein letzter Halt, lege ich beide Hände auf das kalte Glas der Terrassentür und sehe nach draußen, auf den Garten und das kleine Holzhäuschen am angrenzenden Waldstück.
Ich hoffe, dass mein Vater nicht entsorgt hat, was früher darin war, und lasse ein zaghaftes Lächeln auf meinem Gesicht zu.
Ein Geräusch hinter mir lässt mich zusammenfahren. Ich wirble herum, ein unterdrückter Schrei verhakt sich in meiner Kehle. Beinahe erwarte ich, jemanden zu sehen, eine Waffe auf mich gerichtet … doch ich bin alleine. Aber ich bin mir sicher. Es war da. Ein dumpfes Klopfen.
Erneut lässt mich das Geräusch aufschrecken, und ich erstarre. Ich kenne dieses Pochen. Ein Zittern wogt durch meinen Körper, und ich hebe den Blick an die Decke. Jemand ist über mir. Schritte auf dem Dachboden.
Ich balle meine Hände zu Fäusten und zwinge mich, meine Starre zu lösen. Im Alltag bin ich zu nichts zu gebrauchen, doch mit solchen Situationen kann ich umgehen. Mein Körper bleibt angespannt, und während ich mich auf meine Atmung konzentriere, kehre ich zur Wohnzimmertür zurück.
»Martin?«, frage ich mit belegter Stimme in den Flur hinein. Keine Antwort. »Papa?« Ich weiß, dass er nicht hier sein kann.
Tasche und Rucksack lehnen unverändert an der Haustür. Wer auch immer im Haus ist, muss bereits hier gewesen sein, als ich ankam. Mein Herz pocht unangenehm in meinem Hals, drückt ihn zu, macht es mir unmöglich, zu schlucken. Meine Augen wandern die Stufen nach oben, die Luke ist verschlossen, aber das muss nichts heißen. Der Dachboden ist der einzige Makel des Hauses, hat mein Vater immer gesagt. Es sollte ein ausgebautes Obergeschoss werden, doch er hat sich nie darum gekümmert. Stattdessen ist es immer ein Lager für Kisten und abgenutzte Möbel gewesen, es gibt nicht einmal eine richtige Tür, nur eine weiße Holzklappe, die sich nach innen öffnen lässt.
Aus dem Augenwinkel nehme ich eine Bewegung wahr, es ist, als würde ein Blitz in mich einschlagen. Ich reiße die Arme hoch, will meinen Kopf schützen und drehe mich weg, ein Reflex, doch nichts passiert. Mein Herz erschüttert mich mit heftigen Schlägen, ich bin kurz davor, zu fallen, ich spüre das Lauern der Angst mit jedem aufgestellten Härchen an meinem Körper. Ich bin stärker als sie, muss es sein, wenn ich leben will, obwohl ich mir da nicht sicher bin. Ich sehe auf. In der Tür zum Hauswirtschaftsraum steht eine Frau, sie starrt mich an, eine Schere in der Hand. Ich weiche zurück, bekomme keine Luft und greife an meine Kehle. Ich werde sterben, ich weiß es. Das Gesicht der Frau verzieht sich zu einem Grinsen.
»Hallo, Olivia.«
2
Obderwede, 22.Oktober
Es ist ein Lächeln gewesen, kein Grinsen. Mein Verstand hat meinen ersten Eindruck korrigiert, und ich muss ihm glauben, weil ich sonst nichts in meinem verkorksten Leben habe, auf das ich mich verlassen kann. Das überraschte Lächeln der Frau Ende dreißig ist einer schuldbewussten Miene gewichen.
Ich habe keine Angst, nicht mehr, mein Körper hat das nur noch nicht mitbekommen und quält mich mit den Nachwirkungen meiner Panik. Zusammengesunken hocke ich auf den Stufen der Treppe und bemühe mich, das enge Gefühl in meiner Brust wegzuatmen. Tief durch die Nase ein und den Mund wieder aus, wie Dr. Fischer es mir gezeigt hat. Ich spüre den Blick der Frau auf mir wie eine brennende Berührung, er wird ein Branding auf meiner Haut hinterlassen, davon bin ich überzeugt. Immerhin hat sie die Schere weggelegt, bislang aber kein weiteres Wort gesagt. Stattdessen hat sie mich an den Schultern gepackt und aufgefangen, als ich nur noch nach Luft schnappte, in kurzen, verzweifelten Zügen um mein Bewusstsein rang und mir an den Hals griff, als könne ich damit die Enge lösen, die unsichtbaren Hände, die meine Kehle zudrückten, um mich endgültig niederzustrecken.
Der kalte Schweiß ist getrocknet und bedeckt mein Gesicht mit einem schmierigen Film. Ich würde gern duschen, sofort, aber das wäre unhöflich. Ich hebe den Kopf, sehe diese fremde Frau, die mich beobachtet. Sie will mir nichts Böses, dennoch bin ich dankbar für die Distanz, die sie wahrt.
»Wer sind Sie?«, frage ich und wische mir ein paar verklebte Strähnen aus der Stirn. Meine Stimme ist rau, als hätte ich geschrien, habe ich aber nicht. Glaube ich.
»Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe. Johanna Behringer, ich wohne nebenan.«
Ich starre sie ungeniert an, sie macht es mir leicht, sie hat etwas an sich, das zu betrachten es wert ist. Es ist keine klassische Schönheit, aber das Gewöhnliche im Speziellen ihrer äußeren Erscheinung. Dann fällt mir wieder ein, was sie gesagt hat, und ich kehre zurück in eine Matrix, in der es kein Happy End gibt.
»Was ist mit Paul … also, ähm … Herrn Mayr? Wohnt er nicht mehr da?« Ich habe ihn vor Augen, den Mann Anfang vierzig, mit grau meliertem Dreitagebart und dem immer gleichen blau karierten Holzfällerhemd, der die kleinere Bungalowhälfte gemietet hatte, die eigentlich für meine Mutter vorgesehen war.
»Doch, doch, tut er. Er muss sich die Wohnung jetzt mit mir teilen«, antwortet Johanna und lächelt zaghaft, als testete sie, ob es angesichts meiner anfänglichen Labilität angemessen ist.
Ich runzle die Stirn. »Sie sind seine Frau?«
Sie wiegt ihren Kopf. »Vielleicht irgendwann. Momentan bevorzuge ich die Bezeichnung ›Lebensgefährtin‹.«
»Oh.« Ich habe Paul nie in Begleitung einer Frau gesehen, konnte ihn mir nicht mit einer vorstellen und war davon ausgegangen, dass er sich nicht für Frauen interessierte. Anscheinend habe ich mich geirrt.
Das Schweigen zwischen Johanna und mir dehnt sich aus. Meine Atmung hat sich normalisiert, nun ist mir meine Schwäche unangenehm. Sie soll nicht denken, ich sei eine vom Trauma zerbrochene Frau. Ich habe mich sonst unter Kontrolle. Was in meinem Inneren passiert, geht niemanden etwas an. Ich strecke meinen Rücken durch und fühle mich augenblicklich selbstsicherer. Das scheint sich auf Johanna zu übertragen, denn sie blickt erleichtert zu mir herab. Sie spürt es. Ich bin kein Opfer, ich bin nicht schwach. Ich bin mehr als meine Vergangenheit.
»Ich bin froh, dich endlich kennenzulernen, Olivia. Ich darf doch Du sagen?«
Ich zucke gleichgültig mit den Schultern, es ist mir egal, ob sie mich duzt oder siezt.
»Und du sagst Johanna zu mir, ja?«
Ich übergehe ihre Frage und stehe auf. Johanna überragt mich um fast zehn Zentimeter, aber das schüchtert mich nicht ein. »Was machst du hier, Johanna?«, frage ich angriffslustiger als beabsichtigt.
Ihre Stirn legt sich kurz in Falten, doch sie ist sichtlich bemüht, sich von meinem Stimmungsumschwung nicht irritieren zu lassen. »Ich kümmere mich um das Haus, seit dein Vater es nicht mehr kann.«
»Hat er dich darum gebeten?«
»Ja, das hat er, Olivia. Er hat gut vorgesorgt, was du –« Sie bricht ab, aber ich habe eine Vermutung, was ihr auch jetzt noch auf der Zunge liegt.
… was du selbst wüsstest, wenn du in den letzten Jahren mit ihm gesprochen hättest.
Der verschwiegene Vorwurf tut weh, ich lasse es mir aber nicht anmerken. Ich darf solche Dinge nicht an mich heranlassen. Johanna kennt nicht die ganze Geschichte.
»Und was machst du mit einer Schere im Hauswirtschaftsraum?« Meine Frage klingt, als zweifle ich ihre Behauptung an, dabei tue ich das gar nicht.
Entgegen meiner Erwartung sieht sie aus, als hätte ich sie bei einem unverzeihlichen Vergehen ertappt, was sie mit einem unnatürlichen Lächeln zu überspielen versucht. Es ruiniert ihr hübsches Gesicht. »Ich wollte mir einen Ableger der Aloe vera abschneiden. Habe ich aber nicht, weil ich ihr nicht wehtun wollte.«
Irritiert schaue ich an Johanna vorbei durch die offene Tür hinter ihr. Tatsächlich steht auf der Fensterbank am anderen Ende des Raums eine grüne Topfpflanze. Überrascht ziehe ich eine Augenbraue hoch.
»Du kannst sie haben. Ich würde sie nur töten.«
Mein letztes Wort scheint sie zu alarmieren. Als erinnere sie sich erst jetzt daran, dass ich mehr bin als nur die Tochter von Martin Zagel. Dass mein Gesicht und mein Name untrennbar verbunden sind mit den Geschehnissen im Sternenhagel. Nun ist er da, der gewaltige rosa Elefant im Raum, über den niemand von uns sprechen wird.
»Ich weiß nicht, was –«, beginnt sie, bricht aber ab, als ich erst an ihr, dann an der Waschmaschine und den Regalen voller Waschpulver und Handtüchern vorbeigehe, mir die Pflanze von der Fensterbank greife und zurückkehre.
»Nimm sie, meinem Vater ist es egal und mir auch.« Ich drücke ihr den Topf in die Hand.
Johanna nimmt ihn sichtlich unwohl entgegen. »Na gut, also … vielen Dank!«, sagt sie gepresst. »Bleibst du länger in Obderwede?«
»Weiß ich noch nicht. Ein bisschen bestimmt. Du brauchst dich jedenfalls nicht mehr um das Haus zu kümmern. Aber danke für deine Hilfe.«
Sie nickt, ihr Lächeln ist verschwunden. »Also … ich lasse dich mal in Ruhe ankommen. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich erschreckt habe.«
Sie macht ein paar Schritte zur Haustür, sie will weg, weg von mir. Es ist offensichtlich, dass sie mich nicht mag, was ich durchaus verstehe. Auf der Schwelle bleibt sie zögerlich stehen.
»Falls du etwas brauchst, komm zu uns rüber. Ich arbeite zu Hause und bin eigentlich immer da.«
Ich sehe das Angebot als das, was es ist. Gute Erziehung, vielleicht ein Versprechen, das sie meinem Vater gegeben hat. So oder so habe ich nicht die Absicht, ihr Angebot anzunehmen. Ich schließe die Tür und bin mir sofort der Leere des Hauses bewusst. Sie kommt näher, bis sie bei mir ist und mich verschlingt. Mal sehen, wie lange ich es aushalte, ehe ich den Verstand verliere.
3
Obderwede, 22.Oktober
Eine Stunde später fühle ich mich wieder mehr wie ich selbst. Ich habe geduscht, mit heißem Wasser den schmierigen Film von mir geschrubbt, bis das kleine Badezimmer vor Dampf blind war und meine Haut brannte.
Statt in meinem alten Zimmer, das über Jahre hinweg mein zweites Zuhause war, sitze ich im Gästezimmer auf dem frisch bezogenen Bett. Hier halte ich es besser aus, dieser Raum drängt mir keine Erinnerungen auf, die ich nicht haben möchte.
Es war verstörend, eine lähmende Zeitreise, mein altes Zimmer zu betreten. Siebzehn Jahre lang gehörte es mir, war eine Erholung von dem Leben mit meiner Mutter. Alles ist, wie ich es zurückgelassen habe, mein Vater hat nichts angerührt. Er muss fest daran geglaubt haben, dass ich eines Tages wiederkomme.
Nun ist es passiert, ich bin zurück in Obderwede, doch nicht seinetwegen, fast gar nicht. Stattdessen ist es ein Versprechen, das mich hierhergelockt hat, eine lose Vereinbarung, jemanden in diesem Kaff zu treffen, ohne feste Uhrzeit oder Tag. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll, während ich warte. Eine innere Stimme drängt mich zum Handeln, will endlich Antworten, doch ich weiß auch, dass ich es nicht in der Hand habe, was passiert. Unruhe packt mich, lässt mich aufstehen und im Zimmer umherwandern. Ein leichter Kopfschmerz pocht in meiner Stirn, das Denken fällt mir schwer. Die kleine Gartenhütte kommt mir in den Sinn. Wenn mein Vater mein altes Zimmer unberührt gelassen hat, dann vielleicht auch die Hütte.
Plötzlich bin ich aufgeregt, schlüpfe in meine Schuhe und eile zur Terrassentür. Die frische Oktoberluft empfängt mich, als ich nach draußen trete, zerrt an meinen langen Haaren, die noch feucht sind. Der Garten ist verwildert, niemand hat sich um ihn gekümmert. Ich höre das Knistern getrockneter Blätter unter meinen Füßen, spüre das Kitzeln langer Grashalme durch den Stoff der Leggings an den Beinen. Der Herbst erfüllt die letzten Atemzüge des Gartens mit dem Geruch von Gräsern und einem minzigen Hauch von Beifuß. Hannover ließ mich vergessen, dass das Leben so riechen kann.
Die Holztür des Schuppens ist versperrt, das kleine Vorhängeschloss sieht aus wie früher, versteckt unter Rost und Moos. Der Schlüssel an meinem alten Schlüsselbund passt, und als ich bei geöffneter Tür in die Dunkelheit vor mir blicke, ergreift mich eine Freude, wie ich sie seit Monaten nicht mehr empfunden habe. An die rechte Seitenwand gelehnt, halb verdeckt von Rasenmäher, Heckenschere und anderen Gartengeräten, steht es da, als hätte es mich all die Jahre vermisst, zur Trägheit verdammt, und auf mich gewartet. Mein altes Fahrrad, das Gestell einst in einem altbackenen Rosa, ist von oben bis unten mit Bandaufklebern bedeckt. Awolnation, Bloc Party, Welshly Arms, sie alle habe ich seit fünf Jahren nicht mehr gehört, weil mich ihre Songs an ihn erinnern.
Inzwischen ist es egal, ich erlaube mir, an ihn zu denken. Mit meinem alten Fahrrad verbinde ich nur positive Erinnerungen.
4
Obderwede, 22.Oktober
Im niedersächsischen Obderwede ist die Welt noch in Ordnung. Jeder kennt jeden, Fuchs und Hase sagen sich hier noch Gute Nacht. Ein Geflecht aus Bächen zieht sich venenhaft durch die Landschaft, unzählige Waldstücke bieten Lebensraum für Wild und Nager. Das stete Rauschen der grenzenlosen Felder und Wiesen liegt in der Luft, an Orten wie diesen ist es leicht, die Seele baumeln zu lassen. Und auch fürs Leibeswohl ist gesorgt. Ein privat geführter Einkaufsmarkt, der unabhängige Schnellimbiss Kartoffeltopf und die niedliche Pension Zum Schlafenden Reh, Obderwede bietet auf gut fünfzehn Quadratkilometern ein attraktives Angebot für die knapp zweitausend Einwohner wie für Touristen und Durchreisende gleichermaßen.
Gesundheit wird in Obderwede großgeschrieben. Seit über dreißig Jahren versorgt der freundliche Allgemeinmediziner Dr. Fünfziger seine Patienten in der Praxis am Marktplatz und bei seinen beliebten Hausbesuchen. Die benachbarte Apotheke wird von seiner Frau geführt. Es ist das familiäre Gefühl, das Obderwede zu etwas Besonderem macht. Zu einem Ort, an dem man bleiben möchte.
Doch nun ist Obderwedes verlorene Tochter zurückgekehrt. Ihr Name ist Olivia Bloch. Bis vor wenigen Monaten eine unscheinbare junge Frau, hat Olivia inzwischen zweifelhafte Berühmtheit erlangt.
Ab heute werde ich ihren letzten Geheimnissen auf den Grund gehen.
So oder so ähnlich wird er die Reportage über Olivia beginnen, der Einstieg geistert bereits durch seinen Kopf, seit er auf sie wartet. Es ärgert ihn, dass er nicht daran gedacht hat, ein Notizbuch einzustecken. Verfluchter Anfängerfehler, er muss noch viel lernen.
Nervös kaut Malte Henning auf seinen abgenagten Fingernägeln, während er auf der Mauer hockt und seine Überwachung fortsetzt. Langsam bekommt er einen kalten Hintern. Es muss in den letzten Tagen geregnet haben, Feuchtigkeit hängt im Steinwerk und kriecht bis zu seinen Nieren hoch. Aber er harrt aus, denn er ist sich sicher, dass Olivia auftauchen wird.
Ein Blick auf sein Handy verrät ihm, dass er bald zwei Stunden wartet, doch mit seiner Motivation erträgt er alles. Diese Sache mit Olivia könnte ein Riesending werden, deshalb ist er entschlossen, sie professionell und ohne Rücksicht auf seine Befindlichkeiten anzugehen.
Endlich taucht sie auf. Tatsächlich. Olivia Bloch. Wie eine Erscheinung materialisiert sie sich aus dem Nichts, bewegt sich auf ihrem alten Fahrrad beinahe schwebend auf ihn zu, als wäre sie seinetwegen hier, ohne es zu ahnen. Sie sieht ihn nicht, als sie von der Straße auf den Bürgersteig fährt und an den Fahrradständern vor dem Kartoffeltopf zum Stehen kommt. Maltes Brust zieht sich zusammen, für diesen Moment lässt er seine nervöse Aufregung zu, solange er sie noch unbemerkt beobachten kann. Kein Grund, sich deswegen schlecht zu fühlen.
Olivia.
Obwohl sie außer Reichweite ist, fühlt es sich an, als könnte er sie berühren, würde er nur den Arm nach ihr ausstrecken. Nachdenklich sieht er zu, wie sie ihr Rad anschließt. Früher hat sie das nicht gemacht. Weil es in Obderwede nicht notwendig ist. Die Großstadt ist schuld, hat sie misstrauisch und vorsichtig gemacht, Malte weiß es.
Ein übergroßer dunkelgrüner Hoodie versucht zu verstecken, was ihm, dem aufmerksamen Beobachter, nicht entgeht. Sie ist dünn geworden, hat nicht mehr den trainierten Tänzerinnenkörper, schlank und kräftig, der ihn immer angezogen hat. Stattdessen wirkt Olivia ausgehungert und zerbrechlich, von ihren Brüsten ist kaum etwas übrig geblieben. Trotzdem strahlt sie eine Souveränität aus, die Malte beinahe in seinem Vorhaben zurückschrecken lässt. Aber nur beinahe. Selbst wenn er wollte, es wäre zu spät. Er kann nicht zurückkehren in ein Leben ohne Ziel, ohne Motivation.
Ohne Olivia Bloch.
Wie vorhergeahnt verschwindet sie im Kartoffeltopf. Eine unbequeme Reise liegt hinter ihr, dazu der leere Kühlschrank im Bungalow, selbst ein abgezehrter Körper bekommt irgendwann Hunger. Die Tür fällt mit dem altmodischen Geräusch einer Türglocke, das der sanfte Herbstwind zu Malte herüberträgt, hinter ihr ins Schloss. Er zögert nicht und springt von der Mauer, seine Nervosität ist vorüber, den feuchten Hintern spürt er nicht genug, um sich darum zu scheren.
Hastig überquert er die unbefahrene Straße und nähert sich dem einsamen Gebäude mit der lachenden Kartoffel auf dem Flachdach. Wie geplant startet er auf seinem Handy die Diktierfunktion und schiebt es mit dem Mikrofon nach oben in die Hosentasche seiner Jeans.
Als er das Schnellrestaurant betritt, hat Olivia bereits bestellt. Sie trägt ein Käppi, das eben noch nicht auf ihrem Kopf gewesen ist, und hat der Kasse den Rücken zugewandt. Es scheint, als würde sie aus dem Fenster sehen, doch Malte weiß es besser. Sie will nicht erkannt werden, will nicht, dass ihre Rückkehr schon jetzt die Dorfrunde macht. Malte gibt sich gelassen, als er an ihr vorbeigeht. Als würde er sie nicht beachten, vielleicht auch nicht bemerken, und doch gelingt es ihm, einen beiläufigen Blick auf ihre blonden Haare zu erhaschen, die in frisch getrockneten Strähnen auf ihrem Rücken liegen.
Trotz des Frittierfettes riecht er Flieder, ihr vertrauter Geruch will ihn packen und in die Vergangenheit katapultieren, doch diese irrationale Entgleisung kann er sich nicht erlauben. Er muss fokussiert bleiben.
Kurz täuscht er vor, die Speisekarte über dem Kassenbereich zu studieren, obwohl er längst weiß, was er will. Schnell bestellt und bezahlt er, dann muss auch er warten. Olivia hat sich noch immer von ihm weggedreht, und Malte sucht angespannt nach einer Möglichkeit, zufällig in ihr Gesicht zu sehen. Damit er sie erkennen kann.
Was sie offensichtlich nicht will. Ihre Position hat sich verändert, nur minimal. Es kommt ihm vor, als drehe sie ihm demonstrativ den Rücken zu, als er sich ebenfalls ans Fenster stellt.
Beiläufig huschen seine Augen über Olivias abgewandtes Profil. Ihre Haut ist bleich, den Sommer hat sie im Inneren verbracht, doch es ist nicht nur die obere Schicht, die ihr ein kränkliches Aussehen verleiht. Es ist, als wäre das Blut aus ihr gewichen, als hätte die Zeit sie ausbluten lassen. Es entstellt sie nicht, stattdessen trägt es zu ihrer Schönheit, ihrer Ausstrahlung bei. In ihrem Ohr entdeckt er einen kabellosen In-Ear-Kopfhörer, aber nichts dringt bis zu ihm durch.
Die zwei Verkäufer hinter dem Tresen tuscheln miteinander und ziehen Maltes Aufmerksamkeit auf sich. Er versteht ihre geflüsterten Worte nicht, aber das muss er auch nicht. Sie reden über Olivia, sehen immer wieder in ihre Richtung, unauffällig, wie sie nur deshalb glauben, weil sie Malte nicht beachten. Olivia wehrt ihr Wispern mit Geringschätzung ab, scheint über alles erhaben.
Obwohl sie klein ist und wirkt, als könne ein Windhauch sie umhauen, wird Malte sich einmal mehr ihrer Ausstrahlung bewusst. Jeder in diesem Raum nimmt sie wahr, während sie versucht, sich unsichtbar zu machen. Aber das liegt nicht an den Ereignissen der letzten Monate. Malte erinnert sich, dass Olivia schon immer so war. Heiß und kalt. Für sich einnehmend und abwehrend zugleich.
Eine erneute Welle der Unruhe überkommt ihn. Er muss etwas unternehmen, muss sie dazu bringen, ihn anzusehen oder ihm zumindest ihr Gesicht zuzuwenden, bevor die Zeit um ist. Bevor ihr bestelltes Essen verpackt und seine Chance vertan ist. Kurz entschlossen zieht er sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche und öffnet es so ungeschickt, dass sich sein Kleingeld über den Boden verteilt. Ein gutes Dutzend Münzen verstreuen sich zu seinen Füßen und kullern in sämtliche Richtungen davon. Malte stößt einen verärgerten Fluch aus, der sich echter anfühlt als erwartet, und geht in die Knie, um das Geld einzusammeln. Olivia rührt sich nicht, immer wieder sieht Malte zu ihr hoch, überprüft, ob sie seine Anwesenheit bemerkt, doch für sie scheint er nicht zu existieren. Schließlich kommt Malte zu den Münzen, die zwischen Olivias schwarzen Sneakers liegen. Aufgeregt, nun nicht mehr verstohlen, sondern mit einem echten Grund, zu ihr aufzublicken, befeuchtet er seine Lippen.
»Entschuldigung?«
Endlich reagiert Olivia. Sie nimmt einen Fuß zur Seite und gibt das Zwei-Euro-Stück frei. Sie weiß ganz genau, was um sie herum geschieht. Sie ist nur nicht bereit, es sich anmerken zu lassen.
Schnell kommt er wieder auf die Füße, steht nun dichter vor ihr und überragt sie um fast zwanzig Zentimeter, was eine bittere Erregung in ihm weckt. Er räuspert sich und versucht es mit einem unverbindlichen Lächeln.
»Danke.«
Da ist er, der Kontakt, auf den er gewartet hat. Ihr Gesicht ihm zugewandt, finden ihre Augen eine Sekunde lang seine, ein stummes Nicken. Kein Lächeln. Als es vorbei ist, hat es nicht länger gedauert als ein Blinzeln, aber Malte hat es gesehen, ihr Gesicht, hat genug Zeit gehabt, das Mädchen aus seiner Vergangenheit zu erkennen.
»Olivia?« Seine Stimme klingt überrascht, er ist ein Naturtalent.
Sie gibt sich geschlagen, sieht zu ihm auf und nimmt die Kopfhörer aus den Ohren. »Malte.« Sein Name eine Feststellung. Er kommt nicht umhin, eine brachiale Genugtuung zu empfinden über die Tatsache, dass sie sich an ihn erinnert.
»Du bist es! Wie geht es dir? Was machst du hier?«, treibt er sein Schauspiel voran, gibt sich erstaunt und ahnungslos, doch er muss aufpassen, es nicht zu übertreiben.
»Das ging schnell«, sagt sie tonlos und verschränkt die Arme vor der Brust. Typische Abwehrhaltung, er kann es ihr nicht verübeln.
»Was meinst du?« Sein Herz klopft ihm bis zum Hals, er darf sie nicht verlieren, sonst war alles umsonst.
»Wer hat mich gesehen? Hat Sabrina dir erzählt, dass ich hier bin?«
Wie gut sie Obderwede immer noch kennt. Denn sie hat recht. Hilde Bodenwalds Wohnung liegt in der Nähe der Obderweder Bushaltestelle. Die alte Dame, deren einzige Beschäftigung es ist, aus dem Fenster die Straße vor ihrem Haus zu beobachten, hat Olivia gesehen, wie sie mit Tasche und Rucksack Richtung Zagel-Bungalow unterwegs war. Dies hat sie ihrer Enkelin Sabrina berichtet, mit der Malte damals in einer Klasse war, und so hat ihn die Information bereits erreicht, bevor Olivia den ersten Schritt ins Haus getan hatte. So war es früher, und so wird es immer sein, Neuigkeiten verbreiten sich hier schneller als jeder Virus.
»Ich hatte keine Ahnung, ehrlich«, versichert Malte ihr, doch er kann in ihrem Gesicht lesen, dass sie besorgt ist. Wenn er sie mit seiner reinen Anwesenheit in die Flucht schlägt, bleibt ihm nichts anderes übrig, als mit seinem Auto gegen einen Baum zu fahren.
Olivia erwidert nichts, ihr Blick schweift ins Nichts, und Stille breitet sich aus. Gefräßiges Schweigen, das jede geknüpfte Verbindung zwischen ihnen sofort wieder vernichtet.
»Wie geht es dir?«, fragt Malte, als er seine Stimme wiedergefunden hat.
Olivia ist schlagartig wieder da, löst die Verschränkung ihrer Arme. Ein gutes Zeichen, wie er hofft. »Gut. Es geht mir gut.«
Malte nickt und probiert es mit einem mitfühlenden Lächeln. »Schön zu hören. Ich meine, nach allem … Es tut mir leid, was dir passiert ist … und …« Er gerät ins verbale Stolpern, seine Worte werden zu einem Strick, der sich eng um seinen Hals legt. Er hätte nicht mit dem Thema anfangen dürfen, er hat es gewusst, und doch hat ihn seine Ungeduld überrumpelt.
Wie erwartet wird Olivias Gesicht hart. »Ich möchte nicht darüber reden.« Ihre Arme verknoten sich erneut zu einem Schutzwall der Ablehnung, mit aufeinandergepressten Lippen sieht sie ihn prüfend an. Er verliert sie.
Malte nickt noch einmal, sucht nach Worten, vielleicht nach einer Entschuldigung, einem Ausdruck seines Bedauerns über seine unsensible Frechheit, ausgerechnet dieses Thema anzusprechen. Doch er findet nichts dergleichen, seine Angst, Olivia könne nun unwiderruflich dichtgemacht haben, erstickt jeden angemessenen Satz im Keim. Und schon ist die verheerende Stille wieder zwischen ihnen.
»Und, was machst du hier?«
In Olivias Gesicht zuckt etwas, ihre Züge werden weicher, ein Anflug von Erheiterung liegt darin. Als sie etwas erwidern will, wird es unruhig an der Theke.
»Einmal Kartoffeln Lorraine für die Dame!«
»Ich hole mir etwas zu essen«, sagt Olivia und geht Richtung Tresen. Tiefe Befriedigung lenkt Malte kurz ab.
»Und einmal Kartoffeln Lorraine für dich, Malte.«
Man kennt ihn hier.
»Ich auch«, grinst er und nimmt sein Essen entgegen.
Olivia ist bereits an der Tür, sie wäre gegangen, ohne auf ihn zu warten. »So ein Zufall«, sagt sie wenig beeindruckt, und Malte weiß nicht, worauf sie sich bezieht. Das Essen oder seine Anwesenheit. Als würde sie etwas ahnen.
Gemeinsam verlassen sie den Kartoffeltopf, und Malte ist sich darüber im Klaren, dass er das Gespräch am Laufen halten muss. Ihre Begegnung darf nicht schon jetzt enden, er ist noch nicht fertig.
»Und? Was hast du in den letzten fünf Jahren getrieben?«, fragt er, während sie Olivias Fahrrad ansteuern.
Sie zuckt mit den Schultern, als wäre ihr Leben der letzten Monate nicht mit einer Horrorachterbahnfahrt zu vergleichen. »Nichts Besonderes. Abi, Uni, Party.«
Malte betrachtet sie eingehend von der Seite, nimmt ihre Selbstsicherheit wahr, spürt ihre Gegenwart bis in seine Knochen und kann sie nur bewundern. Dafür, dass sie immer noch aufrecht steht, dass sie weiß, wer sie ist und was sie will, obwohl sie ihr Leben zuletzt in der Hölle verbracht hat.
Ihr altes Fahrrad mit den bunten Bandaufklebern hat keinen Gepäckträger, also hängt sie die Plastiktüte mit dem Essen an den Griff und geht in die Knie, um das Schloss zu öffnen. Maltes Blick und Gedanken bleiben an der schaukelnden Tüte kleben, ihm kommt in den Sinn, wie ähnlich er und diese Tüte mit Essen sind. Früher hat Olivia ihn bewegt, und auch heute noch schwankt er bei der Erinnerung an sie hin und her, obwohl sie ihm keine Beachtung mehr schenkt. Einfach vergessen, sobald sie ihm den Rücken zuwandte.
Olivia. Noch immer spürt er die kurze Berührung von damals. Er darf sie nicht erneut verschwinden lassen, endlich steht sie vor ihm, nichts hat sich geändert, sie lässt ihn um ihre Aufmerksamkeit betteln. Sie spielt mit seinen Gefühlen, ignoriert sie, nimmt sie nicht wahr. Für Olivia haben sie nie existiert. Seine Gefühle.
Malte besinnt sich. Wegen seiner Gefühle ist er nicht hier, er ist nicht mehr der Junge von damals. Olivia ist ihm nicht überlegen, aber sie macht Anstalten, sich auf ihr Fahrrad zu schwingen und ihn stehen zu lassen.
»Was studierst du?«, fragt er das Nächstbeste, das ihm in den Sinn kommt. Er kennt die Antwort, weiß alles, was die Presse in den letzten Monaten über Olivia an die Öffentlichkeit gezerrt hat – und noch mehr. Aber Olivia soll nicht wissen, mit welcher Intensität er den Rummel um ihre Person verfolgt hat.
Sie sieht ihn gleichmütig an, ihre Sorge scheint verschwunden, sie wirkt weder teilnahmslos noch gehetzt noch besonders beteiligt an ihrem Gespräch. »Eigentlich Medien- und Kommunikationsmanagement, habe es aber abgebrochen.«
Daumen und Zeigefinger zupfen unbewusst am Henkel der Plastiktüte, die immer noch am Lenkrad baumelt, und wieder ist es, als wäre er die Tüte, als würde Olivia mit ihrer kurz angebundenen Art an ihm zupfen.
»Verstehe.« Eigentlich will er nach dem Warum fragen, doch damit stünde er wieder an der Grenze, die zu übertreten Olivia nicht bereit ist.
»Was ist mit dir? Du bist anders geworden.« Ihre Aussage verblüfft ihn. Dass sie Interesse an ihm zeigt. Dass sie ihn genug beachtet hat, um eine Veränderung zu bemerken, die über seine schlechte Haut von früher hinweggeht. Vor allen Dingen aber verblüfft es ihn, dass sie noch hier ist, auf dem Fahrrad, und mit ihm spricht. Ihren Dialog aktiv am Laufen hält.
Er zuckt mit den Achseln. »Nicht anders. Nur älter.«
»Das Alter kann viel verändern.« Kurz senkt sie den Blick, dann mustert sie Malte nachdenklich. Lässt von der Plastiktüte am Lenkrad ab und nimmt eine Strähne seiner langen dunkelblonden Haare neben seiner Stirn zwischen ihre Finger, um sanft daran zu ziehen. »Hast du schon immer ausgesehen wie der Sänger von Giant Rooks?«, fragt sie neckisch und lächelt.
Ihm wird heiß. Seine Wangen glühen in der frischen Herbstluft. Flirtet sie mit ihm? Tausend Fragen zischen durch seinen Kopf. »Ist das eine Band?«, stellt er Frage tausendundeins.
Olivia nickt und lässt seine Haarsträhne fallen. Nun liegt sie wieder kalt an seiner Schläfe.
Malte muss sich ermahnen, die Ruhe zu bewahren, und räuspert sich. »Keine Ahnung, ob ich früher wie der ausgesehen habe. Sieht er gut aus?«
»Das musst du selbst entscheiden.«
Diese Frau verwandelt seinen Verstand in eine gallertartige Masse. Ohne nachzudenken, zieht er sein Handy aus der Hosentasche. Er muss wissen, wie dieser Typ aussieht, kann nicht warten, erträgt nicht die Ungewissheit, mit welchen Augen sie ihn sieht. Zu spät erinnert er sich an die aktivierte Aufnahmefunktion seines Telefons und erstarrt. Olivia wird merken, dass er ihr Gespräch aufzeichnet, wenn sie sein beleuchtetes Display bemerkt.
»Später«, sagt Olivia entschieden und drückt seine Hand mit dem Smartphone wieder in Richtung Hosentasche, bevor das Licht des Displays sie darauf aufmerksam machen kann, wie dunkel es bereits geworden ist.
Maltes Erleichterung lässt ihn beinahe auflachen. Ihre Ahnungslosigkeit ist seine Rettung. Als hätte sie sich mit ihm gegen sich selbst verschworen. Und auf einmal scheint ihm alles möglich.
»Warum hast du es getan?«, fragt er freiheraus, seine Angst, sie zu verschrecken, ist einer neuen Selbstsicherheit gewichen.
Olivia sieht ihn irritiert an, deutet seine Frage falsch, und ihr Blick huscht zu dem Telefon in seiner Tasche.
Malte schüttelt den Kopf. »Im Sternenhagel, Olivia. Warum hast du es getan?«
Olivia zuckt zurück, als hätte er die Hand gegen sie erhoben. »Ich rede nicht übers Sternenhagel«, sagt sie kalt, und er kann ihrer Körperhaltung ansehen, dass sie nun doch fahren wird. Der kurze Moment der Euphorie ist vorbei. Malte könnte sich für seine Dummheit die Zunge abbeißen. Er wird sie verlieren, jede Chance auf Olivias Vertrauen, ihre Verbundenheit.
Und weil es hoffnungslos scheint, macht er weiter. Er denkt nicht länger nach, wirft jegliche Berechnung über Bord und folgt seinem Bedürfnis, alles zu erfahren. »Komm schon, mach bei mir eine Ausnahme, ja? Das schuldest du mir.« Er hält ihr Lenkrad fest, nun ist er es, der die Tüte ins Schaukeln versetzt.
Olivia wirkt weder wütend noch verängstigt, trotz seines übergriffigen Verhaltens, dessen er sich schlagartig bewusst wird. »Ich schulde es dir? Warum? Was habe ich getan, um dir irgendetwas zu schulden?«
Malte wird verlegen. Er will nicht darüber reden, aber ihre Frage übergehen will er auch nicht. »Du weißt es nicht mehr?«
Ihr Gesichtsausdruck verschließt sich und macht es Malte unmöglich, ihre nächsten Worte vorherzusehen. »Weil ich deine Schwärmerei nicht erwidert habe?«
Bloßgestellt und missverstanden. Malte schluckt hart und schmerzhaft. »Das war keine Schwärmerei«, bringt er dennoch gefasst hervor.
»Natürlich war es das. Du warst ein Baby, was sonst soll es gewesen sein?«
»Ich war fünfzehn«, stellt er klar, als wäre allein die Zahl Aussage genug über den Grad seiner damaligen Reife. Er hatte Pickel, einen armseligen Bartflaum, schlaksige Gliedmaßen, aber im Kopf war er den anderen weit voraus.
»Und ich siebzehn«, unterbricht sie seine Gedanken. »Zwischen uns lag ein Universum.«
Davongewischt sind seine Hoffnungen, er hätte damals eine Chance bei ihr gehabt. Umso mehr wird er sich bewusst, dass dieser Junge von damals nicht mehr da ist. Sie hat es selbst gesagt.
Das Alter kann viel verändern.
Ihm hat es einen anständigen Bartschatten und ein beachtenswertes Wachstum der Muskulatur beschert. Die Evolution des Malte Henning. Er will verdammt sein, wenn sie nicht auch in seinem Kopf stattgefunden hat. Nicht noch einmal lässt er sie darüber entscheiden, was er von ihr bekommt und was nicht. Sie hat etwas, das er will, und keine Vergangenheit der Welt wird ihn daran hindern, es sich zu holen.
Die Wahrheit.
»Warum hast du das im Sternenhagel getan?«, wiederholt er mit einer Dringlichkeit, die nur er selbst begreift.
Olivia lächelt traurig, dann schüttelt sie den Kopf. »Gute Nacht, Malte«, sagt sie und tritt in die Pedale.
»Dann sag mir wenigstens, ob etwas von dem stimmt, was gesagt wird«, ruft er ihr hinterher. Er überlegt, ihr zu folgen, hinter dem Fahrrad herzulaufen, bleibt aber stehen, Kartoffeln Lorraine in seiner Plastiktüte, deren Geruch ihm wie Hohn in die Nase steigt.
Olivia fährt davon, entfernt sich immer weiter. »Es ist alles wahr und nichts davon. Such es dir aus«, hört er sie in den Wind rufen, sieht die Rückseite ihrer Hand, die sie zum Abschied gehoben hat.
»Olivia …«, brüllt er ihr hinterher, flehend und gequält wie ein verlassener Hund.
Als sie plötzlich stehen bleibt, von ihrem Rad steigt und sich zu ihm umdreht, glaubt er kurz, sein Verstand habe in den Traummodus gewechselt.
»Hast du Julian irgendwann mal gesehen?«, fragt sie.
Malte atmet ein. Atmet aus. »Nein, habe ich nicht«, sagt er mit fester Stimme, weil es die Wahrheit ist.
Olivia nickt, nicht enttäuscht, nur in ihrer Vermutung bestätigt, steigt wieder auf ihr Rad und fährt davon.
Malte sieht ihr hinterher, beobachtet, wie sie kleiner und unwirklicher wird, bis eine Kurve sie verschwinden lässt. Auf dem Weg nach Hause landet sein Essen im nächsten Mülleimer. Der Appetit ist ihm vergangen.
5
Obderwede, 22.Oktober
Mit einem lauten Klick fällt die Tür ins Schloss und zerreißt die düstere Stille. Im Wohnzimmer flackert der Fernseher, der Ton ist aus. Es riecht nach teurem Parfüm und Pfeifentabak, eine ekelerregende Mischung, die sich über Jahre hinweg in seine Nasenschleimhäute gebrannt hat. Als er die Treppe nach oben stapft, hört er seine Mutter rufen. Vor seinem Zimmer im ersten Stock ruft sie ihn erneut, die weinerliche Stimme näher als zuvor, sie muss ihm gefolgt sein. Er schlägt die Tür zu und dreht den Schlüssel um, bevor sie ihn erreichen kann, und nur Augenblicke später klopft sie zaghaft. Malte schleudert frustriert seine Jacke auf den Boden und macht über den noch laufenden Laptop Musik an. Laut. Welshly Arms, Olivias altes Fahrrad hat ihn heute Abend daran erinnert, warum er angefangen hat, sie zu hören.
Er reibt sich mehrmals heftig über Gesicht und Haare, läuft im Zimmer auf und ab, fühlt sich gestresst und gescheitert. Aufgewühlt. Und dann ihre Frage nach Julian, das war so typisch für sie. Wie er sich dabei fühlt, ist ihr egal gewesen. Beschissen hat er sich gefühlt. Er holt sein Handy aus der Hosentasche, um sich davon abzulenken. Schon auf dem Weg nach Hause hat er sich die Aufnahme angehört. Seine Fehler erkannt. Er ist bereit, aus ihnen zu lernen. Mit einem Schubs fliegt der Wäscheberg auf seinem Stuhl zu Boden, und er setzt sich vor seinen Laptop, öffnet ein Suchprogramm. Als er die Stelle gefunden hat, spielt er zum wiederholten Male einen ganz bestimmten Satz ab.
»Hast du schon immer ausgesehen wie der Sänger von Giant Rooks?«
Olivias Stimme, ein neckischer Gesang, leicht und schwerelos, als hätte sie niemals etwas Schlechtes erfahren, bereitet Malte jedes Mal eine Gänsehaut. Er holt tief Luft, dann hämmert er die Worte »Giant Rooks« und »Sänger« in die Tastatur. In null Komma sechsundsiebzig Sekunden hat er ungefähr dreiunddreißigtausendachthundert Treffer. Malte weiß nicht, was er erwartet hat, doch während er sich durch eine Fotogalerie klickt, überkommt ihn eine zufriedene Erleichterung. Er steht nicht auf Typen, doch objektiv betrachtet sieht der Typ gut aus. Ein bisschen babyfacig vielleicht, aber das macht das jugendliche Alter. Und die Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen.
Malte lehnt sich zurück, die Anspannung weicht aus seinem Körper, und ein paar Schläge lang lauscht er dem Klopfen seines Herzens. Alles ist gut, sagt er sich, er hat noch nicht verloren. Er muss nur anders vorgehen. Um Journalist zu werden, braucht es mehr als ein gutes Gespür für eine herausragende Story und das fast perverse Glück, die Person des größten medialen Interesses der letzten Monate persönlich zu kennen. Olivias Rückkehr ist ein Zeichen. Sein Zeichen, dass sein neu eingeschlagener Weg der richtige ist. Endlich weiß er, wohin er gehört.
Und das ist nicht Obderwede.
Eine neue Idee nimmt in seinem Kopf Gestalt an. Während er darüber nachdenkt, öffnet er in einem Browser seine eigene Website www.sthboutoiia.de, sein ganzer Stolz, auf der er alles über Olivia dokumentiert, was er in der weiten Welt des Internets über sie gefunden hat. Alles über Olivia Bloch, das Wunder aus dem Sternenhagel, die einzige Überlebende der Geiselnahme vor vier Monaten.
Das Mysterium.
Sein letzter Beitrag ist erst einige Stunden alt und zeigt ein Foto von ihr, verkleidet wie ein Gangsta-Rapper mit weiter Jeans und tief sitzender Kapuze, wie sie am ZOB Hannover einen Bus besteigt. Allein dieser Artikel hat bereits über hunderttausend Aufrufe.
Er öffnet eine Seite seiner Homepage, die nicht für die Öffentlichkeit freigeschaltet ist, und trägt »Giant Rooks« in die Liste der Bands ein, die Olivia über die Jahre hinweg erwähnt hat. Kartoffeln Lorraine stehen in der Kategorie Essen als die häufigste Bestellung im Kartoffeltopf. Auch hier macht Malte einen Eintrag.
Es gibt nichts, was er nicht über sie weiß.
6
Fünf Jahre zuvor – Obderwede, 6.August
Ich war vom Weg abgekommen und ließ achtlos mein Fahrrad zu Boden sinken, wo es im tiefen Gras verschwand. Statt der Straße folgte ich dem unsichtbaren Trampelpfad tiefer ins Gestrüpp, bis es mich gänzlich verschluckt hatte. Kleine Zweige kratzten an meinen nackten Beinen, doch ich spürte es kaum, mein Kopf war mit konzentrierter Spannung gefüllt, denn obwohl ich den Weg kannte, wäre es ein Leichtes gewesen, sich zu verlaufen. Je weiter mich mein Weg führte, desto kühler wurde die Luft, eine Erleichterung angesichts des heißen Tages, der mir den Schweiß aus jeder Körperpore trieb. Eine anstrengende Woche lag hinter mir, die Schule hatte wieder begonnen und mit ihr der zusätzliche Druck, ein möglichst akzeptables Abitur hinzulegen. Aber die Erwartungen an mich hatte ich in Hannover gelassen, vor mir lagen sechsunddreißig mehr oder weniger freie Stunden bei meinem Vater.
Wie jedes Mal bekam ich beim Anblick des zugewachsenen Hauses eine Gänsehaut, und die Zweifel, ob es verwerflich war, was ich tat, ließen mich innehalten. Ein knappes Jahr hatten in dem eingeschossigen Flachdachhaus Leichenwäschen stattgefunden, tote Menschen waren hygienisch versorgt, zurechtgemacht und in der angrenzenden Kapelle betrauert worden. Familien und Freunde hatten geweint, sich mit einem unwiderruflichen Verlust gequält, die letzte Ehre für einen Verstorbenen, der ein paar Meter weiter zu Grabe getragen werden sollte.
Zu letzterem Teil war es nie gekommen. Nach der Klage einiger Anwohner und der langwierigen Verhandlung durfte der »Friedhof der Namenlosen« nicht planiert werden, was neue Bestattungen ausschloss. Das Leichenhaus, nach vorangegangener Ausschreibung für hiesige Architekten unter großem Tamtam erbaut, verlor seine Existenzberechtigung, und das Gebäude wurde stillgelegt.
Was blieb, war ein nahezu unberührter »Lost Place«, ein verlorener Ort, der sich zusehends der festen Umarmung der Natur hingab. In zehn Jahren war er zuerst verspottet, dann ignoriert und schließlich vergessen worden. Niemand interessierte sich für ihn, niemand betrat je diese morbide Stätte des Versagens.
Dass ich mich im Leichenhaus herumtrieb, tat niemandem weh, verscheuchte ich meine Bedenken und setzte mich wieder in Bewegung. Zunächst zog es mich zu einem dreckigen Kellerfenster an der Hinterseite des Gebäudes. Ich kämpfte mich durch kniehohen Giersch und anderes Unkraut, genervt, dass das Grünzeug innerhalb kürzester Zeit wieder alles in Beschlag genommen hatte. Als ich in die Hocke ging, sandte ein vertrauter Muskelkater Schmerzen durch die Nervenbahnen meiner Beine. Der etwa einen Meter tiefe offene Steinschacht wäre breit genug gewesen, um hineinzuklettern, doch da er nun unter Zaunwinde und Löwenzahn verschwunden war, zog ich es vor, die Gewächse zur Seite zu schieben und vornübergebeugt nach dem gesuchten Gegenstand zu tasten. Meine Finger zuckten mehrere Male vor Spinnennetzen und anderen unerwünschten Berührungen zurück, bis ich ihn schließlich fand.
Die kleine dunkelgrüne Sparkasse auf meinen Schoß, wischte ich flüchtig den Dreck von der lackierten Oberfläche. Einen Schlüssel gab es nicht, nur ein loses Gummiband, das die Kasse zusammenhielt. Mit einer Vorahnung entfernte ich es und hob den Deckel. Die Scharniere quietschten, wie sie es immer taten, aber der Inhalt war ein anderer. Mit zusammengezogenen Augenbrauen starrte ich in die leere Kasse, dann schloss ich sie wieder, fummelte das Gummi herum und legte sie zurück in ihr Versteck.
So lautlos wie möglich huschte ich zum Hintereingang des Gebäudes, das Knacken unter meinen Füßen machte mich nervös, als wäre jeder Schritt ein ungezügeltes Brüllen, das allen im Dorf meine verbotenen Machenschaften verriet. Ich blieb vorsichtig. Wenn mich jemand erwischte, würde es Ärger geben.
Die stählerne Tür am Hinterausgang sah verschlossen aus, doch schon vor langer Zeit war sie geknackt worden. Meine Hand auf dem verwitterten Türgriff, hörte ich hinter mir ein Rascheln im Unterholz. Ohne loszulassen, drehte ich mich um. Ein schmaler Weg, kaum zehn Meter lang, trennte mich vom Friedhof der Namenlosen. Vermutlich war es ein Vogel oder ein Eichhörnchen im Wald gewesen, der den Trauerpfad umgab, kein Grund, sich Sorgen zu machen. Energisch drückte ich die Tür auf, als ich glaubte, Schritte hinter mir zu hören. Wieder fuhr ich herum, entdeckte aber niemanden.
Ich sorgte dafür, dass die Tür leise ins Schloss fiel, und hastete durch den kargen, kellerähnlichen Gang. Es roch nach Fäulnis und Schimmel, weshalb ich die Luft anhielt und meinen Schritt beschleunigte.
Die meisten Türen im Leichenhaus waren verschlossen, ließen aber aufgrund ihrer Beschaffenheit Vermutungen zu, was sich hinter ihnen verbarg. Die beschlagene Metalltür mit dem langen waagerechten Griff schützte den Kühlraum vor neugierigen Blicken, eine schwere Eisentür war vermutlich der Eingang in den Keller, andere Türen mit Verglasungen offenbarten Büros und Aufenthaltsräume. Für den Fahrstuhl fehlte der Strom, aber ich hatte ohnehin nicht die Absicht, ihn zu benutzen. In meiner Vorstellung endete er nicht im Keller, sondern fuhr direkt bis in die Hölle.
Eine pulsierende Aufregung begleitete mich jedes Mal, sobald ich mich allein im Leichenhaus aufhielt. Vielleicht machte das den Reiz aus. Die morbide Atmosphäre faszinierte mich, die Vorstellung, dass an diesem Ort Leichen zurechtgemacht und gelagert worden waren, bis sie unter die Erde kamen, beflügelte meine Vorstellungskraft und ließ mich gruseln.
Die Zeit hatte dem Interieur wenig anhaben können, lediglich schwarzer Schimmel hatte sich an den Außenwänden bis an die Decken gefressen. Jedoch nicht in der Haupthalle. Wände und Boden waren mit weißen Kacheln bestückt, die immer noch erahnen ließen, wie es gewesen sein musste, an diesem Ort zu arbeiten.
Als Handlanger des Todes.
Von den Decken hingen längliche Leuchten über den zwei Metalltischen, auf denen die Leichenwäsche stattgefunden haben musste, ohne Strom zur Nutzlosigkeit verdammt. Die bodentiefen Milchglasfenster waren blind, die hoch stehende Sonne hüllte den kühlen Raum in ein diffuses Licht.
Ein Klopfen riss mich aus meiner Ehrfurcht. Ich fuhr herum, doch ich war allein. Da fiel es mir auf. Der einzige Sarg der Haupthalle, es war ein Sanitätssarg aus Aluminium, stand nicht an seinem Platz. Jemand hatte ihn von der Wand weggeschoben und tiefer in den Raum gestellt. Sonst lag der Deckel daneben, doch nun war er verschlossen.
Wieder war das Klopfen zu hören, erschrocken sprang ich zurück. Es war unmöglich, festzustellen, ob das Geräusch aus dem Sarg gekommen war, es prallte an die kahlen Wände, vervielfältigte und verteilte sich im gesamten Saal. Ich schnaubte verächtlich und schritt entschlossen auf den Sarg zu, um meiner aufgekommenen Unsicherheit nicht nachzugeben.
Noch nie hatte ich ihn berührt, entsprechend kostete es mich Überwindung, meine heißen Finger auf die glatte Oberfläche zu legen. Es würde schon kein Vampir darin liegen, sagte ich mir und verdrehte bei dem Gedanken die Augen. Der Deckel war überraschend leicht, und mit heftigem Herzklopfen schob ich ihn zur Seite.
»Du glaubst echt, ich würde mich in einen Sarg legen?«
Die Stimme kam aus dem Nichts, und noch bevor ich einen Blick in den Sarg geworfen hatte, drehte ich mich so schnell um, dass mir schwindelig wurde.
Kaum zwei Meter vor mir stand ein Junge, ein selbstgefälliges Grinsen im Gesicht und einen Joint zwischen den Lippen. Er war einen halben Kopf größer als ich, der gute Schnitt seiner braunen Haare war längst herausgewachsen und sah aus, als wäre er eben erst aus dem Bett gestiegen. Die letzten Spuren seines Babyspecks ließen ihn jünger aussehen, als er war, und es schien mir einmal mehr unbegreiflich, wie er schon mit der Schule fertig sein konnte, während ich noch ein Jahr durchhalten musste.
»Du bist so ein Arschloch!«, blaffte ich ihn an – meine Stimme klang schrill zwischen den Kacheln – und gab ihm einen unsanften Stoß gegen die Schulter. Julian stolperte rückwärts und griente mich an, während er an dem Joint zog und ihn dann zwischen seine Finger nahm. Von meiner heftigen Reaktion verlegen, verschränkte ich die Arme vor der Brust. »Manchmal weiß ich echt nicht, warum ich überhaupt mit dir befreundet bin.«
Er reichte mir den Joint, als wäre das seine Antwort. Widerstrebend nahm ich ihn, wir beide wussten, dass er mich nie lange bitten musste. »Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich habe es fürs Raumklima getan. So Feng-Shui-mäßig, du weißt schon«, sagte er und schob den Deckel des leeren Sarges zurecht.
Der erste Zug war immer der schlimmste. Er kratzte im Hals und verwandelte meinen Kopf binnen Sekunden in ein Karussell, Aussteigen ausgeschlossen. »Natürlich wolltest du mich erschrecken, du Arsch!«, erwiderte ich nasal und ließ den tief inhalierten Qualm aus meinen Lungen entweichen.
»Hier, an so einem Ort? Das wäre pietätlos.«
Zynisch hob ich eine Augenbraue. »Ach, und was wir stattdessen hier machen, ist nicht pietätlos?«
Er grinste, und ich sah ihm dabei zu, wie er die Decke, die er einige Monate zuvor mitgebracht hatte und die seitdem verlässlich auf dem verstaubten Schreibtisch unterhalb des Whiteboards auf uns wartete, auf dem Boden ausbreitete. Sie war hellbraun, weich und mit Brandlöchern übersät.
»Warum bist du überhaupt hier? Ich dachte, du kommst später.« Fünf Minuten bevor ich aufs Fahrrad gestiegen war, hatte mich eine Nachricht von ihm erreicht, in der er seine Verspätung ankündigte. Auch das hatte wohl zu seinem Plan gehört, mich nicht zu erschrecken.
»Veränderte Umstände«, erwiderte er gleichmütig, dann streckte er einladend den Arm in Richtung unseres provisorischen Nestes aus.
Etwas später lagen wir nebeneinander auf der Decke, Kopf an Kopf, und reichten bereits den zweiten Joint hin und her. Für mich waren die Stunden mit Julian pure Entspannung. Gras half mir, einen inneren Druck zu lösen, der mich in Hannover stets begleitete. Meine von dem quälenden Balletttraining schmerzenden Muskeln lockerten sich, und ich konnte für kurze Zeit meine malträtierten Füße vergessen. In unserem Refugium konnten wir sein, wer wir waren. Die Erwartungen der Erwachsenen schienen weit weg, wie in einer entfernten Galaxie, und trotz der bewusstseinsverändernden Droge in meinem Blutkreislauf hatte ich das Gefühl, nur unter diesen Bedingungen frei denken zu können.
Alles war egal, denn alles war gut.
An diesem Tag konnte ich meinen Blick nicht von den Behandlungstischen wenden. Ich fragte mich, ob es unangenehm war, auf dem kalten Metall zu liegen, bis mir wieder einfiel, dass es den Menschen gleich war. Ob kalt oder warm, sie spürten es nicht. Sie waren tot. Vor einiger Zeit hatte ich mich im Internet darüber informiert, was bei einer Leichenwäsche passierte. Seitdem gingen mir die mit Watte verschlossenen Körperöffnungen nicht aus dem Kopf. Spätestens wenn jemand einen Wattebausch in den Hintern gestopft bekam, zeigte sich, ob er wirklich tot war oder nicht.
Der Tod. Er machte mir keine Angst, und doch beschäftigte er mich, seit wir uns hier herumtrieben. Ich hatte noch nie jemanden an den Tod verloren, war selbst noch nie gestorben, und bei beidem fragte ich mich, wie es sein würde. Was schlimmer war. Was mich brechen würde.
»Wusstest du, dass es Nacktschnecken gibt, die Hundekot fressen?«, fragte mich Julian plötzlich mit einer Ernsthaftigkeit, die mich aufrüttelte. Offensichtlich hatten auch seine Gedanken eine unerwartete Richtung eingeschlagen.
»Igitt, du bist ekelhaft.« Ich verzog angewidert das Gesicht.
»In England halten sie die Gehwege sauber.«
Ich gab Julian einen unsanften Hieb mit dem Ellenbogen. »Verarsch mich nicht!«
»Tu ich nicht. Habe ich mal gelesen.«
Ich runzelte die Stirn. »Wenn das stimmt, warum haben wir die dann nicht?«