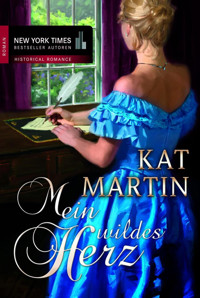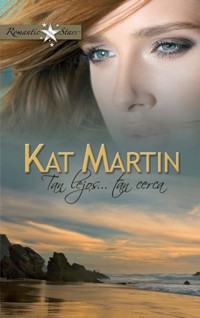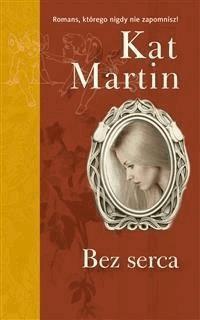3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Garrick-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Schon auf den ersten Blick ist Dominic Edgemont, der Lord von Nightwyck, dem feurigen Temperament seiner schönen Gefangenen verfallen. Die wilde Catrina weigert sich jedoch energisch, sich seinem Willen zu unterwerfen. Doch bald schon besiegen Liebe und Verlangen ihren Rachedurst. Der verwegene Dominic ahnt nicht, dass ihre Wege sich schon bald wieder kreuzen werden – und dann wird er zum Gefangenen seiner geheimnisvollen Geliebten werden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über das Buch:
Schon auf den ersten Blick ist Dominic Edgemont, der Lord von NIghtwyck, dem feurigen Temperament seiner schönen Gefangenen verfallen. Die wilde Catrina weigert sich jedoch energisch, sich seinem Willen zu unterwerfen. Doch bald schon besiegen Liebe und Verlangen ihren Rachedurst. Der verwegene Dominic ahnt nicht, dass ihre Wege sich schon bald wieder kreuzen werden – und dann wird er zum Gefangenen seiner geheimnisvollen Geliebten werden...
Edel eBooks Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2015 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 1992 by Kat Martin
Die Originalausgabe ist unter dem Titel "Gypsy Lord" erschienen.
First published in Germany: 1994 under the title "In den Fängen der Leidenschaft" by Goldmann
Covergestaltung: Eden & Höflich, Berlin.
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-738-7
facebook.com/edel.ebooks
1
London, England
18. September 1805
»Es wird behauptet, er sei ein Zigeuner.«
»Pah! Halb London hat dieses Geschwätz über sein ›unreines‹ Blut schon gehört – das macht ihn doch nur noch faszinierender.«
Lady Dartmoor lachte und hielt sich eine zarte Hand, die in einem weißen Handschuh steckte, vor den Mund. »Ich nehme an, Sie haben recht. Die Klatschmäuler stürzen sich immer mit Begeisterung auf solche Geschichten, aber trotzdem...« Sie musterte die fesche Erscheinung in makellosem schwarzem Gehrock und gutsitzender grauer Kniebundhose, die am anderen Ende des Ballsaals auf dem Marmorboden stand. Glatte dunkle Haut und kühn geschwungene schwarze Augenbrauen bildeten einen starken Kontrast zu dem Weiß seines steifen Kragens und seines Halstuchs.
Sie beäugte ihn schmachtend und strich eine nicht vorhandene Falte in ihrem grünen Seidenkleid glatt. »Bei Gott, ich glaube wahrhaftig, Dominic Edgemont ist einer der attraktivsten Männer in ganz London, so attraktiv, daß er fast schon gefährlich ist.«
Die stattliche Lady Wexford, die neben ihr stand, schien ihr zuzustimmen. Sie sagte etwas im Flüsterton, dann lachten beide. Ihre nächsten Worte wurden von der Musik und der Fröhlichkeit der elegant gekleideten Damen und Herren um sie herum übertönt, aber die rosige Röte auf den Wangen der jüngeren Frau drückte den Sinn der Worte mehr als deutlich aus.
Lady Catherine Barrington, Gräfin von Arondale, beobachtete, wie die beiden Frauen lächelnd weitergingen. Sie fühlte sich ein wenig schuldbewußt, weil sie sie belauscht hatte, war aber dennoch neugierig geworden.
»Ich frage mich, Amelia, von wem diese Damen wohl gesprochen haben.« Sie sah sich noch einmal im Saal um, konnte sich aber nicht entscheiden, welcher der gutgekleideten Männer es war. »Sie scheinen von dem betreffenden Herrn recht eingenommen zu sein.«
Catherine, die ein perlenbesetztes weißes Ballkleid mit einer hoch angesetzten Taille trug, das ihren bleichen Teint und ihr ungewöhnliches goldrotes Haar hervorhob, wandte ihre Aufmerksamkeit Amelia Codrington Barrington zu, der Baronin Northridge, die mit ihrem Cousin Edmund verheiratet und zugleich ihre engste Freundin war.
»Diese schrecklichen Klatschmäuler«, sagte Amelia aufgebracht. »Ich begreife nicht, warum sie sich nicht um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern können.«
»Sag es mir«, beharrte Catherine. »Wenn man sieht, wie sie immer noch kichern, könnte man meinen, daß er sich der allergrößten Beliebtheit erfreut.«
In dem Moment kam ein Bediensteter vorbei, der ein silbernes Tablett auf der Schulter balancierte, und die Kristallperlen des Kronleuchters über ihren Köpfen klirrten leise. Am anderen Ende des Marmorbodens spielten schwarzgekleidete Musiker einen lebhaften Rundtanz, und in der Ferne sah man durch die offene Tür etliche Herren an einem mit grünem Boi bezogenen Spieltisch sitzen und Karten spielen. Der Rauch ihrer Zigarren wogte in dichten Schwaden um ihre Köpfe.
»Sie haben von Dominic Edgemont gesprochen«, berichtete ihr Amelia. »Lord Nightwyck, Erbe des Marquis von Gravenwold.« Amelia, die fünf Jahre älter war als Catherine, lächelte vielsagend. »Das ist der Mann, der neben diesem großen vergoldeten Spiegel am anderen Ende des Ballsaals steht.«
Catherines Augen suchten den prächtigen Salon ab und schauten über die Frauen in den Seidenkleidern und den funkelnden Juwelen und die Männer in den kostspieligen Gehröcken hinweg. Kerzen in kunstvoll verzierten Leuchtern flackerten vor dem Goldbrokat an den Wänden, und die Tische waren mit Leinen und Silber gedeckt und mit Speisen beladen, denen würzige Düfte entströmten. Links von dem Grüppchen, das sie neben dem Spiegel ausfindig machte, funkelten auf Tabletts Champagnerkelche aus Kristallglas wie Prismen.
»Welcher ist er? Da steht doch mindestens ein halbes Dutzend Leute.«
»Nightwyck ist der Große. Der Mann mit dem gewellten schwarzen Haar. Der ist doch wirklich etwas Besonderes, findest du nicht? Die Hälfte aller Frauen in London ist seinen Reizen bereits erlegen, und die andere Hälfte wäre es auch, wenn sie sich nicht mehr als eine Spur vor ihm fürchten würden.«
Catherine konnte ihn augenblicklich identifizieren, doch der Mann, von dem ihre Cousine sprach, war von ihr abgewandt. Sie konnte nur seinen Hinterkopf sehen, das schimmernde Blauschwarz seiner Haare, das im Kerzenschein glänzte, und seine auffallend breiten Schultern, die durch den Schnitt seines einwandfreien schwarzen Gehrocks deutlich betont wurden. Illustre Damen und Herren aus der Oberschicht standen um ihn herum, und die Frauen wirkten verzaubert, die Männer eher neidisch als amüsiert.
»Kennst du ihn?« fragte Catherine, die ihn immer noch nicht sehen konnte, aber die Geschicklichkeit bemerkte, mit der sich Lady Wexford dicht neben seinen Ellbogen manövriert hatte. Gelegentlich wedelte sie mit ihrem handbemalten Fächer.
Amelia zuckte die Achseln. »Wir sind einander hier und da begegnet. Nightwyck zieht das Landleben vor, erfüllt jedoch immer dann seine gesellschaftlichen Verpflichtungen, wenn er das Gefühl hat, es sei um des Anstands willen notwendig.«
Die elegante, statuenhafte Amelia Barrington mit dem kurzen blonden Haar, das ein zartgeschnittenes Gesicht umrahmte, besaß die Form von Schönheit, die Catherines Neid erregte. Vor sechs Jahren hatte sich ihr Cousin Edmund praktisch auf den ersten Blick in Amelia verliebt. Sie hatten einen vier Jahre alten Sohn, der Eddie hieß und den Catherine ganz und gar reizend fand.
»Sind die Gerüchte über ihn wahr?« fragte sie und beobachtete die verführerischen Blicke, die ihm eine dunkelhaarige Frau zuwarf.
»Natürlich nicht. Aber niemand weiß allzuviel über ihn, und Nightwyck zieht es vor, es dabei zu belassen. Er ist allerdings wirklich eine gute Partie. Intelligent, gutaussehend, reich. Dein Vater hatte früher einmal die Hoffnung, er könnte euch beide zusammenbringen.«
Catherine hob mit einem Ruck den Kopf. »Vater ist doch bestimmt nicht an ihn herangetreten.«
»Nur in Form einer subtilen Andeutung durch einen sehr engen Freund. Nightwyck wollte natürlich nichts davon wissen. Er sagt, er hat kein Interesse an einer Heirat, ganz gleich, mit wem. Weder heute noch jemals später.«
»Aber eines Tages wird er zwangsläufig heiraten. Wenn er der Erbe des Marquis ist, wird er heiraten müssen.« Bis vor kurzem hatte ihr stilles Leben auf dem Lande in der Umgebung von Devon Catherine vollauf in Anspruch genommen, sie hatte nichts mit dem gesellschaftlichen Trubel Londons zu tun gehabt und war gegen Gerüchte bestens abgeschirmt gewesen. Mit ihren knapp neunzehn Jahren war sie zwar etwas älter, als sie es hätte sein sollen, doch heute abend fand der Ball statt, auf dem sie in die Gesellschaft eingeführt wurde, ihre erste wirkliche Bekanntschaft mit der eleganten Welt der oberen Zehntausend.
»Das ist eine lange Geschichte«, sagte Amelia zu ihr. »Da ihr beide wohl kaum zusammenpassen würdet, ist sie eigentlich nicht von Bedeutung.«
Catherine machte den Mund auf, um das Thema weiterzuverfolgen, aber Jeremy St. Giles kam auf sie zu, um den Tanz einzufordern, den sie ihm versprochen hatte. Catherine hing sich mit einem Lächeln bei dem gutaussehenden jungen Mann ein, den sie am selben Abend erst kennengelernt hatte.
»Ich hatte schon gefürchtet, Sie hätten es vergessen.« Warme braune Augen glitten über ihr Gesicht.
»Ein Versprechen vergesse ich selten«, sagte sie schlicht und einfach.
Darüber schien sich Jeremy zu freuen, und er lächelte, als er sie auf die Tanzfläche führte. Die schwere, mit Perlen besetzte Schleppe ihres weißen Seidenkleids, die an ihrem Handgelenk befestigt war, hob sich, als sie ihre Hand auf seine Schulter legte. Das Kleid, ein Geschenk ihres Onkels, des Herzogs von Wentworth, fiel gerade geschnitten von ihren Hüften auf den Boden und hatte kleine Puffärmel; der eckige Ausschnitt ließ den oberen Ansatz der Rundungen ihrer hohen, vollen Brüste frei.
»Sie sehen bezaubernd aus, Lady Arondale«, sagte Jeremy, der sie so hielt, als könnte sie zerbrechen. »Sie sind ganz entzückend anzusehen.«
Catherine reagierte angemessen auf die Schmeichelei, obgleich das kaum die Worte waren, die sie selbst gewählt hätte, um sich zu beschreiben. Sie war keine zerbrechliche Schönheit wie Amelia. Sie war nicht schmal und zart gebaut, sondern besaß eine reife Figur mit einer Wespentaille und üppigen Rundungen.
Ihre Haut war zart und rein, von ein paar kleinen Sommersprossen auf der Nase abgesehen, aber ihre Augen waren etwas zu groß und ein wenig zu grün, und ihre Lippen waren etwas zu voll. Sogar ihre schlichte geflochtene Haarkrone vermochte nicht zu kaschieren, wie dick und auffallend goldrot ihr Haar war.
Da ihr der Rhythmus des Tanzes Spaß machte, lächelte Catherine höflich, als sie auf der Tanzfläche herumwirbelte und gelegentlich in den Spiegeln, die die Wände säumten, einen Blick auf sich und ihren Partner erhaschte. Doch ihre Gedanken schweiften immer wieder zu dem faszinierenden Lord Nightwyck ab. Immer wieder ertappte sie sich dabei, daß sie nach ihm Ausschau hielt und neugierig auf sein Gesicht war, aber zu ihrem Verdruß konnte sie nur von hinten einen Blick auf seine großgewachsene Gestalt werfen, als er auf der Terrasse verschwand.
»Was ist los, Dominic?« Rayne Garrick, der Vierte Vicomte Stoneleigh, blickte von dem großgewachsenen dunkelhäutigen Mann an seiner Seite auf den mit Wachs versiegelten Umschlag, den der schmächtige Lakai mit dem rotblonden Haar gerade gebracht hatte.
»Ein Sendschreiben von Vater.« Dominic riß es auf, zog den Brief heraus und überflog die schwach hingekritzelten Worte. »Hier steht, daß sein Zustand eine Wendung zum Schlechteren genommen hat und daß ich mich umgehend bei ihm einfinden soll.«
»Vielleicht ist es diesmal wahr.«
»Und vielleicht können Pferde fliegen.« Dominics schwarze Augenbrauen zogen sich zusammen. »Das ist doch nur einer seiner vielen Versuche, über mich zu bestimmen. Die Entschlossenheit dieses Mannes ist kaum zu überbieten, das muß ich ihm lassen.«
»Du beurteilst ihn furchtbar ungerecht, Dom. Der Mann ist alt und kränklich. Vielleicht bemüht er sich, all die Jahre wiedergutzumachen, in denen er sich nicht um dich gekümmert hat.«
Ein Muskel in Dominics Kiefer spannte sich an. Seine Lippen, die normalerweise voll und sinnlich waren, zogen sich zu einem dünnen, grimmigen Strich zusammen. »Und vielleicht kommt das achtundzwanzig Jahre zu spät.« Er knüllte die Nachricht zu einem kleinen elfenbeinfarbenen Knäuel zusammen, warf sie dem Lakaien zu und wandte sich ab, um zu gehen.
»Werden Sie das Schreiben beantworten, Ihre Lordschaft?« rief ihm der Junge nach.
»Ich werde ihm meine Antwort persönlich übermitteln.« Sein Ausdruck war verkniffen, und seine langen braunen Finger waren zu Fäusten geballt, als Dominic sich auf die Suche nach der Garderobe machte.
Rayne schaute ihm nach und beobachtete, wie etliche Frauen ihn auf dem Weg aufhielten. Er grinste, als er zusah, mit welchem Geschick Dominic mit jeder einzelnen umging, sein einstudiertes Lächeln aufsetzte und schmeichelhafte Worte sagte, die ihm Einlaß in das Boudoir so gut wie jeder Dame verschafft hätten.
Er hatte etwas an sich, was die Frauen faszinierend fanden, etwas Finsteres und Undurchschaubares. Dominic wurde ihrer leicht überdrüssig, und dann ließ er sie schmachten und ersetzte sie für eine ebenso kurze Zeitspanne durch andere. Der Umstand, daß keine ihn halten konnte, schien die Frauen nur noch mehr zu reizen.
Rayne beobachtete, wie sein Freund den Saal verließ und haarscharf einer Begegnung mit der herrschenden Schönheit des Abends, Lady Arondale, entging. Wenn ihre Unschuld nicht ganz so offenkundig gewesen wäre – und ihr Onkel nicht ganz so einflußreich –, dann hätte es interessant sein können, mit Nightwyck um die Aufmerksamkeit der Dame zu wetteifern. So, wie die Dinge standen, würde Dominic wahrscheinlich für den Rest der Ballsaison fort sein, und die allzu offensichtlichen Reize der bezaubernden jungen Dame stellten eine zu große Bedrohung für Raynes Junggesellenstand dar.
Er beobachtete, wie sie sich mit ihrem Cousin Edmund und seiner hübschen Frau Amelia unterhielt. Rayne hatte den schlanken, leicht verweichlichten, allzu geckenhaften Mann noch nie leiden können, doch seine Frau konnte ganz reizend sein. Er fragte sich, ob der Baron seiner jungen Cousine wegen ihrer kürzlich angetretenen Erbschaft grollte – der Grafschaft von Arondale, die an ihn gefallen wäre, hätte ihr Vater nicht bei der Krone eine Petition eingereicht, um Catherine als seine rechtmäßige Erbin einsetzen zu lassen. Was Northridge auch empfinden mochte, er verbarg es geschickt, denn es war deutlich zu erkennen, daß das Mädchen ihn sehr gern hatte.
Rayne beobachtete sie noch einen Moment lang, fragte sich, welche unerforschten Leidenschaften in ihr schlummern mochten, und spürte, wie sein Körper sich regte. Mit einem leisen Seufzer des Bedauerns darüber, daß es weder ihm noch seinem Freund vergönnt sein würde, ihre Reize zu kosten, wandte er sich von der unschuldigen Versuchung ab, die sie darstellte, und mischte sich unter die Gäste.
»Ich glaube, Catherines gesellschaftliches Debüt hat sich als recht erfolgreich erwiesen«, sagte Amelia.
Edmund Barrington, Baron Northridge, sah zu, wie seine junge Cousine wieder einmal auf die Tanzfläche geführt wurde. Ganz im Gegensatz zu der zerbrechlichen und vornehmen Schönheit seiner Frau strömte Catherines kleingewachsene Gestalt eine üppige Sinnlichkeit aus, der die wenigsten Männer widerstehen konnten. Den ganzen Abend über hatten sie sie umschwärmt wie Bienen eine leuchtendrote Blüte.
»Drei Earls, ein Baron und ein Herzog haben ein Auge auf sie geworfen«, sagte Edmund. »Der alte Arondale hätte sich gefreut. Es ist wirklich ein Jammer, daß er nicht lange genug gelebt hat, um sie zu verheiraten.« Da die beiden als Kinder miteinander aufgewachsen waren, hatte Edmund Catherine immer sehr gern gehabt und verspürte Beschützer-instinkte, wie ein Bruder sie seiner kleinen Schwester gegenüber hätte empfinden können.
Sie war ein süßes junges Ding, obgleich sie schon immer ein wenig zu lebhaft gewesen war. Und sie sorgte sich übermäßig um die Menschen, die in ihren Diensten standen. Ein solches Verantwortungsbewußtsein bei einem so jungen Mädchen war eigentlich wirklich albern.
Edmund beobachtete sie jetzt, und ihr silbernes Lachen ließ etliche junge Kerle, die in der Nähe standen, die Köpfe umdrehen. Als sie an ihm vorüberkam, lächelte sie, als wollte sie sich damit für alles bedanken, was er getan hatte. Sie hatte ihm schon immer nahegestanden.
»Sie scheint den jungen St. Giles zu mögen«, sagte Amelia. »So, wie er sie immer wieder ansieht, wird er ihr ganz bestimmt einen Antrag machen. Es ist ein Jammer, daß er nur der zweitgeborene Sohn und nicht der Erbe ist.«
Edmund nickte. »Wir müssen vorsichtig sein und immer daran denken, was für Catherine das Beste ist.« Aber war es nicht schon immer so gewesen?
Als ihr Vater, Christian Barrington, Earl von Arondale, gestorben war, hatte Catherine Edmund und seine Familie gebeten, nach Devon zu kommen und zu ihr ins Schloß zu ziehen. Natürlich waren sie ihrem Wunsch gefolgt, denn Catherine verwaltete die Finanzen, und ihr Onkel, der Herzog, hatte sich darüber gefreut. Da er vollauf mit eigenen Angelegenheiten beschäftigt war, hatte Gilbert Lavenham, Herzog von Wentworth, diese familiären Beziehungen unterstützt. Da seine Schwester, Catherines Mutter, schon lange tot war, glaubte der Herzog, Amelia würde einen guten Einfluß auf sie haben, da ein junges Mädchen die Anleitung einer älteren Frau brauchte.
Diese Regelung war allen außer Edmund gelegen gekommen, der das Landleben haßte und den Trubel der Stadt vermißte. Nach einigen Monaten war es Edmund endlich gelungen, sie zu bewegen, daß sie in Catherines Stadthaus in London zogen.
Ihr Onkel, der Herzog, war außer sich vor Begeisterung.
»Es ist an der Zeit, daß du einen Mann findest«, sagte Wentworth. »Du mußt schließlich an den Namen und den Besitz der Arondales denken. Als dein Vater dich zu seiner Erbin eingesetzt hat, hat er von dir erwartet, daß du heiratest und ihm einen Enkel gebierst.«
Catherine war zwar in ihrer Unschuld bei den Worten des alten Herzogs errötet, doch sie hatte eingewilligt. »In dem Punkt könnte ich deinen Rat gebrauchen«, sagte sie zu ihm, denn sie war sicher, er würde ihr bei der Wahl eines Partners einen großen Spielraum lassen.
»Selbstverständlich, meine Liebe.«
»Amelia und ich werden unser Bestes tun, um dir bei einer weisen Wahl zu helfen«, hatte Edmund eingeworfen.
Das war der Moment, in dem er wußte, daß seine Träume in Kürze wie Seifenblasen zerplatzen würden.
Und das war auch der Moment, in dem er beschloß, etwas zu unternehmen, um dies zu verhindern.
Catherine brachte ihre erste Saison in London hinter sich, und gerüchteweise hieß es, sie sei »der große Schrei«. Als sich die Tage jedoch dahinschleppten und sie eine Soiree nach der anderen besuchte, zahllose Kostümbälle, private Parties und Abende im Theater absolvierte, begann sie seltsamerweise, all dieses Trubels überdrüssig zu werden und sich danach zu sehnen, wieder ihr einfacheres Leben zu Hause zu führen.
Aber andererseits hatte sie etliche Heiratsanträge von Männern aus den besten Familien Englands bekommen, und es standen noch ein Dutzend weitere Anwärter aus, mit deren Anträgen zu rechnen war. Dennoch war keiner darunter, den sie gern geheiratet hätte. Statt dessen bat sie ihren Onkel, sie für die Feiertage mit Edmund und Amelia nach Arondale zurückkehren zu lassen, und Onkel Gil erlaubte es ihr – solange sie nach London kommen würde, sowie das kalte Winterwetter erstmals eine gewisse Besserung versprach.
Als sie jetzt im Londoner Stadthaus ihrer Familie durch ihr Schlafzimmer lief, die Waltranlampe neben ihrem breiten vierpfostigen Bett löschte und matt unter die Zudecke kletterte, seufzte sie bei dem Gedanken an die Tage, die vor ihr lagen.
Edmund war natürlich heilfroh, wieder inmitten des geselligen Trubels zu stehen, doch Catherine hatte die Soiree des heutigen Abends lediglich als eine weitere Runde von endlosen Schmeicheleien und bedeutungsloser Konversation empfunden. Und bei der Wahl eines Ehemannes schien es eher darum zu gehen, unpassende Bewerber auszusondern, als darum, einen Mann zu finden, mit dem sie den Rest ihres Lebens glücklich sein konnte.
Und was ist mit Verlieben? dachte sie und starrte trostlos zu der figurenverzierten Decke über ihrem Kopf auf. Es fiel ihr schwer zu glauben, daß sie sich tatsächlich eingebildet hätte, dazu könnte es kommen. Bloß, weil ihr Vater und ihre Mutter einander geliebt hatten, hieß das noch nicht, daß ihr so etwas zustoßen würde. Das hatte sie gewußt, und sie hatte es als eine Möglichkeit hingenommen, als sie die Verantwortung für den Titel Arondale und das Vermögen übernommen hatte, und doch...
Catherine seufzte in der Dunkelheit. Sie brauchte einen Mann, um einen Erben zu gebären, und obgleich Edmund und Amelia geduldig gewesen waren – sie sogar ermutigt hatten, sich jede Menge Zeit zu lassen und die richtige Wahl zu treffen –, würde sie sich früher oder später in das Unvermeidliche fügen müssen. Dazu kam noch, daß sie um so eher wieder nach Hause fahren konnte, je schneller sie ihre Entscheidung traf.
Als sie unter der Satindecke lag, zog Catherine sich gegen die Kälte, die sich in das Zimmer eingeschlichen hatte, die Decken bis ans Kinn hoch. Das Feuer im Kamin war heruntergebrannt, und ihr weißes Baumwollnachthemd war nicht dick genug, um ihr viel Schutz gegen die Kälte zu bieten. In ihrem Hinterkopf wußte sie, daß sie nach einem Dienstmädchen hätte läuten sollen, damit es ihr eine zusätzliche Decke brachte, doch ihre Gedanken weilten ganz bei ihren Problemen und der drohend bevorstehenden Lösung.
Während die Uhr in der Stille tickte, beschlich sie Mattigkeit, und Catherine schloß die Augen. Sowie ihr Atem langsamer ging und ihre Sorgen zu verblassen begannen, ließen die Dunkelheit und die Ruhe im Raum sie in einen tiefen Schlummer sinken. Selbst als sie leise Geräusche hörte, das Quietschen des Parkettbodens, schien sie sich einfach nicht zwingen zu können, die Augen aufzuschlagen.
Sie tat es erst, als sie spürte, wie sich rauhe, grobe Finger auf ihren Mund preßten und eine riesige Männerhand sich in ihre Schulter grub und sie von der weichen Federmatratze hochriß.
Gott im Himmel, was passiert hier! »Edmund!« rief Catherine laut, doch die schwielige Handfläche des Mannes erstickte den Laut. »Hilf mir!« Die Furcht ließ ihr Herz in einem rasenden Stakkato schlagen. Catherine wehrte sich heftig und schlug mit Armen und Beinen um sich, und ihre grünen Augen waren groß vor Angst.
»Sei ruhig!« fauchte der Mann und schüttelte sie zur Warnung grob.
Wer es auch sein mochte, er war groß und kräftig, und während sie sich noch wehrte, um sich ihm zu entwinden, explodierte ihr Kiefer vor Schmerz. Catherine wimmerte leise, als das Zimmer sich zu drehen begann; dann verblaßte die Welt um sie herum, und Dunkelheit umfing sie.
Sie sackte in die Arme ihres Angreifers, ihr Kopf fiel matt an seine Schulter, und sie wehrte sich nicht mehr.
2
Unberechenbar, unbeständig und unerwartet,
so zogen sie nach einem Plan,
den kein anderer erkennen konnte,
durch das Leben.
Kathryn Esty
Außerhalb von Sisteron, Frankreich 20. April 1806
Catherine zog das rauhe Wolltuch gegen die beißende Kälte des Windes enger um sich. Unter dem dünnen Stoff waren ihre Schultern über dem tiefen Ausschnitt ihrer schlichten weißen Bäuerinnenbluse nackt. Strähnen ihres dichten goldroten Haars peitschten ihre Wange, als der Wagen in ein Schlagloch rumpelte und sie gegen den korpulenten Mann mit der gewölbten Brust geworfen wurde, der neben ihr auf der harten Holzbank saß.
»Das Wetter wird sich bald ändern«, versprach Vaclav. »In ein paar Tagen wird es langsam wärmer werden.«
Catherine warf einen Blick auf die grauen Wolken über ihnen, die Sturmboten waren. »Und weshalb sollte das wohl so sein, wenn ich fragen darf?« bemerkte sie sarkastisch, denn sie hatte die Kälte und den Regen satt, aber noch mehr hingen ihr Vaclav, seine ungehobelten Manieren und seine lüsternen Blicke zum Hals heraus.
Der fette Mann zuckte nur mit den Schultern. »Ich sage dir nur, daß ich es fühlen kann. Bei uns sagt einem so was das eigene Gespür.«
Sie hätte gern gestritten und gesagt, er könne es unmöglich wissen, aber in den letzten acht Wochen hatte sie gelernt, daß es Dinge gab, die nur die Zigeuner wußten und sonst niemand, Dinge, die das Land und das Wetter betrafen. Dinge, die die Zukunft betrafen.
Catherine richtete sich auf der kalten Holzbank auf und zog an ihren weiten roten Röcken, schlang sie, so weit es ging, um ihre nackten Beine. Sie wünschte, sie hätte anstelle ihrer dünnen Ledersandalen kräftiges Schuhwerk besessen. Aber andererseits besaßen die meisten von ihnen überhaupt keine Schuhe.
»Wir werden mein Volk bald erreichen«, sagte Vaclav zu ihr und kratzte sich durch die Öffnung seines ausgefransten blauen Seidenhemds die behaarte Brust. Darüber trug er einen mottenzerfressenen Pullover, den er unterwegs gefunden hatte.
»Wir sind bald da?« Catherines Pulsschlag beschleunigte sich. Sie würde Pläne schmieden und Vorbereitungen treffen müssen. Sie würde wieder anfangen müssen, nach Fluchtmöglichkeiten Ausschau zu halten.
»Sie werden irgendwo am Fluß ihr Lager aufgeschlagen haben. Das ist alles, was ich weiß.«
Mehr ließ sich nicht aus ihm herausholen. Zigeuner kümmerten sich nie um genaue Zeit- oder Ortsangaben und verspürten kein Verlangen, auch nur zu wissen, welcher Monat war. Sie lebten in den Tag hinein, von einem Augenblick zum anderen. Sie seufzte bei dem Gedanken daran, wieviel sie bereits über sie gelernt hatte, seit jener Nacht vor acht Wochen, als jemand sich in ihr Schlafzimmer in ihrem Stadthaus eingeschlichen, sie bewußtlos geschlagen und sie fortgetragen hatte.
Catherine lehnte sich wieder zurück auf der Holzbank in dem Vardo, dem bunt angemalten Haus auf Rädern, in dem Vaclav lebte. Auf englisch, eine der vielen Sprachen, die die meisten von ihnen sprachen, nannte er es einen Wohnwagen, und er war so stolz darauf, daß er geradezu strahlte, wenn er ihn ansah. Er war einer der reicheren Zigeuner, die nicht mehr in Zelten lebten.
Immer mehr von seinen Leuten, hatte er ihr einmal erzählt, hatten begonnen, diese Wagen zu bauen und darin zu leben. Sie waren im Winter wärmer, und sie hielten den Regen besser ab. Sie sollte dankbar sein, hatte er zu ihr gesagt. Wenn sie erst einmal verheiratet waren, würde der Vardo ihnen ein breites bequemes Bett bieten.
Catherines Magen verkrampfte sich. Wie lange konnte es noch dauern, bis er hinter die Wahrheit kam? Nämlich die, daß sie nicht die Absicht hatte, ihn zu heiraten, und daß sie diese Absicht nie gehabt hatte. Es war lediglich ein Trick gewesen, eine Masche, um zu überleben. Es war nur eine von vielen, die sie in den letzten zermürbenden Wochen gelernt hatte.
Sie dachte an die Schläge, die sie eingesteckt hatte, an die vielen Meilen, die sie ohne Schuhe zu Fuß gelaufen war, an ihre empfindlichen Füße, die geblutet hatten und von den spitzen Steinen aufgeritzt worden waren, Füße, die es nicht gewohnt waren, schutzlos aufzutreten. Sie dachte an die Grausamkeit der Frauen, die sie als Ausgestoßene behandelten, als Dienstmädchen, kaum besser als eine Sklavin.
Die meiste Zeit über konnte sie sich kaum noch an ihr Leben als verhätschelte junge Dame erinnern oder die Gesichter von Menschen vor sich sehen, die früher einmal Angehörige und Freunde gewesen waren. Das hier war eine andere Zeit, eine andere Welt. Was zählt, ist nur die Gegenwart, sagte sie sich. Denk nicht an die Vergangenheit. Laß sie hinter dir.
Wieder und immer wieder hatte sie gegen die Tränen angekämpft, die anfangs unaufhörlich geflossen waren. Aber sie hatte schnell gelernt, daß sie ihr nichts anderes als Schläge einbrachten oder eine Nacht ohne Abendessen. Jetzt weigerten sie sich gänzlich zu fließen, und dafür war Catherine dankbar.
Sie würde überleben, hatte sie sich gelobt, während sie sich mit jedem qualvollen Tag weiter und immer weiter von ihrem Zuhause und der Familie entfernte, die sie liebte. Ganz gleich, was sie über sich ergehen lassen mußte, sie würde nach England zurückkehren. Sie würde dahinterkommen, wer für ihre Entführung verantwortlich war, für ihren Verkauf an die Zigeuner, und sie würde denjenigen dafür büßen lassen.
»Domini! Laß die Pferde stehen und komm rein zum Essen. Ich habe dir eine leckere Hasensuppe gekocht.«
Seine Mutter stand am Rande der seicht abfallenden Senke und hatte die kleinen verhutzelten Hände auf dem leuchtendgelben Rock liegen, der an ihrer winzigen und allzu schmächtigen Gestalt herunterhing. Sie wirkt soviel älter dieses Jahr, dachte er, und zum ersten Mal fragte er sich, wie viele Winter die zerbrechliche alte Frau noch überleben würde, und bei dem Gedanken spürte er, wie sich plötzlich seine Brust zusammenschnürte. Sie würde ihm fehlen, wenn sie nicht mehr da war. Er würde diese Lebensweise vermissen.
Dominic winkte in ihre Richtung und band die Apfelschimmelstute bei den anderen Pferden an, die am Rand der Wiese zwischen den Bäumen grasten. Dann ging er auf sie zu.
Die Abendluft war kühl und feucht, aber bald würden die Tage wärmer werden. Durch die dicken grauen Wolken konnte er bereits jetzt Sterne glitzern sehen. Wenigstens würde der Wetterumschlag bewirken, daß die Schmerzen seiner Mutter sich legten und daß die Mattigkeit nachließ, die er in ihren Augen sehen konnte.
»Gehst du heute nacht zu Yana?« fragte sie ihn, als er an ihrer Seite war und sie durch das hohe Gras zum Wagen zurückliefen.
Dominic zog eine dichte schwarze Augenbraue hoch. »Seit wann kümmern dich meine Nächte mit Yana?« Ein Anflug von Belustigung war aus seiner Stimme herauszuhören. Würde sie jemals in ihm nicht mehr den kleinen Jungen sehen, der sich an ihre Röcke klammerte?
»Yana will dich in die Falle locken. Sie ist nicht gut genug für dich.«
Dominic lächelte nachsichtig. »Immer dein Wunsch, mich zu beschützen. Du machst dir überflüssige Sorgen, Mutter. Die Frau wärmt mir das Bett, aber ich habe keine Roma im Sinne.«
»Das sagst du jetzt, aber sie will heiraten, und sie ist geschickt, das kann ich dir versichern. Du brauchst bloß Antal zu fragen, ihren ersten Mann.«
Dominics Lächeln wurde dünn. »So geschickt ist kein Weibsbild. Und außerdem weiß sie, daß ich bald abreisen werde.«
Das verhutzelte Gesicht seiner Mutter wirkte plötzlich älter, und über den faltenzerfurchten Bereichen um die Augen herum zogen sich ihre dünnen grauen Augenbrauen zusammen. »Du wirst mir fehlen, mein Sohn. Aber es ist wie immer das Beste so.«
Das sagte sie jetzt schon, seit er ein Kind von dreizehn Jahren war. Seit sein Vater gekommen war, um ihn zu holen. Sie hatte ihm immer wieder gesagt, das englische Blut des Marquis sei stärker als das seiner Zigeunermutter, und dieses Blut riefe ihn, und er müsse diesem Ruf Folge leisten.
Eine kurze Zeit hatte er sie dafür gehaßt.
Jetzt, fünfzehn Jahre später, erschien es Dominic, als hätte seine Mutter recht gehabt.
Er trat ans Feuer, das im Dunkel der Nacht orange und gelb loderte, wärmte sich einen Moment lang daran und setzte sich dann auf eine kleine Holzbank, die er vor etlichen Jahren aus einem umgestürzten Baum angefertigt hatte. Seine Mutter drückte ihm die dampfende Suppenschale in die Hände, und die Wärme ließ seine eiskalten steifen Finger auftauen.
In Gravenwold, dem palastartigen Gut seines Vaters in Buckingham, hatte man nie Probleme mit der Kälte. Und auch nicht mit einem leeren Magen oder damit, wie man sich gegen den Wind und den Regen schützte. Und doch verspürte Dominic hier, in der Kälte und der Feuchtigkeit der Provence, in diesem Lager, das unter der gewaltigen Granitzitadelle von Sisteron aufgeschlagen worden war, ein Gefühl von Frieden, das er in England nie empfand.
Er würde es vermissen, wenn er wieder zu Hause war.
Catherine entdeckte in der Ferne den flackernden Lichtschein von einem Dutzend Lagerfeuern, rote Glut, die sich gegen die Schwärze der Nacht abhob. Gelegentlich trieb der Wind das melancholische Seufzen einer Geige herüber. Zigeuner. Pindoros – Pferdehändler. Vaclav hatte ihr von seinem Stamm erzählt, als er sie dieser anderen Horde abgekauft hatte, die durch die Lande zog.
»Ich habe dich gekauft«, hatte er an jenem ersten Abend zu ihr gesagt. »Jetzt gehörst du mir.« Er hatte eine unförmige braune Hose aus rauhem Stoff und ein zerlumptes, ausrangiertes Leinenhemd getragen und einen seiner Wurstfinger über ihre Wange gleiten lassen, und Catherine war erschauert.
»Du bist voller Leidenschaft und Glut« – er streichelte ihr dickes, feuerrotes Haar – »wie Mithra, die Göttin des Feuers und des Wassers. Ich begehre dich mehr als alle andere – heute nacht werde ich dich in mein Bett mitnehmen.«
Catherine war vor ihm zurückgewichen. »Ich komme nicht in dein Bett«, sagte sie mit einer heldenhaften Tapferkeit, die sie zu ihrem Schutz einsetzte, aber keineswegs empfand.
Als Vaclav auf sie zugekommen war, hatte Catherine sich gewehrt –sie hatte gekämpft wie eine Tigerin. Sie hatte gekratzt und war mit Zähnen und Klauen auf ihn losgegangen, hatte um sich getreten und geschrien und ihn mit den undamenhaftesten Beschimpfungen bedacht, von denen sie noch wenige Wochen vorher niemals geglaubt hätte, daß sie sie je über die Lippen brächte. Vaclav hatte sie geohrfeigt und ihr Schläge angedroht, aber sie hatte sich trotzdem nicht gefügt.
»Ich denke gar nicht daran, mich zu dir zu legen wie irgendeine Hure, deren Gunst du gekauft hast. Ich werde nur mit dem Mann schlafen, den ich heirate.«
Seine Augen glitten über die Rundungen ihres Körpers, die ihre tief ausgeschnittene Bluse und der schlichte Rock nur zu deutlich zeigten. »Wenn es das ist, was du willst – einen Ehemann –, dann werde ich dich eben heiraten.«
»Du würdest eine Gadjo heiraten?« Eine Nichtzigeunerin. Das war ganz unerhört, soviel wußte sie. Die Roma waren eine Welt für sich. Außenseiter wurden nicht akzeptiert.
Vaclavs Gedanken schienen ihre eigenen widerzuspiegeln. Einen Moment lang schien er unsicher zu sein. Dann straffte sich sein breites Kinn, und seine Augen wurden dunkel. »Genau das werde ich tun, wenn du dann bereitwillig in mein Bett kommst.«
Catherine schwirrte der Kopf, als sie ihre Möglichkeiten erwog. Wenn sie in eine Heirat einwilligte, vielleicht konnte sie ihn sich dann noch etwas länger fernhalten und etwas mehr kostbare Zeit gewinnen. »Was ist mit deinen Eltern? Mit deiner Familie? Du willst doch sicher, daß sie zur Hochzeit kommen?«
»Wir sind jetzt schon auf dem Weg zu ihnen. Eine Reise von zwei, vielleicht auch drei Wochen. Die Hochzeit könnte in Sisteron stattfinden.«
Sisteron. Im Südwesten. Fern von den türkischen Paschas von Konstantinopel. Fern von der weißen Sklaverei, die ihr bestimmt gewesen war. Näher an England und an ihrer Heimat. »Wenn das so ist, nehme ich dein Angebot an. Sowie wir verheiratet sind, werde ich tun, was du wünschst. Aber du mußt mir versprechen, mich bis dahin nicht anzurühren.«
Vaclav hatte mißmutig eingewilligt. Die Tage waren vorübergegangen, und er hatte sein Wort gehalten. Wenn sie nur ihr Wort würde halten können.
»Pindoros«, sagte er und holte sie aus ihren Gedanken an diese früheren Vorfälle heraus. »Wir sind nahezu da.«
»Ja«, flüsterte Catherine. Was, um Gottes willen, würde sie jetzt bloß tun? Sie würde ihm die Wahrheit sagen müssen, ehe er seiner Familie seine Heiratspläne offenbarte. Er würde unbeschreiblich wütend werden, wenn er ihretwegen vor seinem Stamm sein Gesicht verlor.
Catherines Magen zog sich zu einem festen Knoten zusammen. Was würde er tun, wenn er hereingelegt worden war? Er würde böse werden. Vor Wut toben. Er würde sie nehmen, das stand für sie fest, ob mit ihrer Zustimmung oder ohne sie. Sie konnte seine plumpen Hände nahezu auf ihren Brüsten spüren, seinen dicken, behaarten Körper, wie er sich brutal zwischen ihre Beine stieß.
Hätte sie doch bloß fortlaufen können, eine Fluchtmöglichkeit finden können. Aber wohin hätte sie schon gehen sollen? Und er hatte sie im Auge behalten und sie nachts am Wagen festgebunden. Es hatte sich ihr keine Gelegenheit geboten. Aber auch jetzt bot sich ihr keine Gelegenheit.
Der Wagen rumpelte auf das Lager zu, und die hölzernen Räder wühlten Schlamm aus den Pfützen auf dem Weg auf. Ein Dutzend zerlumpter Kinder und etliche bellende Hunde kamen zur Begrüßung auf sie zugerast, ohne der eisigen Kälte, die in der Luft hing, oder der nassen schwarzen Erde unter ihren unbeschuhten Füßen Beachtung zu schenken. Von den Kochfeuern vor jedem der Wagen stiegen dünne weiße Rauchfahnen auf.
»Wir werden unser Lager zwischen den Bäumen aufschlagen, fern von den anderen«, sagte Vaclav mit einem Blick, den sie nur als ausgehungert bezeichnen konnte. »Sowie wir uns dort einquartiert haben, werden wir meine Familie aufsuchen und ihr die Neuigkeiten von unserer Hochzeit mitteilen.«
Sowie sie ihr Lager aufgeschlagen hatten, würde Catherine Vaclav andere Neuigkeiten mitteilen – daß es zu keiner Hochzeit kommen würde. Sie schaute auf seine stämmigen Arme und Schultern und erinnerte sich daran, wie seine schwere Hand sich angefühlt hatte, wenn sie ihn bisher erzürnt hatte. Diesmal würde er seine Wut nicht zügeln. Catherine erschauerte bei dem Gedanken.
Dominic streckte sich hinten in seinem Vardo auf seiner bequemen Eiderdaunenmatratze aus. Er und seine Mutter besaßen die besten Wagen, die man für Geld kaufen konnte. Genaugenommen hatten alle Angehörigen seines Stammes auf die eine oder andere Weise von seinem enormen Reichtum profitiert. Natürlich hatte er dabei mit größter Behutsamkeit vorgehen müssen. Sie hätten wohl kaum Almosen von ihm angenommen. Nur hier und da ein Geschenk, etwas, was jemand »fand« und als sein Eigentum beanspruchte.
Dafür bewunderte Dominic diese Menschen. Sie brauchten keine Reichtümer, um glücklich zu werden. Sie besaßen ihre Freiheit. Das war der größte aller Reichtümer.
Er rührte sich im Wagen, als er in der Ferne Geräusche hörte, die er nicht ganz einordnen konnte. Anfangs waren es nur leise Laute, ein angedeutetes Flüstern im Wind. Dann war es wieder zu vernehmen, diesmal lauter. Er hätte schwören können, daß es die Stimme einer Frau war.
Dominic schwang seine langen Beine auf den Boden, schnappte sich sein Hemd aus der selbstgesponnenen Wolle mit den weiten Ärmeln und zog die Stiefel über seine enge schwarze Reithose. Er riß die Tür des Wagens auf, stieg die Stufen zum Boden hinunter und bahnte sich einen Weg zwischen den Wagen hindurch, die nicht weit voneinander entfernt standen. Seine Mutter stand über dem Kochfeuer vor ihrem eigenen Wagen und rührte in einem großen schwarzen Topf Gulyds um, einen deftigen Fleischeintopf. Der Duft stieg ihm in die Nase, und sein Magen knurrte vor Hunger.
»Das Abendessen ist fast fertig«, sagte seine Mutter. Gewöhnlich aßen sie vor Einbruch der Dunkelheit, aber heute abend hatte sich Pearsa um ein krankes Kind gekümmert, und Dominic hatte eines seiner Pferde geritten.
»Hast du jemanden gehört?« fragte er. »Ich glaubte, Stimmen unten am Fluß gehört zu haben.«
»Vaclav ist zurückgekommen«, sagte seine Mutter schlichtweg und rührte das brodelnde Fleischgericht um. Es roch nach Kräutern und Gewürzen und dem Wildbret, das er ins Lager mitgebracht hatte.
»Normalerweise schlägt er sein Lager neben seinen Eltern auf. Warum...?«
Zornig erhobene Stimmen, eine männliche und eine ganz entschieden weibliche, trieben durch die kalte Nachtluft und schnitten ihm das Wort ab. »Er war allein, als er aufbrach«, sagte Dominic, und diese Äußerung enthielt eindeutig eine Frage.
Seine Mutter wandte den Blick ab. »Jetzt reist er mit einer Frau.« Von ihrer ausweichenden Art und dem abgewandten Blick ging etwas aus, was Dominic Unbehagen bereitete.
»Mit was für einer Frau?« fragte er. In genau dem Moment ertönte ihr schriller Schrei. Die Stimmen wurden lauter, eine flehentlich, die andere schrill und wutentbrannt. Das Geräusch einer Hand, die auf Fleisch klatschte, hallte über die Lichtung, und Dominics Körper spannte sich an. »Er schlägt sie.«
»Sie gehört ihm. Es ist sein Recht.«
In dem Moment ging ihm auf, daß sie Englisch miteinander redeten. Englisch, nicht etwa Französisch oder Romani, die Sprache seines Volkes. Dominic setzte sich in die Richtung in Bewegung, aus der die Laute kamen, fort von dem Kreis, den die Wagen bildeten, und hin zu der Stelle, an der seine Pferde festgebunden waren.
»Geh nicht hin, mein Sohn.« Ihre schmalen goldenen Armreifen klirrten, als Pearsa an seine Seite eilte und seinen Arm packte. »Das geht dich nichts an.«
»Wenn du mehr darüber weißt, dann sag es mir.«
»Sie ist eine Gadjo. Sie sagen, sie sei eine Hexe.«
Dominic setzte sich wieder in Bewegung. Pearsas kleine, gebeugte Gestalt rannte fast, um seinen langbeinigen Schritten folgen zu können.
»Denk an dein Versprechen. Du darfst dich nicht einmischen.« Dominic lief einfach weiter.
»Sie hat Vaclav schon verhext. Sie könnte dich auch verhexen.«
Darüber machte er sich unverhohlen lustig. Die endlosen Stunden seiner Erziehung hatten weitgehend mit seinem Aberglauben aufgeräumt. »Ich werde mich nicht einmischen. Ich will nur sehen, was dort vorgeht. Geh zu unserem Lager zurück. Ich bin bald wieder bei dir.«
Pearsa sah ihm nach und rang die schwieligen alten Hände, als er in die Dunkelheit schlenderte. Er konnte ihren Blick auf seinem Rücken spüren, ihre Mißbilligung wahrnehmen – und ihre Sorge –, aber er lief dennoch weiter. Ein echter Zigeuner hätte die Geräusche ignoriert, da Privatsphäre für jene, die sie nicht besaßen, von allergrößtem Wert war, und der Umstand, daß er die Geräusche nicht ignorieren konnte, verhärtete Dominics Gesichtszüge.
Er bewegte sich mit einer Lautlosigkeit, die ihm so natürlich wie das Atmen war, als er mit nicht mehr als ein oder zwei besänftigenden Worten an den Pferden vorbeilief und schließlich Vaclavs Wagen erreichte. Aus dem Dunkel neben dem Wagen starrte er auf die Lichtung, über das kleine Feuer hinweg, und das Geschehen, das sich vor seinen Augen entfaltete, zog ihn in seinen Bann.
Der korpulente, stark behaarte Zigeuner, den er seit seiner Kindheit kannte, stand über einer wunderschönen Frau mit flammendrotem Haar, die ihn mit einer Mischung aus Abscheu und Trotz anfunkelte. Vaclavs Hemd hing in Fetzen an ihm herunter, das Haar, das zottig und verfilzt war, fiel ihm in die finsteren dunklen Augen, und sein Gesicht mit der ausgeprägten Stirn war vor Wut verzerrt.
Nicht weit von ihm entfernt sah ihm die Frau fest ins Gesicht. Ihre kleinen Hände waren an den Handgelenken gefesselt, ihre Füße gespreizt, ihre Augen auf seine geheftet. Das feuerrote Haar wogte über ihre Schultern, und ihre Bluse, die zerrissen und schmutzig war, legte bis auf die Spitzen ihrer hochangesetzten, üppigen Brüste alles frei. Sogar der Abdruck von Vaclavs Hand auf ihrer Wange konnte die Schönheit ihres Gesichts nicht verbergen.
»Du hast mich belogen!« brüllte er. »Du wolltest mich von Anfang an um das betrügen, wofür ich mein Gold bis auf die letzte Unze ausgegeben habe!«
»Ich habe dir schon ein dutzendmal gesagt, daß ich dir Geld beschaffen kann, mehr Gold, als du tragen kannst, wenn du mich laufen läßt.«
»Für was für einen Dummkopf mußt du mich halten.« Vaclav ohrfeigte sie wieder; sie wankte, doch sie fiel nicht hin.
Dominics Magen schnürte sich zusammen, aber er rührte sich nicht vom Fleck. Er war zur Hälfte ein Zigeuner. Er mußte sich an die Gesetze der Zigeuner halten.
»Ich will dein Geld nicht haben!« schrie Vaclav. »Dein Körper ist es, wonach ich mich verzehre. Ich habe dir die Ehe angeboten. Du hast mich zurückgewiesen, mich vor meinem Stamm beschämt. Und jetzt wirst du lernen zu gehorchen.«
Er packte ihre gefesselten Handgelenke und schleifte die Frau zu einem Baum. Dominic stand wie versteinert da, als Vaclav ein Stück Seil über einen Ast warf, ihre Hände damit band und sie hochhievte, bis ihre Arme hoch über ihren Kopf gestreckt waren. Er packte die Rückseite ihrer Bluse, zerriß sie grob und legte die bleichste und zarteste Haut bloß, die Dominic je gesehen hatte.
»Du wirst lernen, meine Befehle zu befolgen. Du wirst lernen, dich zu unterwerfen. Wenn du dazu erst die Peitsche kosten mußte, dann soll es eben so sein.«
Dominics Mund wurde trocken. Wenn die Frau Vaclav gehörte, dann war es sein Recht, sie so zu züchtigen, wie er es für angemessen hielt. Dominics Hand klammerte sich um das Wagenrad, aber er rührte sich immer noch nicht von der Stelle.
Vaclav drehte sich um, um die lange Lederpeitsche zu holen, die er einsetzte, um seine Pferde anzutreiben; und die Augen der Frau, die klar und leuchtend grün waren, schienen sich so in seinen Rücken zu brennen, wie sich die Peitsche schon bald in ihren Rücken brennen würde.
»Ich werde mich niemals unterwerfen, hast du mich gehört? Ich verabscheue dich und jeden miesen Zigeuner, der mir je begegnet ist! Ihr seid Tiere! Ihr kennt nichts anderes als Grausamkeit und Gewalttätigkeit.« Beim letzten Wort brach ihre Stimme, doch sie versteifte ihre schmalen Schultern gegen den ersten zischenden Peitschenhieb.
Eine dünne Blutspur zeichnete sich ab und verunstaltete das makellose Weiß ihrer Haut, aber sie gab keinen Laut des Protestes von sich, sondern preßte ihr Gesicht nur mit einem resignierten Ausdruck gegen die rauhe Rinde des Baumes.
Als ihre Lider mit den dichten Wimpern sich gegen den Schmerz schlossen, von dem sie wußte, daß er zu erwarten war, war es vorbei mit Dominics Selbstbeherrschung. Er trat gerade noch rechtzeitig neben dem Wagen heraus, um den zweiten brutalen Hieb von Vaclavs Peitsche abzufangen.
Er zwang sich, sich zusammenzureißen. »Es scheint fast, mein Freund, als hättest du gewisse Schwierigkeiten damit, deine Frau zu bändigen.« Er sagte die Worte auf englisch, wie sie bisher auch miteinander geredet hatten. Es gelang ihm zwar, seiner Stimme einen freundlichen Tonfall zu geben, aber es kostete ihn eiserne Selbstbeherrschung, Vaclav die Peitsche nicht aus den Händen zu reißen.
Der korpulente Mann wirbelte zu ihm herum. »Halte dich raus, Domini, das ist nicht deine Angelegenheit.«
»Ich bin nur gekommen, um dich zu begrüßen. Es ist eine ganze Weile her, seit wir miteinander gereist sind.«
»Jetzt ist nicht der rechte Zeitpunkt für eine Begrüßung. Wie du selbst sehen kannst, habe ich mich um andere Angelegenheiten zu kümmern.«
»Es scheint so.« Aber er traf keine Anstalten zu gehen.
»Die Frau hat es verdient, ausgepeitscht zu werden«, fügte Vaclav hinzu, doch ein Teil von ihm schien unsicher zu sein.
»Das kann gut wahr sein. Wenn sie dir gehört, steht es dir von Rechts wegen zu, mit ihr zu verfahren, wie du es wünschst.«
»Warum mischst du dich dann ein?«
»Ich dachte, ich könnte unter Umständen behilflich sein. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, dein Problem zu lösen.« Dominic zuckte die Achseln in einer kaum verhohlenen Geste von Lässigkeit. »Aber an Gold hast du natürlich kein Interesse.«
Zum zweiten Mal schien Vaclav zu zögern. Er warf einen Blick auf die Frau, die an den Baum gebunden war, und Dominic konnte die widerstreitenden Gefühle in seinem Gesicht lesen. Er wollte ihr nicht wirklich weh tun, aber sie hatte ihm keine andere Wahl gelassen. Wenn er sie nicht Gehorsam lehrte, verlor er bei seinen Leuten das Gesicht.
»Ich dachte, vielleicht möchtest du dir – sehr gewinnbringend – deine Last vom Hals schaffen.«
Vaclav sah die Frau an, und die Gier, die er auf sie verspürte, funkelte in den Tiefen seiner Augen. Die Frau spuckte ihm vor die Füße.
»Wie gewinnbringend?« fragte Vaclav.
»Ich gebe dir das Doppelte von dem, was du für sie bezahlt hast.«
»Das Lösegeld eines Königs. Die rothaarige Hexe hat mich ein Vermögen in Gold gekostet.«
Sie machte den Eindruck, als sei sie es wert. »Das Dreifache«, sagte Dominic mit leiser Stimme.
»Du kaufst dir damit nur Ärger ein, Domini. Du weißt gar nicht, wieviel Ärger.«
»Das riskiere ich. Ich biete dir das Vierfache des Preises, den du bezahlt hast.«
Vaclavs Gesicht, das bereits vor Wut gerötet war, lief noch roter an. »Du und dein Geld. Du kannst dir alles kaufen, was du willst, was, Didikai?«
Das war ein gemeines Zigeunerwort – halb Gadjo, halb Roma. Immer ein Außenseiter, der darum kämpfen muß, akzeptiert zu werden, hatte Dominic es als Kind oft gehört, aber im Laufe der Jahre hatte er sich unter seinen Leuten einen Platz errungen und es nie mehr zu hören bekommen. Jetzt schnitt es wie eine Sichel in seine Eingeweide.
»Du willst die Frau?« höhnte Vaclav. »Ich verkaufe sie dir für das Sechsfache des Preises, den ich für sie bezahlt habe.«
Das war eine Provokation, eine grausame Erinnerung an seine Abstammung. Kein echter Zigeuner hätte sich einen solchen Preis leisten können. Dominic heftete den Blick auf das Mädchen. Sie sah ihn über eine bleiche Schulter mißtrauisch an. Blut von der Peitschenstrieme hatte das Wenige dunkel verfärbt, was von ihrer Bluse noch übrig war, und die Lederriemen schnitten brutal in ihre Handgelenke. Seine Mutter hatte recht gehabt – er hätte nicht herkommen sollen. Jetzt konnte er nicht einfach wieder gehen.
»Abgemacht«, sagte er. »Schneide die Frau herunter.«
Vaclav lächelte triumphierend, und Dominic spürte, wie große Erbitterung in ihm aufwogte. Vaclav hatte gewonnen, und beide wußten es.
»Dein Gadjo-Blut macht dich schwach«, stichelte er, denn er wußte, daß keiner der anderen ihm Einhalt geboten hätte. Die Roma-Männer glaubten an die absolute Herrschaft über ihre Frauen. Daran glaubte auch Dominic. Er hielt nur nichts von Gewalt, um sich durchzusetzen.
Vaclav warf ihm ein Messer zu, und die Klinge funkelte im Feuerschein. »Jetzt gehört sie dir. Du schneidest sie herunter.«
Dominic legte die Entfernung zwischen sich und der Frau zurück und benutzte das Messer, um ihre Fesseln durchzuschneiden. Sie taumelte und wankte gegen ihn. Dominics Arm legte sich um ihre zierliche Taille, um sie auf den Füßen zu halten.
»Rühr mich nicht an!« Sie riß sich los und wich zurück.
Dominic packte ihr Kinn und zwang sie, ihm ins Gesicht zu sehen. »Du solltest besser lernen, deine widerspenstige Zunge im Zaum zu halten«, sagte er und erinnerte sich an etliche der Flüche, mit denen sie Vaclav in seinem Beisein bedacht hatte. »Du hast hier nichts mehr zu sagen. Jetzt gehörst du mir. Du wirst lernen zu tun, was ich sage.«
»Scher dich zum Teufel!«
»Der wird mich höchstwahrscheinlich früher oder später holen. Aber du wirst nicht diejenige sein, die mich hinschickt.« Dominic wandte sich ab und wollte gehen. Als sie nicht hinter ihm herlief, blieb er stehen und sah sie an. »Du gehörst zwar mir, aber die Wahl liegt bei dir. Du kannst hier bei Vaclav bleiben, du kannst aber auch mit mir kommen.«
Catherines Blick glitt von dem rabenschwarzen Haar des Zigeuners bis zu den Spitzen seiner abgestoßenen schwarzen Stiefel. Augen, die die Farbe von Obsidian hatten, bohrten sich in sie. Er war so großgewachsen, daß sie sich den Hals verrenken mußte, um ihm ins Gesicht zu sehen. Und sie erkannte, was ihr bereits in dem Moment aufgefallen war, als er auf die Lichtung trat – daß sie, auch wenn er einen noch so harten Eindruck machte, noch nie einen attraktiveren Mann gesehen hatte.
Ohne eine Antwort abzuwarten, kehrte er ihr den Rücken zu und ging. Schultern, die so breit wie der Griff einer Axt waren, schmale Hüften und lange, muskulöse Beine verschwanden in der Dunkelheit, die den Wagen umgab. Catherine warf einen letzten Blick auf Vaclav, der immer noch die Peitsche mit einer plumpen, stark behaarten Hand umklammerte, dann eilte sie hinter ihm her zwischen die Bäume.
»Steig in den Wagen.«
Catherine musterte ihn mißtrauisch. »Mir ist ganz gleich, wieviel du für mich bezahlt hast. Ich werde mich ebensowenig zu dir legen, wie ich mich zu ihm gelegt hätte.«
Die Blicke des großen Zigeuners glitten über sie und brannten sich mit einer Glut in sie, die sie eine Hand auf ihre Brust heben ließ, um die zerrissene bäuerliche Bluse enger um sich zu ziehen.
»Wenn ich es wünsche, Kleines, dann wirst du bei mir liegen. Täusche dich in dem Punkt bloß nicht. Aber wenn du es tust, dann nicht, weil dir mit dem Auspeitschen gedroht wird.«
Dann wird es nie dazu kommen, dachte sie, sagte es aber nicht. Sie hatte auf die harte Tour gelernt, daß es ihr nichts nutzte, mit diesen Menschen zu diskutieren, ebensowenig, wie ihr Flehen oder Tränen halfen.
»Rein mit dir«, wiederholte er.
»Warum?«
»Damit ich die Strieme auf deinem Rücken verarzten kann.«
Es brannte wie die Feuer des Hades. Was für ein Schmerz wäre es erst gewesen, wenn Vaclav sie noch länger ausgepeitscht hätte?
Catherine stieg die hölzernen Stufen hinauf und setzte sich auf eine weiche, breite Eiderdaunenmatratze. »Vaclav hat dich Domini genannt. Ist das dein Name?«
Er drehte sie so um, daß ihr Rücken ihm zugewandt war. »Einer von ihnen. Ein anderer ist Dominic.« Nur dieses einzige Wort. Namen bedeuteten ihnen so wenig wie die Zeit oder der Ort. Die meisten hatten zwei oder drei Namen, die sie unter Umständen änderten, wenn jemand starb oder heiratete – oder vom Gesetz gesucht wurde. »Und du?« fragte er.
»Catherine.«
»Catherine«, wiederholte er. »Catrina. Ich glaube, das paßt zu dir.« Lange braune Finger glitten über ihren Rücken und verteilten etwas, was dickflüssig und klebrig war.
Der Schmerz ließ augenblicklich nach, und Catherine seufzte vor Erleichterung.
»Wie bist du an ihn geraten?« fragte er.
»Er hat mich von einer Karawane von Zigeunern gekauft, die nördlich von hier gereist sind. Vaclav hat ihnen einen enormen Preis geboten, und sie sind auf sein Angebot eingegangen.«
Seine Hand hielt in der Bewegung inne. »Du kannst dich gut ausdrücken; offensichtlich bist du keine Bäuerin. Was hatte eine Engländerin in Kriegszeiten allein in Nordfrankreich zu suchen?«
»Du bist auch kein Franzose. Und dein Englisch ist auffallend gut. Ich könnte dich dasselbe fragen.«
»Ich bin Zigeuner«, sagte er schlicht und einfach. »Wir führen mit niemandem Krieg. Für dich ist das etwas anderes.«
»Ich war nicht in Frankreich. Ich war in England.« Hätte sie ihm doch nur die Wahrheit erzählen und ihn um Hilfe bitten können. Aber das hatte sie schon öfter versucht. Für einen entsprechenden Preis hatten die Zigeuner aus dem Norden dem Mann, der sie entführt hatte, versprochen, sie würden sie weit von England fortbringen – sie dachten gar nicht daran, sie laufenzulassen.
Andere, denen sie die Wahrheit erzählt hatte – darunter auch Vaclav –, hatten ihr ihre Geschichte nicht geglaubt. Sie hatten sie ihre »hochherrschaftliche Hure« und ihre »herablassende Hoheit« genannt. Das hatte ihr das Leben nur wesentlich schwerer gemacht.
Sie dachte daran, wie sie in ihren zerlumpten bäuerlichen Kleidern und mit dem wüst zerzausten Haar aussah, mit einem nahezu entblößten Busen. Sie wies etwa soviel Ähnlichkeit mit einer Gräfin von Arondale auf wie die alte Frau, die draußen über das Kochfeuer gebeugt war. Sie konnte beinahe das Lachen des großgewachsenen Zigeuners hören, und der Gedanke daran bewirkte, daß sich ihr Magen zusammenschnürte.
»Ich bin von zu Hause fortgelaufen«, log sie. »Ein Mann hat mich gefangengenommen und an die Zigeuner verkauft.« Dieser Teil war wenigstens wahr. »Es gab einen Pascha in Konstantinopel, der eine Vorliebe für hellhäutige Frauen hatte, und anscheinend hat er sehr gut bezahlt.«
Weiße Sklaverei. Das war immer noch besser als der Tod – oder zumindest glaubte das der Mann, der sie entführt hatte. Er besaß sozusagen so etwas wie ein Gewissen. »Vaclav hatte Geld, viel Geld.« Wahrscheinlich gestohlen. »Er hat es ihnen angeboten, und sie haben es angenommen.« Wenn er sie an einen anderen Zigeuner verkaufte, dann war das nicht dasselbe, als ließe er sie laufen, hatten sie argumentiert.
»Und in all der Zeit ist es dir gelungen, ihn von deinem Bett fernzuhalten?« Dominic musterte sie auf eine Art und Weise, die die Glut in ihre Wangen strömen ließ. »Kein Wunder, daß er etwas durchgedreht ist.«
Sie ignorierte seine Bemerkung und weigerte sich, sich auf diese Wendung des Gesprächs einzulassen. »Die Zeiten mit Vaclav sind vorbei, und jetzt bist du derjenige, mit dem ich mich gezwungenermaßen auseinandersetzen muß. Was wird jetzt aus mir werden?«
Das ist allerdings eine gute Frage, dachte Dominic. Das allerletzte, was er gebrauchen konnte, war eine Frau. Jedenfalls eine, die ihm gehörte. Er würde in wenigen Wochen fortgehen und sein Leben in England wiederaufnehmen. Zu seinen Pflichten und Verantwortungen zurückkehren. Eine zusätzliche Verantwortung fehlte ihm gerade noch. »Das hängt von dir ab, nehme ich an. Für den Moment schlage ich vor, daß du dich ausschläfst. Du siehst so aus, als könntest du es gebrauchen.«
Sie beäugte ihn wie ein argwöhnisches Kätzchen. »Hier?«
»Ich glaube, du wirst feststellen, daß du es hier recht bequem hast.« »Und wo wirst du schlafen?«
»Auf dem Boden, neben dem Wagen.« Dominic musterte prüfend die glatte weiße Haut der Frau, ihre Wespentaille und ihre üppigen Brüste. »Es sei denn, du lädst mich ein, mit dir hier zu schlafen.«
Grüne Augen, die wie Smaragde funkelten, kniffen sich gereizt zusammen. »Ich habe dir doch schon gesagt, daß ich mich nicht freiwillig zu dir oder irgendeinem anderen Mann lege.«
Dominic lachte in sich hinein, denn ihr Trotz amüsierte ihn mehr, als gut für ihn war. Eine Frau wie sie hatte er noch nie gesehen – voller glühender Willenskraft und Entschlossenheit. Und von einer Engländerin kannte er das schon gar nicht. Sie war wahrhaftig eine enorme Versuchung, und sie faszinierte ihn von Minute zu Minute mehr.
»Das werden wir ja sehen, Feuerkätzchen. Wir werden es ja sehen.«
In dem Moment bewegte sie sich, und ihre zerrissene Bluse sprang auf und legte die Unterseite einer üppigen Brust frei. Sie wirkte schwer und weich, eine vollkommene Rundung, die der Hand eines Mannes genau angepaßt war. Dominics Lenden begannen zu pulsieren. Er würde auf dem Boden schlafen, dabei blieb es – aber erst nach einem wilden Techtelmechtel mit Yana, um den gewaltigen Schmerz zu lindern, der sich in ihm ausgebreitet hatte.
»Ich werde dafür sorgen, daß du etwas zu essen bekommst«, sagte er, und seine Stimme war ein klein wenig heiser.
»Danke.«
Dominic nahm einen Beutel mit Goldmünzen aus einer seiner Truhen und verließ den Wagen, um seine Schulden bei Vaclav zu begleichen. Seine Mutter hielt ihn am Rand des Lichtscheins auf, den das Feuer warf.
»Du hast Vaclav die Frau abgekauft.« Pearsa musterte den Beutel mit einem anklagenden Blick. »Was wirst du mit ihr anfangen?«
»Das habe ich noch nicht entschieden.«
»Sie wird Ärger machen. Das kann ich spüren. Du hättest dich nicht einmischen sollen.«
Dominics Kiefer spannte sich an. Er dachte an die wunderschöne Frau mit dem feuerroten Haar in seinem Wagen. Er dachte daran, was für ein gutes Gefühl es sein mußte, wenn sie sich unter ihm bewegte und ihre wohlgeformten Beine um ihn schlang. Er dachte daran, wie sehr sich Vaclav dasselbe gewünscht hatte.
»Ich weiß«, war alles, was er sagte.
3
Die ach so kleine Hand reiche mir,
in der ich dich weinen gewahrʼ,
Denn all der Träume Balsam hier
Würdʼ ich sammeln für immerdar.
ZigeunergedichtGeorge Borrow
Catherine aß den letzten Bissen des Fleischeintopfs, den die alte Frau ihr gebracht hatte, und sie war dankbar dafür, daß dem Knurren in ihrem Magen ein Ende bereitet worden war. Hinterher kroch sie unter die leuchtendbunte Patchworkdecke, die auf der weichen Eiderdaunenmatratze lag, und zum ersten Mal seit Wochen fühlte sie sich behaglich und warm.
Ihre Blicke durchsuchten das Wageninnere, das vom freundlichen Schein einer Kerze erhellt wurde. Schränke säumten beide Seitenwände des Vardo, und alles war ordentlich verstaut. Ein verschlissenes, selbstgewebtes Hemd mit weiten Ärmeln hing an einem Haken neben einem anderen aus schimmernder roter Seide. Ein gelber Seidenschal, eine abgetragene schwarze Reithose und eine Weste aus einem goldbestickten Wandbehang, die vorn mit einer Reihe von kleinen goldenen Ziermünzen bestickt war, hingen dicht daneben.
Der Vardo sah aus wie andere, die sie gesehen hatte, nur ordentlicher und sauberer und aus teureren Brettern gezimmert, deren Kanten dichter aufeinandertrafen. Das einzige, was unpassend zu sein schien, waren etliche in Leder gebundene Bücher, die neben der Schnitzerei eines winzigen Holzpferdchens in eine Lücke gezwängt waren.
Warum hatte er sie bloß gekauft, wenn Zigeuner doch ohnehin nicht lesen konnten? Oder, was wahrscheinlicher war, sie gestohlen? Sie fragte sich auch, ob dieser faszinierende Mann, den sie Domini nannten, das kleine Holzpferdchen selbst geschnitzt hatte.
Catherine blies die Kerze aus, rollte sich auf die Seite und starrte in das Dunkel. Ihre Lider waren schwer und ihr Körper matt, doch sie wagte nicht einzuschlafen. Statt dessen lauschte sie auf jeden kleinsten Laut, der von draußen hereindrang, und wartete auf die Schritte des Mannes, der mit Sicherheit kommen würde. Wozu hatte er sie gekauft, wenn nicht, um sich von ihr das Bett wärmen zu lassen?
Catherine zuckte beim Schrei einer Eule zusammen und legte sich dann mit einem Seufzer der Erleichterung zurück, als sie erkannte, was es war. Gelegentlich trieb aus anderen Wagen Gelächter durch das Lager, verstummte jedoch allmählich. Im Laufe der Nacht drang das Schnauben von Pferden an ihre Ohren, das Knistern der erlöschenden Glut der Feuer, aber nicht die Schritte eines Mannes. Kurz vor Anbruch der Dämmerung schlief sie endlich ein, wurde jedoch beim ersten Tageslicht von der heiseren Stimme des großen Zigeuners geweckt.
»Die Sonne steigt hoch, Catrina. Steh auf – es sei denn, du möchtest Gesellschaft haben.« Er riß die niedrige Holztür auf, und Catherine setzte sich ruckartig auf und zerrte sich die Zudecken bis ans Kinn.
»Platzt du immer unangemeldet herein, wenn eine Dame im Bett liegt?«
»Nicht immer«, erwiderte er mit einem kecken Lächeln, »aber oft genug, um diesem Zeitvertreib etwas abzugewinnen.« Seine Blicke glitten forschend über sie und nahmen ihr zerzaustes Haar wahr, die schwarzen Ränder unter den Augen, den angespannten Zug um den Mund, der lange, schlaflose Stunden verriet. »Du siehst schlechter aus als gestern abend. Mein Bett war dir wohl nicht genehm?«
Catherine schnaubte vor Wut und reckte das Kinn in die Luft, doch ihre Hand hob sich zögernd, um die Strähnen ihres schlafzerzausten Haars aus dem Gesicht zu streichen. »Ich hatte gefürchtet, du würdest versuchen... ich dachte, du würdest es dir vielleicht anders überlegen und dich nicht an unsere Abmachungen halten, wer wo schläft.«
Von ihm kann man jedenfalls nicht behaupten, daß er schlecht aussieht, fand sie. Er wirkte sogar ausgesprochen gut ausgeruht. Seine Gesichtszüge waren einfach unglaublich: eine gerade, gutgeschnittene Nase, glatte dunkle Haut und Obsidianaugen unter dichten Wimpern. Sein Mund hätte in Stein gemeißelt sein können, so klar gezeichnet und vollkommen geformt war er, und wenn er lächelte, blitzten die weißesten Zähne auf, die sie jemals gesehen hatte.
»Enttäuscht?« fragte er spöttisch und zog eine dichte schwarze Augenbraue hoch. Er sah gut aus, aber nicht im üblichen Sinne. Er strahlte Härte aus, etwas Gezügeltes und Beherrschtes, was sie von Anfang an wahrgenommen hatte. Das machte ihn nur um so attraktiver.
»Wohl kaum.«
Dominic lächelte, als glaubte er ihr kein Wort. Eine solche Arroganz! Aber schließlich war er Zigeuner.
»In dem Schrank links von dir stehen ein Wasserkrug und eine Schale.« Er warf ihr eine Bluse zu, die viel Ähnlichkeit mit der aufwies, die Vaclav zerrissen hatte, doch diese hier war mit buntem Garn bestickt. »Meine Mutter hat Kaffee, Brot und Brynza hingestellt – Schafskäse. Mach dich fertig und komm zu uns.«
Sie hielt die Bluse hoch. »Ist die von deiner Mutter?« Sie wirkte viel zu groß für eine so gebrechliche kleine Frau.
Dominic lächelte belustigt. Heute trug er einen silbernen Ohrring an einem Ohr. »Ich habe sie von einer Freundin geborgt. Möchtest du vielleicht, daß ich dir beim Anziehen behilflich bin?«
»Ganz bestimmt nicht!«
»Dann schlage ich vor, daß du dich eilst. Wenn ich meinen Kaffee getrunken habe und du noch nicht bei uns draußen bist, komme ich wieder in den Wagen!« Mit einem letzten dreisten Blick wandte er sich ab und verließ den Wagen.