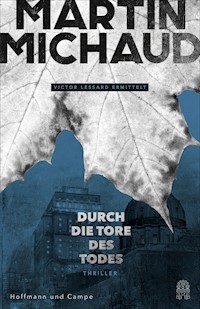9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Meister des kanadischen Thrillers ist zurück! Victor Lessard ist vom Dienst suspendiert, trotzdem tut er seiner ehemaligen Partnerin Jacinthe Taillon den Gefallen, sich den Tatort des Mordes an einem Investigativjournalisten anzusehen. Der Journalist war einer Gruppe von Rechtsextremisten auf der Spur ... Gleichzeitig erfährt Victor Verstörendes über die Vergangenheit seines Vaters Henri Lessard. Als er nur knapp einem Mordanschlag entgeht, muss Victor untertauchen, um sein Leben und das seiner Liebsten zu schützen. Gemeinsam mit Jacinthe begeben sie sich auf die Spur des geheimnisvollen Unterstützers der mörderischen Gruppe von Rechtsextremen. Und Victor muss sich auf eine Reise in die Vergangenheit begeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Martin Michaud
In die Fluten der Dunkelheit
Victor Lessard ermittelt
Thriller
Aus dem kanadischen Französisch von Anabelle Assaf und Reiner Pfleiderer
Hoffmann und Campe
Dem Andenken meines Vaters.
Für Patrice und Julie.
Soundtrack
Die folgenden dreißig Stücke gehören zu denen, die ich während der Arbeit an dem Roman am häufigsten gehört habe.
Sie finden sie auf dem Spotify-Account von Kennes (geben Sie in die Suchleiste »spotify:user:kennes-editions« ein).
Before the Beginning John Frusciante
The SearchNF
Arch My Education
City Luv Foreign Diplomats
Infinity Suuns
Mange un char Maybe Watson
Colourway Novo Amor
What I Saw John Frusciante
The Day I DieISLAND
Lost in Hollywood System of a Down
16 Lines Lil Peep
Le sang mêlé à l’eau salée Laura Babin
I Found Amber Run
L.E. S. Artistes Santigold
Clothes of Sand Nick Drake
Passe ton chemin Jean Leloup
King of Everything Dominic Fike
Real Thing Middle Kids
Cop Killer John Maus
A Time to Be So Small Interpol
La route que nous suivons Louis-Jean Cormier
Lost in the Plot The Dears
I’m Jim Morrisson, I’m Dead Mogwai
The Axe Thom Yorke
Arrows Foo Fighters
Bones of Birds Soundgarden
I Bet on Losing Dogs Mitski
Blanket Me Hundred Waters
Where’s my loveSYLM
Radiant Halftribe
Dreißig Minuten nach der Erstürmung von Ghetto X durch Spezialkräfte
Ein rechteckiger, fensterloser Raum mit holzverkleideten Wänden, darin ein Tisch, ein gerader Stuhl und ein Sessel mit Rollen. Die Tür geht auf, und eine Frau in den Vierzigern tritt ein. Groß, schlank, dunkelhäutig. Sie trägt ein figurbetontes, marineblaues Kostüm und hat ihr schwarzes Haar zu einem Knoten zurückgebunden. Der Mann, der ihr folgt, bleibt in der Tür stehen, und jemand nimmt ihm von hinten die Handschellen ab, mit denen seine Arme auf dem Rücken gefesselt waren.
Die Vernehmungsbeamtin deutet auf den Stuhl.
»Ich möchte Sie bitten, sich zu setzen.«
Der Mann gehorcht, und während sie auf dem Sessel Platz nimmt, massiert er seine schmerzenden Handgelenke und fährt sich mit den Händen übers Gesicht.
»Etwas zu trinken, zu essen?«
Sie legt die Hände vor sich hin. Er betrachtet ihre langen, verschränkten Finger, ihre sorgfältig lackierten Nägel. Dann mustert er seine Hände, die mit Schnittwunden und blauen Flecken übersät sind, und bemerkt, dass er Dreck unter den Fingernägeln hat.
Er hebt den Kopf.
»Ich hätte gerne einen Kaffee. Und meine Zigaretten.«
Sie zeigt ein krampfhaftes Lächeln.
»Wir werden Ihnen auch etwas bringen, damit Sie sich frisch machen und umziehen können.«
Er nickt. Die Frau deutet auf eine Kamera, die auf einem Stativ in der Ecke steht und auf sie gerichtet ist. An dem Apparat leuchtet ein grüner Punkt. Er sieht aus wie das Auge eines Zyklopen, der sie beobachtet.
»Ich weise Sie darauf hin, dass unser Gespräch aufgezeichnet und gefilmt wird.«
Wieder nickt der Mann und stößt einen Seufzer aus. Die Frau starrt ihn an.
»Fürs Protokoll: Ich bin Claire Sondos, Agentin des Service Canadien de renseignement de sécurité. Jetzt darf ich Sie bitten zu sagen, wer Sie sind.«
Er ruckelt sich kurz auf seinem Stuhl zurecht und sieht ihr direkt in die Augen.
»Mein Name ist Victor Lessard.«
1.Leere Versprechungen
Victor öffnete die Glastür und trat hinaus in die Kälte des Tages. Sein Herz pochte bis in die Schläfen, als er der Blutspur hin zum Ende des langen Gebäudevorsprungs folgte.
Der Mann lehnte mit aufgeschnittenen Pulsadern am Geländer und sah ihm entgegen. Der kupferfarbene Himmel rahmte seine schmächtige Gestalt. Das Messer, das er in der zitternden Hand hielt, blitzte in der Sonne, während er einen Blick über die Schulter warf. Sechs Stockwerke tiefer, auf dem überfüllten Parkplatz des Casino de Montréal, strömte eine Menge von Schaulustigen zusammen. Zwischen kurzen Atemstößen rief er Victor etwas zu. Seine helle, angsterfüllte Stimme hallte vom Beton wider.
»Ich springe, wenn du noch näher kommst.«
Victor blieb stehen und hob die Hände, zog seinen Ohrstöpsel heraus und ließ ihn am Kabel baumeln. Dann lockerte er seine Krawatte und streifte sie über den Kopf, ohne den Knoten zu lösen. Vier Meter und eine Mauer des Schweigens trennten die beiden Männer.
Victor musterte den anderen, der sich mit dem Unterarm die Stirn abwischte und dabei Blut ins Gesicht schmierte: Mitte fünfzig, graues Haar, eine hagere Gestalt in schlackernden, abgewetzten Jogginghosen. Der Mann sah ihn seinerseits prüfend an.
Victor kannte diesen Blick. Es war nicht nur der eines Spielers, der zu viele Stunden an den Casinotischen zugebracht hatte. Es war der erloschene Blick eines Menschen, für den gewinnen oder verlieren keinerlei Bedeutung mehr hatte.
Victor klopfte an eine Tasche seiner Jacke.
»Ich will nur meine Zigaretten rausholen.«
Der andere nickte. Victor steckte sich eine an, dann hielt er ihm das Päckchen hin. Der Mann verzog angewidert das Gesicht und lehnte kopfschüttelnd ab.
Victor stieß den Rauch langsam aus und fuhr dabei mit der flachen Hand über seinen Bürstenschnitt. Der Anflug eines Lächelns kräuselte seine Augenwinkel.
»Sie haben recht, irgendwann bringt mich das noch um.«
Der Mann fand Victors Galgenhumor nicht witzig, wurde aber ein wenig lockerer.
»Das ist meine letzte. Versprochen.«
Der Spieler spähte traurig zum Parkplatz hinunter.
»Leere Versprechungen. Das ist das Problem.«
Er blickte wieder zu Victor und entzifferte das Namensschild an seinem Revers.
»Victor Lessard. Es ist das erste Mal, dass ich dich hier sehe …«
»Ich arbeite auch noch nicht lange im Casino.«
»Was hast du vorher gemacht?«
Victor strich über seinen dichten Bart und senkte den Blick seiner grünen Augen in die des Mannes.
»Polizei. Kapitalverbrechen. Und Sie? Wie heißen Sie eigentlich?«
In seiner Schwermut gefangen, ließ der andere die Frage unbeantwortet und spann seinen Gedanken weiter.
»Ich hatte gesagt, dass damit Schluss wäre. Sechs Monate ist das jetzt her.«
Seinem kreidebleichen Gesicht und der Blutlache nach zu urteilen, die sich zu seinen Füßen sammelte, schätzte Victor, dass der Mann nur noch eine Stunde zu leben hatte, wenn er nicht schleunigst ins Krankenhaus gebracht wurde, vielleicht weniger.
»Leere Versprechungen?«
Der Mann schlug die Augen nieder.
»Mein Sohn hatte mir Geld geliehen. Ich hatte meine Schulden damit bezahlt. Aber nein! Ich musste wieder herkommen! Warum?«
Victor zuckte mit den Schultern und beäugte einen Moment lang seine Zigarette.
»Es ist eine Sucht.«
Er nahm noch einen Zug, dann zerdrückte er die Kippe mit dem Schuh. Der Mann sprach weiter.
»Das wird mir mein Sohn niemals verzeihen. Diesmal nicht. Ich kann nicht länger lügen.«
Zehn Meter hinter Victor flog die Glastür auf, und heraus stürmte ein athletisch gebauter Mann mit kahl rasiertem Schädel, der einen weinroten Anzug trug.
Bei seinem Anblick kletterte der Verzweifelte auf das Geländer.
»Wer bist du? Verzieh dich!«
Victor beschwichtigte ihn mit ruhiger Stimme.
»Ich regle das. Einen Moment bitte.«
»Ich springe, wenn er nicht verschwindet!«
Ein Passagierflugzeug durchschnitt mit lautem Getöse den Himmel. Ohne sich umzudrehen, gab Victor seinem Vorgesetzten, dem Sicherheitschef, ein Zeichen, stehen zu bleiben.
»Alles in Ordnung, Dionne. Wir unterhalten uns. Sorg dafür, dass wir nicht mehr gestört werden.«
Dionne nickte, als er die Situation erfasst hatte, machte nach kurzem Zögern kehrt und entfernte sich. Victor wartete, bis die Glastür sich wieder geschlossen hatte, dann setzte er das Gespräch behutsam fort.
»Ihr Sohn wird Ihnen verzeihen, ganz gleich, was Sie getan haben.«
»Nein! Es gibt Dinge, die sind einfach unverzeihlich.«
Victor zupfte an seiner Krawatte.
»Sie können sich ändern. Man kann sich immer ändern.«
Der Spieler schüttelte den Kopf, dann legte sich ein Zug von Bitterkeit um seine Lippen.
»Wenn du dich splitternackt ausgezogen hast, weißt du, wer du wirklich bist.«
Er bedachte Victor, dessen Handy in diesem Moment in der Tasche vibrierte, mit einem zerknirschten Lächeln.
»Aber danke, dass Sie mir zugehört haben.«
Dann ging alles ganz schnell. Während Victor seine Einsneunzig in Bewegung setzte und nach vorn hechtete, schloss der Mann die Augen und ließ sich in die Tiefe fallen.
Die Spätnachmittagssonne hüllte ihre vollschlanke Gestalt in goldenes Licht, und während sie von einem Bein auf das andere trat und an die Scheibe trommelte, hielt sie die linke Hand weiter ans Ohr gedrückt.
Ihr Blick strich über das Stadtzentrum weit unten, in dem es wimmelte wie in einem Bauch, der von Maden aufgefressen wird, wanderte die Rue University hinauf, mäanderte durch das McGill-Ghetto und verlor sich dann am Mont Royal. Der Hügel trug bereits sein Herbstkleid. Durch das Loch, das die Kugel in die Scheibe gebohrt hatte, hörte sie das Rauschen des Verkehrs und das Hupen der Taxis.
Stöhnend vor Ungeduld wartete Jacinthe Taillon, bis Victors Stimme verstummte und der Piepton erklang, dann sprach sie ins Handy:
»Hallo, mein Lieber. Tja, ich bin’s schon wieder. Äh … entschuldige, ich weiß, ich sollte dich eigentlich nicht bei der Arbeit stören …«
Sie musste grinsen.
»He, ich stelle mir gerade vor, wie du ganz entspannt mit deiner kleinen Thermoskanne Kaffee im Casino sitzt und dir die Bilder deiner Überwachungskameras anschaust …«
Sie wurde wieder ernst. Der Anblick ihres Gesichts, dessen erschlaffte Züge sich im Fenster spiegelten, verdross sie. Sie hielt die Hand davor, wobei der Silberring an ihrem Mittelfinger klickend gegen die Scheibe stieß.
»Jedenfalls würde ich gern mit dir über etwas reden. Über etwas anderes …«
Die Frau, die im Kollegenkreis »die dicke Taillon« genannt wurde, drehte sich in den Raum um, in dem Techniker von der Spurensicherung um eine Leiche herumwuselten.
»Und übrigens, ich langweile mich null. Natürlich wirst du jetzt sagen, das liegt daran, dass meine neue Partnerin viel sexyer ist als du …«
Aus dem Augenwinkel beobachtete sie Nadja Fernandez, die junge Ermittlerin südamerikanischer Abstammung, die gerade mit Jacob Berger, dem Pathologen, sprach. Ihr schwarzes Haar brachte ihre makellosen Züge und ihre Lippen noch besser zur Geltung.
»Ruf mich aber auf jeden Fall zurück.«
Sie legte auf. Trotz des Spotts in ihrer Stimme ging ein Ausdruck tiefer Traurigkeit über ihr Gesicht. Mit wenigen Schritten trat Nadja zu ihr. Sie hielt ein Notizbuch in der Hand.
»Mit wem hast du gesprochen?«
»Äh … mit der Leichenhalle. Sie kommen.«
Die junge Frau sah sie an, halb verdutzt, halb amüsiert.
»Na klar. Ich habe sie ja angerufen …«
Jacinthe überging die Bemerkung und richtete ihre Aufmerksamkeit auf Jacob Berger, der zu ihnen herüberkam. Ein verschmitztes Lächeln spielte um ihre Lippen.
»Hallo, Burgers!«
Der Pathologe verdrehte die Augen. Er wusste, dass sie seinen Nachnamen mit Absicht verballhornte, aber es nervte ihn immer wieder aufs Neue, als wäre es das erste Mal.
Ohne die Handschuhe auszuziehen, griff Jacinthe in die Tasche ihrer Cargohose, brachte eine Handvoll Sonnenblumenkerne zum Vorschein und schob sie unter dem missbilligenden Murren Bergers in den Mund. Grinsend leckte sie das Salz ab, das an ihrem Mittelfinger klebte.
»Delaney ist wieder da, Burgers …«
Tatsächlich war der Commandant der Abteilung Kapitalverbrechen soeben von einer mehrwöchigen Reise mit seiner unheilbar krebskranken Frau zurückgekehrt.
Berger zeigte ihr offen seine Verachtung.
»Ich sehe da keinen Zusammenhang, Taillon.«
»Ach nein? Du wirst ihn anrufen und dich beschweren, falls du auf dem Fußboden Sonnenblumenkerne findest.«
Auf dem Casinoparkplatz waren alle Blicke auf die beiden Gestalten gerichtet, die sich sechs Stockwerke höher am Rand des Gebäudevorsprungs damit abmühten, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Dem einen, der versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, war der Schrecken am Gesicht abzulesen.
»Ich will nicht sterben!«
Der Mann baumelte über dem Abgrund und hielt mit blutleeren Fingern die Krawatte umklammert, die Victor, gegen das Geländer gestemmt, mit beiden Händen festhielt.
Dann sah Victor, wie die Finger des Mannes an dem Stoff entlang nach unten glitten. Sein Gesicht wurde puterrot, und die Adern an seinem Hals traten noch stärker hervor, als er in einem letzten verzweifelten Versuch die Muskeln anspannte und mit aller Kraft zog, um ihn zu sich hochzuhieven.
In der Ferne begann eine Sirene zu heulen, doch sie klang wie aus einer anderen Welt. Und selbst wenn man gegen Angst und Einsamkeit nie etwas tun kann, so verschmolzen jetzt die Blicke der beiden Männer und wurden eins.
2.Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
Zwei Stunden später parkte Victor den grauen Saab 900 Turbo, den er gebraucht gekauft hatte, in der Avenue des Canadiens-de-Montréal. Seine Geliebte, Nadja Fernandez, kannte sich mit Autos aus und hatte ihn vor der zweifelhaften Technik dieses alten Modells von 1993 gewarnt, dem Jahr, in dem die Montréal Canadiens letztmals den Stanley Cup gewonnen hatten. Doch Victor hatte der Patina der braunen Ledersitze einfach nicht widerstehen können.
Er stieg aus dem Wagen und inspizierte seine Kleidung. In einer perfekten Welt wäre er schnell nach Hause gefahren und hätte sich umgezogen. Doch die Wirklichkeit sah anders aus. Die Augen mit einer Hand beschirmend, spähte er an dem Wolkenkratzer nach oben. Die blendenden Strahlen der untergehenden Sonne umschlangen den Glastower wie die Tentakel eines Kraken.
Er hatte Lust auf eine Zigarette, widerstand aber dem Verlangen und ging zum Eingang, wo ein Streifenpolizist wartete, der ihn zum Aufzug brachte. Allein in dem Stahlkäfig, drückte er auf den Knopf der vierundvierzigsten Etage. Während die Kabine gen Himmel schwebte, nahm er die rechte Hand in die linke, um das Zittern, das sie schüttelte, zu stoppen.
Ein uniformierter Polizist hielt auf dem Flur Wache. Sie kannten sich vom Sehen und grüßten sich. Dann hob der Ordnungshüter das gelbe Plastikband an, und Victor schlüpfte gebückt darunter durch. Vor der Tür zögerte er. Er hatte Angst davor, in das Grauen einzutauchen, das er unweigerlich dahinter vorfinden würde. Doch er holte tief Luft, um die negativen Gedanken zu verscheuchen, und drückte gegen die Tür, die sich in den Angeln drehte.
Die Scheinwerfer blendeten ihn, und so kniff er die Augen zusammen, um das vertraute Ballett, das in der Wohnung aufgeführt wurde, besser sehen zu können. Kriminaltechniker in weißen Overalls tänzelten durch den Raum, als ob sie imaginären Strichlinien auf dem Boden folgten.
Er warf einen Blick in die Runde: Er befand sich in einem dieser Luxuswohntürme, die rund um das Centre Bell, zugleich Biertempel der Brauerei Molson und Hockeyarena der Canadiens, wie Pilze aus dem Boden geschossen waren. Der offene Wohnraum beherbergte links von der Eingangstür eine umgekehrt l-förmige Theke aus schwarzem Granit, die eine hochmoderne Küche umschloss. Dahinter bemerkte Victor einen Korridor, der zur Toilette und den Schlafzimmern führen musste.
Der Wohn- und Essbereich, der sich zu seiner Rechten erstreckte, war minimalistisch eingerichtet und endete an einem freihängenden Gaskamin mit einem Brenner aus schwarzem Stahl. Die Glaswand gegenüber ging auf einen Wald aus Wolkenkratzern hinaus.
Victor registrierte die unverputzten Betonwände, die klaren Linien, die klinische Nüchternheit der Einrichtung, doch in erster Linie beschäftigte sich sein Gehirn mit dem Blut auf dem Fußboden nahe dem Kamin, einer großen Lache, dunkel und glibberig, deren metallischer Geruch ihm den Magen umdrehte.
Das Blut. Das war es, was er betrachtete, noch vor der Leiche. Einmal, weil dieses Blut das ausgelöschte Leben symbolisierte. Und dann, weil sich der Hergang des Geschehens daraus ableiten ließ. Es war tragisch, wenn ein Mensch das Leben verlor, und noch tragischer, wenn er es durch Mord verlor.
In einem ersten Schritt galt es die Angehörigen aufzusuchen und sich ihren Gefühlen zu stellen: ihrer Sprachlosigkeit, ihren Fragen, ihren Schreien, ihren Tränen, ihrer Fassungslosigkeit. Und dieser ausweglosen Verzweiflung, die einem jedes Mal das Herz zerriss. Später dann die Nächte, die man durcharbeitete. Die Spuren, denen man allen nachgehen musste, Dutzenden an der Zahl. Die Rätsel, die man lösen musste, manchmal unter Einsatz des eigenen Lebens. Das Adrenalin, die Angst, die Gefahr. Und, im günstigsten Fall, ein Einzeltäter, den es zur Strecke zu bringen galt.
Victor näherte sich dem Toten. Es handelte sich um einen blonden Mann mit widerspenstigen Strähnen, der mit dem Gesicht nach unten in der Blutlache lag. Nach der sichtbaren Hälfte des bleichen Gesichts zu urteilen, zwischen dreißig und fünfundvierzig Jahre alt.
Victors Blick wanderte zu der Eintrittswunde, die auf Höhe des linken Schulterblatts deutlich zu erkennen war. Das Projektil hatte das T-Shirt zerfetzt. Ursprünglich grau, hatte das besudelte Textil eine goldbraune Farbe angenommen.
Um seine aufsteigende Übelkeit niederzukämpfen, atmete Victor tief durch. Kurz glaubte er, an die Luft zu müssen, doch das Unwohlsein verflog gleich wieder. Er ging zu der Glaswand, wo ein Kriminaltechniker Proben sammelte, und nahm das Loch in Augenschein, das die Kugel in Kopfhöhe in die Scheibe gerissen hatte. Es weitete sich kegelförmig nach innen, und an seinen Rändern entsprangen feine Risse wie in einer geborstenen Eisdecke. Kein Zweifel, der Schuss war von draußen abgegeben worden.
Victor drehte sich um und blickte zur gegenüberliegenden Wand, an der unten mit roter Kreide ein Loch im Beton umkringelt war. Dort hatte die Kugel ihren Flug beendet, nachdem sie das Opfer durchbohrt hatte. Verwundert nahm er zur Kenntnis, dass das Projektil mehr als einen Meter unterhalb des Lochs in der Scheibe eingeschlagen hatte. Nur ein Einschlag.
Schweren Herzens griff er nach den Zigaretten in seiner Jackentasche. Obwohl er schon vor längerer Zeit den festen Vorsatz gefasst hatte, sich von seiner Abhängigkeit zu befreien, blieb der Tabak ein treuer Verbündeter im Kampf gegen die Finsternis.
Victor verstand, warum Jacinthe ihn angerufen hatte, doch eigentlich war er nur ungern hier. Er war fertig mit diesem Beruf, der ihn zermürbt hatte. Fertig mit dem Papierkrieg, den mühsam erwirkten Haftbefehlen und dem Druck der Vorgesetzten, die in ihrem Schwarz-Weiß-Denken nach einfachen Antworten gierten.
Und er wollte nie wieder seine Lieben vernachlässigen.
Sein Sohn Martin, der seine eigenen Probleme hatte, war noch nicht aus Saskatchewan zurückgekehrt, wo er auf der Farm seines Onkels arbeitete. Und seine Tochter Charlotte, aus der eine hübsche junge Frau geworden war, intelligent, zielstrebig und gebildet, studierte erfolgreich Journalistik. Im Moment weilte sie in Paris, wo sie ihre letzten Prüfungen ablegte.
Auch wenn er sich selbst die Schuld an den Schwierigkeiten gab, die Martin hatte, so wäre er andererseits nie auf die Idee gekommen, den Erfolg seiner Tochter an die eigene Fahne zu heften. Er wollte sich die nötige Zeit nehmen, um die Erwachsenen, zu denen seine Kinder geworden waren, besser kennenzulernen, damit er in dem Leben, das sie sich aufbauten, kein Fremder wurde.
Das war alles.
Victor wandte sich wieder der Glaswand zu. Im Spiegelbild der Scheibe begegnete sein Blick dem eines Technikers, der ihn grüßte. Als Schicksalsgenossen waren sie sich schon hundertmal begegnet, hatten aber keine zehn Worte gewechselt. Er nickte ihm zu und versuchte dann anhand der Einschlagspuren zu bestimmen, wo der Schütze gestanden haben könnte.
Er überlegte einen Moment, dann kehrte er zu dem Toten zurück. Als er sich über ihn beugte, spiegelte sich sein Gesicht in der Blutlache. Er sah aus wie ein alter Löwe, der über das Leid der Welt grübelte.
Er schloss die Augen. Alte Erinnerungen stiegen in ihm auf. Bilder der Opfer. Gesichter des Todes. Die Gespenster, die ihn verfolgten. Er hatte so viele Leichen gesehen, so viele zerstörte Leben, so viel heimtückische Gewalt. Er hatte Mitleid mit diesen jäh beendeten Existenzen, doch dieselbe Empathie empfand er auch für die Lebenden, für diejenigen, die im Stillen litten. Deren Namen man nie behielt.
Und deren Schmerz im Verlauf jeder Ermittlung sein eigener wurde. Häufig auf Kosten seiner körperlichen und geistigen Gesundheit.
Möglicherweise lag das auch ein wenig an dem Schicksalsschlag, den er selbst in seiner Kindheit erlitten hatte. Mit Gewissheit würde er das nie sagen können.
Um die düsteren Gedanken zu verscheuchen, pumpte er seine Lunge voll Luft und atmete langsam durch den Mund wieder aus. Nach und nach verblassten die Bilder. Doch mit jedem Tag schleppte er schwerer an dieser Last, die ihn zu erdrücken drohte. Und ganz gleich, was ihm noch widerfahren, was das Leben noch für ihn bereithalten mochte, er würde sie niemals abwerfen können, so wie er niemals von seiner Alkoholsucht loskommen würde. Bestenfalls konnte es ihm gelingen, Zeit zu gewinnen, den Ablauf der Frist hinauszuschieben, Stunde um Stunde, Tag um Tag. Nun aber genug davon.
Er öffnete die Augen, als eine Stimme in seinem Rücken ihn veranlasste, sich umzudrehen.
»Na, so was! Wen haben wir denn da?«
Jacinthe kam den Flur herunter und blieb zwei Meter vor ihm stehen. Mit spöttischer Miene musterte sie ihren Expartner eingehend von Kopf bis Fuß und stieß dann einen Pfiff aus.
»Na ja, nicht übel, der Anzug … Ist der geliehen?«
Victor grinste.
»Sagen wir, ich habe mir eine Kaufoption gesichert.«
»Cool. Und die roten Flecken, waren die schon drauf?«
Er brauchte nicht nachzusehen: Auf Jacke und Hemd war Blut von dem Mann, den er gerettet hatte. Er zuckte lässig mit den Schultern.
»Das ist Ketchup. Ich muss besser aufpassen.«
Der Sarkasmus in seiner Stimme war Jacinthe nicht entgangen. Sie lächelte. Die beiden musterten sich noch einen Moment mit feuchten Augen, wobei ihr Schweigen verriet, wie sehr sie sich gegenseitig vermisst hatten. Dann fielen sie einander in die Arme.
»Du bist echt bescheuert, Lessard!«
Nachdem sie sich herzhaft gedrückt hatten, trat Jacinthe einen Schritt zurück, und beide lachten, um ihre Nervosität und Verlegenheit zu überspielen. Denn sie hatte ihm zwar viele SMS geschickt, die im Übrigen unbeantwortet geblieben waren, und mehrmals vorgeschlagen, »zusammen essen zu gehen«, doch dies war ihr erstes Wiedersehen, seit er nach Abschluss des Sprayer-falls bei Marc Piché, dem Direktor des Montréaler Polizeidienstes SPVM, seine Kündigung eingereicht hatte.
»Was außer faulenzen hast du eigentlich gemacht, bevor du in deinen neuen Job eingestiegen bist?«
Victor überlegte, während er die Gummihandschuhe nahm, die sie ihm hinhielt. Abgesehen von seinen häufigen Besuchen im Hospiz, wo er an Ted Rutherfords Bett gesessen hatte, verschwamm alles in seiner Erinnerung.
Er hatte sich wohl zum x-ten Mal die Kämpfe Muhammad Alis auf seinem Blu-Ray-Player angesehen, außerdem Tierfilme, und er hatte Blumen auf das Grab seiner Familie auf dem Friedhof Notre-Dame-des-Neiges gelegt, aber die übrige Zeit hatte er nur im Sessel gehangen und zwischen Schüttelfrost und Schweißausbrüchen im Halbschlaf dahingedämmert, in dem er von albtraumhaften Bildern verfolgt wurde, ehe er keuchend hochschreckte, um dann, nachdem er sich beruhigt hatte, in einen tieferen Schlaf zu sinken.
Tatsache war, dass er diese Zeit für sich gebraucht hatte, um sich zu entwöhnen. Denn für Victor Lessard war die Jagd nach Mördern eine Sucht, eine harte Droge. In der Hinsicht war er ein Junkie der schlimmsten Sorte.
Jacinthe merkte, dass er in Erinnerungen abdriftete, und nahm einen neuen Anlauf.
»Ground control to Major Tom. He, Lessard?«
Jäh in die Gegenwart zurückgeholt, stammelte Victor los.
»Äh … nicht viel … relaxt.«
Lieber hätte er geantwortet, er hätte regelmäßig Nadja bekocht, wenn sie von der Arbeit kam. Aber dazu hatte ihm die Kraft gefehlt. Abgesehen von seltenen Ausflügen ins Lebensmittelgeschäft Akhavan, wo er sich mit Pizzen, Hummus und mariniertem Huhn eindeckte, hatte er sich unter dem Vorwand, die Restaurants im Viertel ausprobieren zu wollen, das Essen ins Haus liefern lassen. Nadja respektierte zwar sein Bedürfnis, mal total abzuschalten, hatte sich deshalb aber nichts vormachen lassen.
Jacinthe musterte ihn mit durchdringendem Blick.
»Was ist? Hast du keine Lust, darüber zu reden?«
»Es hat nichts mit dir zu tun.«
Sie ging in Richtung Glaswand, machte dann kehrt, baute sich vor ihm auf, stemmte die Hände in die Hüften und knurrte:
»Ich habe dich angerufen, dir gesimst und Nachrichten hinterlassen. Du bist einfach abgetaucht, Lessard!«
Victor senkte den Kopf.
»Ich habe Zeit gebraucht. Ich musste einen Schnitt machen.«
»Ich wollte doch nur mit dir reden. Fünfzehn Jahre löscht man nicht einfach so aus. Mann, wir waren Partner!«
Er schaute wieder auf und sah ihr in die Augen.
»Du hast recht, ich weiß.«
»Heute habe ich dich zum ersten Mal wegen etwas angerufen, das mit dem Job zu tun hat. Und prompt stehst du auf der Matte. Erklär mir das.«
Victor quittierte den Vorwurf mit Schweigen. Er verstand es selbst nicht. Er schlüpfte gerade in die Gummihandschuhe, als Nadja zu ihnen stieß. Obwohl sie eine dienstliche Miene aufsetzte, verrieten ihre Augenwinkel, dass sie sich freute, ihn zu sehen.
»Ich wollte dir nur sagen: Ich wusste nichts davon.«
Er lächelte und strich ihr über die Wange. Paul Delaney hatte beschlossen, Nadja so lange im Dezernat Kapitalverbrechen zu behalten, bis er jemand gefunden hatte, der die große Lücke, die Victor hinterlassen hatte, schließen konnte.
»Keine Sorge, ich hab verstanden.«
Nadja legte die Stirn in Falten, als sie die Flecken auf seinem Anzug bemerkte.
»Das ist doch Blut, oder? Ist alles in Ordnung?«
Er winkte ab.
»Alles okay. Ich erkläre es dir später.«
Sie stutzte, sah ihm prüfend ins Gesicht und nickte.
Jacinthe schob die Daumen in ihren Gürtel und zog ihre Hose hoch.
»Das reicht, ihr Turteltauben, ihr könnt euch nachher ein Zimmer suchen.«
Nadja begriff, dass dieses Wiedersehen für die beiden wie eine Art Stammesritus war, rang sich ein Lächeln ab und entschwand ohne ein weiteres Wort.
Jacinthe sah ihr nach, wie sie in den Flur einbog, der zu den Schlafzimmern führte.
»Mit ein bisschen Erfahrung wird sie fast so gut werden wie du.«
Victor sah seine Expartnerin ernst an.
»Wenn der Chef erfährt, dass ich an einem Tatort aufgekreuzt bin, kriegen wir Ärger …«
Er hatte vor Marc Piché keine Angst, aber er war lieber auf Abstand bedacht. Er hatte auch deshalb gekündigt, weil er sich außerstande gesehen hatte, weiter unter dem Mann zu arbeiten. Er war nämlich zu der Überzeugung gelangt, dass der Direktor des SPVM Tötungsdelikte eines hochrangigen Polizisten gedeckt hatte.
Jacinthe machte ein finsteres Gesicht und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Scheiß auf Piché! Der wird nichts erfahren.«
»Ach ja? Und die Streifenpolizisten? Die Kriminaltechniker? Alle haben mich gesehen. Irgendeiner wird es ausplaudern.«
Ein wildes Funkeln trat in Jacinthes Augen, und auf ihre Lippen das boshafte Grinsen eines Menschen, der sich wünschte, dass es genau dazu kam. Mit lauter Stimme rief sie drohend in die Runde:
»Der Erste, der redet, kriegt eins in die Fresse.«
Victor seufzte resigniert. Manche Dinge änderten sich eben nie. Die erlesenen Manieren seiner Expartnerin gehörten dazu.
»Für den Fall, dass es noch nicht bei dir angekommen ist, ich habe den Dienst quittiert, Jacinthe.«
»Du hast recht, genau da liegt das Problem: Es ist noch nicht bei mir angekommen. Ich war mir sicher, dass du zurückkommst, wenn du zehn Tage zu Hause Däumchen gedreht hast. Aber nein, der Herr muss sich einen anderen Job suchen. Scheiße, Lessard! Sicherheitsdienst im Casino … Ist das dein Ernst?«
Sie starrten sich einen Moment lang an. Doch in Jacinthes Blick lag kein Vorwurf. Nur die Ohnmacht und Enttäuschung einer Frau, die fest davon überzeugt war, dass ihr Freund gerade sein Leben gegen die Wand fuhr, und sich Vorwürfe machte, weil sie ihn hatte gewähren lassen. Sie wusste es! Sie brauchte ihn. Und er sie, davon war sie überzeugt. Lessard musste in seinen alten Job zurück. Er brauchte diese Arbeit. Daran würde sich nie etwas ändern.
Es war Victor, der die Augen niederschlug und das Schweigen brach.
»Ich gebe dir fünf Minuten. Wer ist das Opfer?«
3.Time to rock and roll
Eine Stunde vor dem Mord
Seit Tagesanbruch lauern die beiden Männer, mit schwarzen Overalls bekleidet und mit Knie- und Ellbogenschützern versehen, im dichten Gestrüpp auf einem Geländevorsprung. Der Schütze liegt auf dem Bauch, eine Sonnenbrille auf der Nase, das Präzisionsgewehr auf eine Unebenheit im Boden gestützt. Er lässt das Zielfernrohr von Stockwerk zu Stockwerk wandern. Der Beobachter, der rechts hinter ihm kniet, macht seine Messgeräte fertig.
»Ziel auf zwölf Uhr, Messiah. Gesehen?«
Der Schütze nickt, ohne den Blick zu heben. Der Beobachter zieht einen Militärcomputer zurate, der auf seinen Oberschenkeln liegt. Dann stellt er das Objektiv seines Fernrohrs ein.
»Okay. Sind wir so weit?«
Der Schütze dreht leicht an einer Stellschraube, um das Zielfernrohr scharfzustellen.
»Wir sind so weit, Black Dog.«
Der Beobachter fährt in roboterhaftem Ton fort.
»Wenn es Probleme gibt, treffen wir uns am Treffpunkt. Rückzugsmöglichkeit über die Kuppe oder den Wanderweg. Verstanden?«
»Roger. Time to rock and roll.«
Im Glastower ziehen Bilder aus dem Bewohneralltag an den Augen des Schützen vorüber. Im sechsten Stock ist ein Paar im Aufbruch begriffen, zweifellos um zur Arbeit zu gehen. Im vierzehnten machen Teenager die Nacht zum Tag und lassen eine Flasche Alkohol kreisen. Im zwanzigsten dient die Glaswand dem Liebesakt zweier schlaffer Körper mit ergrautem Haar als Stütze.
Messiah atmet tief ein. Im einunddreißigsten verharrt er bei einem Mann, der einem kleinen Mädchen vorliest.
Black Dogs Stimme knistert in seinem Ohrhörer.
»Noch keine Bewegung im Sektor Bravo.«
Aber Messiah hört ihn nur wie durch Watte. Beim Anblick des Kindes hat sein Herz zu klopfen begonnen. Um seinen Atem und seine Angst wieder unter Kontrolle zu bringen, lässt er das Gewehr sinken und hält kurz inne. Und dann, emotional aufgewühlt, erinnert er sich.
Afghanistan, 2011. Er liegt auf dem Dach eines Hauses in Schussposition. Die sengende Sonne blendet ihn. Er muss in einer belebten Straße eine Zielperson erschießen. Seine Beobachterin, eine junge Frau namens Iba Khelifi, liegt neben ihm. Ohne das Auge vom Okular ihres Spektivs zu nehmen, nervt sie ihn.
»Die Typen, mit denen du zusammen bist, lachen dich doch bestimmt aus, wenn sie sehen, dass du mit einer Araberin zusammen arbeitest. Wie hältst du das aus? Warum hast du darum gebeten, mit mir zu arbeiten?«
Messiah antwortet im selben sarkastischen Ton.
»Weil du am besten einen bärtigen Taliban von einem anderen bärtigen Taliban unterscheiden kannst.«
Iba lächelt spöttisch.
»Das stimmt … Neulich mit Marchessault hast du danebengeschossen.«
Aber Messiah schaut weiter in sein Zielfernrohr.
»Ich schieße niemals daneben. Aber ich möchte nie wieder auf das falsche Ziel schießen, weil mein Beobachter Mist gebaut hat.«
»Gut. Ich schätze dich für deine Fähigkeiten. Du schätzt mich aus demselben Grund. Ich behandle dich mit Respekt … Ich überlasse es dir, die Gleichung zu vervollständigen.«
Messiah fällt keine Antwort darauf ein. Sichtlich zufrieden mit ihrer Schlagfertigkeit, fasst Iba an ihren Ohrhörer, aus dem es zu quäken beginnt.
»Es wird im Sektor A passieren. Die vier Fenster oben rechts. Bezugspunkte 1, 2, 3 und 4. Im Uhrzeigersinn. Verstanden?«
Messiah bestätigt und ändert seinen Schusswinkel. Iba stellt ihre Geräte ein. Die Warterei geht weiter, unerbittlich. Die brütende Hitze setzt ihnen zu.
Seit Stunden liegen sie reglos da. Messiah ist schweißgebadet und dehydriert. Nicht mehr lange, und er wird kollabieren. Zwei amerikanische F-15-Jagdbomber donnern mit hoher Geschwindigkeit über sie hinweg. Der Lärm ihrer Triebwerke lässt seinen Brustkorb vibrieren und die Mauern erzittern. Dann ertönt Ibas Stimme in seinem Ohrhörer. Endlich ist der Befehl da.
»Der Mann im blauen Kaftan. Er ist gerade herausgekommen …«
Iba Khelifi nimmt mit einem ihrer Geräte eine Messung vor.
»Zielfernrohr auf 1,3. Elevation beibehalten. Spin-Drift 3,4 Zentimeter.«
Messiah nimmt die Korrekturen sorgfältig vor.
»Verstanden. Eingestellt.«
»Feuer frei.«
Der Scharfschütze wischt sich den Schweiß von der Stirn. Die Zielperson schlendert in einer dichten Menge. Er holt tief Luft, dann nimmt er das bewegliche Ziel ins Visier.
Ibas Stimme drängt.
»Der Mann im blauen Kaftan. Worauf wartest du, Messiah?«
Als sein Zeigefinger den Abzug berührt, bleibt die Zeit stehen. Die Detonation zerreißt die Stille, und die Kugel beginnt pfeifend ihren Flug in Richtung Ziel. Dann durchfährt ein Zucken den Mann im blauen Kaftan, seine Arme werden nach hinten gerissen, und sein Körper sackt leblos in die Knie.
»Zielperson am Boden. Good kill, Messiah!«
Er schließt die Augen und beginnt wieder zu atmen. Doch Ibas Stimme holt ihn ans Zielfernrohr zurück.
»Oh nein! Scheiße!«
Die junge Frau bemüht sich um einen sachlichen Ton.
»Kollateralopfer …«
Machtlos beobachtet Messiah durch sein Zielfernrohr eine Szene schieren Grauens: Das Projektil hat die Zielperson durchschlagen und ein kleines Mädchen getroffen, das hinter ihr an einer Mauer gesessen hat. Jetzt liegt es auf dem Boden, mit dem Gesicht nach unten, den Kopf im Staub.
Iba wendet sich ihm zu.
»Das konnten wir nicht ahnen.«
Messiah steht bereits.
»Wir müssen runter. Nachsehen.«
Sie hält seinen Blick fest und schüttelt den Kopf.
»Das ist keine gute Idee. Hier wimmelt es von Taliban.«
Aber Messiah will nicht hören.
»Ich habe gesagt, wir müssen runter, Khelifi! Das ist ein Befehl.«
Messiah kehrt langsam in die Gegenwart zurück. Er zieht einen blauen, ins Violette spielenden Stein aus der Brusttasche, betrachtet ihn und legt ihn vor sich hin. Diese einfache Geste hilft ihm, sich zu beruhigen. Wieder gefasst und Herr seiner Gefühle, nimmt er seine alte Position ein und sucht weiter die Stockwerke des Glastowers nach seiner Zielperson ab.
Gleich darauf ertönt Black Dogs Stimme. Sie klingt wie ein Knattern in der Luft.
»Sektor Bravo. Die beiden Fenster links. Das Licht ist gerade angegangen. Gesehen?«
»Die beiden Fenster links, Sektor Bravo. Gesehen.«
Im vierundvierzigsten Stock erscheint ein Mann mit blondem Haar und stahlgefasster Brille vor seinem Zielfernrohr. Der Mann, den es zu liquidieren gilt.
»Kontakt. Zielperson am ersten Fenster. Bewegt sich nicht. Gesehen?«
Messiah trommelt mit den Fingern der linken Hand auf den Gewehrkolben, um sie zu lockern.
»Gesehen.«
Sie beobachten den Mann eine Weile schweigend, dann sagt Black Dog:
»Ich sende die letzte Nachricht.«
Er tippt ein paar Wörter in seine Tastatur. Unterdessen behält Messiah die Zielperson im Auge. Hellwach und hochkonzentriert, hört er nur noch das regelmäßige Schlagen seines Herzens. Sein Atem geht langsam und tief.
Black Dog studiert Graphiken, die er auf seinen Bildschirm geladen hat.
»Wir haben Gegenwind aus Ost. Korrigiere auf 2.1.«
Messiah dreht an einem Rad am Gewehr. Zwei Klicks sind zu hören.
»Okay. Korrigiert.«
Das Auge am Fernrohr, murmelt der Beobachter:
»Sieht so aus, als ob er mit jemandem spricht.«
»Ich kann den hinteren Teil des Raums nicht einsehen.«
Black Dog späht noch eine Weile durchs Fernrohr.
»Ich auch nicht. Toter Winkel. Okay. Wir bleiben auf der Zielperson. Hast du sie noch?«
»Die ganze Zeit.«
Ohne ihn anzusehen, spricht Black Dog dann die schicksalhaften Worte.
»Feuer frei.«
Den Zeigefinger am Abzug, atmet Messiah tief ein und hält die Luft an.
4.Zurück in alter Spur
Jacinthe hatte ins Schwarze getroffen. Warum hatte er auf ihre Nachrichten nicht reagiert, war aber sofort zur Stelle, als ein Mord geschehen war? Woher dieses plötzliche Bedürfnis, die Glut des Schreckens neu zu entfachen? Wollte er sich bestätigen, dass das Feuer endgültig erloschen war und dass er der Versuchung widerstehen konnte?
Oder litt er, als Mensch ein Gewohnheitstier voller Widersprüche, im Gegenteil so unter Entzug, dass er hergekommen war, um sich einen Schuss zu holen?
Diese quälenden Fragen beschäftigten Victor, während er auf das Display des Handys in seiner Hand schaute, auf dem das Facebook-Profil eines Mannes zu sehen war: dunkle Augen, schüchternes Lächeln, Brille mit Stahlfassung, schütteres, blondes Haar.
Seit einigen Wochen wollte er daran glauben, dass er Fortschritte machte, brauchte er das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein und das Blatt wenden zu können. Wie dumm von ihm, dass er wie auf Kommando hier erschienen war, ohne vorher nachzudenken.
In diesem Moment, als er spürte, wie sich etwas in seiner Magengrube zusammenballte, drang leise Jacinthes Stimme zu ihm.
»Das Opfer heißt Guillaume Lefebvre, siebenunddreißig Jahre alt. Er war Investigativjournalist.«
Victor kämpfte gegen die Unruhe an, die ihn befiel, und betrachtete noch einen Moment lang das Foto des Mannes. Etwas Anrührendes ging von ihm aus, eine Art Melancholie, die Schwermut eines Menschen, der schwere Zeiten durchgemacht hatte.
Victor gab Jacinthe das Handy zurück. Sie steckte es ein, ohne von ihren Notizen aufzuschauen.
»Er war nicht irgendwer. Philosophiestudium an der Universität Montréal, Diplom in Internationalem Journalismus, von 2008 bis 2010 Büroleiter der Nachrichtenagentur AFP im Sudan, 2011 und 2012 Korrespondent in Pakistan. Anfang 2013 wechselt er zum Journal de Montréal und arbeitet in der Rechercheabteilung, wo er für eine Reportage über die Flüchtlingskrise mit dem Judith-Jasmin-Preis ausgezeichnet wird.«
Victor nahm die Informationen unbewegt zur Kenntnis und näherte sich dem Toten. Lefebvre war ein Ausnahmejournalist gewesen, von Kollegen und Lesern gleichermaßen geschätzt.
Wie zu sich selbst sagte er mit leiser Stimme:
»Ein Scharfschütze tötet einen Journalisten. Das wird Staub aufwirbeln.«
Jacinthe, der keine Silbe entgangen war, nickte.
»Verstehst du jetzt, warum ich dich hergebeten habe?«
Victors Blick wanderte von dem Loch in der Glaswand zu dem mit roter Kreide umkringelten in der Betonwand.
»Weil du dir ein Bild verschaffen willst, bevor Piché einen Bericht von dir verlangt …«
»… und weil du die Ermittlungen geleitet hast, als ein Sniper den Paten getötet hat.«
Der Boss der italienischen Mafia war 2010 in der Küche seiner Luxusvilla von einem draußen lauernden Schützen erschossen worden.
»Du weißt, worauf man achten muss … Ich habe ja mit einem Gipsbein zu Hause gelegen.«
Jacinthe hatte sich damals bei einem Motorradunfall das Schienbein gebrochen und mehrere Wochen im Dezernat Kapitalverbrechen gefehlt.
»Und nicht jeder von uns ist bei der taktischen Eingreiftruppe gewesen, Monsieur.«
Er lächelte. Die Bemerkung versetzte ihn weit in die Vergangenheit zurück.
»Das ist lange her.«
Sie machte eine wegwerfende Handbewegung.
»Unser Ballistiker hat seine Schwester in Rimouski besucht. Er ist unterwegs, wird aber erst in ein paar Stunden hier sein.«
Auf einmal war es so, als hätte es die letzten Wochen gar nicht gegeben, als führten sie ein Gespräch, das nie unterbrochen worden war, und hätten in die alte Spur zurückgefunden.
Victor kniff sich mit Daumen und Zeigefinger in den Nasenrücken.
»Okay. Dein Journalist, Guillaume Lefebvre, war er verheiratet?«
Jacinthe nickte.
»Seine Frau ist …«
Sie schaute in ihr Notizbuch, blätterte ungeduldig in den Seiten.
»… 2016 gestorben. An einer Lungenembolie. Sie hieß Constance Awa … Awashish.«
Trauer um eine geliebte Frau. Victor dachte bei sich, dass allein dieser frühe Tod ein hinreichender Grund für die Schwermut war, die Lefebvre auf dem Foto ausstrahlte.
»Awashish, das ist doch ein indianischer Name. Kinder?«
Jacinthe nickte und zog erneut ihre Notizen zurate.
»Eine Tochter, Emma. Zwölf Jahre alt. Im September in die siebte Klasse gekommen. Collège de Montréal.«
Er schluckte die Info kommentarlos. Jacinthe sprach weiter, doch er hörte nicht mehr hin. Zwölf Jahre alt. Genauso alt wie er, als sein Vater in einem Anfall geistiger Umnachtung zum Mörder geworden war.
»He, mein Bester! Bist du noch da?«
Victor fuhr aus seinen Gedanken hoch. Jacinthes Gesicht, nur zehn Zentimeter von seinem entfernt, nahm sein gesamtes Blickfeld ein.
Er straffte sich und wich einen Schritt zurück.
»Nur ein bisschen zu nah … Was hast du gesagt?«
»Die Kleine ist zu einem dreiwöchigen Fahrradcamp in Vermont. Wir haben die Familie verständigt.«
Er biss die Zähne aufeinander. Er dachte an dieses Kind, dem man bald mitteilen würde, dass es seinen Vater nie wiedersehen würde. Eine Waise, deren Leben man zerstören würde, so wie sein Vater seines zerstört hatte.
»Wen hast du zu der Familie geschickt? Den Gnom?«
Gilles Lemaire, mit Plateauschuhen eins fünfundsechzig groß, hatte zusammen mit Jacinthe ein Team gebildet, bevor Victor in die Abteilung Kapitalverbrechen zurückgekehrt war.
»Nein, Loïc. Gilles ist in die Abteilung Computerkriminalität versetzt worden.«
»Auf eigenen Wunsch?«
Jacinthe zog einen Flunsch.
»Es war wohl eher der Wunsch eines Mannes, der versucht, die Ehe mit einer Frau zu retten, die sich scheiden lassen will, obwohl sie sieben Kinder unter sechzehn haben.«
Kopfschüttelnd näherte sich Victor dem Esstisch. Es tat ihm leid für seinen alten Kollegen, dessen Beharrlichkeit er ebenso schätzte wie seinen Sinn fürs Detail.
»Gilles … Ich muss ihn unbedingt mal anrufen.«
Er deutete auf das Computernetzkabel, das in der Wand eingesteckt war. Jacinthe kam seiner Frage zuvor.
»Den Computer haben wir noch nicht gefunden. Nadja hat bei der Zeitung angerufen. Sie sind am Suchen.«
»Und sein Handy?«
»Burgers hat es in einer seiner Taschen gefunden. Lefebvre hat zum Entsperren einen Code benutzt, also weder Fingerabdruck noch die bescheuerte Gesichtserkennung. Ein Techniker sitzt dran, aber das könnte knifflig werden.«
Sie sah ihn verschmitzt an.
»Und was den Gnom betrifft: Wenn es darum geht, ihm Tipps in Sachen gemeinsames Sorgerecht zu geben, könntest du auch seine Nummer verloren haben.«
Sie hatte eine merkwürdige Art, einem mitzuteilen, dass sie sich geärgert hatte, doch Victor kannte die Tour in- und auswendig und ließ sich nichts vormachen.
»Hör bloß nicht mit deiner Therapie auf, egal was passiert. Es ist superwichtig, dass man sozialen Umgang lernt. Du wirst es schaffen, Jacinthe. Du wirst es schaffen. Und was hat die Befragung der Nachbarn ergeben?«
Sie gluckste.
»Absolut nichts. Nada.«
Sie legte ihm, nun wieder ernst, eine Hand auf die Schulter.
»Nadja hat mir von Ted erzählt. Wie es aussieht, hat er nicht mehr lange.«
Victor erstarrte. Er war noch weit davon entfernt, sich einzugestehen, dass es mit Ted zu Ende gehen könnte.
»Hat sie das zu dir gesagt?«
Jacinthe erkannte ihren Fehler und korrigierte sich.
»Vielleicht habe ich sie falsch verstanden. Na jedenfalls, wenn ich etwas tun kann …«
Gerührt über die Anteilnahme, lächelte Victor traurig.
»Danke, Jacinthe.«
Bewegt schlugen sie die Augen nieder und schwiegen eine Weile. Der Techniker war in einem Nebenraum verschwunden. Victor drehte sich um, betrachtete den Toten, der in seinem Blut lag, dann das Loch in der Glaswand.
»Wer hat ihn gefunden?«
Jacinthe deutete auf ein paar Kleidungsstücke, die in einer durchsichtigen Schutzhülle an einem Haken neben der Tür hingen.
»Das Gebäude hat einen Concierge-Service. Als Lefebvre nicht geöffnet hat, ist der Angestellte eingetreten und hat die Sachen von der Reinigung aufgehängt. Ein junger Mann. Ich habe mit ihm gesprochen. Er war, wie man so schön sagt, weiß wie ein Bettlaken.«
Sie hatte die letzten Worte besonders betont, aber Victor war zu sehr mit seinen Gedanken beschäftigt, um auf ihren Scherz einzugehen.
»Ich habe auf der Etage keine Überwachungskameras bemerkt. Habe ich sie übersehen?«
»Es gibt einen altmodischen Begriff, und der lautet Privatsphäre, mein Lieber. Unten im Eingangsbereich findest du zwei Türen mit Schlüsselkarte und Kameras. Nadja hat die Aufzeichnungen angefordert.«
Victor nickte, ganz in seine Überlegungen vertieft. Jacinthe schob die Hände in die Taschen.
»In einem Punkt sind wir uns jedenfalls einig: Der Journalist ist von draußen erschossen worden.«
Er murmelte beifällig.
»Die Kugel ist unweit vom Brustbein wieder ausgetreten, richtig?«
»Sie hat das Herz knapp verfehlt. Schwere innere Verletzungen. Burgers hat mir noch mal die Sache mit der temporären Wundhöhle verklickert. Mann, wie mich das nervt, wenn er mich wie seine Praktikantin behandelt.«
Bei jeder Schussverletzung sah es der Pathologe als seine Pflicht an, ihnen zu erklären, dass es durch die Energieabgabe des Projektils an das Gewebe zu einer Ausdehnung kam, die eine Schädigung der benachbarten Knochen und Organe hervorrufen konnte, selbst wenn diese nicht im Schusskanal lagen.
Victor näherte sich wieder der Leiche.
»Was schätzt du, wie groß war Lefebvre? Eins fünfundachtzig?«
»Ja. Ungefähr.«
Er ging zur Glaswand, blieb vor dem Schussloch stehen und untersuchte es.
Jacinthe trat neben ihn.
»Glaubst du, der Schuss kam von dem Gebäude gegenüber?«
Sie deutete nach Westen auf einen noch im Bau befindlichen Wohnturm. Er war ähnlich hoch wie der, in dem sie sich befanden.
Victor schüttelte ohne Zögern den Kopf.
»Bei dieser Entfernung wäre der Höhenunterschied zwischen dem Loch in der Scheibe und dem in der Betonwand nicht so groß.«
Jacinthe schob sich eine Handvoll Sonnenblumenkerne in den Mund.
»Vielleicht wurde die Kugel im Körper abgelenkt, weil sie auf Knochen oder Organe getroffen ist.«
Er streckte ihr die gummibehandschuhte Hand hin.
»Ich würde dir gern ein paar abnehmen.«
»Ich wusste nicht, dass du ein Körnerfresser bist.«
Kurz entschlossen füllte sie ihm die hohle Hand bis zum Rand. Er schloss die Augen und schüttelte resigniert den Kopf.
»Ach ja, entschuldige, ich muss noch an meinen sozialen Kompetenzen arbeiten, richtig?«
Er verkniff sich ein Grinsen, schob ein paar Kerne in den Mund und den Rest in die Jackentasche.
»Die Kugel wurde nicht abgelenkt. Sieh dir das Loch in der Scheibe an. Er ist ungefähr auf meiner Schulterhöhe. Geschätzte eins siebzig vom Boden aus.«
Jacinthe leckte sich mit der Zunge Schalen aus dem Mundwinkel.
»Ja, schon …«
Victor führte sie zu der Betonwand, wo das Projektil seinen Flug beendet hatte und mehrere Zentimeter tief eingedrungen war. Er sank auf ein Knie und fuhr mit dem Zeigefinger über den gleichmäßigen Rand des Lochs.
»Wie hoch ist das Loch vom Boden aus? Dreißig Zentimeter, allerhöchstens.«
Jacinthes Augen bekamen wieder mehr Glanz, wie es schien.
»Okay. Und was bedeutet das, wenn die Kugel nicht abgelenkt worden ist?«
Victor zog die Stirn kraus, während er sich wieder aufrichtete.
»Kennen wir schon das Kaliber?«
Die Polizistin spuckte Schalen in ihre Hand und ließ sie in einer Tasche ihrer Cargohose verschwinden.
»Ich warte noch auf den Ballistikbericht, aber der Techniker hat von einer Patrone im Kaliber .50 gesprochen.«
Victor sah sich in seiner Vermutung bestätigt.
»Eine 50er-Patrone ist fast so lang wie meine Hand. Knappe fünfzehn Zentimeter. Das Geschoss selbst misst vier Zentimeter. Ein wahres Teufelszeug, das Metall durchschlägt. Ein militärisches Kaliber.«
Der letzte Satz zeigte Wirkung. Jacinthe sah ihm alarmiert in die Augen.
»Was siehst du, was ich nicht sehe?«
»Das Projektil wurde nicht in horizontaler Richtung abgefeuert. Die Flugbahn verläuft von oben nach unten. Die Position des Schützen war viel höher als die des Opfers.«
Nach der ersten Überraschung trat Jacinthe wieder an die Glaswand und ließ den Blick über das vor ihnen sich ausbreitende Häusermeer schweifen.
»Wir haben ein Problem, Schätzchen. Bis auf den Wohnturm gegenüber gibt es nicht sonderlich viele Gebäude, von denen aus der Schütze ausreichend freie Sicht gehabt hätte.«
»Du hast recht.«
Sie deutete auf ein Hochhaus, das unweit der Rue Peel und eines Rundpavillons der Université McGill an einem Hang lag.
»Es ist zwar weit, aber vielleicht das weiße da hinten?«
»Nicht hoch genug.«
Sauer, weil er sie herumraten ließ, kaute Jacinthe auf ihren Sonnenblumenkernen.
»Nicht hoch genug, nicht hoch genug … Du machst mir Spaß.«
Mit dem Finger dirigierte er sie zu dem Gebäude zurück, auf das sie eben gezeigt hatte.
»Hinter dem Rundpavillon, was siehst du dort?«
Sie kniff konzentriert die Augen zusammen.
»Na ja, Bäume …«
Im selben Moment schoss ihr ein verrückter Gedanke durch den Kopf, den auszusprechen ihr schwer fiel.
»Warte mal … Du glaubst doch nicht, dass …«
Sie stockte mitten im Satz, als sie seinen zustimmenden Blick sah.
»Scheiße, der Typ hat vom Mont Royal aus geschossen?!«
5.Die Kunst des Krieges
Sechs Minuten nach dem Mord
Die beiden Männer bereiten sich darauf vor, den Schutz der Bäume zu verlassen. Mit geübter Hand montiert Messiah das Zielfernrohr ab, zerlegt das Präzisionsgewehr und verstaut die Einzelteile in den Fächern seines Rucksacks. Jede Bewegung ist wohlüberlegt: Er will keine Sekunde verlieren.
Neben ihm schält sich Black Dog aus dem schwarzen Overall, unter dem er Shorts und T-Shirt trägt, und stopft ihn zu seiner übrigen Ausrüstung. Auch Messiah zieht seinen aus, verharrt dann einen Moment und stiert ins Leere.
»›Töte einen, um tausend zu warnen …‹«
Black Dog würdigt das Zitat mit Kennermiene.
»Die Kunst des Krieges von Sunzi.«
Messiah nickt.
»Du formatierst den Computer der Zielperson neu?«
»Ist schon so gut wie erledigt.«
Black Dog tippt seit mehreren Minuten auf seinem Laptop, als er aus dem Augenwinkel bemerkt, wie Messiah, ein Knie auf dem Boden, die Patronenhülse, die sein Gewehr ausgeworfen hat, zwischen seinen Fingern betrachtet. Die Hülse, die das Projektil enthielt, das Lefebvres Leben beendet hat.
Er ahnt, was in ihm vorgeht, und versucht ihn zu beruhigen.
»Er hat es verdient. Du hast keine Wahl gehabt.«
Mit bedrückter Miene richtete sich Messiah schließlich auf und schultert den Rucksack. Black Dog arbeitet weiter am Laptop.
»Noch zwei Minuten. Dann bin ich durch.«
Aber Messiah hört nicht hin. Er zieht noch mehr blaue Steine aus der Tasche und legte sie vor sich auf den Boden. Bilder und Stimmen steigen in seiner Erinnerung auf.
Afghanistan, 2011. Die Waffen im Anschlag, die Nerven zum Zerreißen gespannt, rücken Messiah und Iba auf der Straße vorsichtig vor. Die junge Frau ruft den Schaulustigen, die sie mit hasserfüllten Blicken und Beschimpfungen empfangen, auf Arabisch Befehle zu.
»Platz da! Los!«
Der Anblick ihrer Waffen und Messiahs entschlossener Miene überzeugen schließlich auch die Widerspenstigen. Die Menge teilt sich vor ihnen. Bald verschwinden die letzten Passanten im Gewirr der engen Gassen. Sie gelangen an die Stelle, wo das Mädchen gestorben ist.
Erschüttert geht Messiah zu dem kleinen Körper, der auf dem Boden im Staub liegt. Das Mädchen muss fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein. Wäre da nicht der Blutfleck, der auf der Höhe des Herzens ihr Kleid besudelt, könnte man meinen, sie schlafe friedlich.
Iba legt ihrem Partner mitfühlend die Hand auf die Schulter.
»Wir können nichts mehr tun. Wir müssen hier weg.«
Mit feuchten Augen schluckt Messiah den Kloß hinunter, der sich in seinem Hals gebildet hat. Er will sich gerade abwenden, da fällt sein Blick auf etwas Glänzendes in der rechten Hand des Kindes. Ein blauer Stein. Er bückt sich, geht runter auf ein Knie und streckt die Hand danach aus. Noch weiß er es nicht, aber der Stein ist mit einem Draht verbunden, der im Ärmel des Pullovers des Mädchens verborgen ist.
Erst als er den Stein mit den Fingern berührt, wittert Iba die Gefahr.
»Nicht!«
Ihre Warnung kommt zu spät. Messiah erkennt seinen Fehler, als er ein Klicken hört. Iba wirft sich gegen ihn, um ihn von dem toten Mädchen wegzustoßen. Im selben Moment gibt es eine heftige Explosion. Wie Puppen werden sie weggeblasen und in einer Wolke aus menschlichen Körperteilen, Blut, Sand und Staub nach hinten geschleudert.
Black Dogs ernste Stimme reißt Messiah jäh aus seinen Erinnerungen und holt ihn in die Gegenwart zurück.
»Neuformatierung … abgeschlossen.«
Er klappt den Laptop zu und lässt ihn in seinen Rucksack gleiten. Messiah sieht ihn finster an.
»Jetzt können wir nicht mehr zurück.«
Black Dog nickt und berührt ihn an der Schulter.
»Wir treffen uns am Pick-up.«
Ohne ein weiteres Wort macht er sich im Laufschritt auf den Weg. Messiah wirft einen letzten Blick in die Runde, um sich zu vergewissern, dass sie keine verräterischen Spuren zurücklassen.
Andächtig betrachtet er die blauen, ins Lila spielenden Steine, die er im Gedenken an den Mann, der soeben durch ihn gestorben ist, zu einem Inuksuk aufgeschichtet hat.
Er schließt die Augen. Eine Stimme hallt durch seinen Kopf und vermischt sich mit dem Bild und dem Pfeifen eines Stocks, der durch die Luft auf ihn niedersaust. Wie jedes Mal, wenn er an die Kendostunden denkt, schmeckt er wieder den Schmerz und die Wut auf der Zunge. »Immer Respekt vor dem Gegner haben. Beweg dich!«
Sein Vater. Der Mann, den er mehr als jeden anderen liebt und hasst. Er nimmt die Sonnenbrille ab und setzt seine Augen dem Licht aus.
Bei der Explosion der selbst gebauten Bombe in Afghanistan, die Iba Khelifi und ihn fast das Leben gekostet hätte, ist sein linkes Auge in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Iris hat eine starke Depigmentierung erfahren und sieht inzwischen wie verwaschen, fast wie gebleicht aus. »Immer in Bewegung bleiben! Mach schon!«
Er setzt die Sonnenbrille wieder auf und schlägt den Weg zur Straße ein. Der Hang ist hier steil, von Gestrüpp überwuchert und unwegsam. Aber sein Laufstil wirkt geschmeidig und kraftvoll. In diesem Augenblick erinnert Messiah nicht an eine zum Töten gedrillte Kampfmaschine, sondern an einen Jogger, der jeden Tag auf dem Mont Royal Dutzende anderer überholt.
6.Erdkrümmung und andere Parameter
Anfangs erschien ihr die Theorie fraglich. Da sie jedoch dazu neigte, in den Ereignissen stets das Resultat einer gewissen praktischen Logik zu sehen, zermarterte sich Jacinthe weiter das Hirn und versuchte der von Victor angesprochenen Möglichkeit ein Körnchen Wahrscheinlichkeit abzugewinnen.
»Entschuldige, aber anderthalb Kilometer, das ist doch echt weit.«
Er stand reglos bei Lefebvres Leiche. Obwohl ihn der Anblick anwiderte und er am liebsten auf den Korridor geflüchtet wäre, zurück an die frische Luft, zwang er sich hinzusehen, um die ganze Sinnlosigkeit dieses zerstörten Lebens zu ermessen.
»Den Rekord für den weitesten Schuss hält ein kanadischer Soldat: dreitausendvierhundertfünfzig Meter, auf einen IS-Kämpfer. Die Kugel flog zehn Sekunden, bevor sie ihr Ziel traf.«
Jacinthe stöhnte.
»Okay, aber ab einer bestimmten Entfernung sinken doch die Chancen. Es dürfte nicht sehr viele Leute geben, die in der Lage sind, ein bewegliches Ziel aus über einem Kilometer Entfernung zu treffen. Mit dem Wind und so.«
»Das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Man muss mehrere Parameter berücksichtigen: Temperatur, Luftdruck, Schwerkraft, Erdkrümmung, Standort der Zielperson, die Eigenschaften von Waffe und Munition …«
Jacinthe verzog scheinheilig das Gesicht.
»Genau das meine ich doch, wenn ich ›und so‹ sage.«
Er grinste.
»Ich verstehe! Das ist, als ob du ›und so weiter‹ gesagt hättest.«
Sie schwankte zwischen Belustigung und Verärgerung.
»Jedenfalls sind mir Parameter und Rekorde egal. Mich interessiert nur unser Mörder.«
Victor lehnte sich gegen die Glaswand und blickte zu der Masse von Bäumen auf dem Mont Royal.
»Wir reden hier nicht von nur einem Schützen, sondern von einem Team. Denn um aus dieser Entfernung ein bewegliches Ziel durch eine Glasscheibe zu treffen, brauchst du einen Beobachter, der dich mit den Parametern füttert.«
Jacinthe trat neben ihn und sah ihn ungläubig an.
»Moment mal, Lessard. Wenn da ein Beobachter dabei war, dann handelt es sich nicht nur um einen Mord, sondern um ein Mordkomplott. Ist dir das klar?«
Victor fuhr sich mit der Hand durchs dichte Haar.
»Moment, nur damit wir uns richtig verstehen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass das Sniper-Nest auf dem Mont Royal war. Ich sage nur, dass es keine sechsunddreißig anderen Möglichkeiten gibt.«
»Du sagst aber auch, dass wir bei einer solchen Entfernung nicht nach Leuten wie meinen Onkel Gérard und seinen Schwager suchen, die sonntagmorgens Rehe jagen.«
Eine Antwort darauf erübrigte sich. Sie überlegten eine Weile.
»One shot, one kill. Die Arbeit eines Profis … Meinst du, das sind ehemalige Soldaten?«
Victor zuckte gereizt mit den Schultern.
»Nicht unbedingt. Zunächst einmal gilt es die Stelle zu finden, wo sie im Hinterhalt gelegen haben. Ist sie über einen Kilometer entfernt, bekommst du eine Vorstellung davon, wen du suchst und was für eine Ausrüstung er benutzt hat.«
Jacinthe ließ diese Auskunft sacken, dann fing sie an, auf ihrem Handy zu tippen.
»Wir werden trotzdem nicht drum herumkommen, in unseren Akten zu wühlen und eine Liste vorbestrafter Soldaten und Veteranen zu erstellen. Mit einem Schwerpunkt auf Scharfschützen.«
Victor machte, seine Worte sorgfältig abwägend, einen weitergehenden Vorschlag.
»Dasselbe solltest du mit den Scharfschützen von Polizei und Gendarmerie machen.«
Jacinthe hob den Kopf und nickte, obwohl ihr die Vorstellung nicht sonderlich behagte.
»Aber warum Lefebvre auf diese Weise umbringen? Normalerweise versuchst du doch, so nahe wie möglich an dein Opfer heranzukommen, oder?«
Ohne eine Antwort abzuwarten, sprach sie weiter.
»Schließlich war er Journalist und kein Gangsterboss, der von Leibwächtern beschützt wird. Warum ihm nicht auf einem Parkplatz in Laval eine Kugel in den Kopf jagen?«
Die Stimme, mit der Victor antwortete, klang wie ein sanftes Pusten in die Glut.
»Weil sie es konnten …«
Sie sah ihn an, bemüht, die Tragweite seiner Antwort zu ermessen.
»Willst du damit sagen, dass …«
»Das war kein gewöhnlicher Mord. Das war eine Machtdemonstration. Ihr werdet euch mit Lefebvres Arbeit befassen müssen. Womit hat er sich zuletzt beschäftigt?«
Sie wusste, dass er recht hatte, und dennoch sträubte sich etwas in ihr dagegen. Sie zog die Schultern hoch und wartete ab.
Er fuhr fort.
»Und wenn ihr seinen Computer nicht findet, kann das bedeuten, dass ihn jemand mitgenommen hat.«
»Vor dem Mord?«
Jacinthe stutzte, dann begriff sie.
»Oder jemand, der alles gesehen hat …«
Sie tauschten einen langen Blick. Es war klar, was aus einer solchen Hypothese zu folgern war: Wenn jemand den Mord an Lefebvre mitangesehen hatte, dann war er jetzt in Gefahr.
7.Mir ist so traurig ums Herz
Acht Minuten vor dem Mord
Bekleidet mit einem langen, grünen Wollmantel, einen Rucksack auf dem Rücken, die Haare und die obere Gesichtshälfte unter der Kapuze verborgen, tritt die junge, dunkelhäutige Frau geräuschlos in die Wohnung Guillaume Lefebvres.
Während sie die Schlüsselkarte einsteckt, merkt sie sofort, dass etwas nicht stimmt. Eine Jacke, Schuhe, eine Ledertasche und Schlüssel liegen auf dem Fußboden verstreut. Sie begreift, dass sie gegen die Regel verstoßen hat und ungelegen kommt, und will gerade kehrtmachen, als er im Flur auftaucht, seinen Laptop in der Hand. Er ist barfuß, trägt eine schwarze Jogginghose und ein graues T-Shirt.
Die Besucherin nimmt ihre Sonnenbrille ab, und die beiden sehen einander herausfordernd an. Der Journalist wird hochrot im Gesicht, die Adern an seinen Schläfen schwellen an.
»Was willst du hier?«
Obwohl auf den anrüchigen Straßen Abidjans sozialisiert, senkt sie leicht den Kopf, um einen Streit zu vermeiden, doch sie antwortet mit fester Stimme.
»Du bist nicht zu unserer Verabredung gekommen. Da habe ich mir Sorgen gemacht.«
Er geht zu der Glaswand und blickt auf die Stadt, die weit unten pulsiert. Ohne sich umzudrehen, giftet er:
»Ich dachte, wir hätten das geklärt. Du solltest den Kartenschlüssel nur im Notfall benutzen. Du hättest dich ankündigen müssen.«
»Kein Handy, kein Telefon, kein Internet. Wir waren uns doch einig!«
»Ich muss weg. Jetzt gleich.«
Lefebvre tut es bereits leid, dass er aus der Haut gefahren ist. Er will sich gerade entschuldigen, als das Mailprogramm seines Rechners mit einem Piepton den Eingang einer Nachricht meldet.
Ärgerlich beißt die Frau die Zähne zusammen.
»Du willst Schluss machen, stimmt’s?«
Sie ballt die Fäuste, ringt um Fassung.
»Du willst Schluss machen, aber du hast nicht den Mut gehabt, es mir ins Gesicht zu sagen.«
Die Augen auf den Bildschirm gerichtet, kehrt ihr Lefebvre immer noch den Rücken zu. Als er sich umdreht, sieht er so aus, als wäre ein anderer in seine Haut geschlüpft.
»Was ist los, Guillaume?«
Sie fragt ihn, dabei weiß sie, warum die Dinge aus dem Ruder gelaufen sind, warum der Journalist sich zurückgezogen und abgekapselt hat. Sie mustert ihn im weißlichen Gegenlicht der Glaswand. In einem solchen Zustand hat sie ihn noch nie gesehen.
»Ich habe dir doch gesagt, dass du gehen sollst. Du hast hier nichts verloren.«
»So kann das nicht weitergehen, Guillaume. Du musst damit aufhören, denn …«
Er unterbricht sie.
»Glaubst du etwa, ich habe Angst? Glaubst du, ich lasse mich einschüchtern?«
Da dämmert ihr, dass etwas Schlimmeres im Gang ist, als sie vermutet hat.
»Was ist? Hast du Drohungen erhalten. Von ihnen?«
Wieder piept das E-Mail-Programm. Lefebvre blickt auf den Bildschirm. Und als er wieder zu ihr aufschaut, sind seine Züge von Angst verzerrt.
»Verschwinde! Und zwar …«
Er beendet den Satz nicht. Das Geräusch von splitterndem Glas ertönt, ein Pfeifen, dann das dumpfe Klatschen des Projektils, das sein linkes Schulterblatt durchschlägt.
Entsetzt sieht die junge Frau, wie Lefebvres Körper sich aufbäumt und sein Brustkorb explodiert. Fleisch- und Gewebefetzen wirbeln durch die Luft. Der Journalist kippt vornüber, stößt einen Schwall Luft aus und sackt mit dem Gesicht voraus zu Boden. Wie mit Verzögerung beginnt das Blut zu spritzen.
Die Frau fällt auf den Hintern. Sie ist starr vor Angst. Dann findet sie die Kraft, zu ihm zu kriechen. Lefebvre hat den Kopf in ihre Richtung gedreht. Sie sieht ihm in die Augen.
»Wo ist es, Guillaume? In deinem Computer? Guillaume?!«
Sie spricht zu ihm, aber der Journalist hört sie nicht.
Zu dumm, Emma, ich weiß, dass ich sterbe, aber alles, woran ich mich erinnere, ist das Gedicht über die Raubvögel, das du geschrieben hast, als Constance gestorben ist.
Es handelte von einem Falken, der zu den Sternen fliegen und mit den Toten sprechen kann. Ich erinnere mich noch. Es hieß ›Mir ist so traurig ums Herz‹.
Die junge Frau bemerkt plötzlich, dass sie Blut an den Händen hat. Sie möchte schreien, aber es gelingt ihr, Ruhe zu bewahren und sich dem Sterbenden zuzuwenden.
»Bleib bei mir, Guillaume! Sag mir, wo ich suchen muss.«
Doch Lefebvre versinkt bereits in tintenschwarzem Wasser und fühlt, dass er untergeht wie ein ölverschmierter Vogel. Seine reglose Hand liegt auf dem Boden in seinem Gesichtsfeld. Mit geschärftem Blick betrachtet er die Adern, die unter der Haut verlaufen, die Textur der Epidermis, wird sich jeder Linie bewusst, die seine Handfläche durchzieht.
Eine endlose Sekunde lang staunt er über dieses grenzenlose Labyrinth, dieses verschlungene, pulsierende Netz, und er wird von einer Erkenntnis durchdrungen, die ihn beruhigt: Man hat die Unendlichkeit täglich vor Augen, man muss sich ihr nur nähern und hinsehen.
Und darum bemüht er sich jetzt: Er bewundert das viele Blut, in dem seine Hand liegt, wie angespült von der Flut.
»Wer wird sich um mich kümmern, wenn du mal stirbst?«
Das hast du mich immer wieder gefragt, wenn du deine Panikattacken hattest, Emma. Anstatt das zu tun, was alle Eltern tun, wenn sie ihr Kind zu beruhigen suchen, und dir beispielsweise zu sagen, dass du schon alt sein wirst, wenn es geschieht, habe ich dich in die Arme genommen und dir erklärt, dass das Leben so schnell vergeht, dass nichts an ihm festhalten kann. Weißt du noch?
»Du bist das Schönste, was mir das Leben geschenkt hat, Emma. Ich bin da. Du kannst ruhig schlafen.«
Das habe ich zu dir gesagt, mein Mädchen. Gemeinsam haben wir über eine Eigenschaft der Dinge gesprochen, die dich trösten und dir helfen könnte, auch nach dem Tod deiner Mutter weiterzuleben: die Vergänglichkeit.