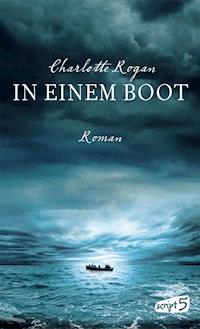
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: script5
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Damit die einen überleben, müssen die anderen sterben. Grace ist frisch verheiratet mit Henry Winter, einem jungen Mann aus reichem Hause, als sie sich am Vorabend des ersten Weltkriegs auf der Zarin Alexandra einschifft. Doch nach einer mysteriösen Explosion sinkt der Ozeandampfer, und Henry erkauft seiner Frau einen Platz in einem Rettungsboot. Den Naturgewalten schutzlos ausgeliefert, treibt das überladene Boot wochenlang auf offener See. In einer Atmosphäre aus Misstrauen und unterdrückter Aggression stellen sich existentielle Fragen. Sollen die Stärkeren sich opfern, damit die Schwächeren überleben können? Oder besser umgekehrt? Wer darf das entscheiden? Und sitzt Grace überhaupt zu Recht in diesem Boot? Grace überlebt die Katastrophe, findet sich aber Wochen später vor einem Gericht in New York wieder. Die Anklage lautet auf Mord.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Kevin.
Prolog
Die Anwälte waren schockiert über mein Benehmen. Es überraschte mich, welche Wirkung ich auf sie hatte. Als wir heute das Gerichtsgebäude verließen, um ein Mittagessen zu uns zu nehmen, ging ein Gewitter nieder. Eilig suchten die Herren Schutz unter der Markise eines Geschäfts, damit ihre Anzüge nicht nass wurden, während ich mitten auf der Straße stehen blieb, mein Gesicht nach oben gewandt, den Mund weit geöffnet. Ich war wieder dort, erlebte noch einmal jenen anderen Regen, der uns in einen grauen Mantel hüllte. Ich hatte diesen Regenguss erlebt, aber dort auf der Straße spürte ich zum ersten Mal, dass ich ihn wieder erleben, dass ich erneut eintauchen konnte und dass es wieder der zehnte Tag war. An diesem Tag hatte es angefangen zu regnen.
Der Regen war kalt, aber wir hießen ihn willkommen. Anfangs war es nicht mehr als ein sanftes Nieseln, aber je weiter der Tag fortschritt, desto stärker regnete es. Wir hoben unsere Gesichter, rissen die Münder auf und wässerten unsere geschwollenen Zungen. Mary Ann konnte oder wollte den Mund nicht öffnen, weder um zu trinken noch um zu sprechen. Sie war etwa in meinem Alter. Hannah, die nur unwesentlich älter war, schlug sie fest ins Gesicht und sagte: »Mach den Mund auf oder ich mache es!« Dann packte sie Mary Ann und hielt ihr die Nase zu, bis sie gezwungen war, nach Luft zu schnappen. Lange Zeit saßen die beiden in einer groben und erbarmungslosen Umarmung da. Hannah drückte Mary Anns Kiefer auseinander, damit der graue, rettende Regen in sie fließen konnte, ein Tropfen nach dem anderen.
»So kommen Sie doch!«, rief Mr Reichmann, der die kleine Gruppe von Anwälten leitet, die von meiner Schwiegermutter angeheuert wurde – nicht etwa, weil ihr etwas an mir liegt, sondern weil sie der Meinung ist, dass meine Verurteilung ein schlechtes Licht auf ihre Familie werfen würde. Mr Reichmann und seine Kollegen versuchten vom Gehsteig aus, mich zum Herkommen zu bewegen, aber ich tat so, als würde ich sie nicht hören. Sie wurden wütend, weil sie sich nicht beachtet fühlten oder besser gesagt: weil ich ihnen nicht gehorchte. Und das ist für Leute, die es gewohnt sind, von einem Podium aus zu sprechen, und die sich der Aufmerksamkeit von Richtern und Geschworenen sicher sein können und von Menschen, die unter Eid stehen oder zum Schweigen verpflichtet sind und deren Freiheit davon abhängt, welche Wahrheit sie sich entscheiden zu erzählen, geradezu eine Ungeheuerlichkeit. Als ich mich schließlich von dem Regen losriss und mich zu ihnen gesellte, zitternd und bis auf die Knochen durchnässt, aber insgeheim voller Freude, weil ich die kleine Freiheit meiner Einbildungskraft wiedergefunden hatte, fragten sie mich: »Was sollte das denn? Was haben Sie gemacht, Grace? Sind Sie verrückt geworden?«
Mr Glover, der immer am nettesten ist, legte seinen Mantel um meine tropfnassen Schultern, und kurz darauf war das feine Seidenfutter ebenfalls völlig durchnässt. Ich war zwar von Mr Glovers Geste gerührt, aber es wäre mir lieber gewesen, wenn der gut aussehende, etwas stämmige Mr Reichmann meinetwegen seinen Mantel im Regen ruiniert hätte.
»Ich hatte Durst«, sagte ich. Ich war immer noch durstig.
»Aber das Restaurant ist gleich um die Ecke. Es ist nur noch ein halber Block bis dahin. In ein paar Minuten können Sie trinken, was Sie wollen«, sagte Mr Glover, während die anderen in die Richtung deuteten, in der das Restaurant lag, und mir ermutigend zunickten. Aber mich dürstete nach Regen und Salzwasser, nach der endlosen Weite des Ozeans.
»Das ist sehr komisch«, sagte ich und lachte über den Umstand, dass ich mir aussuchen konnte, was ich trinken wollte, wo mich doch nach nichts dergleichen verlangte. Ich hatte die vergangenen zwei Wochen im Gefängnis verbracht, und man ließ mich nur für die Verhandlung hinaus. Ich konnte das Lachen nicht unterdrücken. Es schwappte in meinem Inneren hin und her und brach aus mir heraus wie haushohe Wellen.
Ich durfte die Anwälte nicht in den Speisesaal des Restaurants begleiten, sondern musste meine Mahlzeit in der Garderobe einnehmen, wo ein Kanzleigehilfe von einem Stuhl in der Ecke aus über mich wachte, während ich an meinem Sandwich knabberte. Wir saßen da wie zwei Vögel, und ich kicherte vor mich hin, bis mir die Seiten wehtaten und ich befürchten musste, mich zu übergeben.
»Nun«, sagte Mr Reichmann, als die Anwälte ihr Mittagessen beendet hatten und mich abholten, »wir haben darüber geredet, und es scheint uns gar nicht so weit hergeholt, wenn wir auf nicht zurechnungsfähig plädieren.« Die Idee, mich als geisteskrank zu deklarieren, erfüllte sie mit fröhlichem Optimismus. Waren sie vor dem Essen noch nervös und niedergeschlagen gewesen, so zündeten sie sich nun Zigarren an und gratulierten sich gegenseitig zu gewonnenen Fällen, von denen ich noch nie gehört hatte. Sie hatten offensichtlich die Köpfe zusammengesteckt, meinen Geisteszustand unter die Lupe genommen und entschieden, dass die eine oder andere Schraube locker sein könnte, und nachdem der erste Schock über mein Benehmen abgeklungen war und sie überlegt hatten, ob man die Sache nicht vielleicht wissenschaftlich erklären und zum Nutzen des Verfahrens ausschlachten könnte, tätschelten sie mir nacheinander den Arm und sagten: »Machen Sie sich keine Sorgen, meine Liebe. Immerhin haben Sie einiges durchgemacht. Überlassen Sie alles uns, wir kennen uns damit bestens aus.« Es fiel der Name eines gewissen Dr. Cole, und man versicherte mir, dass er »äußerst mitfühlend« sei. Dann ratterten sie eine Liste von Titeln und Spezialgebieten herunter, die mir alle überhaupt nichts sagten.
Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam – vielleicht war es Glover oder Reichmann, vielleicht auch der mausgraue Ligget –, dass ich mich hinsetzen und versuchen sollte, die Ereignisse jener einundzwanzig Tage zu rekonstruieren. Das »Tagebuch« sollte dann als eine Art Entlastungsmaterial dem Gericht präsentiert werden.
»Aber in dem Fall sollte sie besser geistig gesund sein, ansonsten wird das Dokument doch nicht zugelassen«, meldete sich Mr Ligget vorsichtig zu Wort, als hätte er Angst, einen Misston in die Diskussion einzubringen.
»Da haben Sie vermutlich recht«, meinte Mr Reichmann und strich sich über das lange Kinn. »Warten wir ab, was dabei herauskommt, bevor wir uns für einen Weg entscheiden.« Sie lachten und stachen mit ihren Zigarrenspitzen in die Luft und redeten über mich, als ob ich gar nicht da wäre, während wir gemeinsam zum Gerichtsgebäude zurückgingen, wo ich mit zwei weiteren Frauen, Hannah West und Ursula Grant, wegen Mordes auf der Anklagebank saß. Ich war zweiundzwanzig Jahre alt. Ich war zehn Wochen verheiratet gewesen und seit sechs Wochen Witwe.
Teil I
Erster Tag
Am ersten Tag im Rettungsboot waren wir sehr still. Wir waren viel zu sehr damit beschäftigt, entweder das Drama zu verarbeiten, das sich in dem schäumenden Meer ringsum abspielte, oder es zu verdrängen. John Hardie, ein kräftiger und fähig wirkender Seemann und das einzige Mitglied der Mannschaft an Bord des Rettungsboots Nr. 14, übernahm sofort das Kommando. Er verteilte die Leute entsprechend ihres Gewichts auf die einzelnen Sitzplätze, und da das Boot sehr tief im Wasser lag, untersagte er es uns allen, ohne seine Erlaubnis aufzustehen oder heftigere Bewegungen zu machen. Dann zog er ein Steuer unter den Sitzen hervor, befestigte es in seiner Verankerung am hinteren Ende des Bootes und fragte schließlich, wer von den Insassen rudern könne. Drei Männern und einer kräftigen Frau namens Mrs Grant wurden die vier langen Ruder anvertraut, und Hardie gab Anweisung, das Boot so schnell wie möglich so weit wie möglich von dem sinkenden Schiff wegzubringen. »Rudert, was das Zeug hält«, befahl er, »wenn ihr nicht mit ins Verderben gerissen werden wollt!«
Mr Hardie stand mit gespreizten Beinen und wachsamen Augen im Boot und steuerte geschickt um jedes Hindernis herum, das uns vor den Bug geriet, während meine vier Gefährten schweigend ruderten. Ihre Muskeln traten unter ihrer Kleidung hervor, und ihre Fingerknöchel wurden weiß. Weitere Insassen packten die Enden der langen Ruder, um mitzuhelfen, aber es fehlte ihnen an Übung, was dazu führte, dass die Blätter der Riemen über das Wasser fuhren oder flach hindurchglitten, wo sie doch mit der breiten Seite das Wasser nach hinten schieben sollten. Aus lauter Mitgefühl mit den Ruderern stemmte ich meine Füße gegen den Boden des Bootes, und bei jedem Ruderschlag spannte ich meine Schultern an, als ob ich auf diese Weise das Boot voranbringen könnte. Gelegentlich unterbrach Mr Hardie das schockstarre Schweigen mit Bemerkungen wie: »Noch zweihundert Meter und wir sind in Sicherheit.« Oder: »In zehn Minuten geht sie auf den Meeresgrund, vielleicht auch in zwölf, aber länger macht sie’s nicht.« Oder: »Neunzig Prozent der Frauen und Kinder konnten in Sicherheit gebracht werden.« Ich fand Trost in seinen Worten, obwohl ich mit eigenen Augen gesehen hatte, wie eine Mutter ihre kleine Tochter ins Wasser geworfen hatte und ihr nachgesprungen war. Keine von beiden war wieder aufgetaucht. Ob Mr Hardie es auch gesehen hatte, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, aber ich glaube schon, denn diesen schwarzen Augen unter den dichten Brauen schien nichts zu entgehen. Wie auch immer, ich widersprach ihm nicht, und auch der Gedanke, er könnte uns wissentlich angelogen haben, kam mir nicht. Stattdessen sah ich in ihm einen Anführer, der versuchte, seiner Truppe Mut zuzusprechen.
Unser Rettungsboot war eines der letzten, die zu Wasser gelassen worden waren, und so wirkte das Meer ringsum völlig überfüllt. Ich sah, wie zwei Boote zusammenstießen, als sie versuchten, dem Plunder auszuweichen, der auf dem Wasser trieb. Ein Teil meines Gehirns, der nicht von Panik überflutet war, begriff, warum Mr Hardie offenes Wasser erreichen wollte. Er hatte seine Mütze verloren, und mit seinen wild zerzausten Haaren und den blitzenden Augen schien er wie für die Katastrophe gemacht zu sein, die uns mit solchem Schrecken erfüllte. »Legt euch in die Riemen, Kameraden!«, schrie er. »Zeigt uns, aus welchem Eisen ihr geschmiedet seid!« Und die Ruderer verdoppelten ihre Anstrengungen. Gleichzeitig waren hinter uns etliche Explosionen zu hören, und die Schreie und das Kreischen der Menschen, die sich immer noch an Bord der Zarin Alexandra oder im Wasser dicht bei dem sinkenden Schiff befanden, klangen wie das Getöse der Hölle, wenn es eine Hölle gab. Ich warf einen Blick zurück und sah den mächtigen Rumpf des Ozeanriesen erzittern und schwanken, und zum ersten Mal fielen mir die Flammen auf, die an den Kabinenfenstern leckten.
Wir kamen an zersplitterten Holzplanken vorbei, im Wasser trudelnden Fässern und schlangengleichen Tauen. Ich sah einen Liegestuhl vorbeitreiben, einen Strohhut und etwas, was ich für eine Stoffpuppe hielt – eine traurige Erinnerung an das schöne Wetter, das heute Morgen noch geherrscht hatte, und an die Urlaubsstimmung, die sich auf dem Schiff breitgemacht hatte. Als drei kleinere Fässer vor uns auftauchten, die gemeinsam auf den Wellen schaukelten, rief Mr Hardie »Aha!« und befahl uns, zwei davon an Bord zu nehmen. Er verstaute sie unter dem dreieckigen Sitz, der im spitz zulaufenden Heck unseres Rettungsbootes befestigt war. Er versicherte uns, dass sich in den Fässern Trinkwasser befand; wenn es uns gelang, uns so weit von dem sinkenden Schiff zu entfernen, dass wir nicht von dem Strudel mit in die Tiefe gezogen wurden, müssten wir uns, so meinte Hardie, vielleicht auf eine Zeit voller Hunger und Durst einstellen. Aber so weit im Voraus konnte ich nicht denken. Ich fand, dass die Oberkante der Reling unseres Bootes der Wasseroberfläche schon gefährlich nah war, und in meinen Augen bedeutete jeder Halt eine Verzögerung in unserem Bestreben, von dem sinkenden Schiff wegzukommen.
Im Wasser trieben auch Leichen und hier und da klammerten sich Überlebende an Wrackteile. Ich sah eine weitere Mutter und ihr Kind. Das Kind hatte ein kreideweißes Gesicht. Es streckte mir die Hände entgegen und schrie. Als wir näher kamen, sahen wir, dass die Mutter tot war. Ihr Leichnam hing über einer Holzplanke, und ihr blondes Haar trieb wie Seegras im grünen Wasser. Der kleine Junge trug eine zierliche Krawatte und Hosenträger, und ich fragte mich unwillkürlich, warum ihn seine Mutter so unpassend angezogen hatte, obwohl ich immer Menschen bewundert habe, die es verstehen, sich gut zu kleiden, und obwohl meine eigenen Unterröcke, mein Korsett und die weichen Kalbslederstiefel, die ich erst vor Kurzem in London erstanden hatte, mich entsetzlich einengten. Einer der Männer rief: »Ein bisschen weiter hier herüber, dann steuern wir direkt auf das Kind zu!« Aber Hardie entgegnete: »Von mir aus. Und wer von Ihnen will seinen Platz mit dem Kind tauschen?«
Mr Hardie hatte die raue Stimme eines Matrosen. Ich konnte nicht immer verstehen, was er sagte, aber das steigerte nur noch mein Vertrauen in ihn. Er kannte sich in dieser weiten Wasserwelt aus; er sprach ihre Sprache, und je weniger ich ihn verstand, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass er vom Ozean verstanden wurde. Niemand wusste etwas auf seine Bemerkung zu sagen, und wir fuhren an dem schreienden und heulenden Kind vorbei. Ein schlanker Mann, der neben mir saß, brummte: »Wir könnten doch stattdessen diese Fässer über Bord werfen und das arme Kerlchen herausfischen.« Aber dann hätten wir umdrehen müssen, und unser Mitgefühl für das Kind war bereits jetzt Teil der Vergangenheit, die hinter uns versank. Und so schwiegen wir. Nur der schmale Mann neben mir sagte etwas, aber seine dünne Stimme war über dem rhythmischen Ächzen der Ruderdollen, dem Brausen und Tosen ringsum und der Kakofonie aus menschlichen Stimmen, die Befehle brüllten oder laut aufschrien, kaum zu hören. »Es ist doch nur ein kleiner Junge. Wie viel kann so ein Knirps schon wiegen?« Ich erfuhr später, dass der Mann ein anglikanischer Diakon war, aber damals kannte ich noch keinen meiner Kameraden mit Namen und wusste auch nichts über ihren gesellschaftlichen Stand. Niemand antwortete ihm. Stattdessen legten sich die Ruderer in die Riemen, und wir imitierten ihre Bewegungen. Mehr konnten wir nicht tun.
Nicht lange danach begegneten wir drei Männern, die im Wasser trieben. Mit kräftigen Schwimmzügen kamen sie auf uns zu. Einer nach dem anderen packten sie die Rettungsleine, die außen am Rand des Bootes verlief, und legten so viel Gewicht darauf, dass die Wellen in das Boot schwappten. Einer der Männer fing meinen Blick ein. Er war glatt rasiert und seine Gesichtshaut war rot vor Kälte. In seinen blauen Augen lag ein Ausdruck von großer Erleichterung. Auf Hardies Befehl hin schlug der Ruderer, der neben ihm saß, die Hände des einen Mannes weg, ehe er anfing, auf die Hände des nächsten einzuprügeln. Ich hörte Holz auf Knochen krachen. Dann hob Hardie seinen Fuß und trat mit der Sohle seines schweren Stiefels dem blauäugigen Mann ins Gesicht, der daraufhin einen überraschten und verzweifelten Schrei ausstieß. Ich konnte nicht wegschauen, es war einfach unmöglich, und noch nie in meinem Leben empfand ich so viel Mitleid wie für diesen namenlosen Mann.
Wenn ich hier und jetzt berichte, was sich auf der Steuerbordseite des Rettungsbootes Nr. 14 abgespielt hat, dann ist es wohl purer Selbstschutz, wenn ich verschweige, dass sich ringsum in dem brodelnden Wasser tausend ähnliche Dramen abspielten. Irgendwo da draußen war Henry, mein Ehemann. Entweder saß er in einem Boot und wehrte Menschen ab, die versuchten, sich zu retten, oder er war selbst einer von jenen, die im Wasser trieben und weggestoßen wurden. Ich fühlte mich ein wenig erleichtert, wenn ich mich an die energische Bestimmtheit erinnerte, mit der er mir einen Platz in dem Boot gesichert hatte, denn ich war davon überzeugt, dass er dieselbe Energie auch für sich selbst aufgewendet hatte. Aber könnte Henry handeln wie Hardie, selbst wenn sein Leben davon abhinge? Könnte ich es? Mr Hardies grausames Vorgehen beschäftigte mich noch des Öfteren – natürlich war seine Tat abstoßend und keiner von uns anderen hätte die Kraft gehabt, diese entsetzliche und unwiderrufliche Entscheidung zu treffen, die einen starken Anführer erforderte, und es ist gewiss, dass uns diese Tat rettete. Ich wage sogar zu bezweifeln, dass sie grausam genannt werden darf, wenn doch alles andere, was wir hätten unternehmen können, unseren sicheren Tod bedeutet hätte.
Es ging kein Wind, aber trotz der ruhigen See schwappte gelegentlich ein Schwall Wasser über den Rand des voll besetzten Bootes. Unsere Verteidiger führten vor ein paar Tagen ein Experiment durch, das bewies, dass eine einzige weitere erwachsene Person von durchschnittlichem Gewicht unser Boot mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum Kentern gebracht hätte. Wir konnten nicht jeden und gleichzeitig uns selbst retten. Mr Hardie wusste das und hatte den Mut, nach diesem Wissen zu handeln. Seine Entscheidungen in jenen ersten Minuten und Stunden machten den Unterschied zwischen Weiterleben und einem nassen Grab aus. Und seine Entscheidungen waren es, die Mrs Grant, die stärkste und selbstbewussteste der Frauen, gegen ihn aufbrachten. Mrs Grant sagte: »Sie Unmensch! Kehren Sie um und retten Sie wenigstens das Kind!«, obwohl selbst ihr klar sein musste, dass wir dem Untergang geweiht sein würden, wenn wir zurückfuhren. Aber diese Worte kennzeichneten Mrs Grant als Menschenfreundin und Hardie als kaltherzigen Teufel.
Es gab auch Bekenntnisse zu Mitgefühl und Nächstenliebe. Die stärkeren Frauen kümmerten sich um die schwächeren, und es ist der standhaften Anstrengung der Ruderer zu verdanken, dass wir uns so schnell von dem sinkenden Schiff entfernten. Mr Hardie schien wild entschlossen, uns zu retten, und er zog innerhalb kürzester Zeit eine Linie zwischen jenen, die würdig waren, unter seine Fittiche genommen zu werden, und denen, die draußen bleiben mussten. Wir anderen brauchten länger, um diese Unterscheidung zu machen. In den ersten Tagen fühlte ich mich innerlich den Passagieren der ersten Klasse, in deren Gesellschaft ich die Reise auf der Zarin Alexandra verbracht hatte, näher als den Menschen im Rettungsboot Nr. 14. Und wer wollte es mir verübeln? Trotz der Schwierigkeiten, die mich in den letzten Jahren befallen hatten, war ich an Luxus gewöhnt. Henry hatte über fünfhundert Dollar für die Passage bezahlt, und ich sah mich immer noch in Gedanken im Triumph in meiner Heimatstadt einlaufen, nicht als das mittellose Opfer eines Schiffbruchs und nicht als die Tochter eines gescheiterten Kaufmanns, sondern als Ehrengast einer Willkommensfeier, gekleidet in eine Seidenrobe und angetan mit den Juwelen, die jetzt auf dem schlammigen Grund des Meeres ruhen. Ich malte mir aus, wie mich Henry seiner Mutter vorstellen würde, deren distanzierte Haltung dank meines Charmes und dem Umstand, dass an unserer Eheschließung nicht mehr zu rütteln war, dahinschmolz. Und ich stellte mir vor, wie die Männer, die meinen Vater betrogen hatten, von aller Welt öffentlich geschnitten wurden.
Hardie dagegen fand sich sofort in der neuen, schwierigen Situation zurecht. Ob das für oder gegen ihn sprach, vermag ich nicht zu beurteilen. Ich vermute, es lag an seiner Matrosenseele und daran, dass er schon vor langer Zeit seine zarteren Gefühle abgelegt hatte, sollte er jemals über dergleichen verfügt haben. Er hatte sich ein Messer um die Taille gegürtet und seine verlorene Mütze durch einen Lumpen ersetzt, der so gar nicht zu den Goldknöpfen seiner Uniformjacke passte. Aber diese äußerlichen Veränderungen schienen Ausdruck für seine Bereitschaft zu sein, sich anzupassen, und ich vertraute ihm deswegen umso mehr. Als ich mich schließlich irgendwann nach anderen Rettungsbooten umschaute, waren nur noch weit entfernte Punkte am Horizont zu sehen. Mir erschien das als ein gutes Zeichen, war doch die offene See ein Ort relativer Sicherheit nach dem Chaos und dem Tumult rings um das sinkende Schiff.
Mr Hardie gab den schwächsten Frauen die besten Plätze, und er sprach uns alle mit »Ma’am« an. Er erkundigte sich nach unserem Wohlbefinden, als ob es irgendetwas gegeben hätte, was er für uns hätte tun können. Anfangs spielten die Damen mit und erwiderten, es ginge ihnen gut, was eine glatte Lüge war. Jeder konnte sehen, dass Mrs Flemings Hand in einem merkwürdigen Winkel abstand und dass eine spanische Gouvernante namens Maria einen schweren Schock erlitten hatte. Es war Mrs Grant, die eine Schlinge für Mrs Flemings Arm knotete, und es war Mrs Grant, die als Erste offen die Frage äußerte, wie Hardie überhaupt in unser Rettungsboot gekommen war. Später fanden wir heraus, dass entsprechend den Notfallplänen ein ausgebildeter Seemann für jedes Rettungsboot vorgesehen war; allerdings waren Captain Sutter und der Großteil der Mannschaft an Bord der Zarin Alexandra geblieben, hatten den Passagieren in die Rettungsboote geholfen und versucht, die Ordnung wiederherzustellen, nachdem die Menschen in Panik geraten waren. Wir hatten von unserem Boot aus mit eigenen Augen gesehen, mit welch verzweifelter Hast die Matrosen und Passagiere sich gemeinsam bemühten, die Rettungsboote zu Wasser zu lassen. Das Schiff neigte sich bereits stark zur Seite, die Ladung war verrutscht, und als unser Rettungsboot nach unten gelassen wurde, hingen die Seile schräg nach unten statt gerade. Die kleinen Boote waren in ständiger Gefahr, gegen den schief gelegten Rumpf des Schiffs zu prallen oder sich an irgendeinem Hindernis zu verfangen, und die Männer, die an den Winden arbeiteten, hatten alle Hände voll zu tun, die vorderen und hinteren Teile gleichzeitig abzulassen. Direkt nach uns kam ein Boot nach unten, das sich umdrehte und seine gesamte Ladung ins Meer kippte. Wir sahen Frauen und Kinder mit wedelnden Armen schreiend ins Wasser fallen, aber wir unternahmen nichts, um ihnen zu helfen. Und ohne Hardie, der uns anführte und uns sagte, was wir zu tun hatten, hätte uns mit großer Wahrscheinlichkeit das gleiche Schicksal erwartet. Nach allem, was geschehen ist, bin ich nun in der Lage, mir meine Frage selbst zu beantworten: Wenn Mr Hardie die Menschen nicht von unserem Boot weggeprügelt hätte, hätte ich es selbst tun müssen.
Nacht
Wir waren seit etwa fünf Stunden in dem Boot, als der Himmel zuerst eine rosige Färbung annahm, die sich dann in ein tiefes Blau und schließlich in ein schwärzliches Lila wandelte. Die Sonne schien sich aufzublähen, während sie sich zu der dunkler werdenden Wasserfläche im Westen niedersenkte. In der Ferne sahen wir die anderen Rettungsboote als undeutliche Umrisse. Sie schaukelten auf dem Wasser wie wir selbst, hingeworfen in diese rosige und schwarze Weite, zur Untätigkeit verurteilt. Unser Schicksal lag in den Händen unbekannter Kapitäne und ihrer Mannschaften, die mittlerweile von unserer Not erfahren haben mussten.
Ich hatte ungeduldig auf die Nacht gewartet, da es mich zunehmend drängte, meine Blase zu entleeren. Mr Hardie hatte uns erläutert, wie diese Verrichtung vor sich gehen würde. Die Damen durften einen der drei hölzernen Schöpfeimer benutzen, mit denen das hereinschwappende Wasser aus dem Boot befördert wurde. Hardie kämpfte ungeschickt mit den Worten, als er vorschlug, einen der Eimer in die Obhut von Mrs Grant zu geben, der wir unsere Bedürfnisse anvertrauen sollten. Wenn nun die Natur ihr Recht einfordere, müssten wir mit jemandem, der am Rand des Bootes saß, die Plätze tauschen. »Ach!«, rief Mr Hardie, und der schiefe Blick unter seinen dicken Augenbrauen wirkte fast komisch. »Na ja, Sie wissen schon. Ich bin sicher, Sie kriegen das hin.« Ihm, der noch vor wenigen Minuten mit uns die Liste der Vorräte durchgegangen war, die in jedem Rettungsboot vorhanden waren, und uns lang und breit deren Sinn und Zweck erklärt hatte, fehlten bei diesem Thema die Worte.
Als der letzte Rest des orangefarbenen Sonnenrandes verschwunden war, verlangte ich nach dem Schöpfeimer und begab mich zur Reling. Zu meinem Unbehagen musste ich erkennen, dass der Himmel zwar dunkel geworden war, die Nacht jedoch noch immer Konturen zuließ, dass es Lichtquellen und Schatten gab – und hinter den Schatten Augen. Die Nacht war nicht der alles verdeckende Mantel, den ich mir erhofft hatte, und unsere Situation war darüber hinaus noch so beengt, dass das, was ich zu tun gezwungen war, nicht unbemerkt bleiben konnte. Ich dankte den Mächten, die dafür gesorgt hatten, dass ich hauptsächlich von Frauen umringt war, deren Zartgefühl es ihnen untersagte, sich anmerken zu lassen, dass sie wussten, was ich da tat. Wir saßen ja alle im selben Boot, und wir trafen eine stillschweigende Vereinbarung, dass wir dem Biest der körperlichen Notdurft nicht ins Auge blicken würden. Wir würden es ignorieren, würden uns ihm widersetzen, damit es nicht unseren Sinn für Anstand und Sitte zerstören möge, wir würden Höflichkeit wahren noch im Angesicht eines Unglücks, das uns beinahe das Leben gekostet hätte und immer noch kosten konnte.
Am Ende war ich ungemein erleichtert, in mehr als einer Hinsicht. Ich war so mit der Frage beschäftigt gewesen, wie ich die Verrichtung jener Notwendigkeit bewerkstelligen sollte, dass ich kaum auf Mr Hardie geachtet hatte, als dieser uns einen Überblick über die Ausstattung des Rettungsbootes verschaffte. Jetzt aber war ich in der Lage, meine Aufmerksamkeit auf die Tatsache zu richten, dass die Rettungsboote mit fünf Decken bestückt waren, mit einem Rettungsring, der an einer langen Leine hing, drei hölzernen Schöpfeimern, zwei Dosen mit Schiffszwieback, einem Fässchen Trinkwasser und zwei Tassen aus Blech. Zusätzlich zu diesen Vorräten hatte Mr Hardie von irgendwo ein Stück Käse und ein paar Laibe Brot aufgetrieben und noch zwei Wasserfässchen aus dem Meer gefischt, die, so sagte er uns, vermutlich aus einem gekenterten Rettungsboot stammten. Er erzählte uns, dass früher auf dem Deck der Zarin Alexandra eine Kiste mit Kompassen gestanden hätte, die jedoch auf einer früheren Fahrt verschwunden sei. Der Schiffseigner hatte wegen des bevorstehenden Krieges in Österreich die Abfahrt vorgezogen, und so war die Kiste nicht ersetzt worden. »Sie können sagen, was Sie wollen, aber Seeleute sind nicht besser oder schlechter als andere Leute.« Er versäumte auch nicht, uns zu versichern, dass es nur ihm allein zu verdanken war, dass die Segeltuchabdeckung, die das vertäute Rettungsboot trocken gehalten hatte, beim Zuwasserlassen mit im Boot gelandet war. »Aber wozu brauchen wir die denn?«, fragte Mr Hoffman. »Sie ist extrem schwer und nimmt viel Platz weg.« Aber Mr Hardie entgegnete lediglich, dass es in einem Rettungsboot sehr nass werden könne. »Das werden Sie schon noch erleben«, fügte er hinzu. Die meisten von uns trugen Schwimmwesten, die in unseren Kabinen verstaut gewesen waren. Aber in dem Tumult, der dem Untergang des Schiffes vorausging, hatte nicht jeder die Zeit oder die Geistesgegenwart gehabt, sich mit einer Schwimmweste zu versorgen. Mr Hardie, zwei Schwestern, die eng aneinandergedrängt dasaßen und kaum etwas sagten, und ein älterer Herr namens Michael Turner gehörten zu diesen Personen.
Kurz nachdem ich auf meinen Platz zurückgekehrt war, öffnete Mr Hardie eine der Dosen und machte uns mit Schiffszwieback bekannt, steinharten, quadratischen, etwa handtellergroßen Gebäckstücken, die man erst schlucken konnte, wenn man sie mit Speichel oder Wasser eingeweicht hatte. Ich behielt den Zwieback zwischen den Lippen, bis sich Krümel davon lösten, und schaute hinauf in den nicht gänzlich schwarzen Nachthimmel auf die Myriaden von Sternen, die dort funkelten, schaute in die Endlosigkeit der Atmosphäre, die das Einzige war, was noch gewaltiger war als das Meer, und schickte ein Gebet an die Kraft der Natur, die uns an diesen Ort und in diese Lage versetzt hatten, auf dass sie meinen Henry beschützen möge.
Ich war voller Hoffnung, aber rechts und links von mir sackten die Frauen in sich zusammen und fingen an zu weinen. Mr Hardie stand in dem schwankenden Boot auf und sagte: »Ihre Lieben mögen tot sein oder gerettet. Aber es besteht eine gute Chance, dass sie es in eins der anderen Rettungsboote geschafft haben. Und daher sollten Sie nicht das Wasser Ihres Körpers mit dieser Heulerei verschwenden.« Trotz seiner Worte gellten Jammerklagen und Wimmern durch die Nacht. Ich fühlte die junge Frau neben mir hin und wieder erzittern, und einmal stieß sie ein kehliges, fast unmenschliches Schluchzen aus. Ich berührte sie sanft an der Schulter, aber die Geste schien sie nur noch mehr aufzuwühlen, und so zog ich meine Hand wieder weg und lauschte der besänftigenden Musik des Wassers, das gegen die Seiten des Bootes plätscherte. Mrs Grant kletterte von einer Bank zur anderen und tat ihr Bestes, um die Verzweifelten zu trösten, bis Mr Hardie sie anwies, sich wieder zu setzen. Uns anderen erklärte er, dass wir gut daran täten, uns auszuruhen. Wir folgten seinen Anweisungen und versuchten, es uns irgendwie bequem zu machen, lehnten uns aneinander und erbaten oder boten uns gegenseitig Halt, je nach unseren Bedürfnissen und Möglichkeiten. Und trotz allem fanden die meisten von uns tatsächlich Schlaf.
Zweiter Tag
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























