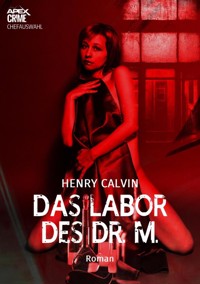5,99 €
Mehr erfahren.
Dies ist die Geschichte des jungen Andy Chivers, der aus der Provinz nach Glasgow kommt und bereit ist, die Welt zu erobern. Aber die große Stadt empfängt ihn nicht sonderlich freundlich: Schon am ersten Abend bekommt er in seinem Hotelzimmer ganz plötzlich unerwarteten Besuch, der damit endet, dass man ihn einfach aus dem Fenster wirft.
Und das ist erst der Anfang; es ist der Auftakt einer wilden Verfolgungsjagd. Für Andy Chivers sind die aufregenden Vorgänge völlig unverständlich, alles liegt für ihn im Dunkeln. Was will man eigentlich von ihm? Wer steckt hinter all dem? Das sind Fragen, die über Andy Chivers Leben oder über seinen Tod entscheiden...
Der Roman In einer kleinen friedlichen Stadt des britischen Schriftstellers Henry Calvin (eigtl. Clifford Hanley - * 28. Oktober 1922; † 9. August 1999) erschien erstmals im Jahr 1967; die deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1969.
Der Verlag DER ROMANKIOSK veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Krimi-Klassikers in seiner Reihe DIE MITTERNACHTSKRIMIS.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
HENRY CALVIN
IN EINER KLEINEN FRIEDLICHEN STADT
Roman
Die Mitternachtskrimis, Band 14
Der Romankiosk
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
IN EINER KLEINEN FRIEDLICHEN STADT
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Das Buch
Dies ist die Geschichte des jungen Andy Chivers, der aus der Provinz nach Glasgow kommt und bereit ist, die Welt zu erobern. Aber die große Stadt empfängt ihn nicht sonderlich freundlich: Schon am ersten Abend bekommt er in seinem Hotelzimmer ganz plötzlich unerwarteten Besuch, der damit endet, dass man ihn einfach aus dem Fenster wirft.
Und das ist erst der Anfang; es ist der Auftakt einer wilden Verfolgungsjagd. Für Andy Chivers sind die aufregenden Vorgänge völlig unverständlich, alles liegt für ihn im Dunkeln. Was will man eigentlich von ihm? Wer steckt hinter all dem? Das sind Fragen, die über Andy Chivers Leben oder über seinen Tod entscheiden...
Der Roman In einer kleinen friedlichen Stadt des britischen Schriftstellers Henry Calvin (eigtl. Clifford Hanley - * 28. Oktober 1922; † 9. August 1999) erschien erstmals im Jahr 1967; die deutsche Erstveröffentlichung erfolgte 1969.
Der Verlag DER ROMANKIOSK veröffentlicht eine durchgesehene Neuausgabe dieses Krimi-Klassikers in seiner Reihe DIE MITTERNACHTSKRIMIS.
IN EINER KLEINEN FRIEDLICHEN STADT
Erstes Kapitel
Ich ließ meine Mutter in dem Glauben, das Kilmory sei eine billige hochanständige Fremdenpension. Sie würde einen dreifachen Salto aus dem Stand vollführt haben, wenn sie das Schleifglas, die dicken Teppiche, die sündige Cocktailbar und die Mahagonifahrstühle gesehen hätte. Jedes beliebige Hotel in Glasgow war in den Augen der alten Dame automatisch ein brodelnder Hexenkessel, bis zum Rande gefüllt mit Schnaps, Prostituierten, unaussprechlichen Seuchen und Rauschgifthändlern.
Aber sie saß geborgen zu Hause in Forfar. Ich war mir selbst überlassen, und das Geld, das ich ausgab, gehörte mir. Ich hatte mich entschlossen, die Ketten zu sprengen und wenigstens zwei Wochen lang das Leben eines reichen Kosmopoliten zu führen, solange ich noch jung genug war, um es in vollen Zügen genießen zu können. Ich hatte mir ein Zimmer mit Bad im sechsten Stockwerk reservieren lassen. Nichts war mir zu teuer und zu gut.
Ehrlich gestanden, war ich durch die elegante Umgebung ein bisschen eingeschüchtert; aber ich gab mir Mühe, Haltung zu bewahren und nicht rot zu werden; als die Empfangsdame sagte, mein Zimmer sei noch nicht ganz fertig, da zuckte ich die Schultern, um recht unbeschwert und unbekümmert zu wirken, und behauptete mit leichtem Gestotter, ich hätte ohnedies einige dringende Besuche zu erledigen. Ich ließ meine beiden Koffer in der Obhut eines uniformierten Pikkolos zurück und schlenderte in die Stadt hinaus, ohne nach rechts oder links zu schauen.
Was die Fallstricke der Großstadt betrifft, so hatte die alte Dame auch noch einen spezifischeren Verdacht. Seit Wochen hatte sie Jennifers Namen nicht mehr erwähnt, aber zuweilen konnte man sehen, wie sie die Lippen zusammenkniff und ein böses Gesicht machte, weil sie wusste, in einer Stadt wie Glasgow müsse Jennifer unweigerlich auf die schiefe Bahn geraten. Damit hatte Jennifer nun kein Recht mehr, mit dem charakterlich sauberen Sohn eines fleißigen, frommen Installateurs in Forfar befreundet zu sein und ihn mit in die Gosse zu zerren.
Ich weiß nicht, warum sie Jennifer nicht leiden konnte, und hatte sie auch nie danach gefragt, um keinen Zank heraufzubeschwören. Über meinen ersten Abend in Glasgow aber würde meine Mutter sich diebisch gefreut haben. Ich verbrachte ihn nämlich damit, während vier Stunden jede Stunde an Jennifers Tür zu läuten, ohne dass sich jemand gemeldet hätte. Ich bebte innerlich vor Angst, Jennifer könnte mit einem der reichen, lasterhaften Verführer ausgegangen sein, welche die Stadt bevölkern und junge Mädchen zugrunde richten. Freilich versuchte ich immerzu, mein Selbstvertrauen und meine Gelassenheit nicht zu verlieren; aber ich war, weiß Gott, nicht sehr glücklich. Mich beschlichen auch leise, erbärmliche Zweifel an der Zukunft meiner Erfindung – einer neuartigen Rohrflanschdichtung. Wenn das Ding nicht funktionierte und ich die Gelegenheit verpasste, reich zu werden, dann würde Jennifer sich bestimmt von mir lösen, einen Mann mit einem Jaguar heiraten und mich meinem traurigen Schicksal überlassen.
Ich hoffte sehr, dass mir von alledem nichts anzumerken war. Wahrscheinlich beachtete mich ohnedies kein Mensch, aber für den Fall, dass einer der wildfremden Passanten mir einen Blick gönnte, wollte ich energisch, vielbeschäftigt und bedeutend aussehen. Ich wollte mir einreden, dass mir alles große Freude mache. Dabei machte mir gar nichts Freude. Ich kam mir verloren und einsam vor. Dass ich Hunger hatte, gab mir den Rest. Dummerweise aber brachte ich nicht den Mut auf, in ein Restaurant zu gehen und etwas zu essen. Ich spazierte stundenlang durch die Straßen, kehrte in regelmäßigen Abständen zu Jennifers Adresse zurück, klingelte und entfernte mich dann langsamen Schrittes. Ich spielte sogar kindische Spielchen mit mir selber und bildete mir ein, Jennifer werde plötzlich auftauchen, sobald ich fünfzig Schritt, hundert Schritt, zweihundert Schritt getan hatte.
Es wurde ziemlich spät. Ich musste mich zusammenreißen und aufhören, schreckliche Erklärungen für ihr Fernbleiben zu ersinnen. Ich durfte mich doch schließlich nicht dazu erniedrigen, bis in die frühen Morgenstunden vor ihrer Wohnung umherzuwanken, wie ein armer Teufel, der kein Dach überm Kopf hat. Hier hieß es, sich wie ein Mann von Welt benehmen. Schließlich gab ich auf und kehrte ins Kilmory zurück.
Wäre ich ein Trinker gewesen, dann hätte ich mich vielleicht in die Bar gesetzt und einen Martini oder ein ähnliches Getränk bestellt; Alkohol aber hat mir nie geschmeckt, und ich dachte nicht daran, mir, nur um mich aufzuspielen, den Magen zu verderben. Wenn ich bloß Jennifer von meiner bevorstehenden Ankunft verständigt hätte! Ich hatte ihr eine freudige Überraschung bereiten wollen. Jetzt wurde mir tatsächlich angst und bange; und ich fragte mich, was mit Jennifer los sei und ob sie in Glasgow Verehrer gefunden habe. Ich ging an der Hotelbar vorbei zur Portiersloge, um meinen Schlüssel zu holen.
Ein magerer Mann mit schütterem Haar und englischem Akzent unterhielt oder kabbelte sich mit der jungen Dame, die sich nicht im Geringsten für seine Sorgen zu interessieren schien. Sie machte ihn immer wieder darauf aufmerksam, dass das Hotel voller Gäste sei und dass keine Möglichkeit bestehe, ihm ein anderes Zimmer zu geben.
»Es ist der Straßenlärm«, sagte er. »Er hält mich wach.«
»Bedaure sehr, Sir«, erwiderte sie. Sie war recht hübsch, aber sie gefiel mir nicht. Es ist nicht fair, hochnäsig zu sein, wenn man hübsch ist, weil man dem anderen gegenüber sowieso im Vorteil ist.
»Ja, Sir?«
Mit hochgezogenen Brauen wandte sie sich zu mir. Ich bemühte mich, nicht zu erröten, und sagte: »Mein Name ist Chivers.« Ich hüstelte und wiederholte mit tieferer Stimme: »Chivers.«
Sie schlug ein Buch auf, suchte meinen Namen, nahm einen Schlüssel vom Brett und betätigte ein Glöckchen auf der Theke. Ein schläfriger kleiner Mann in Hemdsärmeln kam durch die Halle herbei, und sie reichte ihm den Schlüssel. Ich merkte, dass der andere Gast mich mit ausdrucksloser Miene musterte, sah aber geflissentlich weg, weil ich keine Lust hatte, mich in eine Auseinandersetzung verwickeln zu lassen. Der schläfrige kleine Mann entfernte sich und kehrte mit meinen beiden Koffern zurück. Der Engländer und ich folgten ihm in den Fahrstuhl. Er wollte auch den Koffer des Engländers tragen, aber der Engländer winkte ungeduldig ab.
Auf der Fahrt nach oben wurde mir klar, dass der Engländer aller Wahrscheinlichkeit nach ein wenig beschwipst war. Er trällerte vergnügt und halblaut vor sich hin, während ich die Fahrstuhltür betrachtete und ihn geflissentlich ignorierte. Fast wäre ich zu der Überzeugung gelangt, dass das Trinken keine schlechte Angewohnheit sei. Es schien die Menschen froh zu stimmen und von Hemmungen zu befreien. Wir stiegen alle miteinander im sechsten Stockwerk aus. Der Engländer verabschiedete sich von mir mit einer schlaffen Handbewegung, als seien wir alte Freunde, und sagte »Gute Nacht.« Dann torkelte er auf eine der Türen zu und wartete draußen, bis der Hausknecht die Schlüssel sortiert und ihm die Tür aufgesperrt hatte. Der Hausknecht öffnete auch meine Tür und ging voraus ins Zimmer. Ich brauchte mehrere Minuten, um mir darüber klarzuwerden, dass er sich nicht wegrühren würde, bevor ich ihm ein Trinkgeld gegeben hatte. Leicht beschwipste Engländer mögen dem Hausknecht ungestraft die Tür vor der Nase zuknallen: Ich durfte mir so etwas nicht erlauben. Ich holte Geld aus der Tasche und wollte ihm eine halbe Krone geben, aber er betrachtete wortlos die Münze in meiner Hand, und ich fügte eine zweite hinzu.
Das war nun, gelobte ich mir, das letzte Mal, dass ich mich tyrannisieren ließ und mein Geld verschleuderte. Fünf Shilling dafür, dass einer zwei kleine Koffer durch einen Korridor trägt! Meine Mutter würde mir eine runtergehauen haben – mit Recht. Ich konzentrierte meinen ganzen Jammer auf den Hausknecht und blickte ihm finster nach, während er zur Tür hinausschlurfte, aber das war ihm natürlich egal.
Trotzdem war das Zimmer tipptopp. Ich zog mich aus und badete, weil das Badezimmer nun einmal vorhanden war.
Dann duschte ich noch obendrein und spazierte barfüßig auf dem Teppich umher, um für mein Geld etwas zu haben. Ein paar Minuten lang blieb ich am Fenster stehen und blickte auf den Fluss hinunter. Ich ging umher, öffnete und schloss die Schränke, schaltete das Radio ein und aus. Es stand sogar ein Telefon neben dem Bett. Ich hätte mich behaglich aufs Bett setzen und Jennifer anrufen können, wusste aber nicht, ob sie ein Telefon besitze. Ich öffnete den einen Koffer, wickelte das Modell der Flanschdichtung aus und betrachtete es gründlich. Ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand geneigt sein würde, es zu kaufen.
Es war herrlich, in einem piekfeinen Hotelzimmer zu sitzen, aber es machte mir nicht ganz so viel Spaß, wie ich erwartet hatte. Schließlich legte ich mich hin und schaltete das Licht aus. Ich muss müde gewesen sein, weil ich schon nach wenigen Minuten zu dösen begann, obwohl ich mir vorgenommen hatte, mich mit Gedanken an Jennifer zu quälen. Darm wachte ich mit einem Ruck auf, weil ich eine Tür hatte zufallen hören.
Eine Sekunde lang wusste ich nicht, wo ich war; dann sah ich zwei männliche Gestalten im Zimmer stehen. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich vor Schreck und Angst absolut starr war. Es war noch finster. Sie kamen von beiden Seiten auf mich zu, und bevor ich Zeit zum Nachdenken hatte, packten sie mich bei den Armen und zerrten mich aus dem Bett.
Ich wollte schreien. Sie schleiften mich über den Fußboden zum offenen Fenster. Ich wusste, es müsse ein Traum sein, aber sie taten mir weh. Ich begann mich zu wehren, strampelte mit den Beinen und versuchte mich loszureißen. Es gelang mir denn auch, einen Arm zu befreien, aber der Mann, den ich abgeschüttelt hatte, schlang beide Arme um mich, der andere nahm meine Füße und hob sie hoch, so marschierten sie weiter. Meine freie Hand fuchtelte umher und suchte nach einem Halt. Sie stieß gegen den Fensterrahmen, konnte ihn aber nicht greifen. Der Mann, der meinen Oberkörper festhielt, wich zurück, der, der meine Füße trug, bewegte sich weiter. Ich sah sein Gesicht im Mondlicht. Er hob mich hoch. Ich rutschte glatt über den Sims, noch immer bemüht, um Hilfe zu schreien.
Zweites Kapitel
Ich fiel nicht ins Wasser, ich endete auch nicht mit zerschmetterten Gliedern auf dem Uferkai. Die Hotelfassade wurde grade restauriert, und das Gerüst reichte bis zum fünften Stock. Ich stieß mit dem Hinterkopf gegen ein waagrechtes Eisenrohr, wurde zur Wand hingeschleudert und landete bäuchlings auf einer hölzernen Plattform. Jetzt noch zu schreien, kam nicht mehr in Frage. Ich blieb ganz einfach halb betäubt und mit sozusagen plattgedrückten Lungen liegen. Die Höhe des Sturzes betrug knappe zweieinhalb Meter, aber es war das Schlimmste, was mir je in meinem Leben widerfahren war, und verscheuchte sogar die Gedanken an Jennifer.
Mit dem Rest meines Bewusstseins aber hörte ich, dass oben die Gardinen an meinem Fenster zugezogen wurden. Durch die Gardinen waren allerlei Geräusche zu hören, Schritte, das hastige Öffnen und Schließen von Schubladen. Es dauerte nur ein paar Sekunden. Dann fiel eine Tür ganz sachte ins Schloss. Ich rührte mich nicht, ich verhielt mich still. Ich wollte warten, bis ich wieder atmen konnte, aber das war eine langsame und schmerzhafte Prozedur, und ich wollte auch kein Aufsehen erregen. Jetzt, da mir erspart geblieben war, zwanzig Meter tief zu stürzen, war ich verängstigter denn je. Alberne Gedanken flogen mir durch den Kopf, zum Beispiel: wie gut, dass ich beide Teile meines Schlafanzugs anhatte! Für gewöhnlich ziehe ich nur die Jacke an. Zwanzig Meter über dem Erdboden ohne Hose auf einem Gerüst zu hegen, wäre doppelt so schlimm gewesen.
Aber es war schlimm genug. Ich hatte die Armbanduhr umgeschnallt, sie ging, und es war halb drei Uhr morgens. Ich musste also ziemlich lange geschlafen haben, bevor die Mörder mir auf die Pelle rückten. Das Gerüst hörte dicht unter meinem Fenster auf. Ich konnte leider nicht in mein Zimmer zurückklettern.
Vielleicht klingt es dumm und provinziell – aber meine Verlegenheit war fast ebenso groß wie die Angst. Die Höhe des Gerüstes bekümmerte mich nicht allzu sehr, weil man als Installateur und Klempner gewöhnt ist, auf Dächern zu arbeiten, und der Mondschein würde mir erlauben, hinunterzuklettern, wenn auch die einzelnen Absätze nicht durch Leitern miteinander verbunden waren. Aber man kann doch wohl nicht mitten in der Nacht, barfüßig und nur mit einem Pyjama bekleidet, aus einer Höhe von zwei bis drei Meter auf eine Straße in Glasgow hinunterhopsen, um die Ecke schlendern und ein Hotel betreten. Was würde ich zu der hochnäsigen jungen Dame in der Rezeption sagen? Verzeihung, jemand hat mich aus dem Fenster meines Zimmers geworfen, und der Schlüssel liegt auf dem Nachttisch.
Ich sagte es mir in Gedanken vor, um zu prüfen, wie es klingen würde. Damals habe ich sehr oft das, was ich zu Leuten sagen wollte, geprobt und eingeübt. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, wie es mir gelingen sollte, diese absurde Mitteilung in heiterem und überlegenem Ton zu servieren.
Wenn ich jedoch versuchte, durch ein anderes Fenster ins Hotel zurückzukehren, würde es ein Schlafzimmerfenster sein, und das könnte noch ärgere Folgen nach sich ziehen. Oder es glückte, und ich begegnete im Korridor wieder den beiden freundlichen Gentlemen.
Dann aber sagte ich mir, dass diese Variante kaum möglich wäre. Wenn sie annahmen, ich sei in die Tiefe gestürzt, würden sie sich bestimmt nicht länger als unbedingt nötig am Tatort aufgehalten haben. Außerdem begann ich zu frieren, sowohl vor Angst als auch vor Kälte. Die Kälte war es, die mir Beine machte. Ich überlegte mir, wenn ich zu zittern begänne, würde ich vielleicht gar nicht mehr aufhören können und über die Kante purzeln. Ich fand eine kurze Leiter, kletterte auf den nächsten Absatz hinunter und entdeckte dort auch ein geöffnetes Fenster. Ich legte das Ohr an den etwa zwanzig Zentimeter breiten Spalt und lauschte. Ich hörte ein Schnarchen. Ich schob das Fenster weitere fünfzehn Zentimeter hoch und spitzte erneut die Ohren. Das Schnarchen dauerte an. Ich kletterte durchs Fenster und kniff die Augen zu, um nachher im Dunkeln besser sehen zu können.
Die Möbel waren genauso arrangiert wie in meinem Zimmer, und ich sah gar nicht erst nach, ob ein Mann oder eine Frau im Bett lag. Schnell huschte ich zur Innentür, öffnete sie, öffnete sodann die Tür zum Korridor, trat hinaus, machte die Tür ganz leise hinter mir zu und rannte die Treppe hinauf.
Natürlich war meine Tür versperrt. Ich war nicht viel besser daran als zuvor. Ich muss etwa eine Viertelstunde lang dort gestanden und mir überlegt haben, was zu tun sei, muss versucht haben, den nötigen Mut zu fassen, um hinunterzugehen und zu behaupten, ich hätte mich ausgesperrt. Wieder sehr albern: Aber jetzt, da ich mich aus der gefährlichen Lage auf dem Gerüst befreit hatte, war es mir peinlicher denn je. Mit einem Male kam ein junges Mädchen den Korridor entlang, und ich konnte mich nirgendwo verstecken. Sie hatte einen Overall an. Ich ließ meine Hand auf der Türklinke ruhen, legte mir die Worte zurecht, drehte mich dann um, versuchte zu lachen und sagte:
»Ich habe mich ausgesperrt. Ich war im Waschraum, um mir das Gesicht zu waschen.«
»Sie haben ein eigenes Bad.«
Sie war nicht hübsch oder interessant, ganz einfach nur ein junges Mädchen.
»Ich weiß«, sagte ich. »Ich muss noch halb geschlafen haben.«
Sie zog einen Schlüssel aus der Tasche und wartete darauf, dass ich ihr Platz machte. Kopfschüttelnd musterte sie mich von oben bis unten.
»Ihre Frau sollte Ihnen einen Morgenrock schenken.«
Sie war nicht im mindesten verlegen. Ich raffte die Hose zusammen. Mir war erbärmlich zumute.
»Ich bin nicht verheiratet«, sagte ich.
Sie drehte den Schlüssel im Schloss um, öffnete die Tür und sah mich an. »Das sagen alle.«
»Es ist aber wahr.« Ich betrat den kleinen Vorraum und machte erst einmal Licht.
»Einen Augenblick«, sagte ich, griff um die Ecke und schaltete die Deckenbeleuchtung ein, um mich, bevor das junge Mädchen sich entfernte, zu vergewissern, dass niemand mehr da war.
Sie schien es nicht eilig zu haben. Sie stand da, schwenkte den Schlüssel und betrachtete mich mit einem halben Lächeln. »Sie wollen nicht zufällig auch noch zu Bett gebracht werden, oder?«
»Nein, nein, ich wollte mich nur davon überzeugen, dass es das richtige Zimmer ist.«
»Völlig zufrieden?«
»Ja, wirklich.«
Sie blieb stehen, während ich die Tür zumachte. Dann glaubte ich sie Weggehen zu hören. Nun zog ich erst einmal den Pyjama aus und begann mich anzukleiden. Der Schlafanzug genierte mich.
Während ich die Schnürsenkel band, dachte ich über das junge Mädchen nach. Es würde mich nicht wundem, wenn ihr einige seltsame Gedanken gekommen waren. Wenn ich jetzt daran zurückdenke, glaube ich, dass sie sich einbildete, ich hätte mich absichtlich ausgesperrt. Schon damals kam mir der Gedanke, sie würde vielleicht sogar ins Zimmer mitgekommen sein, wenn ich sie dazu aufgefordert hätte. Am Ende hatte meine Mutter recht mit ihrem Urteil über die Großstadtmenschen. Man weiß ja, wie das ist; man erzählt Witze über Handlungsreisende und Stubenmädchen; man weiß, manchmal muss es vorkommen, aber es ist schwer zu glauben, dass es wirklich vorkommt. Trotzdem muss es vorkommen. Jetzt war ich nicht mehr nur verängstigt und verlegen, sondern fühlte mich außerdem ein kleines bisschen wie ein Mann von Welt. Wenn ich meine Trümpfe richtig ausgenützt hätte, wäre mir um ein Haar etwas geglückt, was ich meinen Kumpanen zu Hause in Forfar hätte erzählen können.
Aber ich dachte nicht allzu lange über das junge Mädchen nach. Ich musste einen Entschluss fassen. Ich hatte keine Lust, auf dem Zimmer zu bleiben, und hatte auch nicht – albern hin, albern her – den Mut, hinunterzufahren und der hochnäsigen Empfangsdame zu berichten, jemand habe mich aus dem Fenster geworfen, oder sie zu bitten, sie möge den Geschäftsführer aus dem Bett trommeln. Ich wusste, dass ich mich wie ein echter Bauerntölpel benahm, aber mir fehlte ganz einfach der Mumm.
Was also machte ich? Ich ging die Treppe hinunter, um nicht durch das Geräusch des Fahrstuhls die Gäste im Schlaf zu stören, und spazierte auf die Straße hinaus. Den Zimmerschlüssel behielt ich in der Tasche, um überhaupt nicht mit der Dame an der Rezeption sprechen zu müssen. Ich war ein wenig ängstlich, weil ich befürchtete, die beiden Männer könnten draußen auf mich lauern, aber es war kein Mensch zu sehen. Schnell entfernte ich mich vom Eingang des Hotels und ging die Argyle Street entlang. An einer Bushaltestelle stand ein einsamer Mann. Ich erkundigte mich bei ihm nach der nächsten Polizeiwache, er sagte mir Bescheid, und ich ging hin.
Inzwischen hatte ich mir, so gut ich konnte, meinen Spruch eingeprägt. Ich betrat das Wachlokal und wartete, bis ein barhäuptiger Beamter an die Barriere kam.
»Ich möchte einen Überfall melden«, sagte ich. Das schien ihn nicht sonderlich aufzuregen.
»Sind Sie überfallen worden?«, fragte er. Der Mann war in Ordnung, durchaus nicht hochnäsig, nur eben gar nicht aufgeregt. Während er seine Frage stellte, musterte er mein Gesicht, als halte er nach Schürf- oder Risswunden Ausschau, die jedoch nicht vorhanden waren.
»Ja«, erwiderte ich. »Zwei Männer sind in mein Hotelzimmer eingedrungen und haben mich aus dem Fenster geworfen.«
»Wann ist das passiert, Sir?«
»Um halb drei.«
»Ihr Name, Sir?«
»Andrew Chivers. Ständige Adresse: Caldow Street siebzehn, Forfar.«
»Alter, Sir?«
Ich wusste zwar nicht, was das mit der Sache zu tun habe, sagte ihm jedoch, ich sei vierundzwanzig Jahre alt.
»Zwei Männer haben Sie aus einem Hotelfenster geworfen. Sind Ihnen die beiden bekannt?«
»Nein. Sie kamen ganz einfach zur Tür herein. Es war finster.«
»In welchem Hotel hat sich das abgespielt, Sir?«
»Im Kilmory. Zimmer sechs-dreizehn.«
Wieder sah er mich an und sagte: »Soll das ein Witz sein?«
»Nein. An der Hauswand steht ein Gerüst. Auf diesem Gerüst bin ich gelandet.«
»Es ist also kein Witz?«
»Nein!«
»Haben Sie es dem Geschäftsführer gemeldet?«
»Nein.« Ich wurde rot. »Ich wollte ihn nicht stören.«
»Ach so!« Er schüttelte den Kopf, fragte dann einen Kollegen: »Ian, ist ein Kriminaler da?«
»Mr. Mair.«
Wieder musterte mich der Beamte, der mich empfangen hatte. Er wusste offensichtlich nicht, was er von mir halten sollte. Dann öffnete er eine Klappe in der Barriere, kam nach vorn und bedeutete mir, ihm zu folgen. Er führte mich zu einem Zimmer, klopfte an, öffnete die Tür und sagte: »Haben Sie Zeit für diesen Gentleman, Mr. Mair?«
Aus dem Zimmer war eine Stimme zu hören. Es klang mehr nach einem Ächzen als nach einer Antwort. Der Polizeibeamte führte mich hinein, machte die Tür hinter mir zu, und ich setzte mich auf einen Stuhl. Mr. Mair telefonierte gerade, hörte zu, brummte vor sich hin und schrieb etwas auf einen Notizblock. Ein magerer, aber muskulöser Mann. Er sah eher nach einem Bankbeamten aus als nach einem Polizeibeamten. Er trug Zivil, hatte noch seinen Regenmantel an. Nachdem er sein Telefongespräch beendet hatte, blickte er zu mir auf, als sei er bemüht, seine Gedanken zu sammeln, die anderswo weilten.
»Was haben wir denn auf dem Herzen, junger Mann?«, fragte er.