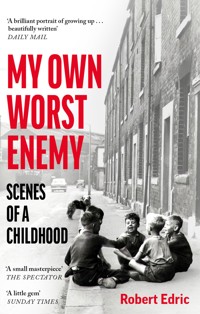Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Kurort in der Schweiz, Spätherbst 1919. Elizabeth Mortlake und ihre Schwägerin sind aus Oxford angereist, um sich in der kleinen Stadt am See von ihrem Verlust zu erholen. Michael, Marys Ehemann und Elizabeths Bruder, ist im Krieg gefallen. Viel Gesellschaft hat der Ort am Ende der Saison nicht zu bieten, nur ein deutscher Waffenhändler und seine langweilige Tochter zeigen ein unwillkommenes Interesse an den beiden jungen Frauen. Während Mary sich mehr und mehr in ihrer Trauer vergräbt, gerät Elizabeth in den Bann des geheimnisvollen Captain Jameson, der eines Tages im Speisesaal des Hotels auftaucht und dort kein gern gesehener Gast ist. Jeder im Ort scheint den abweisenden Engländer zu kennen, jeder etwas über ihn zu wissen. Angeblich hat er Geld, angeblich handelt er mit seltenen Büchern und Manuskripten. Ein gebildeter Mann von zweifelhaftem Ruf, dessen Geheimnis Elizabeth zu ergründen sucht. Das führt sie zu einem nahegelegenen Kloster und in ein Militärkrankenhaus. Sie lernt eine alte Nonne kennen, die alles über die Abgründe des Lebens weiß, eine eifersüchtige Novizin, einen Offizier und Gentleman, dem ein Todesurteil droht, einen Arzt, der den schwer verwundeten Soldaten neue Gesichter machen kann. Und sie lernt, wie fragwürdig ihre eigenen moralischen Urteile sind. Die Stadt am See entpuppt sich für die Gäste als bizarres Zwischenreich: das alte Leben ist zu Ende, was das neue bereithält, ist ungewiss. In dieser gefühlstauben Welt, zwischen all den Verkrüppelten und Versehrten, findet Elizabeth eine ungekannte Freiheit und vielleicht den Mut für einen Neuanfang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IN
ROBERT
FINSTEREN
EDRIC
HIMMELN
Gefallen sind wir in den Träumen, die die Ewig-
Lebenden hauchen auf den Spiegel unsrer Welt,
Teil 1
1 | Allmorgendlich beobachtete sie die Prozession von Schwestern und Invaliden auf ihrer kurzen, langsamen Reise ans Seeufer, wo sie sich versammelten. Sie kamen aus den Krankenhäusern und Genesungsheimen der Stadt, lauter Nebenflüsse, die sich zu einem einzigen Strom vereinigten, die Schwestern fast ausnahmslos junge Frauen, die Invaliden fast ausnahmslos junge Männer. Und ungeachtet des scheinbaren Durcheinanders dieses Vereinigens und Versammelns war ihr, die von ihrem Hotelfenster aus zuschaute, doch klar, dass diese verschiedenen Gruppen sich dort nach einem bestimmten Plan zusammenfanden; dass dem Ganzen trotz des chaotischen Eindrucks und der Vielzahl der Beteiligten irgendeine festgelegte Ordnung und Struktur zugrunde lag.
Die in den Rollstühlen wurden stets als Erste über die Straße am See gebracht; die Bordsteine überwand man mit Hilfe hölzerner Rampen.
Die Droschkenkutscher und die wenigen Kraftfahrer, die von der Prozession aufgehalten wurden, beschwerten sich nicht über die Verzögerung. Die Spaziergänger, die bei ihrer morgendlichen Runde gestört worden waren, die Nachsaisontouristen, sie alle hielten höflich Abstand, verweilten zwischen den Blumenbeeten und unter den Platanen und sahen herüber. Einige, diejenigen, die unvorbereitet auf die Prozession gestoßen und ihr unbeabsichtigt zu nahe gekommen waren, standen da und schauten zu, als wohnten sie einem Trauerzug bei. So war ihr das anfangs auch vorgekommen. Sie hatte manche von diesen Zuschauern den Hut abnehmen und an die Brust drücken sehen und stellte sich die anderen verlorenen Brüder und Söhne und Väter vor, an die auch diese Leute unverhofft erinnert wurden. Wie ein kalter Wind blies dieser schlurfende Zug von Männern und Schwestern durch die dahinschwindenden Tage der Wärme und des Lichts.
An anderen Tagen hatte sie beobachtet, dass einige Frauen in der Zuschauermenge sich von der Prozession abwandten. Junge Frauen und alte Frauen, die den Kopf wegdrehten und mit behandschuhten Händen die Augen bedeckten, als sei schon der flüchtigste Blick auf diese jungen Männer zu viel für sie. Sie fragte sich, was ihnen wohl am meisten an diesem Aufmarsch der Invaliden zusetzte. Manche ließen sogar ihren Schleier herab und falteten die Hände zu abwehrendem Gebet.
Normalerweise bewegte sich die Prozession schweigend Richtung Seeufer, doch gelegentlich war ein Schmerzensschrei oder ein gerufenes Wort zu hören, und wenn das geschah, durchfuhr die Zuschauer ein zusätzlicher Kälteschauer; oft war es mehr das Echo eines Schreis als der Schrei selbst, doch die Wirkung war gleich.
Sie beobachtete das alles jetzt von ihrem kleinen Balkon aus. Rechts und links von ihr standen die anderen Gäste, die herausgetreten waren, um an dem Schauspiel teilzuhaben. Sie hörte ihre Kommentare, und da sie ein wenig Französisch und Deutsch sprach, versuchte sie zu verstehen, was gesagt wurde. Am aufmerksamsten aber horchte sie auf mögliche Laute aus dem angrenzenden Zimmer, in dem Mary, ihre Schwägerin, schlief. Sie beugte sich vor und konnte so erkennen, dass die Vorhänge des Zimmers noch immer zugezogen waren. Die junge Witwe, hoffte sie, hatte gar nicht mitbekommen, was unten auf der Straße vor sich ging, aber im Grunde glaubte sie nicht wirklich daran.
In der Nacht war sie einige Male aufgewacht und hatte gehört, wie jemand herumging, hatte gehört, wie verschiedene Dinge – Bücher, Fotografien, Brillengläser – hochgenommen und wieder hingelegt wurden. Und außerdem hatte sie unkontrolliertes und krampfhaftes Schluchzen gehört, gedämpft, wie ihr schien, doch ihr war nicht ganz klar, ob das einfach an der Wand lag, durch die die Laute zu ihr drangen, oder ob ihre Schwägerin in dem Versuch, ihren ununterdrückbaren Kummer zu unterdrücken, das Gesicht in ein Kissen presste.
Als Elizabeth aufgewacht war und das gehört hatte, wollte sie am liebsten sofort die Tür entriegeln, die die beiden Zimmer trennte, und hinübergehen, um Trost anzubieten, aber sie wusste, dass diese Frau nicht zu trösten war und dass sie es schrecklich gefunden hätte, auf diese Weise unfreiwillig ihren Kummer zur Schau zu stellen oder zu teilen.
Bei mehreren Gelegenheiten hatten die beiden zuhause in England gemeinsam über ihren Verlust geweint, aber selbst da, selbst während der Tage und Wochen unmittelbar nach dem Tod ihres Bruders, hatte sie nie das Gefühl eines geteilten Verlusts gehabt, sondern nur das einer gemeinsamen Leidensquelle, in der die Wurzeln zweier separater Pflanzen plötzlich ums Überleben kämpften.
Hier war sie nun als Begleiterin der jungen Witwe. Sie selbst war dreiundzwanzig, und obwohl ihre Schwägerin ein Jahr jünger war, konnte sie sich diese Frau doch immer nur als mindestens zehn Jahre älter vorstellen, beinahe einer anderen Generation angehörig, durch den Verlust in weite Ferne gerückt.
Sie rauchte selten in der Öffentlichkeit, doch an diesem Morgen, als die Prozession der Invaliden unter ihr halb vorübergezogen war, zündete sie sich eine Zigarette an und setzte sich in den Gartenstuhl. Sie steckte die Hand durch das Zierwerk der Balkonbrüstung und schnippte die Asche in die Luft. Im Zimmer zu ihrer Rechten hörte sie die Stimmen der Gottliebs. Das deutsche Paar und seine Tochter hatten bereits ein unwillkommenes Interesse an ihr und Mary gefasst. Sie vermutete, es rührte daher, dass sie und ihre Schwägerin im selben Alter wie die Tochter Gerda waren, und weil sie selbst ohne Begleitung reisten. Das Mädchen benahm sich wie eine Fünfzehnjährige. Sie hatte drei Brüder, zwei davon Zwillinge, und alle drei waren während der letzten Monate im Krieg gewesen; nur zwei, die Zwillinge, hatten ihn überlebt. Das hatte Elizabeth schon in den ersten Minuten ihrer Bekanntschaft mit der Familie erfahren.
Jetzt hörte sie Gerda, hörte die Aufregung in ihrer Stimme, als sie ihren Eltern zurief, sie sollten rauskommen und sich ansehen, was da unten vor sich ging.
»Elizabet, Elizabet.« Sie sprach den Namen mit hartem »t« aus. Ihre Eltern konnten sich auf Englisch nur sehr einfach ausdrücken, wobei der genaue Sinn der Worte in ihrem klebrigen Akzent ertrank.
Elizabeth bedachte das Mädchen nur mit einem kurzen Nicken, um sie ja nicht noch weiter zu ermutigen.
Herr Gottlieb erschien. Er trug wieder den selben schweren Anzug, dazu den weichen Hut und über dem Sakko den breiten Ledergürtel, der seinen Kugelbauch noch betonte. Er begrüßte Elizabeth mit einer Verbeugung und ermahnte seine Tochter, leiser zu sprechen. Seine Frau rief ihm von drinnen etwas zu, und er ging wieder ins Zimmer zurück.
»Sie rauchen?«, fragte Gerda.
Zur Antwort stieß Elizabeth ein Rauchwölkchen aus.
Unten ertönte eine Hupe, und beide Frauen wandten sich wieder der Straße zu. Ein Kraftfahrer, ungeduldiger als die anderen, war ein Stück vorgefahren, weil er sich zwischen den Männern in den Rollstühlen hindurchdrängen wollte, und nun hatte er den Motor abgewürgt, versperrte ihnen den Weg und zwang die Rollstühle zu umständlichen Ausweichmanövern. Erbost über den Eindringling, schlugen ein paar der Invaliden mit Fäusten oder Stöcken auf die Seiten des Wagens ein. Zur Antwort ließ der Autofahrer seine Hupe ertönen, immer wieder mit dem selben durchdringenden Ton, als wären die Männer in den Rollstühlen und die Frauen, die sie schoben, eine Herde Schafe, die sich um ihn zusammengezogen hatte und nun erschreckt werden musste, damit sie sich fortbewegte. Einige der Krankenschwestern redeten auf den Mann ein, und eine versuchte sogar, seine Hand von der Hupe wegzuziehen, doch er war zu stark für sie und hupte immer wieder und immer wieder, bis schließlich eine männliche Ordonnanz einschritt.
Erst da dämmerte es Elizabeth, warum die Schwestern so sehr darauf gedrungen hatten, den Lärm abzustellen, denn sie beobachtete, wie einige von den Frauen zu einer Gruppe von Männern zurückgingen, die sich unter den Bäumen versammelt hatten. Wegen des Laubs konnte sie nicht ganz genau erkennen, was da vor sich ging, aber doch so viel, dass jeder der Männer in dieser kleinen Gruppe mindestens von zweien der Frauen festgehalten und getröstet wurde, manchmal sogar von dreien, die ihn wie eine Mauer dicht umringten. Weiter dahinter standen andere Männer, die Hände auf die Ohren gepresst, die Augen fest geschlossen.
Schließlich wurde der steckengebliebene Wagen aus dem Weg geschoben, und die Rollstühle konnten weiterfahren. Erst dann wurden die Männer unter den Bäumen herausgeführt und hinüber an den See geleitet.
Es folgten die übrigen gehfähigen Verwundeten. Manche von ihnen bewegten sich auf eine Weise, als hätten sie das Gehen ganz verlernt und lernten es jetzt neu, wobei sie die einzelnen Bewegungsabläufe – die Koordinierung von Knochen, Muskeln, Fleisch, Wille und Energie – noch nicht recht beherrschten.
Danach kamen die Erblindeten, gehalten und geführt, unter gutem Zureden, im Flüsterton aufgeklärt über das, was sie nicht sehen konnten. Ihr Bruder, der Flieger, Marys Ehemann, war blind gewesen und hatte noch sechs Monate ohne Augenlicht gelebt, bevor er schließlich der Infektion erlag, die von seinen Wunden und Verbrennungen herrührte. Deshalb wohl fühlte sie sich auf seltsame Weise zu diesen Männern hingezogen, und sie beobachtete sie genau, war auch bereits in der Lage, zwischen denen zu unterscheiden, die sich langsam an ihre Blindheit gewöhnt hatten, und denen, die noch nicht so weit waren. Sie erkannte auch jene, die sich niemals an die schwarzen Welten gewöhnen würden, in denen sie nun lebten, und jene, die sich damit zufriedengaben, überallhin geführt zu wer den – wenn nicht von diesen Frauen, dann von anderen –, und jene, denen ihre neue und kindische Abhängigkeit zuwider war; jene, die für immer mit ihren Stöcken die Luft vor sich durchstechen und durchhauen würden, als seien die Stöcke Fühler und sie selbst Insekten und als könne die Beharrlichkeit und Gewalt ihres Tuns auf wundersame Weise die Finsternis dieser neuen schwarzen Welten zerschlagen und sie mit Licht fluten.
Sie sah zu, bis der erste von diesen Männern das Geländer an der Seepromenade erreichte, dann verließ sie den Balkon und ging leise hinüber zu ihrer Schwägerin.
Sie war überrascht, Mary schlafend vorzufinden, diagonal auf dem Bett ausgestreckt, die Laken in einem Haufen auf dem Fußboden. Etliche Bücher und Fotografien lagen auf der Matratze neben ihr, und ihr Nachthemd war heruntergerutscht, sodass sie mit nacktem Oberkörper dalag. Elizabeth tastete unter dem Kissen nach der Pillenschachtel, die Mary dort immer versteckte. Sie zählte die Pillen, die noch darin waren, und legte sie wieder zurück. Marys Haut sah bleich aus, sogar hier im Halbdunkel, und unter ihrer Haut zeichnete sich jede Rippe deutlich ab. Ihre Brüste waren klein und flach. Elizabeth hatte sie früher schon nackt gesehen, aber da war es anders um sie bestellt gewesen, und es war ein Schock für sie, zu erkennen, wie wenig Substanz und Vitalität noch übrig war.
2 | Vier Tage danach traf sie Jameson zum ersten Mal. Sie saß im Speisesaal und schaute den Kellnern und Kellnerinnen dabei zu, wie sie das Frühstück wegräumten. Immer zwei deckten einen Tisch ab und trugen die Überbleibsel im zum Bündel gerafften Tischtuch fort, zwei andere wischten den Tisch ab und legten eine neue Decke auf, und wieder zwei andere arrangierten darauf sogleich das Geschirr und das Besteck für die spätmorgendlichen Gäste. Sie arbeiteten wortlos, beobachtet vom Mâitre, der sie durch Fingerschnipsen und Zeigen dirigierte. Gelegentlich hielt er eins der Mädchen an und inspizierte, was sie gerade herbeibrachte. Auch er arbeitete größtenteils wortlos. Wenn er etwas entdeckte, was ihm nicht gefiel – einen unzureichend polierten Löffel vielleicht oder eine nicht ganz perfekt gefaltete Serviette –, nahm er den jeweiligen Gegenstand zwischen Daumen und Zeigefinger hoch, hielt ihn auf Armeslänge von sich weg, starrte ihn angewidert ein Weilchen an und ließ ihn dann zu Boden fallen. Die Kellnerin musste dann ihr Tablett absetzen und wieder aufsammeln, was immer den Mann so beleidigt hatte. Der Mâitre trug ein Paar gestärkter weißer Handschuhe, die ihm als Maßstab für Perfektion schlechthin galten. Kaum jemand von den Gästen sprach ihn jemals direkt an, und im Gegenzug kommunizierte auch er selten mit ihnen. Er war der Steuermann, und sie waren seine Passagiere – seine Gegenwart musste einfach nur zur allgemeinen Beruhigung spürbar sein.
Wie vorherzusehen, saßen die Gottliebs an einem Tisch ganz in der Nähe. Insbesondere Herr Gottlieb beobachtete den Mann und die Kellnerinnen, von denen die meisten jünger waren als seine Tochter, und Elizabeth schnappte die Kommentare auf, die er an seine Frau richtete: wie wichtig es doch sei, dass jemand die Mädchen korrigierte und dafür sorgte, dass alles wie geschmiert lief. Weder Frau Gottlieb noch Gerda reagierte mit mehr als einem verhaltenen, gehorsamen Nicken auf seine Bemerkungen.
Zuvor hatte Mary Elizabeth Gesellschaft geleistet. Sie hatte Frühstück für sich bestellt, doch das Essen war nicht angerührt worden. Alles, was Mary zu sich genommen hatte, war ein kleines Stück trockenen Toastbrots, und sie hatte es fertiggebracht, auch davon noch das meiste in Krümeln wieder von ihren Lippen zu wischen. Ihr war während der Nacht erneut schlecht gewesen, und der kaum überdeckte Geruch danach war Elizabeth beim Eintritt in ihr Zimmer entgegengeschlagen. Sie hatte sich jeder Bemerkung enthalten. Von dem Anblick und dem Duft des gekochten Essens, das ihnen serviert worden war, war Mary übel geworden, und sie hatte den Tisch bei erster Gelegenheit verlassen. Sie erzählte Elizabeth, sie wolle über die Straße zum See gehen, aber Elizabeth wusste, dass das unwahrscheinlich war und sie stattdessen in ihr Zimmer zurückkehren würde.
Andere Gäste standen auf und gingen, bis nicht einmal mehr ein Dutzend übrig blieben. Die Spätankömmlinge wurden zu Tischen gleich bei Elizabeth und den Gottliebs geführt.
Kaum war das letzte Essen aufgetragen, stellte der Mâitre eine Karte auf einen Ständer, die verkündete, dass ab jetzt kein Frühstück mehr serviert werde, und gerade, als er das tat, als er die Karte ausrichtete und dann einen Schritt zurücktrat, um sich zu vergewissern, dass sie ordentlich platziert war, öffnete sich die Tür hinter ihm, und ein Mann trat ein, der eine Zigarre rauchte und eine Zeitung las, die er zu Form und Größe eines Kricketschlägers gefaltet hatte. Er stieß mit dem Mâitre zusammen und warf beinahe den Ständer um. Er sah von seiner Zeitung auf, widmete sich einen kurzen Augenblick der Bekanntmachung, sagte »Kaffee bitte« und schritt dann quer durch den Speisesaal zu einem etwas abseits gelegenen Tisch.
Der Mâitre folgte ihm und wedelte mit beiden behandschuhten Händen durch den Rauch, der im Kielwasser des Neuankömmlings hing, als schlüge er sich durchs Unterholz.
»Da können Sie nicht sitzen«, sagte er.
»Kaffee bitte. Der Tisch ist frei. Und dort werde ich sitzen.« Der Mann sprach, ohne aufzuschauen, ganz in seine Lektüre versunken. Seine Zigarre nahm er nur hin und wieder aus dem Mund. Er war zweifellos Engländer, sprach aber mit einem Akzent, den Elizabeth nicht ausmachen konnte.
»Würden Sie bitte die Freundlichkeit haben, sich zu den anderen Gästen zu setzen«, sagte der Mâitre, der seinen Zorn nun kaum noch unterdrücken konnte.
»Ihr Landsmann«, sagte Herr Gottlieb deutlich vernehmbar zu Elizabeth. »Wohl kaum der beste Botschafter Ihres Landes. Wundert mich bloß, dass er nicht noch seine Stiefel auszieht, um es sich bequemer zu machen.« Er sprach Deutsch und lachte über seine Bemerkungen. Seine Tochter fing an, zu übersetzen, was er gesagt hatte, doch er unterbrach sie.
»Und würden Sie bitte die Freundlichkeit haben, meinem Wunsch nachzukommen und mir ein Kännchen Kaffee zu bringen«, sagte der Engländer zum Mâitre. Er sprach mit leiser, ruhiger Stimme; er weidete sich nicht an den Unannehmlichkeiten, die er dem Mann bereitete.
»Sie sind kein Gast hier.«
»Das muss ich auch nicht sein.«
Der Mâitre machte kehrt und ging davon.
»Er heißt Jameson«, sagte Gerda zu Elizabeth. »Er kommt oft hierher. Ist immer dasselbe mit ihm.«
»Und ist der Mâitre auch immer so wenig zuvorkommend?«, fragte Elizabeth.
Die Antwort bekam sie von Jameson höchstpersönlich: »Der passendere Ausdruck lautet ›unverschämt‹. Oder ›grob‹ womöglich. Aber bitte lassen Sie sich von mir nicht stören.« Er schaute sich im Raum nach den wenigen anderen Gästen um, von denen die meisten ihn jetzt beobachteten. »Bitte um Entschuldigung«, sagte er direkt zu Elizabeth. Er ließ seinen Blick auf ihr ruhen, schien sie zu taxieren.
Um sich herum hörte Elizabeth flüsternde Stimmen, die seine Worte übersetzten. Nur noch wenige Kellnerinnen gingen zwischen dem Speisenden hin und her. Das Mädchen, das Elizabeths Tisch abdeckte, tat das, ohne Jamesons Platz aus den Augen zu lassen.
»Kennen Sie ihn?«, fragte Elizabeth sie auf Französisch.
»Den kennt jeder«, sagte das Mädchen. In ihrer Stimme schwang etwas Beschützendes, beinahe Herzliches mit. Sie schrappte Marys unangerührtes Essen von einem Teller auf einen anderen. »Ihre Begleiterin ist krank?«, sagte sie. Es war eher eine Feststellung als eine Frage.
»Es ging ihr nicht gut«, sagte Elizabeth, aber das Mädchen hörte gar nicht mehr hin.
Drüben auf der anderen Seite des Raums faltete Jameson seine Zeitung neu und drückte seine Zigarre aus. Er beobachtete die Tür. Einen Augenblick später öffnete sie sich, und ein Kellner, der ein Tablett mit Kaffee trug, trat ein. Vorausschauend schob Jameson das Besteck zur Seite, das schon vor ihm lag.
Der Junge setzte das Tablett ab und fing an, die Sachen herunterzunehmen.
»Lassen Sie’s gut sein«, sagte Jameson. Er fingerte in seiner Brusttasche und reichte dem Jungen einen Schein.
»Wir sind angewiesen, den Kaffee und die Milch und –«
»Und ich sage Ihnen, lassen Sie’s gut sein«, sagte Jameson. »Ich möchte bezweifeln, dass die Erde aus ihrer Bahn gerät oder dass dieser gesegnete prunkvolle Palast zerbröselt und einstürzt, nur weil ein Kaffeegedeck nicht ordentlich aufgetragen wird.«
»Ich verstehe nicht«, sagte der Junge.
»Weiß ich.« Jameson fuhr sich mit einer Hand durchs Gesicht. Er schien das kleine Drama, das er da angerichtet hatte, plötzlich leid zu sein. »Sagen Sie Ihrem Feld-, Wald- und Tischwebel da drinnen –«, er deutete Richtung Küche, »– dass ich darauf bestanden habe, es so zu lassen. Er wird Sie schon nicht bestrafen. Er erwartet das von mir. Ich werde einfach nur seinen Erwartungen gerecht.«
»Aber –«
»Bitte, gehen Sie einfach.«
Der Junge wich zurück, doch seine Hände waren immer noch mit den Bewegungen des Gedeck-Auftragens beschäftigt, so als sei der Impuls einfach zu stark und als würde dies sein Versagen irgendwie wiedergutmachen.
Jameson goss sich Kaffee ein. Er trank einen Schluck und setzte die Tasse ab.
»Kein Gift drin«, sagte er an seine Zuschauer gerichtet, und wer ihn verstanden hatte, wandte sich nun ab.
Er saß in einer Nische an einem der Fenster. Hier an der Vorderfront des Hotels reichten sie vom Boden bis zur hohen Decke. Das Morgenlicht fiel als gelber Block zu ihm herein. Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, schloss die Augen und drehte sich ins Licht.
Erst da kam Elizabeth, die ihn immer noch, wenn auch nicht ganz so offensichtlich, beobachtete, der Gedanke, er sehe aus wie ein Mann, der sich nach einer langen Arbeitsnacht endlich entspannt niederlässt. Als junges Mädchen hatte sie ihren Vater, einen Landarzt, oft bei Tagesanbruch nach Hause kommen und in eben dieser Weise in seinem Arbeitszimmer sitzen sehen. Sie beneidete Männer um diese Entspannung, um diesen Lohn der Ruhe nach körperlicher Anstrengung: dergleichen hatte sie nie gespürt.
So saß Jameson, der sich ins aufgehende Licht drehte und hin und wieder mit der Hand die Augen beschirmte, ein paar Minuten lang da, bevor er dem Fenster den Rücken zuwandte und sich Kaffee nachschenkte. Er fing ihren Blick auf.
»Kaltblütig«, sagte er zu ihr. »Ein kaltblütiger Engländer, der auf einem Felsen hockt wie eine Eidechse und die Sonnenwärme braucht, um sich rühren zu können.« Er schüttelte den Kopf. »Beachten Sie mich einfach gar nicht.«
Ohne darüber nachzudenken, was sie tat, erhob sich Elizabeth, nahm ihre eigene leere Tasse und ging zu ihm hinüber.
»Die setzt sich zu ihm«, hörte sie Gerda hinter sich sagen.
»Die verdienen einander auch«, sagte ihr Vater.
Jameson erhob sich, als sie sich näherte, und rückte ihr einen Stuhl zurecht.
Sie wusste, ohne zu fragen, dass sie mit ihrer Vermutung recht gehabt hatte und dass er die ganze Nacht auf gewesen war.
»Ich heiße Jameson«, sagte er und streckte ihr die Hand hin.
»Elizabeth Mortlake.« Sie setzte sich ihm gegenüber.
»Die hier mit ihrer kranken Schwägerin abgestiegen ist«, sagte er unerwartet.
»Das ist wohl kaum ein Geheimnis.«
»Nein. Und der Ort hier ist um einiges kleiner, als er es von sich annimmt.«
»Warum nennt jeder sie krank?«, fragte Elizabeth.
Er dachte darüber nach. »Vielleicht, weil hier jeder auf die eine oder andere Weise krank ist. Klappe, Jameson. Mal wieder vorlaut. Bitte nochmals um Vergebung.«
Die wurde ihm mit einem Kopfnicken gewährt.
»Außerdem ist sie Witwe«, sagte er. »Ihre Schwägerin, aber Sie nicht. Sie haben unglückseligerweise nur den Bruder verloren, und folglich sind Sie in den Augen der Welt des Beileids weniger würdig, haben es nicht so verdient.« Dann schwieg er, und sie musterte ihn.
»Sie haben vergessen, ›Bitte um Vergebung‹ zu sagen«, sagte sie. »Hatten Sie eine anstrengende Nacht?«
Die Bemerkung überraschte ihn nicht. »Geht so«, sagte er. Er sprach, als glaubte er, sie wisse über das, was er machte, bereits Bescheid.
»Sind Sie krank?«, fragte sie ihn.
»Schauen Sie mich doch an.«
»Sie scheinen müde zu sein, mehr nicht.«
Er lächelte. »Dafür besten Dank.« Er blickte sich nach den Zuschauern um. Jetzt fühlten sich nur noch wenige verpflichtet, wegzusehen. »Ich sollte Sie wohl darauf hinweisen, dass Sie durch Ihre kleine Geste der Freundlichkeit zum zweitunbeliebtesten Menschen im ganzen Hotel geworden sind.« Er hob seine Tasse und prostete den Gaffern zu.
»Nennen Sie es bitte nicht Freundlichkeit«, sagte sie. »Das, was heutzutage als Freundlichkeit durchgeht, macht mich krank.«
»Mich auch.«
»Wo sind Sie her?«
»London«, sagte er. »Und Sie?«
»Oxford. Ich konnte Ihren Akzent nicht einordnen.«
»Meine Mutter war Irin. Aus Cork. Von dem, was von meinem Akzent noch übrig war, ist mir das meiste ausgetrieben worden.«
»In der Schule?«
»In mehreren. Und in Cambridge.«
»Und was sind Sie gewesen?«
»Captain. Artillerie. Und Ihr Bruder?«
»Royal Flying Corps. Er war Flieger. Hat sein erstes Flugzeug gesehen, als er noch ein kleiner Junge war.«
»Ich habe früher Drachen gebaut«, sagte er. »Ich habe mich noch gar nicht nach seinem Namen erkundigt.«
»Michael«, sagte sie. »Michael.« Sie füllte sich den Mund mit heißem, bitteren Kaffee. Und so stießen sie zusammen und gingen in ihrem gemeinsamen Schweigen wieder auf Abstand.
»Was haben Sie heute vor?«, fragte er schließlich.
»Mary suchen.«
»Hier gibt’s wirklich nicht viel zu tun«, sagte er.
»Weiß ich. Vielleicht ist das der Grund, hier zu sein.«
»Das kleine Auge der Ruhe im Zentrum des ersterbenden Sturms? Machen Sie sich doch nichts vor. Ich kann einen guten Arzt empfehlen, wenn Ihre Schwägerin einen braucht oder wünscht. Seien Sie gewarnt, der ganze Ort ist voll von Quacksalbern, die erst die Brieftasche fühlen und dann den Puls.« Er holte einen Füllfederhalter heraus, riss ein Stück von der Zeitung ab und schrieb eine Nummer darauf.
»Danke.«
»Und jetzt muss ich los«, sagte er. »Es wäre klug, wenn Sie noch ein Weilchen bleiben. Weiß Gott, was die sonst –« Er wurde von Frau Gottlieb unterbrochen, die quer durch den Raum gekommen war und sich nun stocksteif neben ihm aufbaute.
»Gerda lässt fragen, ob Sie vielleicht Lust hätten, uns heute Vormittag bei einem Besuch der Brennerei zu begleiten, Elizabeth.« Dabei wandte sie sich demonstrativ von Jameson ab.
»Was für eine prima Idee«, sagte Jameson. »Wir könnten alle gemeinsam hinfahren.«
»Das Angebot richtet sich an Elizabeth, und natürlich an ihre Schwägerin«, sagte Frau Gottlieb. »Elizabeth?« Sie wollte unbedingt, dass Elizabeth etwas sagte.
»Mary geht’s nicht gut«, sagte Elizabeth.
»Natürlich.« Frau Gottlieb kehrte zu Mann und Tochter zurück. Gerda hob ein wenig die Hand in Elizabeths Richtung, als könne das dem Angebot ihrer Mutter irgendwie Nachdruck verleihen. Herr Gottlieb saß da und trommelte mit einem beringten Finger gegen seine Tasse.
»Sie ist gekommen, um Sie vor mir zu retten«, flüsterte Jameson.
»Ich habe sie gekränkt«, sagte Elizabeth.
»Na und? Die werden nachher zu Ihnen kommen und Sie fragen, worüber wir gesprochen haben.«
»Über nichts«, sagte Elizabeth.
»Ganz genau.« Er erhob sich und streckte ihr die Hand hin, zog sie dann bei der leisesten Berührung zurück. »Wie ich schon sagte, kaltblütig.«
Er durchquerte den Raum und nickte allen zu, die noch da waren. Kaum war die Tür des Speisesaals hinter ihm zugefallen, ging die Küchentür auf, und der Mâitre nahm Kurs auf den Tisch, an dem Elizabeth immer noch saß, um ihn höchstpersönlich abzuräumen und sich seines eigenen kleinen Triumphes zu versichern.
3 | Die folgenden Tage verbrachte sie damit, die Stadt zu erkunden. Es war kein großer Ort – sie las im Baedeker, dass er weniger als zwanzigtausend Einwohner hatte –, was, wie sie vermutete, hauptsächlich mit der Lage zu tun hatte. Der See erstreckte sich von Osten nach Westen, und alle wichtigen Gebäude, zum größten Teil Hotels, standen mit Blick nach Süden daran aufgereiht. Rundherum erhoben sich Berge nach allen Richtungen – hohe, steile Matten, die zu kahlen Bergkämmen, Geröllflächen und scharfzackigen, schneebedeckten Gipfeln anstiegen. Auf der Südseite des Sees ragten schroffe Steilwände aus dem Wasser. Hier gab es keine Gebäude, keine Gehöfte, keine Straßen, keine kultivierten Flächen, nur etwas, was nach einem stillgelegten Steinbruch aussah, und man konnte sich kaum vorstellen, dass diese Hänge jemals beständig Sonne abbekamen, nicht einmal im Hochsommer, der nun zwei Monate zurücklag. Im Winter, erzählte man ihr, waren die Flüsse und Wasserfälle, die aus diesen Bergen herabflossen, monatelang ohne Unterbrechung gefroren.
Man erzählte ihr auch von dem tätigen Gletscher, der das Ende des Tals ausfüllte, sich alljährlich vorschob und dann wieder zurückzog und den sich verengenden Zwischenraum gen Osten versiegelte wie die hohe steile Mauer einer Talsperre.
Sie hatte gleich nach ihrer Ankunft einen Ausflug zum Gletscher vorgeschlagen. In ihrem Zimmer hatten Broschüren und Prospekte ausgelegen, und sie hatte sie alle genauestens durchgesehen, begierig darauf, ihre Tage irgendwie auszufüllen. Schon bald aber musste sie einsehen, dass sich ein solches Vorhaben wohl kaum realisieren ließe.
Zwei Tage nach Elizabeths Zusammentreffen mit Jameson war Mary wieder übel, und Elizabeth saß mit ihr im Badezimmer, bis der Brechreiz überwunden war. Gemessen an der ganzen schmerzhaften Mühsal war nicht viel herausgekommen.
»Wir bleiben besser im Hotel«, sagte Elizabeth, enttäuscht darüber, dass sie dann also nicht wie erhofft das alte Stadtzentrum besichtigen würden.
»Nein. Ich richte mich ganz nach deinen Wünschen.« Mary sprach durch das Handtuch hindurch, das sie sich an den Mund presste.
Es war Elizabeth in den Sinn gekommen, dass Mary die Übelkeit absichtlich herbeiführte, aber die Gründe dafür durchschaute sie nicht so ganz, und so hatte sie die unklare Vorstellung entwickelt, es handle sich um eine Art Bestrafung, die sich Mary für ihr Unvermögen auferlegt hatte, das, was sie an Konfusion, Unsicherheit oder Kummer immer noch durchlitt, in Schach zu halten.
Mary strich sich ihr langes Haar aus dem Gesicht. Stirn und Wangen waren ganz feucht von Schweiß. »Ich weiß, was du denkst«, sagte sie. »Und wenn ich mich zu Tode hungere, dann hab ich während dieses letzten Jahres wenigstens etwas Positives mit meinem Leben angefangen.«
Elizabeth nahm diese Bemerkung nicht ernst. Sie hielt ihrer Schwägerin die Hand.
»Aber das mache ich gar nicht«, sagte Mary schließlich.
»Ich weiß.«
»Ich hätte mir nie träumen lassen, dass irgendetwas so schlimm sein kann, so schmerzhaft. Man hat uns beigebracht, dass alles mit der Zeit wieder besser wird. Tut’s aber nicht. Es wird nur schlimmer. Alles verliert seinen Zweck. Es gibt kein Ziel mehr. Überhaupt keins. Nichts ist von Bedeutung. Alles wird wertlos, billig. Gegenstände, Menschen …«
»Und so fühlst du dich?«
Mary nickte. »Ich fühle mich, als würde ich tiefer und tiefer fallen. Das klingt so einfach und glatt, wenn man es ausspricht. Als Michael starb – als er umgebracht wurde –, da fühlte ich, dass ich entzweigebrochen war. Eigentlich müsste ich nun langsam wieder heile werden, aber ich werd’s nicht. Das geht einfach so weiter. Immer weiter und weiter und wird jeden Tag schlimmer. Alles ist bloße Ablenkung, Geplänkel. Ich gehe, ich rede, ich sehe, ich höre, aber nichts von alldem bedeutet mir etwas, nichts von alldem ergibt irgendwie Sinn für mich.«
»Hast du mal versucht, es zu verstehen?«
»Das lässt sich einfach nicht verstehen. Ich hab mich immer als unabhängige, intelligente Frau gesehen, aber das hier, das ist einfach alles –« Sie fing wieder an, sich zu übergeben.
Elizabeth ließ ihre Hand los und wartete an ihrer Seite, strich ihr sachte über den Rücken, während Mary den letzten Rest Flüssigkeit ins Becken spie.
»Ich brauche frische Luft«, sagte Mary, als es überstanden war, spülte sich den Mund aus und untersuchte im Spiegel ihre Zähne. »Es muss enttäuschend oder kränkend für dich sein, mich so reden zu hören, so, als seist du nichts weiter als meine Stütze oder meine Hüterin.«
»Du weißt, dass es nicht so ist. Wir könnten rausgehen und uns an den See setzen.«
Mary quittierte den Vorschlag mit einem kalten Lachen. »Zu den ganzen anderen verlorenen Seelen?«
»Warum nicht?«
Sie verließen das Hotel eine Stunde später. Es war fast Mittag. Das grelle Sonnenlicht und der klare Himmel der vorangegangenen Woche waren von einer Schicht aus dünnen Wolken abgelöst worden, durch die die Sonne nur gelegentlich und verschwommen sichtbar war.
Sie gingen zu der über dem See gelegenen Promenade hinüber und setzten sich auf eine leere Bank. Es war ein windstiller Tag, und es gab keine Wellen, nur ein Kräuseln und Klatschen, wo das Wasser auf die Felsen und das weite Halbrund der Mauer traf. Im Gegensatz zum wilden Ufer gegenüber war diese Seite des Sees fast über die gesamte Länge gezähmt und eingefasst worden. Der Wassersaum lag drei oder vier Meter unter ihnen, verborgen vom überhängenden Rand der Promenade. Eine doppelte Geländerreihe lief die ganze Länge des Spazierwegs entlang, in Abständen unterbrochen von Granitstufen, die zum Wasser hinab führten. Dort waren Anleger erbaut worden, und dort saßen die Bootsvermieter und die Fischer und versuchten die Touristen zu Ausflügen auf den See zu überreden, dort flickten sie Netze oder landeten ihren kleinen Fang an.
Von oben hatten Elizabeth und Mary einen guten Blick auf ein Grüppchen dieser Männer und konnten auch ihren Gesprächen zuhören. Es war ein Dutzend, alle Generationen waren vertreten. Die Jüngeren pfiffen und riefen den Frauen nach, die auf der Promenade entlangspazierten. Die Passantinnen lachten in sich hinein und taten entweder beleidigt oder so, als hörten sie nichts.
Mary sagte: »Ich hab alles über dein Zusammentreffen mit dem berüchtigten Captain Jameson gehört. Die Kellnerin hat’s mir erzählt. So wie sie geredet hat, wär ich gar nicht überrascht, wenn’s da nicht irgendetwas zwischen den beiden gäbe.«
»Ach?«
»Sonst scheint im ganzen Hotel niemand besonders viel von ihm zu halten. Sie wollte mir nicht sagen, weshalb.«
»Na und?«
Die schroffe Reaktion überraschte Mary. »Ich meinte das nicht als Kritik«, sagte sie.
»Was hat sie sonst noch gesagt?«
»Nicht viel. Nur, dass ich Glück gehabt hätte, dass ich nicht dabei war. Hast du ihn in der Zwischenzeit gesehen?«
»Nein.«
An jedem Morgen der drei Tage, die seit ihrer Begegnung mit Jameson vergangen waren, hatte Elizabeth damit gerechnet, dass er wieder auftauchte. Sonst hatte niemand sein Fernbleiben kommentiert.
»Warum hat sie das gesagt, was meinst du?«, fragte sie Mary.
»Aus keinem bestimmten Grund. Du weißt ja, wie diese Mädchen so sind.«
»Weiß ich das?«
Elizabeth drehte sich um und blickte hinter sich. An der Uferstraße reihte sich ein Hotel ans andere. In der Mitte standen die imposantesten Bauten, die, die kürzlich erst neu gestrichen worden waren, die mit den pompöseren Eingängen und Markisen. Links und rechts davon folgten die Gebäude, die zwar immer noch durch Größe und Uniformität beeindruckten, aber nicht ganz so prächtig waren. Ihr eigenes Hotel gehörte zu dieser Gruppe. Nach Osten hin endete die Front dieser Fassaden abrupt bei einem Kasino, jenseits dessen ein sich von den hochgelegenen Matten zum See herab erstreckender Felsvorsprung der Stadt eine natürliche Grenze setzte. Im Westen lag die Altstadt, und das Weiß und Blassblau und Beige der Fassaden wich dem Braun und Rot von Naturstein und Ziegeln. Rauch stieg aus zahllosen Schornsteinen auf und versammelte sich über den Gebäuden.
Es gab keine Prospekte, die diesen Teil der Stadt beschrieben, und als Elizabeth den Rezeptionisten am Empfang nach einer Karte gefragt hatte, in der die Straßen und kleinen Plätze der Altstadt verzeichnet waren, hatte er sie verwirrt angesehen und zurückgefragt, was sie denn damit wolle. Dort gebe es für Touristen wenig zu sehen. Doch sie hatte nicht lockergelassen, und am nächsten Tag hatte der Geschäftsführer des Hotels persönlich ihr einen schlichten handgezeichneten Plan mit den hauptsächlichen Straßen und Sehenswürdigkeiten überreicht. Auch von ihm erhielt sie die Auskunft, dass es in der Altstadt wenig zu sehen gebe und sie ihre Zeit anderswo besser verbringen könne. Wie sie bemerkte, enthielt sein Plan nur Denkmäler, Kirchen, Museen und die wenigen übrigen öffentlichen Gebäude.
»Das hier ist alles so … so unwirklich«, sagte Mary und wedelte mit dem Arm. »Sieh dir diese Berge an, sieh dir den See an, die Hotels, das ist doch alles nicht wirklich. Sogar diese Wälder, sieh sie dir bloß an, jeder Baum sieht genau gleich aus, das ist doch nicht wirklich. Das ist eine Illustration aus einem Märchenbuch.« Sie schien beglückt über diese Erkenntnis und lächelte in sich hinein, während sie ihren Blick umherschweifen ließ und auf alles zeigte.
Elizabeth brachte es nicht über sich, ihr zu widersprechen, und blieb lieber stumm.
Es war etwas Wahres dran an dem, was Mary sagte – genau so, wie die Abläufe und Geschehnisse dieses Ortes ihre feste Ordnung hatten, war auch seine äußere Erscheinung auf künstliche Weise wohlgeordnet –, und diese Wahrheit wurde umso offensichtlicher, je mehr man danach Ausschau hielt. Aber die Gipfel und die Bäume sah man nur aus der Ferne, die kleinen Felder hatten aus gutem Grund alle die gleiche Größe und Farbe und Form, und der See lag so still da, weil es ein windstiller Tag war, und er verlor sich in der diesigen Ferne, weil das Licht nicht kräftig genug war, dass ihre Blicke hätten weiter reichen können.
»Sogar die Möwen da«, sagte Mary. Sie zeigte auf die Vögel jenseits der Anleger, ein jeder von ihnen reines Weiß und reine Form. Sie tauchten nach Fischen, hingen als Schwarm in der Luft und legten dann, wieder als Einzelwesen, die Flügel an, um hinabzuschießen und zu tauchen; sie rührten kaum die Wasserfläche auf, wenn sie verschwanden. Kamen sie wieder an die Oberfläche, konnte Elizabeth sogar aus der Entfernung die kleinen silbrigen Fische in den Schnäbeln blitzen sehen, bevor sie verschluckt wurden.
Sie saßen ein paar Minuten schweigend da, und als Elizabeth sich schließlich wieder ihre Schwägerin zuwandte, sah sie, dass ihr Tränen über die Wangen liefen. Mary zitterte und atmete keuchend, gab aber sonst keinen Laut von sich.
»Lass uns reingehen«, sagte Elizabeth.
»Nein. Ich will hier nicht weg. Lass mich. Frag nicht. Versuch nicht, mich zu trösten.«
Sie saßen noch eine Weile so da. Passanten hielten inne, um die weinende Frau zu mustern, doch keiner ging zu ihr hin oder sprach sie an. Elizabeth bedeutete ihnen mit Gesten und beruhigendem Kopfnicken, sie sollten weitergehen, und die Leute gaben sich damit zufrieden, aus dem Gesehenen ihre eigenen unvollkommenen Schlüsse zu ziehen. Die einzige Person, die echte Besorgnis erkennen ließ, war eine andere junge Frau, die mit dem Rücken zum Wasser dastand und sie mit vor den Mund gehaltener Hand anstarrte. Sie trug einen dunklen Mantel und einen schwarzen Schal, den sie sich um den Kopf gewickelt hatte und der ihr Gesicht zur Hälfte verhüllte. Elizabeth blickte sie an und schüttelte den Kopf, voller Sorge, was passieren könnte, wenn sie näher kam. Neben ihr hatte sich Mary ein wenig beruhigt und saß nun mit gebeugtem Kopf da und holte tief Luft. Elizabeth glaubte nicht, dass sie diese andere Frau überhaupt bemerkt hatte, und sie wollte der Fremden ein Zeichen geben, damit sie sich entfernte, denn der Kummer ihrer Schwägerin sollte nicht wieder aufflammen.
Doch die Frau trat einen Schritt auf sie zu, und als sie das tat, blickte Mary zu ihr auf und nahm sie zum ersten Mal wahr. Die Frau blieb stehen. Die beiden sahen einander einen Augenblick lang an, dann machte die andere Frau kehrt und ging davon.
»Hat sie mich beobachtet?«, fragte Mary Elizabeth.
Elizabeth nickte. »Vielleicht wollte sie dich trösten.«
»Nein, das ist das Letzte, was sie wollte. Sie wollte es einfach nur wissen.«
Diese Bemerkung verwirrte Elizabeth. »Was wissen?«
»Dass sie nicht allein war. Sie wäre nicht näher gekommen, sie hätte nichts gesagt.«
Elizabeth schaute in die Richtung, in der die Frau verschwunden war, konnte sie zwischen all den anderen Leuten dort aber nicht wiederfinden. »Verstehe«, sagte sie.
Draußen auf dem See fuhren zwei von den größeren Dampfschiffen aufeinander zu; die doppelten schwarzweißen Rauchfahnen verflochten sich hinter ihnen, bis sich das Muster in der stillen Luft krakelig verlor. Von ihrem Platz aus hatte Elizabeth den Eindruck, die beiden Schiffe wären auf Kollisionskurs, aber in dem Augenblick, da die Bugspitzen sich gegenseitig hätten aufschlitzen müssen, passierten die Dampfer einander mit hundert Meter Abstand.
Von den Schiffen abgelenkt, bemerkte sie gar nicht, dass Mary sich neben ihr erhob und dorthin ging, wo die Frau gestanden hatte.
»Siehst du, so austauschbar sind wir alle«, rief sie ihr zu.
Elizabeth ging zu ihr. Einer der Fischer unten rief ihr etwas zu, aber sie verstand ihn nicht.
Mit starrem Blick sah Mary in Richtung ihres Hotels. Es war noch nicht ein Uhr nachmittags, aber in einigen der unteren Fenster brannte bereits Licht.
»Ich hab’s dir nie erzählt«, sagte Mary und fixierte dabei weiter ihr Hotel, »aber vor ein paar Monaten hab ich einmal Michaels Dienstpistole rausgekramt, hab mich vergewissert, dass sie geladen war, und dann den ganzen Tag damit zugebracht, mit der Pistole in Jacken- oder Handtasche herumzulaufen. Ich war beim Arzt, bei der Bank, in mehreren Geschäften, ich hab mich mit Bekannten getroffen und mich drauf eingelassen, mich mit ihnen zu unterhalten, und die ganze Zeit wusste ich, dass ich diese geladene Pistole griffbereit bei mir hatte. Hinterher hab ich sie wieder weggepackt. Den ganzen Tag lang war ich ganz berauscht von dem Wissen, was ich tun könnte.« Sie klang völlig abwesend. »Den ganzen Tag lang. Und keiner hat’s gewusst. Ich habe alle Verbindungen zu ihnen gekappt, einfach indem ich mir vorstellte, wozu ich fähig sein könnte. Ich habe die Verbindung zu allem gekappt. Es ging tatsächlich so einfach, so umstandslos.«
Elizabeth war sich nicht ganz sicher, ob sie damit meinte, sie sei fähig gewesen, sich selbst zu erschießen, oder jemand anderen.
4 | Am nächsten Morgen dann sah sie Jameson wieder. Er stand unter dem Baum und blickte suchend die Straße auf und ab, als würde er auf jemanden warten.
Sie war allein. Sie blieb einen Augenblick im Eingang des Hotels stehen und trat dann hinaus. Er sah sie sofort. Sie erwartete, er würde die Hand heben und sie heranwinken, aber er beließ es dabei ihr zuzuschauen, wie sie die Stufen hinunter schritt und über die Straße auf ihn zuging. Sie gaben einander die Hand.
»Warten Sie auf irgendwen?«
»Ich bin früh dran«, sagte er.
Jeder andere, jeder der Männer, mit denen sie in Oxford verkehrt hatte, hätte aus diesem Impuls, es erst zu leugnen und dann doch zuzugeben, womöglich gleich ein kleines Spiel gemacht und seine Bemerkungen mit einer Geheimnistuerei aufgeladen, hinter der gar nichts steckte. Er aber enttäuschte sie nun, indem er einfach weiter die Straße absuchte. Er rollte seine Zeitung auf und steckte sie in seine Jackentasche.
»Sie können Deutsch«, sagte sie.
»Nicht sehr gut. Und Sie?«
»Ich hatte mal daran gedacht, es zu lernen. Jetzt nicht mehr.«
»Verstehe.« Ihm schien in ihrer Gesellschaft plötzlich unbehaglich. »Wie geht’s Ihrer Schwägerin?«, fragte er.
»Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn ich es nur wüsste. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, zwischen ihren körperlichen Leiden und dem, was sie sonst noch quälen mag, zu unterscheiden.«
»Ich weiß, was Sie meinen. Wird sie nach Hause fahren?«
»Warum sollte sie? Unser Plan war es – ist es –, sechs oder sieben Wochen zu bleiben und dann Ende November nach England zurückzukehren. Wenigstens kann sie sich dann auf Weihnachten freuen.«
»Zum ersten Mal ohne ihren Mann«, sagte er.
»Lassen Sie das. Es gibt nichts, was ich nicht bedacht hätte.«
»Und zum ersten Mal ohne Ihren Bruder. Ich weiß.« Er blies in seine Hände. »Zigarette?« Er holte sein Etui heraus.
Sie nahm eine, und er gab ihr Feuer.
»Was machen Sie, wenn sie sich entschließt, früher zurückzufahren? Bleiben Sie dann noch alleine hier?«
»Weiß ich nicht. Sie scheinen ja sehr überzeugt davon, dass sie vorzeitig abreisen wird.«
Er zuckte die Schultern. »Leben Ihre Eltern noch?«, fragte er.
»Nein. Meine Mutter ist gestorben, als ich noch ein Kind war, mein Vater vor drei Jahren. Zwei Jahre vor Michael, ein Jahr sogar, bevor sein Sohn überhaupt fliegen gelernt hat. Ein Segen, wirklich.«
»Und Michael war Ihr einziger Bruder?«
Sie nickte. »Wir waren nur ein Jahr auseinander. Wir wurden dauernd für Zwillinge gehalten.« Sie lächelte bei dieser unwillkürlichen Erinnerung, und dann sagte sie: »Warum haben alle so eine Abneigung gegen Sie?«
»Wer denn?« Er hatte sie nur zu gut verstanden. »Naja, sicher nicht alle. Hauptsächlich der Geschäftsführer des Hotels und dieser anmaßende Oberkellner.«
»Der Mâitre.«
»So eine erlauchte Bezeichnung würde ich ihm nicht zugestehen mögen. Aber er ist ein mächtiger Mann. In der Hauptsaison werden die Leute von einem Tag auf den anderen eingestellt und rausgeschmissen.«
»Liegt es daran, dass Sie Engländer sind?«
»Glaube ich nicht. Warum sollte das noch von Bedeutung sein?«
»Und außerdem bringen Sie ihn absichtlich gegen sich auf.«
»Ich weiß.«
»Aber Sie könnten Ihr Frühstück überall einnehmen; es muss in in der Nähe ein Dutzend Cafés und Bars geben.«
»Gibt’s auch.« Er schaute wieder die Seestraße entlang. »England Ende November, was für betrübliche Aussichten.«
»Sie haben also überhaupt nicht vor, zurückzugehen?«
»Darüber hab ich noch nicht wirklich nachgedacht. Ich bleibe hier so lange, wie ich bleiben muss, und dann wird sich schon was finden. Waren Sie schon mal in Nordafrika?«
Sie schüttelte den Kopf. Sie war zuvor erst einmal aus England herausgekommen, und nur bis nach Calais.
»Liegt da drüben, hinter dem Wasser und hinter den Bergen.« Er zeigte, ohne sich umzudrehen, als spräche er von einem mythischen Land. »Ist alles Wüste. Unvorstellbar weit und heiß. Dort würde ich leben wie ein Araber.«
»Das glaube ich Ihnen«, sagte sie. »Und wo möchten Sie danach hin? China? Zum Amazonas?«
»Vielleicht. Eigentlich ist es egal.« Er sah auf die Uhr und sagte »Verdammt«, aber ohne wirkliche Empörung.
»Stimmt etwas nicht?«
»Er kommt nicht. Hat gesagt, er käme vielleicht, vielleicht aber auch nicht.«
»Ich hasse unzuverlässige Menschen«, sagte sie. Sie wusste nicht warum, aber plötzlich hatte sie Angst, er würde gleich gehen. Der Tag, der vor ihr lag, war leer.
»Er ist nicht unzuverlässig«, sagte er. »Er hat gesagt, vielleicht würde es ihm nicht möglich sein, zu kommen.«
»Was werden Sie jetzt machen?« Sie spürte, wie sie seiner Antwort entgegenbangte. Aber er sagte nichts. Stattdessen schaute er über ihre Schulter Richtung Hotel. Sie drehte sich um. Über die Straße kam eine kleinere Prozession der Blinden auf sie zu. Sie war überrascht, sie zu sehen. Die übliche Zeit für die Invaliden war lang vorbei.
»Die sind spät dran«, sagte sie.
»Es muss etwas passiert sein.«
Neben den ihr schon vertrauten Schwestern und Ordonnanzen machte sie in der Gruppe in noch größerer Zahl Nonnen und junge Novizinnen aus. Jede Frau hielt den Arm eines Mannes. Einige der Blinden kamen mit noch bandagierten Augen an, bei manchen war der Großteil des Gesichts verhüllt; andere trugen schwarze Brillengläser oder Mützen mit tief herabgezogenen Schirmen. Einige wenige hatten ihre Augen ganz verloren; andere querten die Straße mit starrem Blick.
»Sollten wir nicht besser zur Seite gehen?«, fragte sie, als sie sah, dass die Nonnen und Männer in der ersten Reihe direkt auf sie zukamen.
»Nein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Die tun Ihnen nichts.«
»So meinte ich das nicht.«
»Margaret«, rief er.
Die Nonne, die ihnen am nächsten war, beschirmte ihre Augen, um besser sehen zu können. Sie hielt den Arm eines Jungen, der nicht älter sein konnte als achtzehn, und führte ihn auf sie zu, wobei sie ihm etwas zuflüsterte. Der Junge grinste über das, was sie sagte. Als sie nahe genug herangekommen waren, hob sie seine Hand, sodass Jameson sie schütteln konnte.
»Den sollten sie einer der jungen, attraktiven Schwestern überlassen«, sagte er zu der Frau. Er beugte sich vor, um sie auf beide Wangen zu küssen.
»Egal, was er sagt, glauben Sie ihm von zehn Sätzen bloß einen«, sagte die Frau zu Elizabeth. Sie hielt ihr die Hand hin. »Und nein, bevor Sie danach fragen, Männer wie Jameson in der Öffentlichkeit zu küssen ist keineswegs etwas, was unsere Mutter Oberin gutheißt.« Sie sprach gut Englisch, aber mit starkem Akzent.
»Das hier ist Andrew«, sagte Jameson und hielt die Hand des Jungen hoch, sodass Elizabeth sie ergreifen konnte.
Der Junge sagte: »Miss.«
»Nennen Sie sie Elizabeth«, sagte Jameson zu ihm. Er zündete eine weitere Zigarette an und steckte sie Andrew in den Mund. »Sie ist dreiundzwanzig, braune Haare, braune Augen, bisschen zu blass, bisschen zu dünn. Ihr Bruder war beim RFC und ist gefallen.«
Elizabeth war auf diese Direktheit nicht vorbereitet.
»Tut mir leid«, sagte Andrew.
Jameson sah sie an und wartete.
Aber ihr fiel nichts ein, was sie sagen konnte, und so hob sie stattdessen die Hand des Jungen an ihr Gesicht und ließ ihn ihre Wangen und ihr Kinn fühlen.
Jameson reichte den Rest seiner Zigarette der alten Nonne.
»Warum sind Sie so spät dran?«, fragte er sie.
Sie warf einen kurzen Blick auf Elizabeth, bevor sie etwas sagte. »Es gab irgendeinen Vorfall in der Nacht. Ich weiß nicht genau, was. Wir waren zur üblichen Zeit da, aber niemand war ausgehfertig.« Sie wandte sich wieder an Elizabeth. »Unser Kloster grenzt an das Militärkrankenhaus«, sagte sie. »Die meisten unserer Schwestern und Mädchen opfern dort ihre Zeit. Wir können uns dort nützlich machen.«
»Gott behüte«, sagte Jameson. »Nützliche Nonnen.«
Die anderen Blinden und die Frauen, die sie führten, waren nun ebenfalls eingetroffen. Jeder schien Jameson zu kennen. Die Frauen grüßten ihn schweigend, und die Männer und Jungen riefen ihn bei seinem Namen, drehten dabei die Köpfe, um ihn besser lokalisieren zu können. Er stellte Elizabeth niemand anderem mehr vor, und sie fühlte sich unsichtbar, ein Gegenstand von Mutmaßungen, nur dem Urteil der Frauen zugänglich.
Noch weitere der älteren Nonnen traten vor, um Jameson entweder zu küssen oder ihm die Hand zu geben. Einige der Novizinnen knicksten vor ihm; Elizabeth grüßten sie mit einem knappen Nicken.
Jameson ließ sie stehen und ging durch die Menge auf eine der Schwestern zu. Er tätschelte Arme und Schultern und sprach mit jedem, an dem er vorbeikam. Er sprach mit der Schwester, woraufhin sie sich umdrehte und über die Straße in Richtung des Hotels deutete. Dort stand am Bordstein ein Mann, der sowohl von einer Schwester als auch von einer Nonne begleitet war. Jameson winkte ihm zu, doch der Mann ließ durch nichts erkennen, dass er ihn gesehen hatte.
Dann kehrte Jameson zu Elizabeth zurück.
»Ist das der, auf den Sie gewartet haben?«, sagte sie.
»Sicher nicht. Das ist jemand, den ich aus dem Krankenhaus kenne. Er heißt Hunter.«
»Er ist nicht blind«, sagte sie.
»Nein.«
Als sie ihre Stimme hörten, rückten die ihr am nächsten stehenden Männer sogar noch dichter heran. Der Junge, dem sie vorgestellt worden war, beschrieb sie den anderen. Sie grüßten sie im Chor. Einige von ihnen trennten sich, nachdem sie sicher über die Straße geführt worden waren, von den Frauen und spazierten alleine herum; andere klammerten sich noch mehr an die Mädchen, die sie festhielten.
»Die bringen bloß die dämlichsten und die fröhlichsten hier raus«, sagte Jameson laut und stieß damit bei den Männern auf begeisterte Zustimmung. Ein paar schoben sich zum Geländer vor, die Arme nach vorne ausgestreckt.
Sie schwärmten rund um sie aus, und Elizabeth entschuldigte sich bei jedem, der sie anrempelte. Sie alle bewegten sich langsam zu der Stelle, von wo aus man über den See blicken konnte. Erst später kam ihr der Gedanke, dass die Männer absichtlich mit ihr zusammengestoßen waren und auf diese Weise ihre Schuldunfähigkeit ausspielten.
»Sie können die Brise vom Wasser her spüren«, sagte Margaret zu ihr.
Elizabeth spazierte mit Andrew ans Geländer. Als er sich mit einer Hand daran festhalten konnte, entspannte sich der Junge etwas. Sie überlegte, über was sie mit ihm reden konnte.
»Ich hab Gas abgekriegt«, sagte er, doch in seiner Stimme lagen weder Selbstmitleid noch Bedauern.
»Das tut –«
»Das tut Ihnen leid«, sagte er. Er lächelte sie an, und sie rückte unwillkürlich ein paar Handbreit von ihm ab, sodass er ihr gegenüberstand. Sie wollte etwas von ihrem Bruder erzählen, tat es aber dann doch nicht. Sie hatte schon lange bemerkt, dass man Leid zwar, wie indirekt oder beiläufig auch immer, teilen konnte, es sich dadurch aber nicht im Geringsten lindern ließ, sondern durch Bedauern und Verlegenheit und Unaufrichtigkeit nur verwässert und versetzt wurde und auf diese Weise seine Kraft verlor. Genauso stand es nunmehr um das Leid von Mary, die im Gewirr von aufgebrauchten Ausflüchten und Platitüden umherirrte. Sie selbst, Elizabeth, wollte sich ganz und gar nicht so verhalten und gesehen werden.
»Man muss die Berge gar nicht sehen«, sagte der Junge. »Und Sie müssen nicht ständig reden. Ich weiß, dass Sie da sind.«
»Wie lange sind Sie schon hier?«, fragte sie ihn.
»Drei Monate. Ich werde bis zum Frühjahr hierbleiben.«
»Und dann?«
»Wieder nach Hause, nehm ich an.«
»Haben Sie Familie?«
»Bloß meine Mutter.«
Andere traten zu ihnen. Sie alle stellten sich vor, streckten ihre Hand aus, und sie alle schüttelten, wie sie durchaus bemerkte, Elizabeths Hand länger, als es die Geste erforderte, und sie alle streichelten beim Wegziehen mit den Fingerspitzen Elizabeths Handfläche, dann ihre Finger. Sie zeigte sich durch ein leichtes Drücken erkenntlich.
»Die fühlen, ob Sie Ringe tragen«, meinte Andrew. Ein paar der Männer hatten ihr die linke statt der rechten Hand gegeben.
»Nein, keine Ringe«, sagte sie.
Sie kamen so nah wie möglich heran und nahmen ihren Geruch auf.
Mehrere Nonnen gesellten sich zu ihnen, darunter auch Margaret, und warnten die Männer davor, irgendeinen Unfug zu machen. Das wiesen sie alle weit von sich.
Elizabeth hielt nach Jameson Ausschau. Er war nicht mehr dort, wo sie ihn zurückgelassen hatte.
Margaret sah ihren suchenden Blick. »Er ist gegangen, um Hunter zu begrüßen«, sagte sie. Sie deutete auf den Mann, der immer noch auf der anderen Straßenseite wartete.
»Kommt er nicht herüber?«, fragte Elizabeth.
»Manchmal schon. Er und Jameson kennen sich. Sie sind dicke Freunde. Jameson kommt oft ins Krankenhaus. Sie müssen ihn überreden, dass er Sie mitnimmt. Kommen Sie zum Kloster.«
»Hunter, ist der krank?«
»Er ist ein charmanter, intelligenter Mann, genau wie Jameson.«
»Er hat auf jemand anderen gewartet«, sagte sie.
»Er hat viele Bekannte in der Stadt.«
Elizabeth begriff, dass die Frau in Jamesons Abwesenheit nicht über ihn reden wollte.
»Sagen Sie ihm, ich hätte mir gewünscht, dass er Sie bei seinem nächsten Besuch mitbringt«, sagte Margaret.
Eine der Novizinnen trat zu ihnen und wartete auf eine Gesprächspause.
»Das ist Ruth.«
Ruth neigte den Kopf.
»Sie und Jameson und Hunter sind ebenfalls enge Freunde geworden. Sie glaubt, ich sei eine alte Frau, die kaum noch hören und sehen kann, aber ich höre und sehe doch genug, um zu wissen, dass sie sie schon auf Abwege geführt haben. Sie spielt mit ihnen Karten. Sie trinkt Kaffee mit ihnen, und wahrscheinlich tut sie noch viel Schlimmeres.«
Das Mädchen hielt den Kopf weiterhin geneigt, nahm aber nichts von dem, was über sie gesagt wurde, ernst. Dass sie die Nonne sehr mochte, war offensichtlich. Elizabeth schätzte sie auf sechzehn oder siebzehn, aber wegen des unter ihrem Umschlagtuch verborgenen Haars war das schwer zu bestimmen.
»Geh und kümmer dich um irgendwen«, sagte Margaret zu ihr, und das Mädchen ging sofort los. »Sie ist nur gekommen, um einen Blick auf Sie zu werfen«, sagte Margaret im Verschwörerton. »Sie hat Sie schon in dem Augenblick mit Jameson gesehen, als wir zur Straße kamen.«
»Ist sie –?«
»Sie ist in einem gewissen Alter. Jede von uns bekommt die Verantwortung über eine der Novizinnen übertragen, und sie steht unter meiner Aufsicht. Sie ist Französin, wie ich, aus dem Norden. Sie kam vor einem Jahr hierher.«
Elizabeth erahnte noch einiges mehr, was die Frau unausgesprochen ließ. »Wird Jameson noch länger bei Hunter bleiben?«, fragte sie.
»Das bezweifle ich. Dafür ist im Krankenhaus reichlich Gelegenheit. Die Stadt ist nicht immer der beste Ort.« Und wieder wurde sie ausweichend. Irgendwer rief nach ihr, und sie ließ Elizabeth stehen, um sich zu den anderen zu gesellen.
Die Männer hatten sich jetzt über die ganze Promenade verteilt und die Frauen und Mädchen mit ihnen. Ruth, sah Elizabeth, spazierte mit der Hand auf dem Arm eines der jungen Männer umher. Sie machten häufig kehrt und gingen immer wieder dasselbe Pflasterstück auf und ab. Elizabeth beobachtete die beiden und hatte den Eindruck, als sei der Junge nicht vollkommen blind, als verfüge er vielmehr über eine Geschmeidigkeit und Sicherheit, die bei kaum einem der anderen auszumachen war. Auch kam ihr in den Sinn, dass sie sie, wenn sie Ruth nicht vorgestellt worden wäre, aus dieser Entfernung gut und gerne für ein Mädchen von kaum mehr als elf oder zwölf Jahren gehalten hätte.
»Sie haben Ruth also getroffen.« Jameson stand neben ihr.
»Sie ist da drüben.«
Jameson hielt Ausschau nach ihr. Er erkannte, bei wem sie war, und schüttelte den Kopf.
»Was ist los?«
»Nichts. Ich muss los.«
»Schwester Margaret sagte, Sie würden mich mal zum Krankenhaus mitnehmen.«
»Warum sollten Sie das wollen? Das ist keine Irrenanstalt. Sie werden sich kein bisschen besser fühlen, wenn Sie die alle da oben zu Gesicht bekommen haben.«
Sie war überrascht von der Feindseligkeit seiner Antwort, sagte aber nichts.
»Natürlich nehme ich Sie mit«, sagte er schließlich, als er merkte, sie würde sich ohnehin nicht davon abbringen lassen. »Sie können mit ihnen rumsitzen und schwatzen, mit ihnen spazieren gehen, ihnen ihre Briefe vorlesen, ihre Briefe schreiben.«
»Sehen Sie«, sagte sie. »Ich werde mich noch genauso nützlich machen wie eine Nonne.«
»Ich hol Sie ab.«
»Ist Hunter krank?«, fragte sie ihn rasch und ziemlich plump.
»Warum fragen Sie?«
»Ich –«
»Sie fragen, weil Sie auch zu diesen Leuten gehören, die es nicht übers Herz bringen, direkter zu fragen. Hunter leidet an dem, was man allgemein und bequemerweise als Neurasthenie bezeichnet. Davon haben Sie sicher schon gehört. Wahrscheinlich haben Sie keine genauere Vorstellung davon als alle anderen, aber zumindest müssen Sie schon davon gehört haben.«
Sie sah zu der Stelle hinüber, wo Hunter mit den beiden Frauen gewartet hatte, doch weder er noch sie waren mehr zu sehen.
»Er ist zurückgegangen«, sagte Jameson. »Heute hat er sich nicht überwinden können, die Straße zu überqueren. Gestern hat er’s getan, morgen tut er’s vielleicht wieder, aber heute war es ihm unmöglich. Noch etwas, was Sie wissen wollen?«
Sie schüttelte den Kopf.
Er drehte sich um, und ohne ein Wort des Abschieds an sie oder sonst irgendwen ging er raschen Schrittes davon. Sie sah ihm nach und bemerkte zum ersten Mal, dass er ganz leicht hinkte, so leicht, dass sie nicht einmal mit Bestimmtheit sagen konnte, welches seiner Beine verwundet war.
5 | Zwei Tage später brach sie alleine auf, um das Kloster zu besuchen. Der Rezeptionist erklärte ihr den Weg. Das Kloster, sagte er, liege in Richtung des Gletschers und es gebe eine regelmäßige Busverbindung von der Stadt zum Krankenhaus und weiter zu den Hütten dahinter, von wo die Ausflüge zum Gletscher normalerweise losgingen.
»Warum wollen Sie denn da hin?«, wollte er wissen.
»Man hat mich eingeladen.«
»Da gibt’s nichts zu sehen. Ins Krankenhaus wird man Sie nicht lassen, falls Sie das gehofft haben sollten.«
Elizabeth ignorierte die Bemerkung.
»Der Bus fährt hier am Hotel vorbei.« Er schaute sich nach der Uhr um. »Noch eine Stunde hin.«
»Ich gedenke zu Fuß zu gehen«, teilte sie ihm mit.
»Das sind fünf Kilometer.«
»Na und?«
»Hauptsächlich bergauf.«
Das hatte Elizabeth nicht berücksichtigt. »Trotzdem sollte ich nicht länger brauchen als zwei Stunden.«
»Mindestens drei«, sagte er.
Zuvor hatte sie versucht, Mary zum Mitkommen zu überreden. Sie hatten den ganzen Tag Zeit für den Ausflug. Sie würden mal etwas von der ländlichen Umgebung zu sehen bekommen. Sie würden der klaustrophobischen Enge des Hotels und seiner Routine entkommen. Sie könnten jederzeit mit dem Bus zurück in die Stadt fahren, wenn die Wanderung sich als zu anstrengend erweisen würde. Doch Mary lehnte ab. Sie hatte wieder einmal eine größtenteils schlaflose Nacht hinter sich und auch schon das Angebot der Gottliebs angenommen, sie bei einer ihrer bis ins Letzte vorgeplanten Exkursionen zu begleiten.
»Wohin denn?«, fragte Elizabeth.
Mary war sich nicht ganz sicher. Sie zählte mehrere Örtlichkeiten auf, die Herr Gottlieb schon einmal erwähnt hatte. »Sie haben ein Taxi gemietet«, sagte sie.
»Die wollen bloß, dass du ihrer langweiligen Kuh von Tochter Gesellschaft leistest, damit sie ihr Englisch an dir üben kann.«
»Na und? Vielleicht ist das genau das, was ich brauche, einen Tag in Gesellschaft mit jemandem, der noch langweiliger ist als ich.«
Elizabeth hatte sich an diese ständigen Gegenargumente und Ausflüchte bereits gewöhnt.
Mary saß auf ihrem Bett, noch immer im Nachthemd. Der kurze Wortwechsel hatte sie erschöpft. Elizabeth ließ die Sache auf sich beruhen.
Eine halbe Stunde später verließ sie das Hotel.
Zuerst führte die Straße am Seeufer entlang. Sie kam an dem weiten Bogen der anderen Hotels und dann am Kasino vorbei. Männer und Frauen saßen auf den breiten Stufen, die zu dem Gebäude hinaufführten. Die Männer trugen Abendgarderobe, und die Frauen wirkten in ihren Roben irgendwie deplatziert. Irgendjemand hatte entlang der obersten Stufe eine Reihe leerer Champagnerflaschen aufgestellt.
Danach wurde die Straße etwa über einen Kilometer von kleinen Wiesen flankiert, auf denen Rinder grasten. Die Promenade endete am Kasino, und zum ersten Mal ging sie am ursprünglichen Seeufer entlang, außer Sichtweite der Stadt. Holztrümmer und anderes Treibgut lagen am Wassersaum zwischen den Felsen und den freigelegten Baumwurzeln verstreut.
Die Wiesen wurden vom allgegenwärtigen Wald abgelöst, der hier bis zur Straße reichte. Im Unterholz lagen gefällte und umgestürzte Stämme herum. Unter den Bäumen war es viel kühler. Weit konnte sie nicht hineinsehen, denn ihr Baldachin schloss das Licht nahezu aus. Sie erblickte Schilder, krumm und schief an die Stämme genagelt, die Besucher vor dem Betreten warnten. Stellenweise war die Straße mit einer dünnen Schicht Nadeln bedeckt, die beim Darübergehen ihren Duft verströmten.
Dann begann die Straße vor ihr anzusteigen, und sie musste alle paar Minuten innehalten, um wieder zu Atem zu kommen. Nach einer weiteren Kurve wurde es wieder flacher. Sie passierte einen lebensgroßen gekreuzigten Christus aus rohem Holz, der am Straßenrand vor sich hin faulte. Das Kreuz trug eine Inschrift, aber auch die war vom Moder zerfressen.
Sie ging weiter. Hier und da wurde der Wald lichter, und sie fühlte sich versucht, ihn zu erkunden. Der Bus zur Gletscherhütte überholte sie, und alle Insassen drehten den Kopf nach ihr. Wegweiser besagten, der Gletscher liege zwölf Kilometer voraus. Brücken überspannten die schnellfließenden Bäche, die sich von den Bergen herunter in den See ergossen. Sie machte auf jeder Rast und betrachtete das rauschende Wasser unter sich.
Nach mehr als zweieinhalb Stunden erreichte sie schließlich das Krankenhaus. Es war von einer hohen Mauer umgeben, nur das Dach des Hauptgebäudes mit seinen hohen, zierlichen Schornsteinen war zu sehen. Das grobe Pflaster neben der Straße war erst kürzlich verlegt worden.