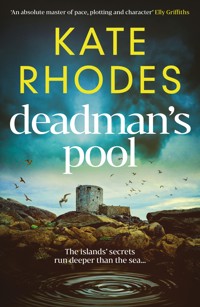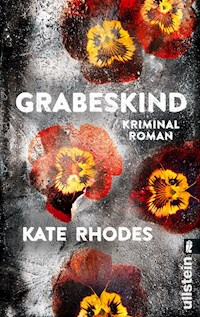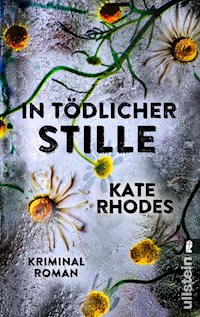
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Beim Joggen im Park werden Clare Riordan und ihr Sohn Mikey entführt. Der zehnjährige Junge kann sich befreien, aber seine Mutter ist spurlos verschwunden. Die Londoner Polizei versucht vergeblich, Mikey zu befragen, um Clare zu finden -ihr einziger Zeuge ist verstummt. Nur Kriminalpsychologin Alice Quentin könnte es mit ihrer einfühlsamen Art gelingen, langsam das Vertrauen des Jungen zu gewinnen. Doch die Zeit drängt: Eine Blutspur deutet darauf hin, dass Clare nicht mehr lange leben wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Clare Riordan beginnt den Tag, wie so oft, mit einer Joggingrunde durch den Park. Doch dieses Mal kommt alles anders. Zwei Unbekannte stürzen sich auf sie und ihren zehnjährigen Sohn Mikey. Von Clare fehlt daraufhin jede Spur, Mikey wird abends allein und desorientiert aufgefunden. Alle Bemühungen, den traumatisierten Jungen zum Sprechen zu bringen, scheitern. Dann taucht mitten in London ein Beutel Blut mit Clares Namen darauf auf.
Die Polizei holt Kriminalpsychologin Alice Quentin zur Hilfe. Sie soll den Jungen dazu bringen, seine Erinnerungen wiederzuerlangen und die Ermittler zu seiner Mutter führen. Doch Mikey bleibt stumm. Erst als weitere Beutel mit Blut gefunden werden, erschließt sich Alice das ganze Ausmaß des Falles. Mikey muss endlich reden, denn die Täter wollen offenbar nur eins: blutige Rache …
Die Autorin
Kate Rhodes wurde in London geboren. Sie ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und lehrte jahrelang an amerikanischen und britischen Universitäten. Für ihre Lyrik wird sie von der Presse hoch gelobt und erhält regelmäßig Preise. Sie lebt in Cambridge, am Ufer des Flusses, für dessen Erkundung sie sich extra ein Kanu zugelegt hat. Ihre Serie um die Kriminalpsychologin Alice Quentin ist eine der größten Entdeckungen im englischen Kriminalroman.
Von Kate Rhodes sind in unserem Hause bereits erschienen:
In der Serie »Ein Alice-Quentin-Thriller«:Im TotengartenBlutiger EngelEismädchenGrabeskindIn tödlicher Stille
Kate Rhodes
In tödlicher Stille
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Corinna Rodewald
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1695-6
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018© 2016 by Kate RhodesTitel der englischen Originalausgabe: Blood Symmetry(Mulholland Books at Hodder & Stoughton, London)Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, München (Hintergrund, Eis); gettyimages / © Nisian Hughes (Blumen); gettyimages / © Bruno Dantas / EyeEm (Blumenkopf)E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
1
Samstag, 11. Oktober
Die Bäume im Clapham Common leuchten in flammenden Herbstfarben. Ein Mann und eine Frau auf einer Parkbank halten sich an den Händen und sehen zu, wie sich die Blätter in der frühen Morgensonne von Rot zu Gold verfärben. Sie sitzen in einem verlassen daliegenden Wäldchen, der Pfad vor ihnen ist von Haselnusssträuchern überwuchert.
»Vielleicht kommen sie ja gar nicht«, sagt der Mann. Die Kälte zehrt bereits an seinen Kräften.
»Gib ihnen noch ein bisschen Zeit. Du bekommst doch nicht etwa Panik?«
»Natürlich nicht. Schließlich war es meine Idee.«
Sie beugt sich zu ihm, um ihn zu küssen, ihr Gesicht ist halb im Schatten vom Kragen ihres schwarzen Wollmantels verborgen, doch der intime Augenblick ist schnell vorüber. Schritte ertönen auf dem Kies, und der Mann lehnt sich angespannt vor – jemand kommt durch die Bäume in ihre Richtung gerannt.
»Jetzt«, flüstert er. »Jetzt bringen wir es wieder in Ordnung.«
Die erste Joggerin ist eine schlanke Frau mit braunen Haaren in einem blauen Trainingsanzug. Ein Junge läuft ihr hinterher, er lacht und wirkt völlig unbeschwert, sein Sweatshirt flattert im Wind um seine schmale Statur. Der Mann tritt aus dem Schatten hervor und packt die Joggerin von hinten; sie wehrt sich heftig, ein Ausdruck erstaunten Wiedererkennens erscheint auf ihrem Gesicht. Sie stößt ihm ihren Ellbogen in die Rippen, während sie dem Jungen zuruft, dass er wegrennen soll, doch die Frau hat ihn bereits geschnappt. Um sich schlagend sinkt er zu Boden, seine schmale Gestalt sackt in sich zusammen, als er das Betäubungsmittel einatmet, eine Augenbinde bedeckt sein Gesicht. Auch seiner Mutter wird ein mit Chloroform getränkter Wattebausch unter die Nase gedrückt, bevor sie sie ins Farngestrüpp schleifen.
Das Paar hievt die beiden leblosen Körper auf den Rücksitz ihres von dichtem Blattwerk getarnten Autos. Mit zitternden Händen deckt der Mann sie zu. Die Frau setzt sich hinters Steuer. Der morgendliche Verkehr ist stärker geworden. Die gefährlichste Etappe ist vorüber; jetzt müssen sie Mutter und Sohn nur noch ins Labor bringen. Der Mann späht noch einmal unter die Decke; Clare Riordans Gesicht ist wachsbleich, der Junge liegt zusammengerollt hinterm Fahrersitz. Der Mann lässt seinen Blick über die Straße vor ihnen schweifen.
»Nicht mehr weit, gleich sind wir da.« Wie ein Mantra wiederholt er die Worte.
Auf einer Seitenstraße kurz vor dem Ziel versperrt ihnen ein Lieferwagen den Weg. Doch als der Mann sich umschaut, bemerkt er eine Bewegung. Durch die Heckscheibe sieht er, wie der Junge über den Asphalt rennt.
»Verdammt«, zischt die Frau. »Ich dachte, die Türen wären verriegelt.«
Mit dumpf schlagendem Herzen stürzt der Mann aus dem Auto. Seine Haut fühlt sich fiebrig an. Der Junge ist verschwunden. Der Mann lässt seinen Blick über Häuser und menschenleere Vorgärten schweifen. An der Kreuzung bleibt er schwer atmend und frustriert stehen. Gott sei Dank hat der Junge ihre Gesichter nicht gesehen. Die Mutter werden sie töten, sobald sie ihnen die benötigten Informationen geliefert hat, doch ihren Sohn haben sie verloren.
2
Montag, 13. Oktober
In der Stadt roch es nach Lagerfeuern und faulendem Laub. Um acht Uhr früh Mitte Oktober war die Luft kalt genug, dass mein Atem Wölkchen vor meinem Mund bildete, als ich die Carlton Street entlangging, auf der die anderen Fußgänger stramm marschierten, um sich warm zu halten. Mir war mulmig bei der Vorstellung, mein erstes Teammeeting in der Rechtspsychologie zu leiten. Vor anderen zu sprechen war für mich immer mit an Panik grenzender Aufregung verbunden. Obwohl ich eine jahrelange psychologische Ausbildung hinter mir hatte, rechnete ich immer noch damit, dass meine ganze Professionalität wie weggeblasen war, sobald ich einer Menschenansammlung gegenüberstand.
Ich hatte mein Outfit mit ungewöhnlicher Sorgfalt ausgesucht: ein dunkelgraues Kleid von Jigsaw, schlichte hochhackige Stiefel, hochgesteckte Haare. Das Ensemble entsprach eher der strengen Version von schick, doch ich hatte es mit einem unverschämt teuren Hermès-Schal aufgelockert. Auftritte im Karrierelook waren ein Trick, den ich schon seit Jahren anwandte. Mit einer Körpergröße von einem Meter fünfzig, blonden Haaren und fünfundvierzig Kilo war ich leicht zu übersehen. Obwohl ich vierunddreißig war, behandelten mich Fremde nicht selten wie ein Kind.
Als ich auf der Dacre Street ankam, zog ich meinen iPod aus der Tasche, aus dem Scott Matthews’ sanfte Stimme mich beruhigte. Der große Brownstone, in dem sich die Rechtspsychologie der Metropolitan Police befand, war so unauffällig, dass man ihn kaum wahrnahm. Er sah aus wie jedes andere schicke Wohnhaus in St James’s Park. Nichts wies darauf hin, dass dort zwölf Psychologen damit beschäftigt waren, die schlimmsten Morde, Vergewaltigungen und Fälle organisierten Verbrechens des Landes zu lösen.
Die Frau am Empfang schenkte mir ein mitfühlendes Lächeln. Es war kein Geheimnis, dass einige der älteren Kollegen gegen meine Ernennung gewesen waren. Jahrzehntelang war die Leitung der Rechtspsychologie mit Christine Jenkins an der Spitze unverändert geblieben. Christine hatte einen Weltklasseruf, folgte jedoch ihren eigenen mysteriösen Regeln. In so einem geschlossenen System war jeder Neuling eine potenzielle Bedrohung des Status quo.
Als ich die Treppe erklomm, schlug mir der eigentümliche Geruch des Gebäudes entgegen: Möbelpolitur, Staub und Geheimnisse. Der Teppich auf den Gängen war abgewetzt, und an den Wänden hingen Fotografien der Pioniere aus den glücklichen Zeiten der Psychoanalyse: Carl Jung, Freud, Melanie Klein. Am liebsten hätte ich das gesamte Gebäude entkernt und jedes einzelne Fenster vergrößert, damit mehr Licht hereinfiel, aber diese Möglichkeit hatte ich nicht. Mein Büro war ein kleines, an das Großraumbüro der anderen Mitarbeiter angrenzendes Vorzimmer, doch ich war stolz auf meinen neuen Titel an der Tür: »Stellvertretende Leiterin«. Für die meisten forensischen Psychologen war die Rechtspsychologie der Met so etwas wie der Heilige Gral. Hier tat man an führender Stelle der Kriminalpsychologie Dienst, und das mit der neuesten Software des Innenministeriums.
Ich sah gerade ein letztes Mal die Tagesordnung durch, als es an meine Tür klopfte. Ohne meine Antwort abzuwarten, kam meine Chefin herein. Christine sah dünner als sonst, als wäre sie zu oft im Fitnessstudio gewesen. Ihre akkurate Bobfrisur passte zu ihrem nüchtern eleganten Outfit: schwarze Hose, weiße Seidenbluse, dezente Perlenohrringe.
»Bereit für den Ring, Alice?«
»Mehr oder weniger.«
»Lassen Sie uns nachher bei Enzo einen Kaffee trinken, dann feiern wir Ihren neuen Posten. Ich muss auch noch etwas mit Ihnen besprechen.«
Diese Art von kryptischer Ankündigung war typisch für Christine, bei der jeder Satz ein zweischneidiges Schwert sein konnte. Wir kannten uns seit einem Jahr, und ich war mittlerweile davon überzeugt, dass sie ihre Berufung verfehlt hatte – mit ihrer geheimnisvollen Aura hätte sie die perfekte Spionin abgegeben.
Zwanzig Kollegen saßen im Besprechungsraum um den großen Tisch versammelt. Mein Mund war wie ausgetrocknet; der Großteil der Psychologen hier war international anerkannt, und im Schnitt waren sie fünfzehn Jahre älter als ich. Einzig Mike Donnelly, der mit seinen weißen Haaren, dem Rauschebart und der stämmigen Statur aussah wie der Weihnachtsmann, bedachte mich mit einem Lächeln. Außer Christine war der unerschütterliche Ire auch der einzige Kollege gewesen, der mir zu meiner neuen Stelle gratuliert hatte.
Mein erster Tagesordnungspunkt wurde schweigend aufgenommen, doch trotz der steifen Atmosphäre trugen die meisten etwas zur Diskussion bei. Ich bemühte mich um eine ungezwungene Stimmung und versuchte sogar einen Witz über die Launen der Psychologie. Am Ende sahen die meisten meiner Kollegen erleichtert aus, doch als sie den Raum verließen, entdeckte ich mehr lächelnde Gesichter, als ich erwartet hätte. Nur eine Kollegin verweilte noch einen Augenblick. Joy Anderson hatte seit meiner Ernennung kaum ein Wort mit mir gewechselt. Sie trug eine üppig verzierte hochgeschlossene Bluse, ihre Miene war eine Mischung aus Trübsal und Feindseligkeit, und sie hatte sich die langen grauen Haare streng aus dem Gesicht gebunden.
»Ich war nicht da, als man Sie ernannt hat, Dr. Quentin. Ich hoffe, es wird Ihnen bei uns gefallen. Leider weiß ich gar nichts über Ihren beruflichen Hintergrund.«
»Vielen Dank für den Empfang«, sagte ich mit einem Lächeln. »Meine letzte Stelle war am Guy’s Hospital. Ich habe zu gewalttätigen Persönlichkeitsstörungen und Psychopathologie in der Kindheit geforscht.«
»Und Sie haben an einigen Fällen von großem öffentlichen Interesse mitgearbeitet?«
»Vier erfolgreiche Morduntersuchungen. Warum kommen Sie nicht mal nachmittags bei mir im Büro vorbei, dann können wir uns ein wenig unterhalten. Ich würde gern mehr über Ihr Forschungsgebiet erfahren.«
Dr. Anderson wich meinem Blick nicht aus. »Verzeihen Sie, dass ich es so sage, aber Sie scheinen mir noch recht unerfahren, um eine so komplexe Einrichtung zu leiten.«
»Die Leiterin ist immer noch Christine. Als ihre Stellvertreterin kümmere ich mich um die Zuweisung von Fällen und Mitteln. Jetzt sollte ich Sie aber zurück an Ihre Arbeit gehen lassen. Und vereinbaren Sie gern einen Termin für ein längeres Gespräch, wenn Sie die Zeit dafür haben.«
Sie nickte knapp und verließ den Raum. Auf dem Flur standen die Mitarbeiter noch in Grüppchen zusammen und plauderten. Sie wirkten wie eine über die Zeit zu einer Einheit verschmolzene Gruppe. Es könnte Monate dauern, bis ich ihre Abwehr durchbrochen hatte. Ich kehrte in mein Büro zurück, doch niemand klopfte an die Tür, während ich mich mit meinem neuen Computer anzufreunden versuchte.
Bei Enzo war es menschenleer, als ich um elf dort eintraf. Schon von Weitem konnte ich Christines Anspannung daran erkennen, wie sie die Schultern hochzog, während sie in einen Bericht vertieft dasaß. Als ich bei ihr war, schlug sie die Mappe abrupt zu, und ihr Lächeln war professionell kühl. Ich war immer noch nicht sicher, ob unter all dem sang-froid auch ein Mensch steckte.
»Dr. Anderson ist nicht gerade ein Fan von mir, oder?«
»Joy mag einfach keine Veränderungen, das ist alles. Das wird schon.«
»Hoffentlich lässt sie sich nicht zu lange Zeit damit. Sie machen doch sonst nie Pause, Christine, es geht wohl um etwas Wichtiges.«
»Hier können wir ungestört reden. Bestellen wir, dann erkläre ich es Ihnen.«
Informelle Gespräche verunsicherten sie offensichtlich. Unsere Unterhaltungen blieben immer im strikt professionellen Rahmen, sodass ich keine Ahnung hatte, ob Christine allein oder mit jemandem zusammenlebte. Tiefes Schweigen hatte sich zwischen uns ausgebreitet, als endlich unsere Getränke kamen. Christine nippte an ihrem Espresso, während ich darauf wartete, dass sie mir verkündete, sie habe einen Verdienstorden bekommen oder sei ins Innenministerium befördert worden. Stattdessen schob sie mir einen Schnellhefter über den Tisch zu.
»Ich will, dass Sie diesen Fall übernehmen, Alice.«
Ich überflog die erste Seite. »Die Angelegenheit ist doch landesweit in den Nachrichten. Die Frau ist am Wochenende mit ihrem Sohn laufen gegangen und nicht nach Hause gekommen.«
»Wer auch immer sie entführt hat, hat eine Blutprobe von ihr vor ein Bürogebäude gelegt. Das Blut war in einem Plasmabeutel aus dem Krankenhaus und mit ihrem Namen beschriftet.«
»Wo ist der Junge?«
»Ein psychiatrischer Krankenpfleger kümmert sich um ihn in einem sicheren Versteck. Sie sollen in dem Fall beraten und die Betreuung des Jungen beaufsichtigen. Er hat noch kein Wort gesagt, seitdem die Polizei ihn vor zwei Tagen aufgelesen hat.«
»Das überrascht mich nicht. Es verschlüge den meisten Kindern die Sprache, wenn sie sähen, wie ihre Mutter entführt wird.« Ich sah zu Christine auf. »Habe ich eine Wahl?«
Sie zog die Augenbrauen hoch. »Es war schon ein anderer Therapeut bei ihm, aber der Junge ist auf ihn losgegangen.«
»Schlimm?«
»Nur ein paar blaue Flecken. Wahrscheinlich hat er um sich geschlagen, um zu zeigen, dass er noch nicht bereit ist zu reden.«
»Mike Donnelly hat doch viel mehr Erfahrung mit verhaltensgestörten Kindern. Warum fragen Sie nicht ihn?«
»Es muss eine weibliche Therapeutin sein; der Junge steht seiner Mutter sehr nahe. Er hat keine männlichen Verwandten, und Sie haben Erfahrung mit traumatisierten Kindern. Wir brauchen die Fakten, bevor er sie vergisst. Sie könnten mit im Versteck wohnen, bis er so weit ist.«
»Ich dürfte maximal jeden zweiten Tag eingreifen – mehr schadet oft nur. Aber selbst dann kann es Wochen dauern, bis ich sein Vertrauen gewonnen habe.«
Christine lächelte mich aufmunternd an. »Sie können heute Nachmittag anfangen, Alice.«
Ich blätterte die Bilder in der Akte durch. Die Mutter des Jungen war eine attraktive Frau Mitte vierzig, die braunen Haare elegant zum Zopf gebunden. Etwas rührte sich in meiner Brust, als ich die Aufnahme ihres elfjährigen Sohnes betrachtete. Mein Bruder hatte als Kind genauso verletzlich ausgesehen: ein schmales Gesicht, himmelblaue Augen, dunkle Haare, die unbedingt geschnitten werden mussten.
»Warum ist er in einem Versteck?«
»Die Polizei geht davon aus, dass der Entführer auch den Jungen mitnehmen wollte. Bis auf eine Tante, die er nicht häufig trifft, hat er keine Familie. Riordan hat eine Verfügung wegen Belästigung gegen sie erwirken lassen.«
»Und der Vater?«
»Bei einem Verkehrsunfall gestorben, als Mikey fünf war. Der Junge hat es anscheinend nur schwer weggesteckt. Laut seiner Lehrerin hat er danach ein halbes Jahr lang nicht gesprochen. Er ist klug für sein Alter, sportlich und künstlerisch begabt, hat aber Schwierigkeiten, sich zu integrieren.« Christine stellte ihre Tasse ab. »Eine Sache sollten Sie noch wissen: Don Burns leitet die Ermittlungen. Scotland Yard wollte den Fall in guten Händen wissen.«
»Ich dachte, Paare dürfen nicht zusammenarbeiten.« Nur sehr wenige wussten von meiner Beziehung zu Burns; ich hatte Christine auch nur davon erzählt, falls es zu einem Interessenkonflikt führen sollte.
»In der Zentrale haben sie eine Ausnahme gemacht.«
»Wer hat denen von unserer Beziehung erzählt?«
Sie sah mich missbilligend an. »So etwas spricht sich rum, Alice.«
»Jetzt ist kein guter Zeitpunkt. Ich würde mich lieber auf meine Stelle konzentrieren und jemand anderen einteilen.«
»Niemand ist so kompetent wie Sie. Dieser Fall wird groß in die Medien kommen; Sie und Burns wissen, wie man mit der Presse umgeht.«
Aus Erfahrung wusste ich, dass die Zeitungen sich um Informationen reißen würden, und so wie sie die schlimmsten Ängste aller Eltern weckten, würde die Angelegenheit Millionen von Klicks auf ihren Websites bringen. Christine sah mich so eindringlich an, dass es mir schon unangenehm wurde. Ich hatte keine Wahl: Ich musste einen Fall annehmen, in dem sich womöglich herausstellte, dass ein verletzlicher Junge erfuhr, dass seine Mutter umgebracht worden war. Die Aussicht darauf war so ernüchternd, dass ich nichts weiter entgegnete. Meine Vorgesetzte schien den Druck genauso zu spüren. Als sie aufstand, fiel mir erneut auf, wie dünn sie geworden war; in den zwei Monaten, die seit meinem Vorstellungsgespräch vergangen waren, hatte sie um eine Kleidergröße abgenommen. Sie bestand darauf zu zahlen und ließ mich dann mit meinem Cappuccino allein, den ich nur mit Mühe hinunterbrachte.
Ich war immer noch in Gedanken bei dem Fall, als ich ins Institut zurückkehrte. Ich hatte bereits angebissen. Als mein Taxi vorfuhr, hatte sich mir Claire Riordans Hochglanzlächeln bereits unauslöschlich eingeprägt. Während der Wagen nach Süden durch Holborn in Richtung Themse fuhr, versuchte ich, mich in ihren Sohn hineinzuversetzen. Ich ließ den Blick über die Leute in Anzügen schweifen, die mit Kaffeebechern, so groß, dass man darin ertrinken könnte, den Bürgersteig entlangschlenderten. Bisher hatte der Junge jegliche Hilfe abgelehnt, den Traumatherapeuten angegriffen und sich anschließend zusammengerollt. Selbst wenn Christine an mich glaubte, war es nicht unwahrscheinlich, dass er mit mir genauso umging. Ich holte mein Handy aus der Tasche und schickte Burns eine Nachricht, bekam jedoch keine Antwort. Jetzt, wo er Detective Chief Inspector für ganz King’s Cross war, unterstanden ihm Hunderte Mitarbeiter. Es brauchte schon ein kleines Wunder, um ihn während seiner Arbeitszeit zu erreichen.
Das Versteck lag in einer Sackgasse in Bermondsey. Im schwindenden Licht färbten sich die Blutbuchen daneben schwarz. Davor parkte ein Streifenwagen, doch keiner der beiden Uniformierten zuckte auch nur mit der Wimper, als ich mich näherte; offensichtlich standen kleine Blondinen nicht auf ihrer Liste potentzieller Gefahren, dabei hätte ich bis an die Zähne bewaffnet sein können. Die Doppelhaushälfte machte von der Straße aus nicht viel her. Sie war gelb verklinkert, die Fenster im Erdgeschoss wurden von einem hohen Zaun verdeckt, und der Vorgarten war eine Wildnis aus wucherndem Lavendel.
Als ich klingelte, wurde die Tür so schnell von einem indisch aussehenden Mann in etwa meinem Alter aufgezogen, dass er direkt dahinter gewartet haben musste. Gurpreet Singh sah mich sanft an. Er war mittelgroß, schlank und hatte seine schwarzen Haare zu einem kurzen Pferdeschwanz zusammengebunden. Zaghaft lächelte er mich an, als ich ihm die Hand gab.
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Alice.« Er führte mich den Flur entlang. »Mikey sieht fern. Ich habe ihn so ziemlich alles machen lassen, was er will, solange er sich an die Mahlzeiten und Schlafenszeit hält.«
»Klingt nach einer klugen Strategie. Hat er gesprochen?«
»Nur ein paar Brocken. Ich habe ihn noch nicht weinen oder lächeln sehen, aber es sind ja auch erst achtundvierzig Stunden. Der andere Therapeut hat es zu sehr forciert. Er hat sofort Puppen herausgeholt, mit denen Mikey die Geschehnisse nachstellen sollte.«
»Ich werde versuchen, etwas behutsamer vorzugehen.«
»Und geben Sie acht: Kommen Sie ihm nicht zu nahe. Wenn er sich in die Ecke gedrängt fühlt, wird er sich wieder wehren.«
Meine Hände kribbelten, als Gurpreet mich ins Wohnzimmer führte. Der Raum hatte etwas Verstörendes an sich: die Luft stickig und überheizt, triste olivgrüne Wände, abgewetzte Möbel. Mikey Riordan kauerte auf dem Sofa. Er sah klein aus für einen Elfjährigen, flaumiges dunkles Haar umrahmte sein Gesicht. Den Blick hielt er starr auf den Bildschirm gerichtet. Eine Reihe von Blutergüssen verlief von seiner Schläfe bis zum Kiefer, und um sein Auge schillerte es in allen Regenbogenfarben. Er sah so zerbrechlich aus, dass ich einen Anflug von Wut unterdrücken musste; zu viel Mitgefühl würde nur mein Urteilsvermögen beeinträchtigen.
»Das hier ist Alice, Mikey. Ist es in Ordnung, wenn du mit ihr allein bist, oder soll ich lieber bleiben?« Eine geschlagene Minute blieb Gurpreet stehen, während der Junge unverwandt weiter auf den Fernsehbildschirm starrte. »Gut, ich bin dann in der Küche, falls du mich brauchst.«
Der Junge schaute mit abgestelltem Ton einen Western, in dem ein Dutzend Männer auf Pferden lautlose Kugeln auf einen abfahrenden Zug abfeuerten. Ich achtete darauf, Mikey nicht anzustarren, als ich mich auf ein Kissen auf den Boden setzte, die Hinweise über Körpersprache im Kopf: Traumatisierte Kinder entspannen sich nur dann, wenn sie das Gefühl haben, körperlich die Kontrolle zu behalten. Ich richtete meinen Blick auf den Fernseher, als ich sprach.
»Ich gucke auch gern Western. Bei all den Pferden wünschte ich immer, ich könnte auch reiten.« Die Ähnlichkeit mit meinem Bruder in dem Alter war nun noch deutlicher. Vor zwanzig Jahren hatte Will den gleichen verlorenen Gesichtsausdruck gehabt und genauso unruhig herumgezappelt.
»Ich bleibe eine Stunde, Mikey. Du musst nicht mit mir reden, aber wenn du Lust hast zu plaudern, dann ist das prima. Ich helfe der Polizei bei der Suche nach deiner Mum, du kannst mich also fragen, was wir machen.«
Er sah mich noch immer nicht an, doch seine Schultern entspannten sich. Das Wissen, dass mein Besuch nicht lange dauern würde, schien ihn zu beruhigen, wobei meine ruhige Stimme vermutlich ebenfalls dazu beitrug. Gurpreet kam mit einem Tablett zurück. Er stellte ein Glas Milch vor Mikey und reichte mir eine Tasse Tee und blieb dann noch ein paar Minuten in der Tür stehen, bevor er wieder verschwand. Mikey und ich saßen schweigend zusammen, bis der Film zu Ende war, dann holte ich ein paar Buntstifte und zwei kleine Malblöcke aus meiner Tasche und legte einen davon aufs Sofa, nahe genug, dass Mikey ihn nehmen konnte.
»Ich habe gehört, dass du gern malst, Mikey. Ich auch, aber ich bin nicht so gut darin.«
Seine ausbleibende Antwort besorgte mich. Bislang hatte es auch keinerlei Zeichen nonverbaler Kommunikation gegeben; er hatte sich hinter einer Mauer aus Schweigen verschanzt, die zu dick war, um sie zu durchbrechen. Selbst meine Ablenkungsaktivität konnte ihn nicht hervorlocken. Ich sah mich in dem nichtssagenden Zimmer um; es wirkte, als wären die letzten Bewohner in aller Eile ausgezogen. Die einzige Dekoration war eine Vase mit roten Chrysanthemen, die auf dem Kaminsims vor sich hin welkten.
»Ich versuch mal die Blumen da. Du kannst malen, was du willst, wenn du Lust hast mitzumachen.«
Als ich ihm einen erneuten Blick zuwarf, hatte er die Knie bis unters Kinn gezogen. Den Malblock hatte er nicht angerührt, aber er sah mir bei meinen Bemühungen zu. Während mein Stift über das Papier strich, erklärte ich Mikey, dass ich schon mit anderen Kindern gearbeitet hatte, die Schlimmes durchgemacht hatten. Ich erzählte ihm, dass ich wusste, wie viel Angst er haben musste, doch dass er an einem sicheren Ort war und ich hoffte, er würde sich von mir helfen lassen. Doch sein Schweigen dehnte sich immer weiter aus, während ich meine Zeichnung beendete. Als sich mein Besuch dem Ende zuneigte, hielt ich meinen Block hoch, um ihm mein Bild zu zeigen.
»Nicht besonders gut geworden, oder? Aber hat Spaß gemacht, es auszuprobieren.«
Seine Miene blieb ernst, sein blasser Blick flatterte über das Blatt. Bei der Arbeit mit Kindern gibt es manchmal Augenblicke, in denen es schwierig ist, die angemessene Distanz zu wahren, und das hier war genau so einer. Mikey sah so zerbrechlich aus, ich hätte am liebsten seine Hand genommen. Er hielt sich jedoch so fest umklammert, dass jegliche Berührung seinen Bewältigungsmechanismus in der Luft zerfetzen könnte.
»Der Block und die Stifte sind für dich.« Ich legte meine Visitenkarte auf den Couchtisch. »Du kannst mich auch jederzeit anrufen oder mir eine Nachricht schicken. Möchtest du, dass ich morgen wiederkomme?«
Er hielt den Blick weiter auf den Boden gerichtet, doch zum ersten Mal bewegten sich seine Lippen, und ein dünnes Flüstern kam hervor. »Nicht mehr weit, gleich sind wir da.«
»Das klingt nach einem Ja. Halb sechs bin ich da, und ich bringe Pizza mit.«
Ich hoffte, er würde noch etwas sagen, doch es kam nichts mehr. Gurpreet wartete im Flur auf mich. Ich hatte den Eindruck, er hätte damit gerechnet, ich würde Reißaus nehmen wie die anderen. Jedenfalls lächelte er mich an, als hätte ich eine Medaille verdient, weil ich eine Stunde durchgehalten hatte.
»Sollen wir uns in die Küche setzen?«, fragte ich.
Ein Vorschlag, den ich sogleich bereute. Der Raum war in etwa so groß wie ein Schuhkarton und senfgelb gestrichen, und ich bekam sofort Platzangst, ignorierte sie jedoch, und wir setzten uns, um uns über Betreuungsstrategien auszutauschen. Der Junge zeigte alle klassischen Anzeichen von Hyperreaktivität: Angstzustände, Beeinträchtigung von Schlaf und Appetit sowie selektiver Mutismus. Laute Geräusche und plötzliche Bewegungen jagten ihm Angst ein, und es gab auch Zeichen kindlicher Regression. Er ging zum Angriff über, wenn man ihn aufregte, und beide Nächte im Unterschlupf hatte er ins Bett gemacht, obwohl er elf Jahre alt war. Ich machte mir Notizen, während Gurpreet die Symptome des Kindes beschrieb.
»Hat er irgendwas nachgespielt?«, wollte ich wissen.
»Bisher hat er nur vermieden. Er träumt vor sich hin und starrt auf den Fernseher, wird aber zugänglicher. Er wirkt zwar abwesend, aber ich glaube, er hört zu.«
»Wie reagiert er auf den Namen seiner Mutter?«
»Er zieht sich vollkommen zurück. Ich versichere ihm immer wieder, dass die Polizei alles in ihrer Macht Stehende tut.«
»Darf man seine Hand nehmen oder ihm auf die Schulter klopfen?«
»Noch nicht. Er beißt oder schlägt um sich, wenn ich ihm zu nahe komme.« Er hielt das Handgelenk hoch, um mir einen tiefen roten Kratzer auf seiner Hand zu zeigen.
Mitfühlend sah ich ihn an. »Natürlich hat er Angst. Wenn er mich erst einmal akzeptiert hat, kann ich jede zweite Nacht hier verbringen.«
»Das sind gute Nachrichten. Meine eigenen Kinder vergessen mich ja, wenn ich nicht bald nach Hause komme.«
»Er hat eben ein paar Worte gesagt: Nicht mehr weit, gleich sind wir da.«
Gurpreet nickte. »Das ist sein Slogan, aber echte Kommunikation findet nicht statt.«
»Es hat sicher etwas zu bedeuten, wenn er sonst nichts sagt. Können Sie Buch führen über alles, was er sagt? Dann entdecken wir vielleicht Zusammenhänge.«
Auf dem Heimweg dachte ich über Mikey Riordans Symptome nach. Es überraschte mich nicht, dass er nicht schlafen konnte. Er hatte schon viel zu viel Schmerzen erlitten, nach dem Verlust seines Vaters mit fünf Jahren. Selbst wenn die Erinnerung daran vergraben war, kam sie doch sicher oft in Albträumen an die Oberfläche, und jetzt wiederholte sich das Trauma. Das Geheimnis über das Verschwinden seiner Mutter mochte in seinem Kopf verschlossen sein. Und nur wenn ich in seiner Nähe blieb, gefangen im stickigen Wohnzimmer des Unterschlupfs, hatte ich eine Chance, sein Schweigen zu durchbrechen.
Burns machte mir an diesem Abend mit seinem Telefon zwischen Kiefer und Schulter geklemmt die Tür zu seiner Wohnung in der Southwark Bridge Road auf. Geistesabwesend drückte er mir einen Kuss auf den Scheitel und winkte mich dann herein. Er hatte sich ein Handtuch um den Nacken gelegt, sein nasses Haar war beinahe schwarz, seine Miene besorgt. Ich ertappte mich immer noch hin und wieder dabei, wie ich ihn erstaunt anstarrte. Er war das Gegenteil der Männer, auf die ich normalerweise stand: groß und kräftig wie ein Schwergewichtsboxer. Alle seine Züge waren übertrieben, von seinen groben Wangenknochen bis zu seiner gebrochenen Nase und seinen dunklen Augen, deren Blick besagte, dass er keine Gefangenen machte.
Er warf sein Handy auf den Couchtisch und sah von seiner vollen Größe auf mich herab. »Wie lief das Teammeeting?«
»Die Kollegen sind nicht gerade erfreut über meine Ankunft.«
»Die haben nur Angst, dass du sie ausstichst.«
»Vielleicht werde ich das auch. Diese Stelle wird mich zur Expertin für jeden mordenden Psychopathen des Landes machen.«
»Ist das dein größtes Ziel?« Er strich mir durchs Haar und streifte dabei mein Schlüsselbein. »Wann hast du dir die Haare schneiden lassen?«
»Samstag.«
»Nicht kürzer, ja? Mir gefällt es länger besser.«
»Gott, du bist so ein Klischee. Ich bin nur vorbeigekommen, weil ich dich nach dem Riordan-Fall fragen wollte.«
»Lügnerin, du willst was essen.«
»Woher weißt du das denn?«
Er legte mir den Arm um die Schultern, und wir gingen in die Küche, wo ich mich an den Frühstückstresen lehnte, um von dort seine Version von Kochen zu betrachten. Zu seinen Mahlzeiten gehörte stets bei nuklearen Temperaturen angebratenes Fleisch. Er ließ Steaks auf eine Gusseisenplatte fallen und schüttete dann eine Packung Salat in eine Schüssel. Ich spürte seine Anziehungskraft, während ich ihm zusah.
»Hast du der Zentrale von uns erzählt, Burns?«
»Hör auf, mich beim Nachnamen zu nennen, um Gottes willen.«
»Ja oder nein?«
Er nickte beiläufig. »Ich hab letzte Woche eine Offenlegungsmeldung geschickt.«
»Ohne mich zu fragen?«
»Du hättest gesagt, es sei zu früh.«
»Natürlich.«
»Es wird getratscht, Alice. So haben wir die Kontrolle über das, was geredet wird.«
Auch wenn es stimmte, ärgerte es mich doch, dass er persönliche Details preisgegeben hatte, ohne sich vorher mit mir abzusprechen. Er entschädigte mich mit einem einfachen, aber schmackhaften Essen: erstklassiges Rib-Eye-Steak, ein großes Stück Baguette, Chicoréesalat und ein dank der Tannine vollmundiger Rotwein. Genüsslich nahm ich einen Schluck und lehnte mich entspannt zurück.
»Die Jungs haben mich gestern dazu genötigt, mit ihnen zum Paintball zu gehen.« Er erschauderte übertrieben.
»Und du fandest es großartig?«
»Es war die Hölle auf Erden; ich war über und über mit hellrotem Glibber bedeckt. Als der Riordan-Fall dann auf meinem Schreibtisch gelandet ist, musste ich sie nach Hause bringen.« Stirnrunzelnd stellte er sein Glas ab. »Ich bin nicht gerade begeistert, dass du mir zugewiesen wurdest.«
»Wie nett.«
»Du bist die Beste auf deinem Gebiet, aber wir waren uns doch einig, dass wir nicht zusammenarbeiten würden.« Er sah mich an. »Das wird die größte Story in den Medien dieses Jahr: Eine hübsche Frau wird entführt, und nur ihr niedlicher Junge mit den blauen Augen hat die Bösewichte gesehen. Sie schreien schon nach Bildern.«
»Halt sie von ihm fern; er hängt so schon am seidenen Faden. Was habt ihr bisher?«
»Ein Nachbar hat sie am Samstag um sieben Uhr morgens im Clapham Common gesehen. Das war ihre Routine: lange laufen gehen, sobald sie aufstehen, danach dann ein ausgiebiges Frühstück. Ein Zeuge hat sie in ein bewaldetes Stück laufen sehen, und ein paar Minuten später fuhr ein Auto weg.«
»Eine Entführung?«
»Sieht ganz danach aus. Den Jungen hat man Stunden später in Walworth aufgelesen; wie er dort hinkam … keine Ahnung. Spätabends hat dann jemand einen halben Liter Blut von Riordan auf einer Vortreppe in Bishopsgate hinterlassen. Sie war Chefärztin für Bluterkrankungen am Royal Free Hospital.«
»Interessante Verbindung.«
»Sie hat ihre ganze berufliche Laufbahn in der Hämatologie gearbeitet.«
»Sprichst du in der Vergangenheitsform, weil du glaubst, dass sie tot ist?«
»Entführte Frauen werden in der Regel vergewaltigt und anschließend zügig umgebracht. Du kennst das Schema.«
»Aber das hier ist untypisch. Es könnte jemand sein, den sie kannte und der Zugriff auf ihren Terminkalender hatte. Wie wurde das Blut hinterlassen?«
»In einem Plastikbeutel abgelegt. Das Gebäude liegt nicht in Reichweite der Überwachungskameras. Derjenige ist vermutlich über eine Seitenstraße gekommen und dann weitergeschlendert.«
»Wenn er ein solches Risiko eingegangen ist, kann der Ort nicht unwichtig gewesen sein.«
»Oder er war praktisch.«
»Es muss symbolisch für etwas stehen.«
Die Nachricht war eindeutig: Riordan hatte bereits einen halben Liter Blut verloren. Ihre Zeit war begrenzt. »Es ist zu durchdacht, um von etwas Sexuellem motiviert zu sein. Gibt es irgendwelche Verbindungen zu vergangenen Fällen?«
»Noch nicht, aber lass uns das bis morgen auf Eis legen. Wir haben schließlich Dienstschluss.«
Als wir beinahe mit dem Essen fertig waren, klingelte sein Handy erneut, und er fluchte lautstark. »Danach wird das verdammte Teil ausgeschaltet.«
Er stampfte in den Flur, doch ich wusste, dass sein Telefon keine Ruhe geben würde, bis Clare Riordan gefunden worden war. Ich konnte nicht anders, als einen Blick in die Mappe zu werfen, die er auf dem Küchentisch hatte liegen lassen, und zog ein Foto von dem Ort hervor, an der die Ärztin zuletzt gesehen worden war. Darauf war eine Lichtung zu sehen, die Bäume warfen dichte Schatten auf den gewundenen Pfad. An einem der Bäume war ein Schild angebracht worden, aber es war zu weit weg, um es genau erkennen zu können. Es schienen zwei vertikale Streifen – der eine weiß, der andere schwarz – auf grauem Untergrund zu sein. Es zog meinen Blick auf sich, konnte aber schon lange, bevor Clare verschwand, dort befestigt worden sein. Ansonsten fiel mir nichts Ungewöhnliches auf, und so legte ich die Aufnahme zurück, bevor Burns sich beschweren konnte, und machte es mir auf seinem übergroßen Sofa gemütlich.
Seit vier Monaten, seit der Trennung von seiner Frau, wohnte Burns in der Mietwohnung, und allmählich verschwanden die im Flur gestapelten Kisten. Zwei Landschaftsmalereien füllten die breiteste Wand im Wohnzimmer. Sie waren wunderschön, wenn auch schlicht: Wintersonne, die in einer stürmischen See versank, Vögel, die über einer Insel aus Granitgestein kreisten. Ich hörte Burns diskutieren, während ich mich im Zimmer umsah. Es hatte keinerlei Ähnlichkeit mit den kahlen Wänden und dem spärlichen Mobiliar in meiner Wohnung. Sein ganzes Leben war hier ausgestellt. An einer riesigen Pinnwand hingen verschiedene Fotos seiner Söhne, auf dem Boden stand die Sporttasche, auf den Möbeln stapelten sich Zeitungen und Notizbücher. Die Ordnungsfanatikerin in mir sehnte sich danach, alles in einen Schrank zu stopfen und außer Sichtweite zu verstecken.
Als Burns wiederkam, zuckte es um seine Mundwinkel. Über die Jahre hatte ich diesen Gesichtsausdruck Dutzende Male gesehen, und ich kannte diesen Zug auch von mir selbst; keiner von uns beiden würde zur Ruhe kommen, solange es Probleme zu lösen gab. Er schaltete sein Handy aus und lümmelte sich dann neben mich auf das Sofa, eine Hand auf meinem Oberschenkel.
»Hast du die gemalt?«, fragte ich mit Blick auf die Landschaften. Sein Jahr auf der Edinburgh Art School war ein Geheimnis, das nur wenige seiner Kollegen von der Polizei kannten.
Er nickte. »Ich war mal im Januar im Wohnwagen meiner Eltern in Oban. Von da aus kann man über die Bucht bis nach Mull sehen. Das Licht ist der Wahnsinn.« Sein Gesicht entspannte sich wieder ein klein wenig.
»Kann ich sie dir abkaufen? Sie würden meinem Wohnzimmer ein bisschen Stil verleihen.«
»Nein, auf keinen Fall. Ich muss die Hebriden sehen, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme.«
»Würdest du gern mal wieder dorthin?«
»Ich nehme dich irgendwann mal mit. Nur wie würdest du mit mir in einem Wohnwagen zurechtkommen, wenn draußen der Sturm tost?«
»Das würde ich überleben.«
»Und wie, wenn ich fragen darf?«
»Kartenspiele, Monopoly, Tee.«
»Das ist also deine Vorstellung von guter Unterhaltung?« Er sah mich amüsiert an.
Ich konnte nicht widerstehen und beugte mich zu ihm, um ihn zu küssen, meine Hand lag auf seiner Brust, seine Finger fuhren durch mein Haar. Den Ausschlag gab schließlich sein Duft: Seife, Moschus und frische Luft. Ich hatte mir vorgemacht, dass ich direkt nach dem Essen wieder gehen würde, doch das Verlangen in seinem Gesicht war schwer zu ignorieren. Ich konzentrierte mich auf seine Hände, begierig und fordernd, wie sie sich mit dem Reißverschluss meines Kleids abmühten. Der Sex war schnell, aber befriedigend, Burns presste meine Schultern ins Sofa, und sein Arm hielt mich fest, als rechnete er damit, dass ich zu entkommen versuchte. Danach glühte ich am ganzen Körper, aber meine erste Reaktion war ein Lachen. Burns war noch fast vollständig angezogen, während meine Kleider auf dem Fußboden verstreut lagen.
»Warum lachst du?«
»Du hattest es wohl eilig.«
»Das ist deine Schuld.« Er umklammerte mein Handgelenk fester.
»Ich sollte mich auf den Weg machen. Morgen muss ich früh raus.«
»Kannst du nicht ausnahmsweise mal bleiben?«
»Heute nicht.«
»Aber bald?«
»Wenn ich herausgefunden habe, was mich davon abhält.«
Er seufzte entnervt. »Ich dachte, Seelenklempner wüssten, wie sie ihre Ängste unter Kontrolle halten.«
»Die Ängste anderer, nicht unsere eigenen.« Ich gab ihm einen Abschiedskuss und stand auf.
Er gab ein Geräusch von sich, das wie eine Mischung aus Stöhnen und Lachen klang. »Wie ist deine Wahl eigentlich auf mich gefallen?«
»Es war vor allem die Lust.« Ich hätte auch Ehrlichkeit oder Integrität sagen können, aber es war einfacher zu lügen.
»Ist das alles?« Er strich mir mit dem Daumen über die Wange. »Meine Jungs glauben, ich würde mir dich nur einbilden. Sie wollen dich unbedingt treffen.«
»Es ist noch zu früh. Du und Julie habt euch doch gerade erst getrennt.«
»Sie wissen aber, dass wir danach zusammengekommen sind. Es ist kein Geheimnis.«
»Gibst du niemals auf?«
»Nicht, ehe du zugestimmt hast.«
Ich schlüpfte wieder in mein Kleid, um das Gespräch zu beenden. Erst als ich im Flur meinen Mantel holte, überkam mich wieder Panik. Zwischen den Jacken und Schals blitzte etwas Glänzendes hervor: ein Lederriemen, glatt vom Gebrauch, eine Pistole mit schwarzem Griff im Halfter. Erstaunt blickte ich sie an. Seit vier Jahren kannte ich Burns nun schon, und ich hatte keine Ahnung gehabt, dass er eine Waffe trug. Ich stand immer noch wie angewurzelt da, als er mit seinen Schuhen in der Hand aus dem Wohnzimmer spaziert kam.
»Das ist eine Überraschung.«
»Sie ist nicht geladen. Ich hätte sie wegschließen sollen.«
»Ich wusste gar nicht, dass du eine Lizenz hast.«
Er zuckte langsam die Achseln. »Jede Dienststelle braucht ein paar Kollegen mit Waffenschein. Es ist nur vernünftig, dass ich einer von ihnen bin.«
»Trägst du sie die ganze Zeit?«
»Nur bei der Arbeit. Ich benutze sie nicht so viel.«
Ich wollte ihn fragen, wie es sich anfühlte, eine tödliche Waffe neben dem Herzen zu tragen, doch seine ausdruckslose Miene zeigte, dass es nichts mehr dazu zu sagen gab. Obwohl es seltsam war, bestand er darauf, mich nach Hause zu begleiten. Alle Kneipen waren geschlossen, der Fluss glitt unbemerkt durch die Stadt, ein paar Sterne waren über dem Canary Wharf an den Himmel gestreut. Zuerst liefen wir schweigend nebeneinanderher, dann erzählte er vom Fall. Ich fragte nach dem Schild am Tatort mit seinen rätselhaften schwarzen und weißen Streifen, doch er konnte mir nicht sagen, was es bedeutete. Er wollte lieber über Clare Riordan sprechen. Sie war eine gewissenhafte alleinerziehende Mutter und verdiente Ärztin an einem staatlichen Krankenhaus gewesen – nicht der Typ Mensch, der dunkle Geheimnisse mit sich herumtrug. Ich musste an das Gesicht ihres Sohnes am Nachmittag denken, es war leichenblass gewesen. Meine Gefühle für Burns brodelten immer wieder unter der Oberfläche hervor, während ich ihm zuhörte; seine Waffe erinnerte mich daran, welchen Gefahren er ausgesetzt war. Etwas in mir schämte sich. Ich war eine ausgebildete Psychologin und autorisiert, mich in die Innenwelt anderer Menschen zu vertiefen, und doch war ich, was unsere Beziehung betraf, vor Angst wie gelähmt. Vielleicht, weil es Neuland für mich war. Bisher hatte ich mich an flüchtige Affären und One-Night-Stands gehalten, aber Burns war etwas anderes. Ich hatte noch nie jemanden getroffen, der so hartnäckig war. Wenn ich versuchte davonzurennen, wäre es nur eine Frage der Zeit, bis er mich gefunden hätte.
3
Die Frau lässt ihren Blick durch das Labor schweifen. Es ist so sauber wie im Operationssaal. Die Wände, die Decke und der Fußboden sind glänzend weiß, die kühle Luft riecht übel nach Jod und frischer Farbe. Bis auf einen Schrank und einen Metalltisch gibt es kaum Einrichtung. Eine Neonröhre erhellt den Raum mit ihrem grellen Schein. Die Frau hat Tage damit zugebracht, dem Mann zu helfen, Schallschutz, Flaschenzüge und Verdunkelungsrollos anzubringen. Ihr Blick fällt wieder auf Riordans Gesicht: Ihre Augen sind zugeschwollen, seitlich am Hals erkennt man eine frische Wunde, dunkles Haar, das seinen Glanz verliert. Die Ärztin ist nach wie vor bewusstlos und an einen Zahnarztstuhl aus Leder geschnallt. Die Frau überprüft die an der Decke angebrachten Stricke. Als sie sich davon überzeugt hat, dass die Fesseln halten, wendet sie sich an den Mann.
»Bereit?«
Er nickt. »Geh nicht zu hart mit ihr um. Wir brauchen lediglich die Informationen.« Ihm steht der Schweiß auf der Stirn. Sie kann sehen, dass er heute schwächer ist, mehr Angst hat als zuvor, auch wenn er es niemals zugeben würde.
»Ich will immer noch den Jungen hier haben.«
»Was soll das bringen?«
Ihre Augen funkeln. »Wir können sie schneller knacken, wenn sie ihn sieht.«
»Es wird nicht leicht sein, ihn zu finden.« Der Mann verschränkt fest die Arme vor der Brust.
»Warum machst du dir solche Sorgen? Die anderen haben dir nichts ausgemacht.«
»Die haben auch direkt die Namen ausgespuckt. Sie hier wehrt sich.«
»Nicht mehr lange. Hilf mir, sie umzudrehen.«
Die Frau sieht ihm zu, wie er sich abmüht, und mit einem Mal wird ihr bewusst, wie sehr ihn seine Krankheit geschwächt hat. Nach der Kraftanstrengung, ihr Opfer auf die Seite zu hieven und die Lederriemen festzuzurren, ist er außer Atem. Die Frau konzentriert sich auf ihre Aufgabe und zerrt an einem Hebel, bis Riordans Arme gestreckt sind. Jetzt hängt sie an den Handgelenken von der Decke, ihre Füße baumeln über dem Boden, und sie ist so stark sediert, dass sie nur kurz auftaucht, als die Nadel sich in ihren Rücken bohrt. Ein dumpfer Schrei hallt von den Wänden wider, während das Blut in den Plasmabeutel sprudelt. Als der Beutel voll ist, landet ein letzter Spritzer auf den Fliesen. Der dünne rote Strich folgt dem Weg des geringsten Widerstands und schlängelt sich über den Fußboden.
»Das wird sie schon zum Reden bringen.« Langsam zieht die Frau die Nadel heraus.
»Woher weißt du das?«
»Irgendwann wird sie es müssen. Die Schmerzen werden unerträglich sein.« Sie beugt sich vor, bis sie Riordan in die Augen sehen kann. »Du wirst alles ausplaudern wie ein Kind, Clare«, zischt sie. »Ihr werdet alle leiden, bevor wir der Presse erzählen, dass ihr schuldig seid.«
Als sie wieder den Mann ansieht, hat sich in seinen Augen etwas geschlossen, als wäre eine Tür zugefallen. Riordans Kopf ist nach vorn auf ihre Brust gefallen, doch der Mann hält den Blick abgewandt.
»Nach allem, was sie getan haben, findest du es trotzdem schlimm, sie sterben zu sehen.«
»Ich kann schon damit umgehen«, entgegnet er leise.
»Du willst nicht nach dem Jungen suchen, oder?«
Er schüttelt den Kopf. »Doch, natürlich. Das Leben eines Kindes ist nichts im Vergleich zu dem, was ich alles verloren habe.«
Die Frau ist nicht überzeugt, auch wenn seine Stimme entschieden klingt. Er plant die Angriffe und bereitet jede Einzelheit vor, und dann ist er zu zimperlich, um den Opfern wehzutun. Hin- und hergerissen zwischen Verärgerung und dem Bedürfnis, ihn zu trösten, lässt sie die Nadel in ein Glas Sterilisierflüssigkeit fallen, während Riordans Wimmern zu einem Schrei anschwillt.
4
Dienstag, 14. Oktober
Im Institut war es leer, als ich am nächsten Morgen um acht Uhr dort ankam. Ich hatte schlecht geschlafen, die Sorge um Mikey Riordan nagte an mir, und so hatte mich die Unruhe viel zu früh aus meiner Wohnung getrieben. Ich warf die Zeitung auf meinen Schreibtisch und betrachtete das Foto auf der Titelseite. Mikeys Mutter lächelte mich treuherzig an, als hätte sie nie in ihrem Leben einer Fliege etwas zuleide getan. Ich setzte mich und versuchte, mich zu konzentrieren. Mein Kopf war vernebelt, aber allein in einer ruhigen Umgebung konnte ich mir am besten ein Bild von Clare Riordans Entführer machen. Nachdem ich mich in die Datenbank der Polizei eingeloggt hatte, gab ich die Schlüsselmerkmale bei HOLMES2 ein. Mir war bewusst, dass ich lange warten müsste, bevor das Programm Ergebnisse ausspuckte; die Software des Innenministeriums für schwerwiegende Fälle bedurfte dringend einer Überholung. Es waren zwar Einzelheiten zu jedem erfassten Verbrechen der letzten Jahrzehnte darin verzeichnet, doch es bewegte sich nur im Schneckentempo. Ich nutzte die Suchkategorie »ähnliche Beweislage«. Das übergreifende Thema war Blut: Das Opfer war eine Hämatologin, deren Blut als Visitenkarte hinterlassen wurde. Mein Rechner summte laut, während er alte Fälle durchforstete.
Ich stellte mich ans Fenster und sah hinaus auf den St James’s Park. Über den Dächern tanzten die scharlachroten Blätter eines dahinterliegenden Wäldchens, sodass es aussah, als stünde die ganze Häuserreihe in Flammen. Bisher war mein Vormittag nicht besonders erfolgreich gewesen. Zwei Kollegen führten eine heftige Diskussion im Büro nebenan, und ich konnte ihre Ausbrüche durch die Wand hören. Ich dachte an Mikey Riordan, der sich in diesem kargen Haus verzehrte. Meine Entschlossenheit, seine Mutter zu finden, wurde immer stärker.
Eine Stunde später spie mein Computer einen Ausdruck aus. Einer der Fälle war so entsetzlich, dass ich ihn mir lieber auf nüchternen Magen hätte ansehen sollen. Vor fünf Jahren hatte ein Mann einen Stricher aus Paddington umgebracht und von dessen Blut getrunken, bevor er dann Blutproben an die Verwandten verschickte. Der leitende Ermittler war so traumatisiert vom Tatort gewesen, dass er einen Zusammenbruch erlitt. Ich rieb mir die Augen. Ich wollte mein Gehirn nur ungern mit noch mehr Grauen belasten. Noch einige weitere Fälle wiesen Ähnlichkeiten auf, doch die Täter befanden sich alle bereits hinter Gittern. Ich legte den Bericht auf meinen Schreibtisch und verglich die Einzelheiten vorheriger Überfälle mit der Entführung von Clare Riordan, musste mich aber schon bald geschlagen geben. In den letzten zwanzig Jahren gab es keine direkten Parallelen. Indem er ihr Blut als Visitenkarte hinterließ, hatte Riordans Entführer so etwas wie Originalität an den Tag gelegt, was mich zu der Frage brachte, ob er von der Nachwelt angetrieben wurde – vielleicht gefiel es ihm nicht nur, seinen Opfern wehzutun, sondern er wollte einen Platz in den Annalen echten Verbrechens ergattern.
Als ich wieder aufblickte, stand Christine in der Tür. In ihrem cremefarbenen Kleid hatte sie etwas Gespenstisches; selbst ihr Lächeln schien unwirklich.
»Wie geht es dem Riordan-Jungen?«, erkundigte sie sich.
»Noch in der ersten Phase: stumm vor Schock und eine Tendenz zu gewalttätigen Ausbrüchen und Panikattacken.«
»Sie haben schon bei anderen Fällen großartige Arbeit mit Opfern im Kindesalter geleistet.«
»Mikey steht unter mehr Druck; alles hängt davon ab, was er gesehen hat. Und er hat keine Familie, die ihn unterstützt.«
Christine lächelte mich beruhigend an. »Er ist in guten Händen, Alice.«
Ohne ein weiteres Wort verschwand sie wieder. Ihre Art zu kommunizieren war so kryptisch, dass selbst ihre Ermutigungen bedrohlich klangen.
Ich sah die Transkriptionen der Vernehmungen von Clare Riordans Freunden und Kollegen durch, aber sie gaben frustrierend wenig her. Ihr Lebenslauf zeichnete das Bild einer Frau, die unermüdlich gearbeitet hatte: Fachärztin mit dreißig, Mitglied in zahlreichen Ethikgremien und im Drogenberatungsausschuss. Es faszinierte mich, dass es scheinbar keinen einzigen Makel in ihrer glänzenden Laufbahn gab. Der einzige bekannte Konflikt bezog sich auf ihre jüngere Schwester Eleanor. Seit zwei Jahren steckten die beiden in einem Rechtsstreit, ein Grund war nicht näher angegeben. Diese Leerstelle in Clare Riordans Leben musste ich zunächst einmal füllen, bevor ich herausfinden konnte, warum sie verschwunden war.
Es war eine Erleichterung, um halb zwei dem Büro entfliehen zu können. Ich hatte einen Besuch bei Clare Riordan zu Hause in Clapham vereinbart, wo ich hoffte, mehr über ihre Persönlichkeit zu erfahren. Mittags war nicht viel Verkehr, und ich fuhr nach Süden an den exklusiven Geschäften in Mayfair und den Villen in Chelsea vorbei. Das Bild änderte sich, als ich über die Themse Richtung Battersea fuhr. Die eleganten georgianischen Plätze wichen einem Meer aus Glas, Wohnhochhäuser breiteten sich vor mir aus, so weit das Auge reichte, ein Beleg dafür, dass die Bauunternehmer glaubten, ein Flussblick sei ein Vermögen wert.
Stormont Road war eine Reihe vornehmer viktorianischer Doppelhäuser, und in der Ferne sah man den Park von Clapham Common. Ein Flatterband der Polizei umspannte Clare Riordans Haus, und auf der Straße herrschte Hochbetrieb: Polizisten standen auf den Türschwellen und führten immer noch Befragungen in der Nachbarschaft durch.
Ich fragte mich, ob Mikey wohl jemals in das Zuhause zurückkehren würde, das seine Mutter so sorgsam gepflegt hatte. Kalksteinstufen führten auf eine Veranda mit schmiedeeisernem Geländer, die Haustür war in elegantem Blau gestrichen, und die Schiebefenster glänzten. Ich öffnete gerade das Tor, als eine Frau um die sechzig neben mir auftauchte. Ihr Blick bohrte sich in mich, und um ihren Mund zogen sich tiefe Falten, was mich vermuten ließ, dass ihre erste Handlung jeden Morgen darin bestand, sich eine Zigarette anzustecken.
»Sind Sie von der Polizei?«, fragte sie.
»Ich bin Alice Quentin, eine Beraterin in den Ermittlungen. Möchten Sie mit einem Detective sprechen?«
»Gestern war einer hier, aber mir hat sein Auftreten überhaupt nicht gefallen. Respektlos würde ich das nennen.« Sie blinzelte heftig mit ihren kleinen Augen. »Hätten Sie wohl eine Minute?«
Sie führte mich ins Nachbarhaus der Riordans. Ihr Wohnzimmer war mit Möbeln vollgestellt, und ein süßlicher Duft lag in der Luft, so als hätte jemand einen Flakon billigen Parfums verschüttet.
»Wie war doch gleich Ihr Name?«, fragte ich.
»Pauline Rowe. Ich lebe seit vierzig Jahren hier.«
»Und Sie haben Informationen, Pauline?«
»Womöglich ist es unwichtig.«
»Keine Sorge – Kleinigkeiten sind oft nützlich.«
Sie blickte zu Boden. »In den Nachrichten haben sie gesagt, Clare sei alleinstehend, aber sie traf sich mit jemandem. Ich habe sie im Garten gehört.«
»Wie sie geredet haben?«
»Es war wohl eher ein ausgewachsener Streit.« Ihr Atem rasselte, als sie Luft holte.
»Haben Sie verstanden, worum es ging?«
»Clare hat sich die Seele aus dem Leib geweint. Sie hat immer wieder gesagt ›es muss aufhören‹, aber der Kerl wollte nichts davon wissen.«
»War das erst kürzlich?«
»Vor zwei oder drei Wochen.«
»Haben Sie den Mann gesehen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Es muss ihr Freund gewesen sein. So streitet man sich nur, wenn starke Gefühle im Spiel sind.«
»Hat sie auch öfter anderen Besuch?«
»Kann man nicht sagen. Ein paarmal habe ich so ein Paar bei ihr auf der Treppe vorne gesehen. Der Kerl war schick angezogen, aber es können auch Zeugen Jehovas gewesen sein.« Sie hielt inne, um sich eine Zigarette anzuzünden.
»Niemand, mit dem sie sich sonst noch gestritten hat?«
»Nur ihre Schwester, aber die hat sich schon länger nicht mehr blicken lassen. Das Mädchen ist total irre.«
»Wie meinen Sie das?«
»Andauernd macht sie Ärger, schreit rum, knallt die Haustür. Psychische Probleme, wenn Sie mich fragen.«
»Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte?«
»Mikey verehrt seine Mum. Sie hocken immer aufeinander, außer wenn sie bei der Arbeit ist.«
»Das klingt, als wären sie sehr innig.«
»Er ist ein lieber Junge.« Sie sah mir in die Augen. »Gibt es irgendwelche Neuigkeiten?«
»Die Polizei macht gute Fortschritte. Vielen Dank für die Informationen, Mrs Rowe.«
Pauline schien mich nur widerwillig verabschieden zu wollen, sie plauderte weiter, während sie mich in einer Rauchwolke zur Tür begleitete. Als ich wieder auf der Straße stand, fragte ich mich, wie das Leben der älteren Dame wohl aussah. Vielleicht hatte die Rente ihr nicht das gebracht, was sie sich erhofft hatte, und Langeweile trieb sie aus dem Haus, um ihre Nachbarn zu belauschen.
In Riordans Haus traf ich als Erstes auf Pete Hancock, Burns’ leitender Ermittler in der Spurensicherung. Mein Mut sank. Hancock stand im Flur und kritzelte etwas auf ein Klemmbrett, während ich in den sterilen Anzug schlüpfte. Seine Miene war undurchdringlich.
»Jetzt ist die schlechteste Zeit für einen Besuch.« Seine Worte klangen monoton.
»Das sagen Sie immer, Pete. Ich weiß, dass wir nach unterschiedlichen Sachen suchen, aber es wäre hilfreich, wenn wir uns austauschen könnten. Wann haben Sie Pause?«
»Ich mache keine.«
»Geben Sie mir eine halbe Stunde, ich lade Sie auf einen Cappuccino ein.«
»Ich trinke keinen Kaffee.«
»Dann eben auf einen Tee.« Ich sah auf die Uhr. »Um drei.«
Er sah mich verdutzt an, lehnte jedoch nicht ab. Zum ersten Mal in all den Jahren vergaß er, mich anzuschnauzen, während ich an seinem Tatort herumspazierte. Ich achtete darauf, nur auf die ausgelegte Plastikfolie zu treten, und vermied die Räume, die noch abgesperrt waren. Meine Besorgnis wuchs, während ich durchs Erdgeschoss wanderte. Die gesamte Dekoration wies ausschließlich auf eine Mutter-Sohn-Beziehung hin. Im Flur hing eine Reihe schwarz-weißer Porträtaufnahmen, die in jährlichem Abstand gemacht worden waren, beginnend bei Mikey als Säugling in den Armen seiner Mutter. Auf jedem Bild war der Junge etwas älter, doch die Nähe zwischen ihm und seiner Mutter nahm nicht ab. Auf dem letzten Foto standen sie Arm in Arm und strahlten mit dem gleichen Lächeln in die Kamera. Die Zimmer bestätigten meinen Eindruck, dass nur wenige andere Menschen in ihr Leben vorgedrungen waren. Möglicherweise hatte der Verlust ihres Mannes Clare so eng an ihren Sohn gebunden, dass niemand anders mehr eine Rolle spielte.
Das Wohnzimmer war ein Musterbeispiel geschmackvoller Neutralität. Die Gegenstände auf dem Sofatisch spiegelten ihrer beider Interessen wider: ihre Einrichtungsmagazine und Ausgaben der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet; seine Spielekonsole und Comichefte mit Eselsohren. Mikeys Zimmer schien das typische Kinderzimmer eines Elfjährigen zu sein: Fußballpokale über dem Bett, ein signiertes Poster der Mannschaft von Chelsea. Erst bei näherer Betrachtung entdeckte ich, dass Fußball nicht seine einzige Leidenschaft war. Mehrere große Zeichnungen hingen an den Wänden – lebendige Landschaften, auf denen eine überdimensionale Sonne beinahe den ganzen Himmel einnahm, Sturzwellen vor weißen Klippen, voller Licht und Energie. Gerahmte Urkunden zeigten, dass Mikey zwei Jahre in Folge den Kunstwettbewerb an seiner Schule gewonnen hatte. Das Zimmer war ungewöhnlich aufgeräumt für einen Jungen in seinem Alter, und es roch nach Seife und frischer Wäsche. Das Schlafzimmer seiner Mutter war ebenfalls ordentlich. Der Inhalt ihres Kleiderschranks gefiel mir: Kostüme von Ghost und Karen Millen, Jeans und Seidenblusen fürs Wochenende. Sie hatte allerdings einen gewagteren Geschmack als ich. Ganz hinten versteckten sich Outfits, die zu einer Femme fatale passten: knappe Cocktailkleider, ein Lederrock, schmerzhaft hohe Stilettos. Die Kleider deuteten auf eine Frau mit zwei Leben hin. Eine hart arbeitende Frau, die jedoch selbstbewusst genug war, ihre Attraktivität zu zeigen, wenn sich die Gelegenheit ergab.
Meine Frustration nahm zu, als ich in den Flur ging. Manchmal spricht das Zuhause eines Opfers Bände über die Gewohnheiten, die es angreifbar macht, doch abgesehen von Clares Kleidung schien ihr Privatleben leicht zu deuten zu sein. Es offenbarte guten Geschmack, den Komfort der Mittelschicht sowie einen hohen Grad von Vertrautheit zwischen Mutter und Sohn. Diese Nähe bereitete mir umso mehr Sorgen darüber, wie es Mikey wohl ergehen würde, wenn seine Mutter nicht mehr zurückkehrte.
Ich traf Hancock auf der Veranda, als ich hinausging. Er warf mir einen bösen Blick zu, während ich mich aus meinem Tyvek-Anzug schälte.
»Es gibt ein Café in der Nähe«, sagte ich.
»In Ordnung, wenn Sie zahlen.«
Auf dem kurzen Spaziergang zum Lavender Hill blieb er wortkarg, und ich nutzte die Gelegenheit, ihn aus dem Augenwinkel zu beobachten. Sein weißes Haar und dazu die düsteren schwarzen Augenbrauen ließen ihn wie eine jüngere, feindseligere Version von Politiker Alistair Darling aussehen. Es widerte ihn ganz offensichtlich an, als ich einen doppelten Espresso bestellte.
»Von dem Zeug bekommen Sie bloß ein Magengeschwür.«
»Das Risiko gehe ich ein. Woher stammen Sie, Pete?«
»Ursprünglich aus Tyneside.«
»Der singende Tonfall kam mir bekannt vor. Und haben Sie grundsätzlich etwas gegen Psychologen oder nur gegen mich?«
Seine Miene verdüsterte sich noch mehr. »Ich verbringe den ganzen Tag auf den Knien und sammele Kippen und Proben von Körperflüssigkeiten auf, damit Leute wie Sie sich anschließend über den Modus Operandi auslassen können. Sie bekommen sogar mehr Gehalt.«
»Und das ärgert Sie?«
»Ich löse den Fall für Sie, aber die meisten Seelenklempner zollen mir keinerlei Respekt.« Er nahm einen Schluck Mineralwasser.
»Dann entgeht Ihnen etwas. Wenn ich sehe, was der Mörder angefasst hat oder welche Schuhe das Opfer trug, erfahre ich viel mehr, als irgendein Foto mir erzählen kann. Und das kann ich nicht ohne Ihre Hilfe.«
»Sie wollen, dass ich aufhöre herumzujammern, wenn Sie vorbeischauen?«
»Wäre das machbar?«
Er sah mich scharf an. »Burns sagt, Sie machen Ihre Sache gut.«
»Das Gleiche hab ich auch über Sie gehört.«
»Warum arbeiten Sie nicht für zweihundert Tacken die Stunde in irgendeinem noblen Krankenhaus?«
»Vielleicht bin ich verrückt, aber die Rechtspsychologie übertrifft für mich ein fettes Gehalt.«
Diese Antwort schien ihn zufriedenzustellen. Als wir zu Riordans Haus zurückkehrten, hatte Hancocks Team in seiner Abwesenheit offensichtlich hart gearbeitet. Zwei Kollegen der Spurensicherung in weißen Anzügen und mit Plastikbehältern für Beweismittel fürs Labor schoben sich auf der Treppe an uns vorbei. Meine Stunde mit Pete Hancock war jedoch nicht vergeudet gewesen; für eine Flasche Mineralwasser hatte ich ein paar seiner Vorbehalte aufheben können. Er hatte mir anvertraut, dass er ein abtrünniger Katholik und verheiratet war, zwei Kinder über zwanzig hatte sowie ein leidenschaftlicher Newcastle-Fan mit einer Vorliebe für Jazz war. Im Gegenzug hatte ich ihm von meinem Wunsch nach einem Motorrad erzählt und bestätigt, dass ich eine Beziehung mit seinem leitenden Ermittler führte.
»Das ist doch nichts Neues, Pete. Haben Sie es noch nicht gehört?«
»Ich bin nicht so der Typ für Klatsch und Tratsch.« Er schlüpfte bereits wieder in seine Überschuhe.
»Haben Sie da drin was gefunden?«
»Die IT-Jungs sehen sich gerade ihre Rechner an, aber da ist noch etwas, das Sie sich anschauen sollten.«
Widerwillig zog ich den sterilen Anzug wieder über. Ich mochte den synthetischen Geruch und den knisternden Stoff nicht.
Wir gingen den Flur entlang, und in der Küche blieb Hancock stehen. »Fällt Ihnen was auf?«
»Ziemlich teure Ausstattung.« Ich ließ den Blick über die maßangefertigten Küchenelemente, die Arbeitsflächen aus Granit und die Bodenfliesen im Schachbrettmuster schweifen. Klassisch für eine Familie mit Geld; sogar ein Entsafter der Spitzenklasse und eine Gaggia-Espressomaschine standen auf dem Tresen.
»Schauen Sie noch genauer hin.« Er hielt ein blaues Licht über den Fußboden, und ein Schatten erschien, etwa dreißig Zentimeter breit. »Jemand hat versucht, es wegzuschrubben, aber wir haben den Fußboden mit Luminol eingesprüht. Unter UV-Licht kann man Blutspuren sehen.«
»Es muss nicht ihr Blut sein.«
»Von wem es auch ist, es muss eine verdammt große Wunde gewesen sein. Man braucht schon einen Viertelliter, um es so weit zu verteilen.«
»Kann das Labor feststellen, ob es von ihr war?«
Er nickte. »Wir schaben eine Probe vom Boden und machen eine Kreuzprobe mit der DNA ihres Sohnes, nur datieren können sie es nicht.«
»Warum nicht?«
»Das Bleichmittel in Reinigern zerstört alles bis auf das genetische Profil.«
Als ich mich verabschiedete, begleitete Hancock mich zur Tür, und wie ein Geist stand er in seinem Anzug auf der Veranda, als ich mich noch einmal zum Haus umdrehte. Uniformierte Polizisten bewachten noch immer das Wäldchen, in dem Clare Riordan und ihr Sohn zuletzt gesehen worden waren. Auf meiner Fahrt nach King’s Cross dachte ich wieder an die Ärztin. Vielleicht war sie noch am Leben, und ihr Blut wurde ihr aus Gründen abgenommen, die wir nicht kannten. Nur warum sollte ihr Entführer sie zu ihr nach Hause bringen und dann dort wie wild putzen, bevor er die Leiche wegschaffte? Ich sah durch die Windschutzscheibe. Die Straße war mit Laub übersät; dicke rote Kleckse, wie Blutgerinnsel auf dem Asphalt.
5
In der Polizeidienststelle auf dem St Pancras Way wimmelte es nur so von Polizisten und Detectives, und in der Luft lag eine enorme Energie. Dieser brutale Fall hatte bei allen Adrenalin freigesetzt. Monatelang verrann die Zeit mit der eintönigen Arbeit der präventiven Verbrechensbekämpfung, bis dann ein- oder zweimal im Jahr eine Entführung oder ein Mordfall die Routine durchbrach. Ich konnte die Anspannung förmlich spüren, während das Team sich darauf vorbereitete, alles zu geben.
Burns war zu beschäftigt, um mich zu bemerken. Er stand an der Fensterseite im Einsatzraum und bedachte jeden mit dem gleichen aufmerksamen Blick, wobei ihm seine massige Gestalt einen natürlichen Vorteil verschaffte. Mich machte Stress immer zappelig, aber er stand ungerührt da wie eine Statue und hielt seine körperliche Energie in Schach. Sein Gesicht sah ziemlich ramponiert aus und ähnelte mehr dem eines Fußballmanagers vor einem großen Spiel als dem eines Detectives. Trotz seiner Rolle als leitender Ermittler, der für ein riesiges Team verantwortlich war, schien es eine Übereinkunft zu geben, dass jeder fundierte Fragen stellen durfte. Die Polizisten standen um ihn herum und warteten darauf, dass sie an der Reihe waren. Ich zwang mich dazu, wegzusehen und mich auf meine momentane Aufgabe zu konzentrieren.
Etwa dreißig Detectives und Kollegen der Spurensicherung waren zur Besprechung gekommen. Zwei Fotos in Postergröße hingen an der Tafel mit den Beweismitteln. Auf dem einen war eine schlanke Frau mit braunen Haaren zu sehen, die sich gut gehalten hatte und professionell in die Kamera lächelte. Die andere Aufnahme war deutlich weniger gestellt. Clare Riordan saß in kurzer Hose und Trägershirt an einem sonnenbeschienenen Strand und wirkte nachdenklich, als würde sie sich über etwas Sorgen machen, das außerhalb ihrer Kontrolle lag. Neben ihr auf dem Strandtuch saß Mikey und strahlte in die Kamera. Der Junge auf dem Foto hatte nichts mit dem hohläugigen heimatlosen Kind gemein, das gefangen im Unterschlupf hockte und zu verschreckt war, um einen Ton von sich zu geben.