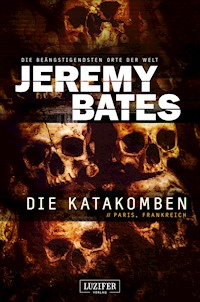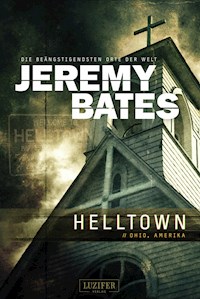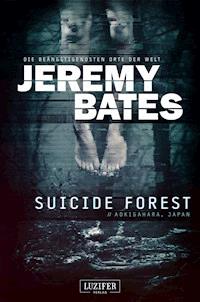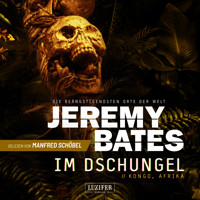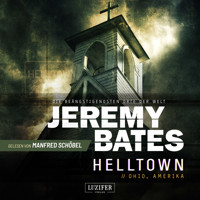Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die beängstigendsten Orte der Welt
- Sprache: Deutsch
Weit im Süden der heutigen Mexiko-Stadt, in einem Gebiet aus unzähligen Wasseradern und Inseln, liegt die Isla de las Muñecas – ein kleines Stück Land, in dessen Bäumen hunderte verstümmelter Spielzeugpuppen hängen … Ein Team junger Dokumentarfilmer wird während ihrer Dreharbeiten auf der Insel Zeuge eines brutalen Mordes. Schnell sorgen Angst und Paranoia dafür, dass sich die jungen Leute gegeneinander wenden - und das, obwohl sie in der vielleicht längsten Nacht ihres Lebens von einem unbekannten Killer gejagt werden … In seiner Romanreihe »Die beängstigendsten Orte der Welt« entführt Jeremy Bates seine Leser an real existierende verfluchte, beängstigende oder berühmt-berüchtigte Schauplätze auf der ganzen Welt, und verbindet den Mythos dieser Orte geschickt mit fiktiven Begebenheiten. Und gerade dieser Bezug zu realen Orten, die der interessierte Leser nach der Lektüre im Prinzip vor Ort selbst erforschen kann, macht diese Romane zu einem Wagnis – oder einem besonderen Vergnügen. Lesen als Grenzerfahrung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 434
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Insel der Puppen
Die beängstigendsten Orte der Welt – Band 4
Jeremy Bates
This Translation is published by arrangement with Jeremy Bates Title: ISLAND OF THE DOLLS. All rights reserved. First Published 2018.
Impressum
Deutsche Erstausgabe Originaltitel: ISLAND OF THE DOLLS Copyright Gesamtausgabe © 2023 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Übersetzung: Sylvia Pranga
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2023) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-762-4
Sie lesen gern spannende Bücher? Dann folgen Sie dem LUZIFER Verlag aufFacebook | Twitter | Pinterest
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Der Ochsenfrosch saß auf einem großen, grünen Seerosenblatt in der Mitte eines faulig riechenden Tümpels. Seine Kehle blähte sich wie Ballon auf, als er einen rostig klingenden, krächzenden Laut von sich gab.
Die acht Jahre alte Rosa Sánchez machte einen weiteren vorsichtigen Schritt auf ihn zu, dann noch einen, wobei sie sich bemühte, das trübe Wasser nicht aufzustören. Sie hatte ihren Sandalen ausgezogen, und der Schlamm am Grund des Tümpels quetschte sich zwischen ihre Zehen, was sich gleichzeitig gut und ekelhaft anfühlte.
Der Frosch verschob seinen dicken Körper auf dem Seerosenblatt, sodass er sie jetzt direkt anzustarren schien, seine hervorstehenden Augen glänzten.
Rosa erstarrte mit einem Fuß in der Luft, wie ein Storch.
Der Ochsenfrosch quakte.
»Sieh weg, Frosch«, murmelte Rosa auf Spanisch. »Sieh weg.«
Er tat es nicht und Rosa, die fürchtete, sie könnte umfallen, ihre Sachen nass und schmutzig machen, setzte ihren vorderen Fuß ab. Etwas Scharfes – ein Stein oder ein spitzes Aststück – stach in die Unterseite ihrer Ferse. Sie ignorierte den Schmerz und behielt den Ochsenfrosch im Blick.
Er starrte weiterhin ohne zu blinzeln zurück. Die Luft wich aus seinem Kehlsack, und der Ochsenfrosch schrumpfte fast um die Hälfte. Trotzdem war er immer noch ein großer Kerl. Und er war so nah …
Rosa machte einen weiteren Schritt und dachte, dass sie ihn jetzt vielleicht fangen könnte, wenn sie schnell genug wäre. Sie streckte die Arme vor sich aus und beugte sich langsam vor.
Der Ochsenfrosch sprang. Rosas Hände schlossen sich um seine glitschigen Seiten. Doch sie war zu langsam. Er platschte ins Wasser und verschwand.
Rosas Schwung trieb sie jedoch weiter vorwärts. Ein, zwei unkoordinierte Schritte, dann stürzte sie kopfüber ins Wasser. Sie kniff die Augen zu, vergaß aber, den Mund zu schließen, und schluckte eine Menge Wasser, das wie Jauche schmeckte. Ihre Hände versanken in dem schlammigen Grund des Teichs, dann ihre Knie, aber es gelang ihr, den Rücken durchzudrücken, sodass ihr Kopf nicht völlig versank.
Sie gab einen Laut von sich, als würde sie weinen, obwohl sie gar nicht weinte. Sie war acht Jahre alt, ein großes Mädchen, und große Mädchen weinten nicht, wenn sie ins Wasser fielen. Allerdings wollte sie es. Sie war durchnässt, hatte einen ekligen Geschmack im Mund und kam nicht wieder auf die Füße. Der Schlamm, der an ihren Händen und Knien saugte, war zu glitschig.
Jetzt verschwand ihr Kopf doch unter der Oberfläche. Wasser lief in ihre Ohren und die Nase, aber zumindest ließ sie dieses Mal den Mund geschlossen. Als sie wieder durch die Oberfläche brach, kroch sie stöhnend auf das Ufer zu und griff nach allen hohen Gräsern und Wurzeln, nach allem, was sie zu fassen bekam, bis sie wieder auf trockenem Boden war. Rosa drehte sich auf den Bauch, in ihren Augen brannten Tränen. Dann setzte sie sich auf. Ihre Sachen klebten unangenehm an ihrem Körper. Und sie roch wie eine Toilette. Schlimmer als eine Toilette. Es erinnerte sie an den Geruch, als ihr älterer Bruder Miguel die tote Ratte in der Wand ihres Hauses gefunden und Rosa gesagt hatte, sie solle sie nach draußen bringen.
Miguel. Er würde sie umbringen. Er war schon wütend auf sie, weil sie zu langsam gegangen war, als sie auf die Insel kamen und nach einem Platz zum Campen suchten. Dann wurde er sogar noch wütender, weil er seine Freundin küssen wollte, es aber nicht tun konnte, wenn Rosa in der Nähe war. Darum hatte er Rosa gesagt, sie solle irgendwohin gehen und etwas machen. Rosa wollte zuerst nicht. Die Insel jagte ihr Angst ein, weil überall Puppen in den Bäumen hingen oder auf dem Boden saßen. Sie starrten sie mit ihren angemalten Gesichtern und den Glasaugen an. Allerdings sagte man nicht Nein zu Miguel, außer man wollte eine Kopfnuss bekommen. Also ging Rosa los, allerdings hatte sie nicht vorgehabt, so weit zu gehen. Und dann sah sie den Teich. Zuerst wollte sie ein bisschen im Wasser herumplanschen. Sie hatte nicht gewusst, dass es hier Ochsenfrösche gab. Doch es gab sie hier, sogar überall. Sie entdeckte auf Anhieb drei. Anfangs war sie allerdings nicht vorsichtig, und sie sprangen alle von ihren Seerosenblättern und verschwanden unter Wasser, bevor sie dicht genug herankam, um einen zu fangen. Es dauerte weitere fünfzehn Minuten, bis sie diesen großen, dicken Frosch fand.
Und jetzt war er auch weg, und sie war klatschnass, und Miguel würde sie beschimpfen und sie auf den Kopf schlagen.
Ein Schrei durchbrach die Stille.
Rosa riss den Kopf herum.
Das war die Freundin ihres Bruders, Lucinda, gewesen.
War Miguel hinter irgendetwas hervorgesprungen und hatte sie erschreckt, wie er es so gern bei Rosa machte? Oder war eine in den Bäumen hängende Puppen lebendig geworden und hatte sie angegriffen? Das hatte Miguel Rosa immer wieder gesagt: Die Puppen waren lebendig, sie schliefen nur. Und wenn man sie ansah, dann würden sie …
Ein weiterer Schrei.
Nicht Lucinda. Es war eine tiefere Stimme, männlich.
Miguel?
Rosa wusste es nicht, denn sie hatte ihren Bruder noch nie schreien hören, zumindest schon seit Jahren nicht weit. Miguel hatte vor nichts Angst.
Rosa stand auf, ihre klatschnassen Sachen waren vergessen.
Ihr Blick glitt suchend über die Bäume vor ihr, sie hielt nach Bewegung Ausschau, nach Miguel, der sich hinter Sträuchern verborgen anschlich. Denn genau darum ging es hier, oder nicht? Ein Scherz, nicht auf Lucindas Kosten, sondern auf Rosas. Miguel hatte Lucinda dazu gebracht, zu schreien. Dann hatte Miguel auch geschrien. Und sobald Rosa kommen würde, um nachzusehen, würden sie irgendwo hervorspringen und sie erschrecken.
Rosa wartete. Der Wald war still. Kein Wind. Keine Grillen. Nichts.
»Miguel?«, sagte sie.
Keine Antwort.
Rosa hob ihre Sandalen auf und ging den Weg zurück, den sie gekommen war, auf den Ursprung der Schreie zu. Sie wusste, dass Miguel ihr auflauern würde, aber das war okay, denn es würde sie nur für eine Sekunde erschrecken, danach würden alle lachen. Und das wäre besser als das Gefühl, das Rosa im Moment hatte. Ihr war übel, so als würde sie sich gleich übergeben müssen.
Rosa verließ die Lichtung mit dem Teich. Die Bäume schlossen sich eng um sie. Sie musste sich unter Zweigen ducken und aufpassen, wohin sie trat. Der Spätnachmittag erschien ihr plötzlich dunkel. Sie erinnerte sich nicht daran, dass es vorhin so dunkel gewesen war. Lag es daran, dass wegen der Äste die Sonne und der Himmel nicht zu sehen waren? Oder hatte sich eine Wolke vor die Sonne geschoben?
»Miguel?«, sagte sie, dieses Mal allerdings nicht besonders laut.
Denn was war, wenn etwas anderes sie hörte?
Was denn zum Beispiel?
Die Puppen?
Sie konnten ihr nichts antun. Es waren nur Puppen. Selbst wenn sie zum Leben erwachten, war sie viel größer als sie.
Aber sie haben Miguel und Lucinda erwischt.
Nein, das hatten sie nicht! Das sagte sich Rosa jedenfalls streng. Miguel alberte herum. Er würde jetzt jede Sekunde irgendwo hervorspringen.
Er sprang jedoch nirgendwo hervor.
Der Wald blieb still und dunkel.
Vielleicht sollte sie zum Teich zurückgehen und dort darauf warten, dass Miguel sein Spielchen langweilig wurde und kam, um sie zu holen. Doch was war, wenn Miguel oder Lucinda wirklich verletzt war? Was war, wenn sie Hilfe brauchten?
Rosa ging weiter, drängte sich durch das dichte Unterholz.
Sie bewegte sich schneller, ignorierte die kratzenden Zweige, die spitzen Steine und den Windbruch unter ihren nackten Füßen. Dann rannte sie. Alles, was sie hörte, war ein Dröhnen in ihrem Kopf und ihr lauter Atem. Jeder Baum sah gleich aus und sie fragte sich, ob sie in die richtige Richtung lief. Doch sie blieb nicht stehen. Wenn sie sich umdrehte, würde sie sich wahrscheinlich noch mehr verirren. Außerdem war sie sich sicher, dass das Camp direkt vor ihr war. Es konnte nicht mehr weit sein.
Sie duckte sich um einen Baum herum – und lief in mehrere Puppen, die von einem tiefen Ast hingen. Sie schrie auf und fiel auf den Hintern. Sie sah auf und erkannte die Puppen von vorhin: schmutzig, sich abschälend, düster.
Das bedeutete, dass das Camp nicht mehr weit weg war.
»Miguel!«, rief sie. Sie konnte ihre Furcht nicht mehr länger unterdrücken.
»Rosa!«, kam seine Stimme zurück, erstickt, schwach und angsterfüllt. »Hau ab! Lauf!«
Rosa kam auf die Füße. Ein Schluchzen stieg in ihrer Kehle auf, die sich eng anfühlte und schmerzte.
»Miguel!«
»Lauf weg …« Er wurde abrupt unterbrochen.
Rosa zögerte noch einen Augenblick, dann drehte sie sich um und rannte los.
Xochimilco, Mexiko
Jack
1
Ich wachte in meinem eigenen Blut liegend auf.
Es war zwischen meiner rechten Kopfseite und dem Kissen geronnen, und ich musste das verdammte Kissen abschälen, als ob es ein verkrusteter Verband wäre. Ich hielt das Kissen vor mich und starrte die braunen Flecken auf dem weißen Stoff angeekelt an. Dabei versuchte ich mich die ganze Zeit daran zu erinnern, was in der Nacht zuvor passiert war.
Ich war mit meiner Verlobten, ihrem Bruder und seiner Freundin essen gewesen. Das war vielleicht etwas gewesen. Ich musste zuhören, während Jesus die ganze Zeit über sich selbst sprach. So hieß Pitas Bruder, Jesus. Ironisch – er war der einzige Typ, dem ich je begegnet war, der nach Gott benannt war, und er hatte das dazu passende Ego eines Gottes. Seine Freundin, Elizaveta, war viel zu gut für ihn. Klug, bodenständig, attraktiv. Ich wusste nicht, wie er sich sie geangelt hatte. Doch, ich wusste es eigentlich: Geld. Pitas und Jesus Vater, Marco, hatte ein Familienrestaurant und –pub in eine Multimillionen-Brauerei verwandelt, und nachdem Marco im vorigen Jahr an einem Hirnaneurysma gestorben war, übernahm der neunundzwanzigjährige Jesus die Geschäftsführung.
Ich legte das schmutzige Kissen beiseite und berührte den Schnitt an meinem Kopf, was einen scharfen Schmerz hervorrief, der bis dahin geschlummert hatte. Der Schnitt verlief von der Außenseite meiner Augenbraue bis zu meinem Haaransatz. Getrocknetes Blut bröselte unter meinen Fingerspitzen und fiel wie rote Schuppen auf das Bett.
Als ich mich erinnerte, was passiert war, zuckte ich vor Verlegenheit zusammen.
Wir saßen auf der hinteren Terrasse, wir vier. Das Abendessen war beendet. Jesus rauchte eine seiner teuren Zigarren und erzählte endlos von dem Ski-Ausflug, den er und Elizaveta im vorigen Winter nach Chile gemacht hatten. Ich hörte nur mit halbem Ohr zu, bis er mit einer lächerlichen Geschichte anfing, wie er außerhalb des Bereichs des Skigebiets Ski gefahren war, wohin er mit einem Hubschrauber gekommen war. Ich lachte laut. Es war nicht so, dass ich ihm nicht glaubte. Pita hat mir mal erzählt, dass sie und Jesus jedes Jahr im Ski-Urlaub gewesen waren, als sie noch jünger waren. Also nahm ich an, dass er ein ganz guter Skifahrer war. Es lag an seiner Angeberei. Er sorgte dafür, dass wir erfuhren, dass er einen Hubschrauber gechartert hatte, erwähnte das schwierige Terrain abseits der Pisten und seine Begleiter, unter denen sich ein berühmter mexikanischer Sänger befand.
Ich war gegenüber Jesus nicht kleinlich oder überkritisch. Alles, was der Typ sagte oder tat, war darauf ausgelegt, ihn gut aussehen zu lassen, damit die Leute ihn bewunderten und ihn als ein Sinnbild des Erfolgs sahen. Gleichzeitig war alles mit Bescheidenheit überzogen, als wäre er ein Kerl wie jeder andere. Seine Bemühungen waren so durchsichtig, dass er zu einer Karikatur, zu einer Witzfigur wurde. Man konnte sich manchmal ein Lachen über ihn nicht verkneifen.
Jesus fragte mich, was so lustig wäre. Ich antwortete nichts und bat ihn, fortzufahren. Das Wortgefecht eskalierte, die Beleidigungen wurden schärfer und Pita und Elizaveta baten uns, damit aufzuhören. Dann versetzte mir das Arschloch einen Tiefschlag, indem er den Unfall erwähnte, der meine Karriere als Rennfahrer beendete. Er meinte, dass ich nicht mehr den Mut hätte, das Tempolimit zu überschreiten.
Ich hätte ihn schlagen können. Das hätte ich tun sollen. Stattdessen ging ich hinein, um zu pinkeln. Ich kehrte nicht auf die Terrasse zurück. Ich ging in den zweiten Stock auf den Balkon, von dem aus man die Terrasse und den daneben liegenden Swimmingpool überblicken konnte. Ich kletterte auf das Geländer, sodass ich schwankend auf der oberen Stange stand. Ich schrie, dass ich in den Pool springen würde, und forderte Jesus, den furchtlosen alpinen Skifahrer, dazu auf, dasselbe zu tun.
Es war wahrscheinlich gut, dass ich ausrutschte. Zwischen dem Balkon und dem Pool lagen ungefähr drei Meter und wäre ich gesprungen, hätte ich das Wasser vielleicht nicht erreicht. Doch das passierte nicht. Ich rutschte aus, oder verlor das Gleichgewicht, das ist alles etwas verschwommen, fiel nach hinten und schlug mir den Kopf an etwas auf. Ich habe keine Ahnung, woran. Alles, woran ich mich erinnere, ist der explodierende Schmerz – er fühlte sich irgendwie laut an – das hervorspritzende Blut und wie sich alle um mich herum versammelten. Sie wollten einen Krankenwagen rufen, aber aus irgendeinem Grund wollte ich das nicht. Ich glaube, ich wollte die Nacht nicht im Krankenhaus verbringen. Dann stand ich unter der Dusche. Ich meine mich zu erinnern, dass ich sehr lange geduscht und zugesehen habe, wie rosafarbenes Wasser in den Abfluss lief.
Ich verzog das Gesicht, schob mich aus dem Bett und stand auf. Einen Augenblick lang war mir schwindelig, wahrscheinlich wegen des Blutverlustes. Ich war im Gästezimmer. Es war nicht überraschend, dass Pita mich nicht in unserem Bett hatte schlafen lassen, so wie ich blutete, obwohl es mein Haus war. Und was hatte sie sich dabei gedacht, mich mit einer ernsthaften Kopfverletzung schlafen gehen zu lassen? Ich weiß, dass ich gesagt hatte, sie sollte keinen Krankenwagen rufen, doch sie hätte es trotzdem tun müssen. Ich hätte nicht wieder aufwachen können.
Licht fiel durch das Fenster, viel zu hell, fast hörbar, wie eine Hupe. Ich fragte mich, wie spät es war. Ich trat in den mit Kiefernholz vertäfelten Flur und ging zum Badezimmer, weil ich laufendes Wasser hörte.
Ich klopfte leise an die Tür, öffnete sie dann. Der Dampf hatte den Spiegel beschlagen lassen. Pita stand unter dem Wasserstrahl der Dusche, ihren mokkafarbenen Rücken und Hintern mir zugewandt, und massierte sich entweder Shampoo oder Conditioner in ihr dunkles Haar.
»Hey«, sagte ich, und das Wort kam heiser heraus. Meine Kehle war so trocken, als hätte ich eine Handvoll gesalzene Kräcker gegessen.
Als wir vor etwa fünf Jahren das erste Mal miteinander ausgingen, hätte Pita sich ganz umgedreht und ihren Körper gezeigt. Jetzt drehte sie nur etwas den Kopf, sodass sie mich von der Seite sehen konnte. Sie legte einen Arm über ihre Brüste.
»Du lebst noch«, sagte sie in ihrem Englisch mit spanischem Akzent.
»Gerade so«, sagte ich.
»Heißt das, dass du nicht mehr mitkommst?«
»Mitkommen?«
»Erinnerst du dich an gar nichts mehr von gestern Abend?«
Das ärgerte mich, aber ich sagte: »Was meinst du damit?«
»Du weißt es nicht?«
»Ich würde nicht fragen, wenn ich es wüsste.«
»Wenn du vielleicht nicht so viel getrunken hättest …«
»Vergiss es, Pita.«
Ich wollte gerade die Tür schließen, als sie sagte: »Isla de las Muñecas.« Dann wusch sie sich weiter das Haar.
2
Mann, ich musste so betrunken gewesen sein, dass ich einen Blackout gehabt hatte. Doch jetzt ging mir ein Licht auf, die Dunkelheit, in der meine Erinnerungen verborgen gewesen waren, klärte sich und der Rest des Abends kehrte in Bruchstücken zurück. Isla de las Muñecas, Insel der Puppen. Das war der Grund, weswegen Jesus und Elizaveta vorbeigekommen waren. Wir hatten die meiste Zeit beim Abendessen damit verbracht, über die Einzelheiten des Ausflugs zu sprechen. Wir waren übereingekommen, um zehn Uhr zu starten. Jesus und Elizaveta würden Pepper abholen und dann zu meinem Haus kommen. Pita und ich würden ihnen in meinem Auto nach Xochimilco folgen, wo wir ein Boot besteigen wollten, das uns innerhalb von zwei Stunden zu der Insel brachte.
Pepper war ein Moderator der mexikanischen Version von The Travel Channel, eine einfache Kabelserie, die Dokumentationen und Erläuterungsprogramme zeigte, die mit Reisen und Freizeit in dem Land zu tun hatten. Er hatte am Anfang seiner Karriere Glück gehabt und regelmäßige Auftritte als Moderator für Tiersafaris, Touren durch große Hotels und Resorts und Lifestyle-Themen ergattert. Dadurch war er eine Art Mini-Promi geworden. Trotzdem startete er erst im letzten Jahr richtig durch, und zwar weil er eine Dokumentation im El Museo De Las Momias, dem Mumienmuseum, moderierte. Die Geschichte erzählte, dass sich während eines Choleraausbruchs im neunzehnten Jahrhundert der Stadtfriedhof von Guanajuato so schnell füllte, dass eine örtliche Steuer erhoben wurde, die von Verwandten eine Gebühr forderte, damit die Leichen begraben blieben. Die meisten Verwandten konnten sich das nicht leisten, oder es war ihnen egal. Also wurden die Leichen exhumiert und die am besten erhaltenen wurden in einem Gebäude gelagert. Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts verlangten geschäftstüchtige Friedhofsarbeiter von Touristen ein paar Pesos, damit sie sich die Knochen und Mumien ansehen durften. Und seitdem ist der Ort zu einem Museum geworden, das mehr als hundert getrocknete menschliche Leichname zeigt, inklusive Mordopfer, ein Opfer der Spanischen Inquisition in einer Eisernen Jungfrau, lebend begrabenen Kriminellen und Kindern, die als Heilige gekleidet zur Ruhe gebettet wurden. Die meisten waren so gut erhalten, dass ihre Haare, Augenbrauen und Fingernägel noch intakt waren, und bei fast allen war der Mund zu einem ewigen Schrei erstarrt. Das lag daran, dass sich nach dem Tod die Zunge verhärtet hatte und die Kiefermuskeln erschlafft waren.
Die Dokumentation wurde ein großer Hit, sodass Pepper die Moderation für die fortlaufende Serie mit dem Titel Mexikos furchterregendste Orte auf The Travel Channel anstieß. Ihnen gefiel die Idee, und Peppers nächstes Projekt führte ihn zu La Zona de Silencio, der Todeszone, ein Wüstenstück in Durango, das seinen Spitznamen erhielt, nachdem eine Testrakete, die von einem US-Militärstützpunkt in Utah gestartet wurde, eine Fehlfunktion hatte und in der Region von Mexikos Mapimi Wüste abstürzte. Die Rakete beförderte zwei Behälter mit radioaktivem Material. Ein groß angelegter Rückholversuch der US-Air Force dauerte Wochen – und verwandelte die Region in eine Pseudo-Area 51 voller Rätsel und lokaler Legenden, bei denen es um Mutationen der Flora und Fauna, um Lichter am Nachthimmel, Außerirdische und magnetische Anomalien ging, die Funkübertragungen verhinderten. Das volle Programm.
Pepper hatte seitdem mehrere weitere Folgen der Serie moderiert – die meisten handelten von Spukhäusern, verlassenen Irrenhäusern und Ähnlichem – aber die Insel der Puppen war sozusagen immer sein Goldenes Ei gewesen. Das Problem war, dass die Insel sich in Privatbesitz befand. Der Besitzer war vor Kurzem gestorben, und jetzt hatte sein Neffe das Sagen. Er hatte sich wiederholt geweigert, Pepper und seine Filmcrew auf die Insel zu lassen. Vonseiten des Travel Channels hatte Pepper die inoffizielle Zustimmung für die Dokumentation. Man hatte ihm gesagt, dass es großartig wäre, wenn er verwendbare Aufnahmen bekäme. Wenn er allerdings dabei erwischt wurde, würden sie behaupten, nichts davon gewusst zu haben.
Und hier kamen Pita und ich ins Spiel. Pepper wollte nicht allein zur Insel fahren, und wir standen in keinerlei Verbindung zu dem Fernsehsender. Ich hatte mich auf den Ausflug gefreut, Jesus bekam vor ein paar Tagen Wind davon, und bestand auf seine stürmische Art darauf, dass er und Elizaveta auch mitkommen würden.
Pita spülte jetzt ihr Haar aus. Milchig-weißes Seifenwasser floss ihren Rücken hinunter. Ich fragte sie: »Fahren wir immer noch um zehn los?«
»Ja«, sagte sie, ohne mich anzusehen.
»Wie spät ist es?«
»Du hast eine halbe Stunde, um dich fertigzumachen.«
Ich stöhnte und fragte mich, ob ich mich in dieser Zeit zusammenreißen konnte.
»Du musst nicht mitkommen«, sagte sie zu mir und drehte sich so weit um, dass ich die Seite ihrer linken Brust sehen konnte.
»Ich habe Pepper schon gesagt, dass ich mitkomme.«
»Ich bin sicher, er würde es verstehen – dein Kopf und all das.«
»Würde es dir etwas ausmachen?«, fragte ich vorsichtig und fragte mich, ob ich gerade in eine ihrer Fallen tappte. Ich würde ihr zustimmen, und dann würde sie zuschlagen und mich beschuldigen, dass ich nie etwas mit ihr unternehmen wollte, ihren Bruder nicht mögen würde oder irgendetwas in dieser Art. Ihre Intrigen wären amüsant, wenn sie nicht immer gegen mich gerichtet wären.
»Ich denke, dass du dich ausruhen solltest, Jack«, sagte sie. »Das denke ich. Aber es ist deine Entscheidung.«
3
Jesus und seine Crew fuhren vierzig Minuten später in seinem brandneuen Jaguar X vor. Das Auto passte zu ihm: viel Show, wenig Substanz. Denn hinter der Motorhaube, die mit einer tänzelnden Raubkatze verziert war, und der Innenausstattung aus Leder und Holz verbarg sich nur ein einfacher Ford Mondeo mit Allradantrieb. Wahrscheinlich wusste Jesus das nicht. Er hatte ihn wohl gekauft, weil es die Art von Auto war, das ein junger, reicher Kerl fahren sollte.
Während Pita hinausging, um alle zu begrüßen - sie trug ein Chambray-Shirt mit hochgerollten Ärmeln und abgeschnittene Jeans-Shorts, die die Rundung ihres Hinterns betonte – ging ich in die Garage und lud unser Tagesgepäck in meinen drei Jahre alten Porsche 911. Er parkte neben einem schrottigen 79er Chevrolet Monte Carlo. Ich hatte als Jugendlicher in Vegas das gleiche Modell gehabt. Ich hatte drei Jahre lang in einer Autoreparaturwerkstatt gearbeitet, um genug Geld zu sparen, um mir dieses Auto zu kaufen. Als ich achtzehn wurde und meine Rennfahrerlizenz bekam, fuhr ich an vier Abenden in der Woche Rennen auf den örtlichen Bahnen. Ich endete immer im Mittelfeld oder als Schlusslicht, aber ich wurde wegen meines Namens trotzdem ein Liebling der Fans. Die Ansager bei den Rennen waren der Ansicht, dass Jack Goff wie ein Scherz klang, und ergriffen jede Gelegenheit, ihn zur Freude des Publikums über das Lautsprechersystem zu erwähnen. Bald nannte mich niemand mehr Jack. Es hieß immer Jack Goff. Ansager, Interviewer, Fans, wer auch immer. Alle sagten Jack Goff. Der Name hatte diesen zweisilbigen Rhythmus – und natürlich die Andeutung – was die Leute dazu brachte, ihn vollständig sagen zu wollen.
Ich gewann mit dem Monte Carlo nie ein Rennen, aber er war mein erster Rennwagen und verband mit ihm einige meiner schönsten Erinnerungen. Darum hatte ich vor ein paar Monaten das Schrottauto gekauft, um es zu restaurieren. Es war ein Projekt, eine Möglichkeit für mich, meine Tage zu füllen, weil meine Rennzeit nun vorbei war.
Ich setzte mich hinter das Lenkrad des Porsches und rollte die Zufahrt hinunter, bis ich Haube an Haube mit dem Jaguar stand. Elizaveta, die auf dem Beifahrersitz saß, das Gesicht hinter einem großen Sonnenhut und einer Sonnenbrille verborgen, lächelte mich an und winkte mir zu, was ich erwiderte. Jesus hatte sein Fenster geöffnet, sein Ellenbogen ragte heraus. Er sprach mit seiner Schwester. Sein Haar saß wie immer makellos, es war an den Seiten kurz geschnitten, die oberen Haare waren nach links gescheitelt und glatt an den Kopf gekämmt. Er trug eine Fliegersonnenbrille und hatte einen leichten Bartschatten, den er zweifellos für schick hielt. Das grelle Sonnenlicht auf der Windschutzscheibe verhinderte, dass ich Pepper auf dem Rücksitz sah, und ich fragte mich, ob ich aussteigen und ihn begrüßen sollte, als Jesus und Pita ihr Gespräch beendeten.
Jesus nahm mich endlich zur Kenntnis, grinste und drückte auf die Hupe des Jaguars. Ich umklammerte das Lenkrad fester und fragte mich, warum ich beschlossen hatte, mitzukommen. Doch ich hatte kaum eine Wahl gehabt. Wie ich Pita gesagt hatte, hatte ich Pepper bereits zugesagt. Ich wäre ein Drückeberger gewesen, wenn ich eine Ausrede vorgeschoben hätte, insbesondere da mein Kopf nicht allzu sehr schmerzte. Tatsächlich litt ich mehr unter meinem Kater als unter der Verletzung. Ich fühlte mich schwerfällig, unmotiviert, antriebslos – aber mir ging es gut genug für einen Tagesausflug. Und ob Jesus nun dabei war oder nicht, ich war immer noch daran interessiert, die berüchtigte Insel der Puppen zu sehen.
Ich drehte die Lautstärke hoch, und die Bässe irgendeines mexikanischen Songs dröhnten, während Jesus rückwärts auf die Straße fuhr, drehte und losfuhr. Pita stieg neben mir in den Porsche.
Nach ein paar Minuten Fahrt fing sie an, vor sich hin zu summen. Sie hatte ihr dickes, welliges Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden, aus ihrem Gesicht heraus, das makellose Züge aufwies. Kojotenbraune Augen – von denen sie gerne behauptete, sie wären haselnussbraun - mit langen Wimpern, eine gerade Nase, die sie unauffällig war, dass man sie kaum bemerkte, was ein Vorteil war, wenn es um Nasen ging, volle Lippen, die eher verspielt als schmollend waren, hohe Wangenknochen und ein sanft gerundetes Kinn.
Pitas Summen verwandelte sich in Worte, ein spanischer Song, den ich aus dem Radio kannte. Sie sang ihn leise vor sich hin. Sie hatte eine raue Singstimme.
»Was ist los?«, fragte ich sie.
Sie sah mich an. »Was meinst du?«
»Du hast gute Laune.«
»Darf ich keine gute Laune haben?«
»Ich meine ja nur … worüber hast du mit Gott geredet?«
»Nenn ihn nicht so.«
»Ich sage es ihm ja nicht ins Gesicht.«
»Er nennt dich Jack.«
Was sie damit meinte, war, dass er mich nicht Jack Goff nannte. Und sie hatte recht, das tat er nicht. Jedenfalls nicht, wenn ich es hörte. Ich sagte: »Worüber hast du mit deinem Bruder geredet?«
»Über nichts.«
»Ihr habt fünf Minuten miteinander gesprochen.«
»Er ist mein Bruder. Wir haben nur geredet.«
»Über das Wetter? Über den Ausflug?«
»Warum ist das wichtig?«
»Ich mache nur Konversation, Pita.«
»Nein, bei dir klingt es, als würden wir uns beschwören oder so etwas.«
Ich korrigierte ihre falsche Aussprache nicht. Manchmal verwechselte sie englische Worte oder sagte sie völlig falsch. Ich hatte allerdings noch nie gehört, dass man beschwören und verschwören verwechselte.
»Wie geht es Pepper?«, fragte ich und wechselte damit das Thema.
»Er ist aufgeregt.«
»Will er dich immer noch interviewen?«
»Ja. Er wird mir auf dem Boot sagen, was ich mir merken soll. Er will auch, dass du ein paar Sachen sagst.«
»Ich lasse mich nicht aufnehmen.«
»Er will es aber.«
»Warum fragt er nicht Jesus?«
»Weil Jesus zu bekannt ist.«
»Und ich nicht?«
»Wir sind nicht mehr in Amerika, Jack«, sagte sie. »Ich rede von Mexiko. Die Leute hier kennen meinen Bruder. Dich kennen sie nicht.«
Das stimmte. Ich fiel in diesem Land nur auf, weil ich weiß war, und wegen meiner Größe. Diese Anonymität war der anfängliche Auslöser gewesen, hierher zu ziehen. Denn mein Ausscheiden aus dem Rennsport ist eine ziemlich große Sache gewesen, und ich konnte mir vorstellen, wie ESPN eine Kopie von Peppers »Insel der Puppen«-Episode in die Finger bekam und einen Ausschnitt von mir sendete, mit der Überschrift: NASCAR Neuling des Jahres, Jack Goff, ist jetzt paranormaler Forscher für das mexikanische Fernsehen.
»Ich lasse mich nicht aufnehmen«, wiederholte ich.
Jesus hielt vor einer roten Ampel. Ich fuhr neben ihn. Ich starrte geradeaus, auf nichts Bestimmtes, ging die Strecke nach Xochimilco im Kopf durch, als ich den Motor des Jaguars aufheulen hörte.
Ich sah an Pita vorbei zu Jesus, der mich angrinste. Er ließ den Motor noch lauter und länger aufheulen.
»Meint er das ernst?«, fragte ich.
»Wag es nicht, auch nur daran zu denken, ein Rennen mit ihm zu fahren«, sagte Pita.
»Ich schlage ihn mit Leichtigkeit«, sagte ich und grinste.
Jesus trat aufs Gas, sodass der Jaguar dröhnte und sportlich klang.
Ich drückte die Kupplung durch, legte den Gang des Porsches ein und brachte den Motor auf fünftausend Umdrehungen.
»Jack!«, schrie Pita über den Lärm hinweg.
Jesus startete, bevor die Ampel umsprang. Ich ließ die Kupplung los und gab Gas. Die Reifen quietschten kurz, die Drehzahl geriet in den roten Bereich. Mein Kopf wurde zurückgerissen. Jesus Frühstart hatte ihm eine Stoßstangenlänge Vorsprung gegeben, aber die gewann ich zurück, als ich in den zweiten Gang schaltete.
Im dritten Gang blieben wir Seite an Seite. Ich machte mir keine Gedanken, denn ich wusste, dass ich ihn im vierten Gang hinter mir lassen würde.
Und genauso war es. Als wir beide hochschalteten, ließ ich ihn problemlos eine Autolänge zurück.
»Fahr langsamer, Jack!«, sagte Pita.
Da ich in einer Sechzigerzone hundertvierzig fuhr und Jesus jetzt zwei Autolängen hinter mir gelassen hatte, fand ich, dass ich mich ausreichend unter Beweis gestellt hatte. Ich ging vom Gas.
Statt ebenfalls zu verlangsamen, raste Jesus an mir vorbei.
»Dieses kleine Arschloch«, grunzte ich und gab wieder Gas.
»Jack!«, sagte Pita.
Wir näherten uns einer Auffahrt zur Autobahn, die in Ost-West-Richtung mitten durch Mexico City führte. Jesus fuhr darauf, ohne zu verlangsamen. Ich tat es ihm nach.
Pita schrie immer noch über das Dröhnen des Motors hinweg, nur dass sie jetzt eher ängstlich als verärgert klang und ihr Geschrei mit den Worten »Stopp!« und »Wir werden sterben!« durchsetzt war. Doch ich würde auf keinen Fall nachgeben. Nicht, bevor ich diesen Angeber in seine Schranken verwiesen hatte.
Jesus und ich wechselten auf die linke Spur und fuhren mit mehr als hundertfünfzig an anderen Fahrzeugen vorbei. Ich klebte an seiner Stoßstange, fuhr in seinem Windschatten.
Ich schenkte leicht nach rechts, um nach vorn sehen und meinen Zug zum Überholen planen zu können. Da bemerkte ich, dass eines der Autos, an denen wir vorbeigerast waren, Lichter auf dem Dach hatte und auf seiner Seite stand »Policia«.
Einen Augenblick später wechselte der Polizist auf die linke Spur hinter mir, die Sirene heulte auf.
»Jack, du musst rechts ranfahren! Wir werden noch verhaftet! Fahr rechts ran! Jack!«
Jesus überholte einen roten Sedan vor ihm und schwenkte wieder auf die linke Spur. Ich klebte die nächsten fünfhundert Meter an ihm und kurvte um mehrere weitere Fahrzeuge herum.
»Jack!« Pita schluchzte fast. »Bitte!«
Und ich gab nach.
Ich raste über eine Überführung, warf einen Blick in den Seitenspiegel, sah das Polizeiauto nicht, trat auf die Bremse und zwängte mich zwischen zwei Sattelschlepper auf der rechten Spur, die auf ihre blöden Signalhupen drückten und das Fernlicht aufleuchten ließen.
Mehrere lange Sekunden später raste der Polizist an mir vorbei, ohne mich zu entdecken.
Er war jetzt Jesus‘ Problem.
4
Als wir eine Stunde später in Xochimilco ankamen, folgte ich den Schildern, auf denen »los embarcaderos« - Pier – stand bis nach Cuemanco, einer der neun Orte, die Zugang zu dem alten Azteken-Kanalsystem boten. Hier wollten wir uns mit den anderen treffen. Ich parkte auf einem fast vollen Parkplatz, holte unsere Rucksäcke aus dem Kofferraum des Porsches und reichte Pita ihren. Sie nahm ihn schweigend und ging schweigend die Reihe von baufälligen Häusern entlang, die den Parkplatz vom Ufer trennten. Ich wühlte eine Minute in meiner Tasche herum, um den bescheidenen Inhalt zu überprüfen. Es war nicht nötig. Ich wusste, was ich eingepackt hatte. Doch Pita und ich brauchten etwas Abstand.
Nachdem wir dem Polizisten entkommen waren, hatte Pita die nächsten zehn Minuten damit verbracht, mich in einer Mischung aus Englisch und Spanisch anzuschreien. Sie sagte mir, ich wäre verrückt, ich hätte uns umbringen können, und das alles nur wegen meines Egos. Ich widersprach ihr nicht. Sie hatte recht. Straßenrennen waren dumm und rücksichtslos. Also hörte ich mir stoisch ihr Schimpfen an, was sie nur noch wütender zu machen schien. Schließlich jedoch ebbte ihre Wut ab, und sie rief Jesus auf seinem Handy an. Wie sich herausstellte, hatte der Polizist ihn angehalten und er musste bezahlen. Mehr Einzelheiten bekam ich nicht mit, denn Pita weigerte sich, mit mir zu sprechen, ganz zu schweigen davon, mir Näheres zu erläutern, nachdem sie das Gespräch beendet hatte.
Nichtsdestotrotz war das Ergebnis so, wie ich es erwartet hatte. Das hier war schließlich Mexiko, und jeder Polizist konnte gekauft werden. Einige suchten sogar aktiv nach Bestechungsgeldern. Ich hatte das in meiner ersten Woche in diesem Land am eigenen Leib erfahren. Ein Polizist hielt mich auf einer leeren Straßenstrecke an und sagte mir, dass ich zu schnell gefahren wäre, was nicht so war. Er nahm meinen Führerschein als »Garantie« und sagte mir, ich könnte ihn sofort zurückbekommen, wenn ich ihm hundertfünfzig amerikanische Dollar zahlen würde - oder ich könnte ihm zum Polizeirevier folgen, wo ich zweihundertfünfzig zahlen müsste. Es war ganz eindeutig ein Betrug, und ich wurde sauer und versuchte, meinen Führerschein von seinem Klemmbrett zu reißen. Er beschuldigte mich, »aggressivo« zu sein, und verdoppelte die Strafe. Wir stritten weiter, bis ich aufgab. Ich bezahlte ihm hundertsechzig Dollar – alles, was ich dabeihatte – was er mehr als zufrieden akzeptierte.
Ich schloss den Kofferraum des Porsches mit einem schweren Schlag, schlang mir den Rucksack über die Schulter und ging zu den Docks.
5
Die Promenade entlang des Kanals war voller Menschen, und es herrschte eine allgemeine festliche Stimmung. Gondelartige Kähne, die trajineras genannt wurden, säumten das Ufer, soweit ich blicken konnte. Die meisten hatten die Größe eines großen Lieferwagens, hatten ein Dach, das Schatten gab, und offene Fenster, dazu Tische und Stühle für ein Picknick. Sie waren in verschiedenen Farben gestrichen und trugen aus irgendeinem Grund weibliche Vornamen.
Ich suchte die Menschenmenge nach Pita ab – ich hatte kaum Probleme, über die vielen dunkelhaarigen Köpfe hinwegzusehen – konnte sie aber nirgendwo entdecken. Ich war nicht allzu besorgt. Ich hatte mein Handy. Wenn ich sie nicht früher oder später fand, konnte ich sie anrufen, oder sie würde mich anrufen.
Ich ging die Promenade entlang. Verkäufer riefen mir von ihren Marktständen aus zu, boten mir ihre Waren von, von Kunsthandwerk, T-Shirts, bestickter Kleidung, Wäsche, Sandalen bis zu den üblichen Souvenirs.
Ein mobiler Händler ging neben mir her. Er war klein und dicklich und trug eine weiße Hose und ein weißes Shirt. Er lächelte und fragte mich, wonach ich suchte.
»Meine Freunde«, sagte ich.
»Wollen Sie Armbanduhr? Rolex? Wollen Sie Rolex?«
»Nein, danke.«
»Was wollen Sie? Marihuana? Pillen? Ich besorge Ihnen alles.«
Ich schüttelte den Kopf und entzog mich ihm.
»Hey, Mann!«, rief er mir nach. »Mädchen? Willst du Mädchen? Ich gebe dir meine Schwester! Billig!«
Nach weiteren fünfzig Metern traf ich auf zwei alte Frauen, die Tamales in Bananenblättern verkauften. Mir wurde klar, dass ich den ganzen Morgen noch nichts gegessen hatte, und ich kaufte zwei, eins mit Hühnchen und Salsa gefüllt, das andere mit Bohnenmus.
Ich fand eine leere Bank und verschlang die Tamales. Zwei der besten Dinge an einem Leben in Mexiko, fand ich, waren das Wetter und das Essen. Es war fast das ganze Jahr über frühlingshaft, mit sehr niedriger Luftfeuchtigkeit, und das fettige Straßenessen musste mit Crack oder so etwas zubereitet werden, denn es machte einfach süchtig.
Ich gab den letzten Bissen meines zweiten Tamales einem flohgeplagten Köter, der es gierig beäugt hatte, und überlegte mir, ob ich mir ein drittes holen sollte, als der Verkäufer, der mir seine Schwester angeboten hatte, mich entdeckte und zu mir kam. »Mein Mann!«, sagte er und setzte sich zu mir. »Wie ist das Tamale? Gut, ja? Magst du mexikanisches Essen?«
»Ich bin kein Tourist«, sagte ich zu ihm. »Ich lebe hier.«
»Sie leben hier? Wo?«
Ich würde ihm nicht das Viertel nennen, wo ich wohnte, da es eine teurere Gegend in Mexico City war, also sagte ich ihm einfach den Namen des allgemeinen Bezirks. »Und was machen Sie?«, fragte er.
»Hören Sie mal, ich will nichts kaufen.«
Er lächelte. »Kein Problem. Kein Problem. Aber wo sind Ihre Freunde? Vielleicht wollen sie eine Armbanduhr? Ich habe auch Cartier. Alles, was sie wollen.«
Ich stand auf und ging wieder die Promenade entlang. Der aufdringliche Verkäufer folgte mir.
»Sie und Ihre Freunde fahren die Kanäle runter, was?«, sagte er. »Braucht ihr ein Boot? Ich mache euch einen guten Preis.«
»Mein Freund hat schon eins organisiert.«
»Ihr Freund, was?« Ich spürte, dass er mich ansah, als würde er mir nicht glauben oder als wollte ich ihn loswerden, was auch stimmte.
»Ja, mein Freund. Er will auf der Insel mit den Puppen filmen. Er hat alles organisiert. Das Boot. Die Tickets. Wir brauchen nichts.«
»Ihr wollt zur Isla de las Muñecas?«, fragte er.
Mir wurde klar, dass ich zu viel gesagt hatte, und ich wollte den Schlepper ignorieren und weitergehen, aber sein Gesichtsausdruck ließ mich innehalten. Ich konnte nicht sagen, ob er Angst oder Wut ausdrückte. »Was ist?«, fragte ich.
»Ihr fahrt zur Isla de las Muñecas?«, wiederholte er.
»Nein«, sagte ich. »Wir werden die Insel nicht betreten. Wir fahren darum herum.« Ich machte eine kreisende Bewegung mit dem Finger. »Wir machen ein paar Bilder und kommen zurück. Nur Touristen, okay?« Ich wollte weggehen, aber seine Finger legten sich fest um mein Handgelenk.
»Ihr fahrt nicht dorthin.«
»Lassen Sie mich los.«
Passanten sahen uns neugierig an, und ich wurde langsam wütend. Ich versuchte, meinen Arm aus seinem Griff zu ziehen. Er wollte nicht loslassen.
»Warum wollt ihr da filmen?«
»Lassen Sie mich los.«
»Warum wollt ihr da filmen?«
»Die letzte Warnung.«
»Ihr fahrt«, sagte er und senkte die Stimme zu einem bedrohlichen Flüstern, »ihr sterbt.«
Ich starrte den Kerl an und fragte mich, ob er vielleicht verrückt war. Auf seiner Stirn hatte sich ein Schweißfilm gebildet. Die Fröhlichkeit war aus seinem Gesicht verschwunden, jetzt war es angespannt. Seine schwarzen Augen blickten in meine.
Mein Handy klingelte und unterbrach den angespannten Moment. Ich riss meinen Arm los und holte das Handy aus meiner Tasche.
»Ja?«, sagte ich und ging weiter, mischte mich unter die Menschenmenge auf der Promenade.
»Wo bist du?« Es war Pita.
»Ich habe mir nur etwas zu essen geholt.«
»Wir warten alle auf dich.«
»Alle sind schon da? Wo? Ich wusste nicht, wohin du gegangen bist.«
»Ungefähr vierhundert Meter von der Stelle entfernt, wo wir geparkt haben. Da siehst du ein Restaurant mit einer grünen Markise. Das Trajinera ist direkt davor.«
»Ich bin gleich da.«
Wir legten auf.
Ich stopfte das Handy in meine Tasche zurück, blickte über die Schulter und erwartete, den verrückten Händler zu sehen, der mir nachstarrte.
Er war fort.
1950
1
Maria Diaz wurde zu früh geboren, sie kam in der zweiunddreißigsten Woche durch einen Notkaiserschnitt zur Welt. Sie wog tausendsiebenhundert Gramm. Sie bestand alle Standardtests und wurde als kerngesundes Baby deklariert. Als sie jedoch eine Woche alt war, schnellte ihr Puls in die Höhe. Ihre Eltern brachten sie schnell ins Krankenhaus zurück, wo sie während der nächsten zwölf Stunden zweiundzwanzig Krampfanfälle erlitt. Da man Epilepsie damals noch nicht gut verstand, nahm ihr Kinderarzt an, dass ihr Zustand durch eine Hirnblutung hervorgerufen worden war, und versicherte ihren Eltern, dass sie die Nacht nicht überleben würde.
Jetzt war Maria vier Jahre alt. Sie wusste natürlich nichts davon, was in der ersten ereignisreichen Woche ihres Lebens passiert war. Wie bei den meisten Vierjährigen waren ihr Wissen zum großen Teil auf ihre unmittelbare Umgebung beschränkt, was ihr Haus und die Straße davor einschloss.
Im Moment stand Maria vor einem Regal im Spielzimmer des Hauses und musste sich entscheiden, welche Puppen an ihrer morgendlichen Tee-Party teilnehmen würden. Ihre erste Wahl fiel auf Angela, die ein spitzenbesetztes blaues Kleid und eine Haube trug. Sie war ein Rock-a-bye Baby, was bedeutete, dass man sie zur Schlafenszeit so lange wiegen musste, bis sie die Augen schloss und einschlief. Maria trug sie vorsichtig zu dem kleinen Tisch und setzte sie auf einen Stuhl. Sie fiel nach vorne, und ihr schwerer Gummikopf fiel mit einem dumpfen Laut auf die Tischoberfläche. »Nicht mehr schlafen«, sagte Maria streng zu ihr und setzte sie wieder aufrecht hin. Sie wartete, um sicherzugehen, dass Angela sich nicht mehr von allein bewegen würde. Zufrieden wandte sie sich erneut dem Regal zu. Acht Puppen starrten sie an, aber am Tisch gab es nur noch zwei freie Plätze. Nachdem sie eine Weile nachgedacht hatte, entschied sich Maria für Miss Magic Lips. Sie trug ein pinkfarbenes Kleid mit Glitzersaum, und sie lächelte, wobei sie ihre Vorderzähne zeigte, was hieß, dass sie glücklich war. Wenn sie unglücklich war, drückte sie die Lippen aufeinander und weinte.
Da Maria nicht ein drittes Mal zum Tisch gehen wollte, griff sie auch nach einem Teddy, der nichts außer einem apricotfarbenen Pullover trug. Er war zwar ein Bär und keine Puppe, aber er war ein freundlicher Bär und kam mit jedem gut aus.
Am Tisch setzte sie Miss Magic Lips links von Angela hin und den Teddy zu ihrer Rechten. Sie benahmen sich besser als Angela, keiner von ihnen versuchte, wieder einzuschlafen. Zufrieden ging Maria zu der Kommode in der Ecke und suchte zwischen den Spielzeugen nach den nötigen Untertassen, Teetassen und dem Kessel. Sie deckte den Tisch und sagte dann: »Ich danke euch allen, dass ihr zu meiner Tee-Party gekommen seid. Wer möchte etwas Tee?«
»Ich, ich!«, sagte Angela, obwohl es in Wirklichkeit Maria war, die mit höherer Stimme sprach.
»Hier, bitte, Angela«, sagte Maria mit ihrem normalen Gastgeberton. Sie goss Fantasie-Tee in ihre Tasse. »Wer sonst noch?«, fragte sie.
»Ich!«, sagte Miss Magic Lips.
»Du bist heute glücklich, Miss Magic Lips«, merkte Maria an und goss Tee in ihre Tasse.
»Ich möchte einen Cupcake«, sagte Angela.
»Ich habe keine Cupcakes.«
»Kannst du welche backen?«
Maria sah zu dem pinkfarbenen Ofen an der Wand hinüber und sagte: »Na ja, vielleicht. Aber Teddy braucht noch Tee. Stimmt’s, Teddy?«
»Ja, bitte.«
Sie füllte seine Tasse.
»Kann ich Honig dazu haben?«, fragte er.
»Ich habe nur Zucker. Ist das okay?«
»Ja, bitte.«
Sie nahm ein Stück Würfelzucker, das nur in ihrer Fantasie existierte, und ließ es in seine Tasse fallen.
»Ich will einen Cupcake!«, sagte Angela.
Maria seufzte und ging zu ihrem Backofen. Sie drehte ein paar Knöpfe und sagte: »Okay, sie backen.«
Zurück am Tisch nahm sie gegenüber von Angela Platz, goss sich eine Tasse Tee ein und hob sie an die Lippen. »Oh, er ist sehr heiß. Ihr müsst alle vorsichtig …«
Sie beendete ihren Satz nie.
2
Marias Mutter kniete vor ihr, ihre Miene war besorgt. Maria blinzelte langsam, wie betäubt, wie eine Hauskatze, die gerade gefüttert worden war. Wann war ihre Mutter gekommen? War sie auch wegen der Tee-Party hier? Sie redete mit ihr. »Antworte mir, Maria«, sagte sie. »Ist alles in Ordnung? Kannst du mich hören?«
»Ich mache eine Tee-Party, Mom«, sagte sie.
»Das sehe ich, Süße. Aber gerade eben, was hast du gedacht?«
Maria runzelte die Stirn. »Dass der Tee heiß war.«
»Das ist alles?«
Sie nickte. »Warum?«
»Du hast mir nicht geantwortet, als ich ins Zimmer kam. Du hast in die Luft gestarrt.«
»Ich habe gedacht, dass der Tee sehr heiß ist.«
»Das ist alles?«
»Das ist alles.«
Ihre Mutter schien erleichtert zu sein und umarmte sie.
»Bist du zur Tee-Party gekommen?«, fragte Maria an ihrer Schulter.
Ihre Mutter ließ sie los. »Nein, Süße. Es ist Zeit fürs Mittagessen. Ich habe dir Tortillas gemacht.«
»Ich liebe Tortillas.«
»Dann lass uns essen.«
»Was ist mit meiner Tee-Party?«
»Die kannst du später beenden. Deinen Puppen wird es nichts ausmachen, oder?«
»Angela vielleicht schon. Sie mag es nicht zu warten.«
»Das muss sie lernen, wenn sie eine kleine Dame werden will. Manchmal muss man geduldig sein.«
»Angela«, sagte Maria zu ihr, »du musst geduldig sein.«
Angela starrte sie nur an.
Jack
1
Ich sah zuerst Pepper, dann Elizaveta. Sie standen neben einem Baum am Ufer des Kanals.
»Jack!«, sagte Pepper und breitete die Arme aus. »Bienvenidos Xochimilco!«
Er lächelte mich breit an, und ich konnte nicht anders, als das Lächeln zu erwidern. Er war einer der fröhlichsten Menschen, die ich kannte, hatte ein Engelsgesicht und funkelnde Augen, die zu seiner glücklichen Persönlichkeit passten. Er war auch einer der modebewusstesten Menschen, die ich kannte. Heute trug er ein bananengelbes Oxford-Shirt, das am Hals offen war, er hatte sich einen lilafarbenen Blazer über die Schulter geworfen, aus dessen Tasche ein gepunktetes Tuch hervorschaute, eine dazu passende lilafarbene Hose, die knitterig und am Saum aufgerollt war, dazu einen weißen Gürtel und farblich dazu passende Slipper ohne Socken.
Wir umarmten uns und schlugen uns auf den Rücken.
Pepper gefiel es immer, wenn jemand sein Outfit kommentierte, also trat ich zurück und sagte: »Mir gefällt deine Jacke, so wie du sie über der Schulter trägst. Sehr Ralph Lauren.«
»Jack«, sagte er, eindeutig entzückt von dem Kompliment, »die schickste Art, eine Jacke zu tragen, ist, sie nicht zu tragen, wusstest du das nicht?«
»Hi, Eliza«, sagte ich und küsste sie auf die Wange. Sie duftete nach Blumen und trug immer noch den Sonnenhut und die übergroße Sonnenbrille. In Kombination mit ihrem pinkfarbenen Top, den weißen Shorts, Armbändern, Keilabsätzen und der Schultertasche aus Leder, hätten sie und Pepper direkt vom Mittagessen in St. Regis kommen können.
Elizaveta schlug mich leicht auf die Brust und wackelte dann mit dem Zeigefinger. »Du bist verrückt«, sagte sie mit ihrem russischen Akzent, der leicht maskulin klang, breit und kühn. Sie ließ die Zigarette fallen, die sie geraucht hatte, und trat sie aus. »Wusstest du das? Sehr verrückt.«
»Das hat man mir schon gesagt.«
»Willst du uns umbringen?«
Sie versuchte, wütend auf mich zu sein, schaffte es aber nicht. Sie presste die Lippen zusammen, um ein kleines Lächeln zu verbergen.
»Jesus hat mich herausgefordert«, sagte ich. »Bist du auch auf ihn wütend geworden?«
»Sehr wütend. Ich denke, dass er auch verrückt ist.« Serr verrückt. Ich denke, err ist auch verrückt.
»Wo ist er überhaupt? Und Pita?«
»Sie sind zur Toilette gegangen.« Elizaveta runzelte beim Anblick des Verbands an meinem Kopf besorgt die Stirn. Sie nahm die Sonnenbrille ab, um ihn besser ansehen zu können. Sie hatte smaragdgrüne Augen, aristokratische Züge mit hohen Wangenknochen, schmale Lippen und langes, dunkles Haar. Während sie wahrscheinlich weiß wie eine Schneeflocke gewesen war, als sie noch in Sankt Petersburg lebte – oder Sankt Peterburg, wie sie es aussprechen würde – war ihre Haut jetzt braun von der tropischen Sonne.
Sie war jetzt seit etwa vier Jahren in Mexiko. Sie arbeitete als Kindermädchen für eine reiche russische Familie und unterrichtete ihre beiden Töchter zu Hause. Ihr Arbeitgeber, ein Berater für ein staatliches mexikanisches Öl-Unternehmen, verkehrte in denselben Kreisen wie Jesus, den sie auf einem Nachbarschaftspicknick kennen lernte. Jesus verbrachte mehrere Wochen damit, ihr den Hof zu machen, bevor sie vor ungefähr einem Jahr ein Paar wurden.
Manchmal dachte ich, dass Elizaveta und ich ein gutes Paar abgegeben hätten, wenn ich nicht mit Pita verlobt und sie nicht mit Jesus zusammen wäre. Sie war klug, lustig und frech – genau mein Typ, denke ich.
Ich fühlte mich schuldig, als ich mir vorstellte, dass wir beide zusammen wären, aber es waren nur Gedanken, das war alles, ich hatte keine Kontrolle über sie. Ich hatte Pita nie betrogen und würde es auch nie tun.
»Ist dein Kopf in Ordnung?«, fragte Elizaveta mich und runzelte mit Blick auf den Verband an meinem Kopf die Stirn.
Ich hob mein Käppi an und strich mir durchs Haar. »Es geht mir gut«, sagte ich zu ihr.
»Was ist passiert?«, fragte Pepper.
»Er hat gestern Abend versucht, von einem Balkon in den Swimmingpool zu springen und ist gefallen«, sagte Elizaveta. »Siehst du, er ist verrückt.«
»Ich stimme Eliza zu«, sagte Pepper. »Jeder, der sich dafür entscheidet, ein Auto mit zweihundert Meilen pro Stunde auf einer Rennstrecke zu fahren, die voller anderer Autos ist, muss verrückt sein.«
Ich wechselte das Thema und sagte: »Dieser Ort ist ziemlich spektakulär. Ich hatte keine Ahnung, dass hier so viel los sein würde.«
»An Wochentagen ist es ruhiger«, sagte Pepper. »Aber an Wochenenden, besonders am Sonntag, ist sehr viel los.«
»Welches ist denn unser Boot?«
Wir drehten uns zum Kanal um, die Kähne lagen am Ufer aufgereiht. Mit ihren grellen Farben und den kitschigen Dekorationen waren sie das amphibische Äquivalent des philippinischen Jeepney. Pepper zeigte auf einen direkt vor uns. »Lupita« stand auf der hinteren Rundung geschrieben.
»Was soll das mit den weiblichen Namen?«, fragte ich.
»Manche beziehen sich auf jemand Besonderen«, sagte Pepper. »Vielleicht eine Ehefrau oder Tochter. Bei den anderen, denke ich, ist es einfach der Name des Bootes.«
»Ich hätte nie gedacht, dass es irgendwo in Mexico City so grün ist.«
»Wir nennen Xochimilco die Lunge der Stadt. Xochimilco bedeutet Blumenwiese. Warte, bis du ein paar der Chinampas siehst. Sie sind wunderschön.«
Ich runzelte die Stirn. »Chin-, was?«
»Die Inselgärten, die die Kanäle voneinander trennen. Die Azteken haben sie angelegt.«
»Um Blumen zu züchten?«
»Und andere Nutzpflanzen. Früher gab es noch viel mehr Chinampas, aber nach der spanischen Invasion und nachdem die Seen ausgetrocknet waren, sind diese Kanäle alles, was geblieben ist.«
Ich sah Pepper skeptisch an. »Die Seen?«
»Oh Mann, Jack«, sagte er. »Wusstest du nicht, dass Mexico City einst von fünf Seen umgeben war?«
»Ich hatte keine Ahnung.«
»Ihr Amerikaner«, sagte Elizaveta.
»Du wusstest es?«, fragte ich sie.
»Natürlich. Ich bin Russin, und Russen sind keine ungebildeten Amerikaner. Ich lerne etwas über das Land, in dem ich leben will.«
Ich verdrehte die Augen. »Wohin sind die Seen verschwunden?«, fragte ich Pepper, wobei ich mir immer noch nicht sicher war, ob er mich veralberte. »Wie konnten sie einfach austrocknen?«
»Da ist er ja!«, rief eine Stimme hinter uns, sodass ich meine Frage nicht beenden konnte. »Mr. Days of Thunder höchstselbst!«
Ich drehte mich um und sah, dass Jesus und Pita sich uns näherten - in Begleitung von Jesus neuem besten Freund Nitro.
2
Zu sagen, dass Nitro und ich nicht miteinander auskamen, wäre untertrieben. Die Feindschaft zwischen uns fing wegen einer Fliegengittertür an. Vor ein paar Monaten gab eine von Pitas Freundinnen eine Party, und wie es von jeder anständigen Party erwartet wurde, wurde ziemlich viel Alkohol getrunken.
Gegen zwei Uhr morgens, nachdem fast alle Gäste gegangen waren, blieben noch etwa zehn von uns zurück. Pitas Freundin hatte ein Penthouse in einer Art von altem Art-Deco-Gebäude gemietet. Wir waren auf die Terrasse gegangen, um den Ausblick auf die Stadt zu genießen. Irgendwann ging ich hinein in die Küche, um mir noch ein Bier zu holen, und als ich auf die Terrasse zurückkehrte, lief ich direkt in die Fliegengittertür und stieß sie aus ihrer Schiene. Ich hob sie auf und stellte sie beiseite, denn ich war nicht im Geringsten dazu in der Lage, herauszufinden, wie ich eine Fliegengittertür wieder einsetzen konnte. Ich dachte, dass es kein Problem darstellte. Doch Nitro schien die Angelegenheit persönlich zu nehmen. Er fing an, auf Spanisch über mich zu schimpfen. Ich wusste nicht, was er sagte, aber es war klar, dass er beleidigt war. Ich fragte ihn, was sein Problem wäre. Er sagte mir, ich sollte die Tür reparieren. Ich sagte ihm, er sollte sich um seinen eigenen Kram kümmern. Er regte sich auf, stank nach Testosteron, also versetzte ich ihm einen Schlag. Er ging daraufhin wie ein von der Leine gelassener Pitbull auf mich los. Wir prügelten uns auf der Terrasse, warfen Pflanzen um, zerschmetterten Flaschen und Gläser, zerbrachen einen Couchtisch aus Glas – mit anderen Worten verursachten wir wesentlich mehr Schaden als eine herausgerutschte Fliegengittertür.
Als die Leute uns auseinanderzerrten, hatte Nitro eine aufgeplatzte Lippe und ich ein blaues Auge. Pita und ich nahmen ein Taxi nach Hause, und ich dachte, dass ich den Kerl das letzte Mal gesehen hatte. Doch die Schlägerei schien ihn Jesus sympathisch gemacht zu haben, denn danach lud Jesus ihn überallhin ein. Er tauchte sogar auf Pitas Geburtstagsparty im Juli auf. Ich gab mir die größte Mühe, ihn zu ignorieren, wenn wir uns begegneten, aber er war genauso geschickt darin, mich auf die Palme zu bringen wie Jesus, und seither standen wir mehr als einmal wieder kurz davor, uns zu prügeln.