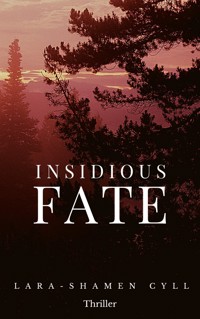
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Jackson Burrow kann sich an nichts erinnern. Er hatte einen Unfall, sagt sein Arzt. Seitdem steht Jack unter Medikamenten und es geht ihm nicht besonders gut. Ein seltsamer Instinkt lässt ihn aus unerfindlichen Gründen in einer fremden Stadt Fuß fassen, wo er versucht, sein Leben in die Hand zu nehmen. Als er in einer verrufenen psychiatrischen Klinik einen Job als Hilfspfleger annimmt, tauchen neue Rätsel auf: Eine Unbekannte, zu der er eine unerklärliche Verbindung spürt, wird eingeliefert und verschwindet wieder, ein Patient begeht Selbstmord und Jack wird unbemerkt Zeuge eines Gesprächs, das ihm den Atem verschlägt. Die schöne Sicherheitsbeauftragte Diana Kingsley wird Jacks geliebte Vertraute. Aber auch sie wird von tiefgreifenden Dämonen geplagt. Jack und Diana geben sich Halt und versuchen gemeinsam, die bitteren Geheimnisse der Klinik zu entschlüsseln. Während sie Stück für Stück die Schatten der Vergangenheit ausräumen und sich an eine lebenswerte Zukunft herantasten, eskalieren die Geschehnisse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lara-Shamen Cyll
Insidious Fate
Thriller
Impressum
Texte: © 2023 Copyright by Lara Shamen Cyll
Umschlag: © 2023 Copyright by Lara-Shamen Cyll
Lektorin: Heike Susanne Przybilla
Verantwortlich für den Inhalt:
Lara-Shamen Cyll
Papenstraße 113,
27472 Cuxhaven
Druck: epubli – ein Service der Neopubli GmbH, Berlin
Dir wird ängstlich beim Gedanken an den Tod? Ich habe nur entsetzliche Angst vor Schmerzen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Den Tod wollen. Die Schmerzen aber nicht, das ist ein schlechtes Zeichen. Sonst aber kann man den Tod wagen. Man ist als biblische Taube ausgeschickt worden, hat nichts Grünes gefunden und schlüpft nun wieder in die dunkle Arche.
Franz Kafka
Prolog
Die spitzen Steinchen des Asphalts bohrten sich in ihre nackten Füße. Schritt. Atmen. Schritt. Ihr war nicht klar, wie weit sie diesmal gelaufen war und wieso sie es immer wieder an diesen Ort zog, aber das war ihr auch egal. Ihr fehlte etwas. Tief in ihrem Innern spürte sie eine Leere, die nur einmal in ihrem Leben für kurze Zeit gefüllt worden war. An dem Tag auf dem Spielplatz. Das war das erste Mal, dass sie ihrer Pflegefamilie entschlüpft und diesem lautlosen Ruf gefolgt war. Immer wieder aufs Neue wurde sie den Behörden gemeldet, weil sie so verwahrlost aussah und nicht richtig sprechen konnte. Dann wurde sie wieder vermittelt. Aber keiner konnte ihr diese Leere nehmen.
Auch jetzt trug sie nur ein Nachthemd, durchgeweicht von Schweiß und Dreck, der Körper ausgemergelt, unfähig, klare Gedanken zu fassen. Denn teilweise lief sie wochenlang, nur um von der jeweiligen Pflegefamilie in diesen Vorort zu flüchten. Die steil ansteigende Straße, die sie nun erneut erklomm, war gesäumt von Einfamilienhäusern, eines schöner als das andere. Gepflegte Gärten und Bäume, die genau auf Maß angepflanzt worden waren, ließen dieses Gebiet so surreal erscheinen, so bildhaft. Da vorn. Dort stand ein rotes Backsteinhaus. Es hob sich ab, von den malerisch perfekten Nachbarhäusern. Es war kleiner und irgendwie … schief, umringt von einem Beet aus strahlend-weißen Steinen. Der Vorgarten war mit unzähligen bunten Blumen und einer großen Eiche bepflanzt. Schritt. Atmen. Auf der anderen Straßenseite hockte sie sich hinter einen Stromkasten und spähte zu dem Haus hinüber. Noch nie war sie weiter gekommen als bis zu diesem Punkt, denn jemand wie sie fiel hier ganz schnell auf. Ihr ganzer Körper schrie vor Erschöpfung. Doch sie richtete all ihre Sinne auf die Familie, die dort drüben lebte. Ein paar Mal hatte sie sie gesehen. Die Mutter hatte blonde, lange Haare, wie ein Wasserfall aus flüssigem Gold, so wie die Tochter auch. Sie waren lebhaft und laut, voller Energie. Der Vater arbeitete in einem Krankenhaus. Vor ein paar Jahren wurde sie mal dort eingeliefert. Und er war so freundlich und warm, wie sie noch nie jemand kennen gelernt hatte. Vielleicht zog es sie deshalb hierher. Wegen des Gefühls, willkommen zu sein. Damals auf dem Spielplatz war es dieser Junge, der auch zu der Familie gehörte. Er hatte nur mit ihr geschaukelt und sie wusste, dass sie nie wieder woanders sein wollte als an seiner Seite. Leider wurde sie danach in eine weit entfernte Stadt vermittelt. Es hatte lang gedauert, bis sie herausfand, wo sie hinmusste. Und bevor sie ihr Ziel hier erreicht hatte, wurde sie in das Krankenhaus gebracht. Heute war aber etwas anders. Heute würde sie den Mut finden, dort drüben zu klingeln, bevor sie erwischt wurde. Auch wenn ihr nicht bewusst war, was sie sagen sollte, zumal sie sehr schwer zu verstehen war, durch dieses Problem mit ihrer Zunge. Und wenn sie sie wieder wegschickten? Wenn sie sie nicht wollten? Was passierte, wenn sie den Jungen endlich wiedersah und dann würde er nichts von ihr wissen wollen? Diese Fragen spukten ihr jedes Mal im Kopf herum. Doch heute … Heute würde sie Antworten bekommen. Die Nacht bot ihr Schutz, selbst die Laternen waren bereits erloschen. Sie zwang sich aufzustehen, obwohl ihre Beine brüllten und flehten, einfach sitzen zu bleiben, für immer. Schritt. Atmen. Schritt. Sie war gerade an der Eiche angekommen, da erhellten Autoscheinwerfer die dunkle Straße. Schnell versteckte sie sich vor dem heranrasenden Fahrzeug. Es hielt direkt vor dem Haus. Mehrere Männer stiegen aus, allesamt in Schwarz gekleidet. Sie beschlich das Gefühl, diese Gestalten schon einmal gesehen zu haben. Angst und Panik fluteten ihren Geist. Wollten sie sie holen kommen? Nein, sie waren nicht wegen ihr hier, stellte sie fest, denn sie beobachtete, wie die Männer schnurstracks auf den Eingang zugingen und klingelten. Und noch einmal und noch einmal. In sämtlichen Fenstern gingen die Lichter an. Dann riss der Vater der Familie die Tür auf, mit einem Baseballschläger in der Hand und blaffte die Störenfriede an. Was dann passierte, konnte ihr vor Entsetzen getrübter Geist nicht ganz erfassen. Der vorderste Mann zog eine Waffe und schoss dem Vater direkt in den Kopf. Es ertönte kein Knall, wie man es aus den Filmen kannte. Geräuschlos sank der Mann mit den himmelblauen, warmen Augen zu Boden und die Männer stürmten ohne einen Laut ins Haus. Oh Gott. Was sollte sie nur tun? Zum ersten Mal in ihrem Leben flehte sie still darum, dass die Behörden kamen. Die Polizei, Krankenwagen, alles. Alles, was eine Sirene besaß. Was konnte sie nur tun? Um Hilfe schreien? Würde man ihr glauben? Würde sie überhaupt die Chance haben, zu erklären? Man konnte sie nicht verstehen. Sie wirkte doch für jeden normalen Menschen wie eine Verrückte. Glas zerbrach und Schreie ertönten. Warum hörte das denn keiner? Sie durfte nicht noch mehr Zeit verlieren. Mit wild pochendem Herzen befahl sie ihren Gelenken, sich zu bewegen. Zu der Eingangstür. Das Adrenalin dröhnte in ihren Ohren, als sie die Klingel betätigte. Dann noch einmal. Atmen. Im Innern des Hauses wurde es totenstill. Sie hörte nur ihr Blut rauschen, ihren Atem rasseln. Plötzlich wurde die Tür aufgerissen und in dem Moment, als sie das bekannte, wutverzerrte Gesicht des Beamten, der die letzten Jahre die Familien für sie ausgesucht hatte, und die gezückte Waffe sah, wusste sie, was sie zu tun hatte. Sie nutzte die Sekunde der Überraschung, um blitzschnell einen der weißen Steine aus dem Beet zu klauben und einen Haken zu schlagen. Dann rannte sie. So schnell wie noch nie in ihrem Leben. Direkt zu dem Nachbarshaus, in dessen Fenster sie den Stein schmiss, ohne stehen zu bleiben. Sie rannte, bis ihre Lungen brannten und ihre Muskeln wild zuckten. Die Alarmanlage gellte in schrillen Tönen weit hinter ihr durch die Straße. Sie musste sich nicht umdrehen, um zu wissen, dass die Männer ihr dicht auf den Fersen waren. Und dass sie sie lebend haben wollten.
Kapitel 1
5 Jahre später, November
Die Schlaufen der Einkaufstüten schnürten in seine Hände. Als Jack an der Bushaltestelle angekommen war, stellte er sie schnaufend ab und zündete sich eine Zigarette an. Zum Glück hatte er das mit Vogeldreck beschmierte Glasdach der Haltestelle über sich, denn mit lautem Donner riss innerhalb von wenigen Minuten der Himmel auf. Jack ließ sich auf einen der Sitze sinken und atmete den frischen Spätherbstduft ein. Der Regen, der sich nun wild über das belebte Dublin ergoss, roch nach einer Mischung aus Laub und Meersalz. Selbst der Geschmack der Chesterfield konnte der wohligen Frische nichts anhaben. Jack liebte Regen. Besonders den Moment, wenn es aufhörte. Dann wirkte die Welt so friedlich, gereinigt und voller frischem Leben. Vielleicht war er deshalb hierher nach Irland gezogen, wegen der hohen Niederschlagsrate. Vielleicht … Endlich kam der Bus, der ihn nach Hause brachte. Nach Hause … Eigentlich wusste er gar nicht, was das bedeutete. Die letzten fünf Jahre hatte er in einer psychiatrischen Anstalt in Leipzig verbracht, in halb komatösem Zustand, bis er vor drei Monaten aufgewacht war. Dr. Siemann, sein Arzt, hatte mit ihm als Voraussetzung für die Entlassung vereinbart, sich jeden Tag einmal zu melden und vor allem regelmäßig an seine Medikamente zu denken. Die kleine Dose mit den Dicodid klapperte wie eine Erinnerung in seiner Hosentasche, als er in den Bus stieg. Hydrocodon. Ein Opiat, an dessen Wirkung er sich so gewöhnt hatte, dass sie für ihn seine eigene Realität darstellte. Jack bezahlte sein Ticket bei dem unscheinbaren, schlaksigen Fahrer und schlitterte vorsichtig über den matschigen Boden durch den schmalen Gang. Die regennasse Kleidung der anderen Passagiere gab einen modrigen Geruch nach nassem Hund in die schwüle Hitze. Jack rümpfte die Nase und entschied sich, für die paar Stationen stehenzubleiben. Die schweren Tüten zwischen seine Beine geklemmt, packte er die Halteschlaufe über sich, als der Bus sich ruckelnd in Bewegung setzte. Draußen schlug ohne Erbarmen der Sturm gegen die Fenster, verwandelte die Welt in einen alten Schwarz-Weiß-Film. Obwohl es mitten am Tag war, herrschte in den Straßen eine Düsternis, die Jack eine Gänsehaut verschaffte. Da bemerkte er, wie ihn hellgraue Augen anstarrten, direkt vor sich in dem schmierigen Busfenster. Ein Fremder. Die blonden, feuchten Locken fielen ihm schwer ins Gesicht, die müden Augen leer, von dunklen Ringen unterzogen. Für einen kurzen Moment schaute er sich um, bis ihm klar wurde, dass es sein eigenes Spiegelbild war. Jack schloss die brennenden Augen und versuchte, die Geräuschkulisse der sich vielen unterhaltenden Menschen und den Schweiß, der sich auf seiner Stirn bildete, auszublenden. Noch immer hatte er sich nicht daran gewöhnt. An sein Aussehen, sein Leben. Als wäre er einfach mitten in einen reißenden Fluss geworfen worden, ohne zu wissen, ob er schwimmen konnte. Ohne Erinnerung, ohne Identität, ohne Vergangenheit war er wie aus einem langen, traumlosen Schlaf erwacht. Immer wieder hatte er sich erschreckt, wenn er sein Spiegelbild sah, weil er den Mann, der er war, nicht kannte. Dr. Siemann hatte ihn unterstützt, sowohl therapeutisch, als auch organisatorisch. Gemeinsam verschafften sie ihm Stück für Stück eine neue Identität, Ausweisdokumente, Versicherungen, eine Wohnung, das Nötigste an Einrichtung. Selbst ein kleines Startkapital hatte Jack von seinem Arzt bekommen. Für den Umzug. Für den Neuanfang. Denn vom ersten Moment an, als er die Augen aufgeschlagen hatte, zog ihn ein seltsamer Impuls mit voller Kraft auf die grüne Insel. Vielleicht würde er hier seine Erinnerungen wiederfinden? Jack folgte seinen Instinkten, vertraute restlos auf sein Unterbewusstsein, das ihn durch diese unbekannte Welt leitete. Die Eindrücke, die Tag für Tag auf ihn einprasselten, die er kennenlernen musste, überforderten ihn oft, besonders abends, wenn er versuchte, zur Ruhe zu kommen. Wenn er nicht seine Pillen hätte … Sein Handy piepte und riss ihn aus den Gedanken. Jack fingerte das kleine Prepaidhandy aus seiner Tasche und nahm den Anruf an, ohne auf das Display zu schauen. Es gab nur eine Person, die diese Nummer hatte. Nur einen Menschen in seinem Leben.
»Hey, Doc«, begrüßte Jack seinen Arzt mit gedämpfter Stimme, rau von den vielen Zigaretten.
»Jack, wie geht es dir?«
»Gut soweit. Hab gerade eingekauft.«
»Nicht nur Alkohol hoffentlich?«, fragte Dr. Siemann mit sorgenvoller Stimme. Jack hatte sich in der Klinik allen Suchtmitteln, zu denen er Zugang hatte, hingegeben. Etwas in ihm schrie nach jedem Rausch, den er kriegen konnte. Der Teil in ihm, der sich fehl am Platz fühlte, der es für falsch empfand, am Leben zu sein. Dieser Teil drängte ihn, flehte darum, wieder in das selige Vergessen eintauchen zu können. Besonders dann, wenn ihm selbst das Atmen zu anstrengend erschien. Der Doktor war mit ihm immer wieder durchgegangen, welch gravierende Folgen seine Alkoholexzesse haben könnten und dass er sich ausschließlich an seinen Medikamentenplan halten sollte. Widerwillig hatte Jack sich dem gefügt, zumindest bis er hierher aus der Reichweite des Arztes gekommen war. »Nein«, log Jack.
»Ich kenne dich nun schon seit vielen Jahren und weiß, wenn du lügst.« Er seufzte und fuhr mit sanfterer Stimme fort. »Jack, bitte. Pass auf dich auf. Du hast eine zweite Chance bekommen. Nutze sie.«
Jack war zu müde, um wieder einmal über dasselbe Thema zu diskutieren.
»Ja, gut«, sagte er nur. Obwohl er Dr. Siemann für alles, was er getan hatte, dankbar war – er war nun mal nicht sein Vater. Er hatte keine Familie, Freunde, niemanden, der ihn vermissen würde. Nicht selten hatte Jack im Suff darüber nachgedacht, seiner wertlosen Existenz ein Ende zu machen. Wenn da nicht … dieses Kribbeln wäre. Dieses Bauchgefühl. Ein unsichtbares Band, das ihn mit irgendetwas oder irgendjemand verband. Und ihn hierher geführt hatte.
»Wie sieht heute die Skala aus?«, fragte Dr. Siemann ruhig. Von eins bis zehn, war es ein guter Tag? War er auszuhalten? Oder brauchte Jack dringend ein ausführlicheres Telefonat?
»Sechs.«
»Wann hast du zuletzt …?«
»Vor einer Stunde. Es ist alles gut, Doc«, unterbrach er ihn.
Dr. Siemann seufzte noch einmal tief.
»Findest du dich denn zurecht? Mit dem Busnetz und so?«
Jack senkte die Stimme noch etwas. Vermutlich konnte ihn keiner hier verstehen, dennoch wollte er solche Gespräche ungern in der Öffentlichkeit führen.
»Alles okay. Ich bin anscheinend früher oft Bus gefahren, aber das Einkaufen … war schon schwieriger. So viel Auswahl und irgendwie ist überall das Gleiche drin, es steht aber ein anderer Name drauf und die Preise sind auch völlig verschieden … Aber ich werde mich schon daran gewöhnen.«
»Gut, Jack, brauchst du …«
»Ich muss aussteigen. Ich muss hier raus, wir telefonieren bald wieder.«
Jack beendete das Telefonat und drückte auf den Halteknopf vor ihm. So sehr er die Sorge seiner einzigen Bezugsperson schätzte, manchmal war es ihm einfach zu viel. Er stieg eine Station zu früh aus, wie er feststellte, aber das kam ihm ganz gelegen. Trotz des strömenden Regens genoss er es, die letzten Meter zu seiner Wohnung zu laufen. Den Mief des Busses von sich spülen zu lassen und durchzuatmen. Es gab immer wieder Dinge, die ihm sofort vertraut erschienen, Glücksgefühle weckten, wie Wasser, Bäume oder Bücher. Und es gab auch immer wieder Dinge, die ihm auf Anhieb ganz leichtfielen. Wie Kartentricks, Joggen, mit Gewürzen hantieren, oder der Umgang mit Tieren. Die liebte er. In der Klinik gab es Therapiepferde. Jack hatte sich stundenlang bei ihnen aufgehalten, ihre Stärke und Wärme in sich aufgenommen. Dr. Siemann hatte bei jeder Sitzung die Nase gerümpft, wegen des Stallgeruchs, der Jack dauernd anhaftete. Ein Schritt nach dem anderen. Das war sein Motto. Jack stoppte nochmal kurz, um sich unter dem Schutz eines Hauseingangs eine weitere Zigarette anzuzünden, bevor er in die Straße zu seiner Wohnung bog. Zu seinem neuen Zuhause. Was war das nur, das in ihm loderte, das ihn so unerbittlich anzog? Was sich in seinem Innern mit seinem Lebenswillen duellierte? Wie zur Bestätigung flatterte es in seinem Bauch, ein sanftes Streicheln über seine Seele, das ihm Heilung versprach. Deswegen war er hergekommen. Heilung, Erinnerung, vielleicht sogar Familie.
Zwei Wochen später
Hagelkörner prallten gegen die beschlagene Scheibe des Wohnzimmerfensters, aus dem Jack mit müden Augen hinausstarrte und die hell erleuchteten, verschwommenen Gassen des Temple-Bar-Bezirks taxierte. Sein Appartement lag im Dachgeschoss eines der antiquierten Altbaugebäude, die inmitten des lebhaften Viertels die letzten Jahrzehnte überlebt hatten. Die Schritte und die Stimmen der unzähligen Menschen, die die Kopfsteinpflaster passierten, hallten üblicherweise bis in sein Schlafzimmer wider. Doch nun übertönte der prasselnde Regen und der rauschende Wind, der unerbittlich gegen die Fenster schlug, das Gemurmel der Welt da draußen. Es wirkte, als säße er in einer schallisolierten Blase, in der er seine Umgebung wie durch ein Portal aus dumpfen Geräuschen und unscharfen Bewegungselementen wahrnahm. Die paar Gläser Scotch, die er getrunken hatte, halfen nicht gerade, die verzerrte Optik zu klären und aus dem Wirrwarr vor ihm ein sinnbringendes Bild zu erschaffen. Eine Ringeltaube suchte unterdessen Schutz vor dem Unwetter auf dem Fenstersims und pickte beharrlich mit dem Schnabel gegen das dünne Glas. Das spitze Klopfen bahnte sich einen Weg durch die Wand der Blase. Immer lauter, bei all der Stille in seinem Kopf, wirkte es beinahe ohrenbetäubend laut. Das Tier zog Jacks Aufmerksamkeit erfolgreich auf sich und ihm fielen ein paar kahle Stellen in ihrem durchnässten Gefieder auf. Kurzerhand öffnete er den Fensterhebel und ließ das kränkliche Vögelchen herein. Um das Fenster zu schließen, musste er sich mit der Schulter und seinem ganzen Gewicht dagegenstemmen, da der alte Rahmen sich im Laufe der Zeit verzogen hatte. Jack bekam einen Regenschwall ins Gesicht, der ihn brutal aus seinem Trancezustand riss. Er fühlte sich plötzlich wieder hellwach, doch in seinem Kopf begann es sofort zu hämmern. Die Taube flatterte wild in dem kleinen Appartement umher, bevor sie sich, immer schwächer werdend, auf den haselnussbraunen Flokati-Teppich sinken ließ. Jack setzte sich leise zu ihr auf das ausgefranste Fell und ließ seine Finger über ihre Flügel gleiten.
»Na, kleines Täubchen«, flüsterte er. Behutsam setzte er das gurrende Tier auf die Couch und raffte die urige Baumwolltagesdecke, die er aus der Klinik gestohlen hatte, um sie herum zu einem Nest. Die Taube ließ die Einbettung zu, vermutlich war sie auch nicht in der Lage, sich groß zu wehren, da der Orkan ihr Gefieder bis auf die dünne rosa Haut durchweicht hatte. Ihr Körper zitterte. Jack setzte sich auf den Boden, legte seine verschränkten Arme auf das senfgelbe Polster und stützte sein Kinn auf ihnen ab. Mit seinem Zeigefinger fuhr er weiter zärtlich über das graue Kehlchen und flüsterte ihr beruhigende Worte zu. Während er das feuchte, samtweiche Federkleid streichelte und ihre onyxschwarzen Augen beobachtete, drifteten seine Gedanken ab. Das war nun sein Leben. Hier in dieser Wohnung, spartanisch und einfach. Sein Wohnzimmer bestand aus dem gelbem Schlafsofa, auf dem er gerade halb lag und einem Fernseher, den er dauerhaft im Hintergrund laufen ließ – im Moment lief eine Dauerwerbesendung über neuartige Tragetaschen, besonders reißfest und klimatisierend – nicht, dass ihn das Programm groß interessierte. Es war eher wie ein leises Summen, das die Gedanken übertönte, die ihn manches Mal so überforderten. In den Wohnraum integriert war außerdem eine kleine Küchenzeile, die er aber nicht wirklich nutzte, was die leeren Pizzakartons, die sich in der Ecke des Raumes stapelten, untermalten. In Jacks Schlafzimmer stand lediglich ein einfaches hölzernes Doppelbett, seine Kleidung war in Kartons verstaut, die er Tag für Tag neu sortierte. Bis auf das Badezimmer und eine kleine leere Kommode im Flur, war es das auch schon. In der Pizzeria an der Ecke zum Liffey hatte er einen Minijob angenommen. Zumindest bekam er dort etwas zu essen und genug Lohn, um die Wohnung unterhalten zu können, nicht zu vergessen, um die Zigaretten und den Alkohol zu finanzieren. Den Rest bekam er von seinem Arzt regelmäßig zugeschickt. Seine Medikamente. Jack nervte es unbändig, diese Last mit sich herumzutragen, wie einen Koffer, gefüllt mit Baggersteinen. Diese Abhängigkeit. Bei dem Alkohol und den Zigaretten war es anders, nicht so … verzehrend. Doch die Symptome, die sich einstellten, wenn er mal zu spät mit der nächsten Tablette dran war, waren kaum auszuhalten. Jack hatte letzte Woche versucht, alles abzusetzen. Nicht zum ersten Mal. Er hatte sich in einem Augenblick der Verzweiflung in der Wohnung eingeschlossen, all die restlichen Dosen und Packungen im Klo heruntergespült und sich in sein Bett gelegt. Ganz bald begannen die Kopfschmerzen. Brüllende, zerreißende Schmerzen. Dann setzten die Übelkeit und der Schwindel ein. Seine Haut brannte, als würde sie in Flammen stehen. Und dann begannen die Halluzinationen. Nach sechsunddreißig Stunden, so lange hatte er immerhin noch nie durchgehalten, war Jack völlig am Ende gewesen und hatte sich mit mordlustigen Geisterwesen unterhalten, die ihm Bilder des Todes zeigten. Sie jagten ihn, während sie die Wohnung vollbluteten. Jack hatte sich mit seinen Klamotten unter die Dusche gestellt, weil er überall nur noch Blut sah, und diese Schmerzen … Er überstand es nicht. Wie ein Wahnsinniger lief er in die nächste Apotheke und kaufte alles, was er rezeptfrei kriegen konnte, und spülte es mit einer halben Flasche Wodka herunter, bevor er in einer kleinen Gasse zusammenklappte. Seitdem war diese Stimme in seinem Kopf eingezogen. Ein Alter Ego, die Stimme der Sucht, die ihn triezte, alles kommentierte und sein Inneres lichterloh brennen ließ, sollte er die Tabletten nicht rechtzeitig nehmen. Dr. Siemann hatte er von alldem nichts erzählt. Der war schon besorgt genug. Jeden Tag rief er an und wollte haarklein wissen, wie es lief. Das war die Abmachung, aber allmählich hatte Jack genug davon. Wie aufs Stichwort vibrierte sein Handy auf dem Wohnzimmertisch.
»Ja«, meldete er sich knapp.
»Hallo, Jack. Ich wollte nur fragen, wie es dir geht?«
»Gut.«
»Brauchst du etwas? Geld? Kleidung?«
Jack schnaubte. »Kümmern Sie sich eigentlich um all Ihre Patienten so? Schmeißen mit Ihrem vielen Geld um sich, füllen sie mit Tabletten ab wie ’ne Nutte, was bin ich eigentlich für Sie? Ihre Eintrittskarte in die Wohlfahrt? Oder bin ich irgendein besonderes Experiment?«
Einem Teil in ihm tat der verächtliche Tonfall leid, mit dem er seinen Arzt anfuhr. Doch diese Fragen schwelten nun schon länger in seinem Kopf.
»Hast du wieder getrunken? Was sagt die Skala?« Seine Stimme klang leicht ängstlich, zögerlich, als hätte Jack einen Nerv getroffen.
»Null, ich bin beim absoluten Nullpunkt angelangt! Beantworten Sie doch ausnahmsweise einfach mal MEINE Fragen!«
»Da ich noch nie einen Patienten hatte, der in einer solchen Situation steckte, nein. Vermutlich würde ich es aber auch für andere tun. Ich will dich nicht abfüllen. Ich will dir helfen.«
»Warum?! Warum muss ich diesen ganzen Scheiß nehmen? Was ist mit mir passiert? Was soll ich mit mir anfangen?!« Der Frust sprudelte aus Jack heraus wie ein glühender Lavastrom. Das letzte Glas hätte er sich vielleicht verkneifen sollen.
»Du …« Der Arzt zögerte kurz. »Wo bist du jetzt gerade?«
Noch eine weitere Gegenfrage und Jack wäre durch das Telefon gesprungen. Dr. Siemann schien es in seinem angestrengten Atem zu hören und fuhr rasch fort.
»Du weißt doch … Du hattest einen Unfall. Und dein Gedächtnis verloren, durch eine schwere Hirnverletzung. Und die Tabletten helfen dir, die chronischen Schmerzen, die du als Folge der Verletzung erlitten hast, im Zaum zu halten. Du hattest dir vor Schmerzen beinahe die Augen ausgekratzt. Und die Neurochirurgie hatte mir gesagt, es gäbe keine Möglichkeit, dich anders zu therapieren.«
»Aber sie vernebeln meinen Verstand!«
Nun fuhr auch der sonst so gelassene, gefasste Mann am anderen Ende der Leitung leicht aus der Haut. »Weil du sie andauernd mit Alkohol panschst! Wenn du dich mal an meinen Rat halten würdest, würde es dir besser gehen!«
»Aber … Der Alkohol hilft mir immer noch am besten.«
»Das ist ein Irrglaube. Denn er macht dich aggressiv und unberechenbar.« Seine Stimme wurde sanfter. Beruhigend langsam bat er Jack, wie immer in solchen Momenten, tief ein- und auszuatmen. Und wie immer zeigte es Wirkung. Die Anspannung wich der Erschöpfung und der Traurigkeit, die sein Herz in einer festen Umklammerung aus Dornen hielt. Er musste ein paar Tränen zurückhalten, brachte kein Wort mehr hervor.
»Jack, mein Lieber. Du hast so viel durchgemacht! Erinnere dich an deinen Plan.«
Es fühlte sich an, als würden die Worte seines einzigen Vertrauten einen Schalter bei ihm umlegen. Einen Schalter der Ruhe.
»Ich suche mir einen Job.«
»Und was für einen?«
»Kellnern. Vielleicht in einem Pub.«
Seine Antworten kamen wie automatisch über seine Lippen. Er hörte sich wie aus weiter Ferne, leise und unklar.
»Und wann?«
»So bald wie möglich.«
Eine Kälte, die tief aus seinem Innern kam, schüttelte Jacks Körper. Die Taube schlug ihm plötzlich ihre Flügel ins Gesicht und holte ihn aus dieser seltsamen Trance. Ich muss mich echt wieder in den Griff kriegen. Das geht so nicht weiter.
»Sehr gut.«
Jack massierte die Stelle zwischen seinen Augenbrauen und rieb sich über die Lider.
»Ich hab doch einen Job. In der Pizzeria«, fiel ihm ein.
»Das ist aber nichts für länger. Glaub mir, Jack, ich weiß, wovon ich rede.«
»Ach ja? Ich glaub kaum, dass Sie jemals so etwas nötig hatten.«
»He, ich war auch mal jung«, rief der Mann und lachte aus vollem Halse.
Jack stimmte nicht mit ein, obwohl die anfängliche Wut verraucht war. Er konnte seinem Arzt nie lange böse sein. Immer wieder schaffte er es, zu Jack durchzudringen und ihn zu beruhigen. Vielleicht sollte ich mich wirklich mal drauf einlassen und tun, was er sagt …
»Ich mach jetzt Schluss. Danke«, sagte Jack nur und beendete das Gespräch. Seufzend ließ er sich erneut gegen die Couch sinken und flüsterte dem kleinen Täubchen zu, dass er bald wieder da wäre.
In Baalsdorf, einem Stadtteil in Leipzig, legte der grauhaarige Mann den Telefonhörer zurück auf die Station. Erschöpfung und Zweifel zerrten an seinen Gliedern. Tat er das Richtige? Ist es erlaubt, falsche Dinge aus den richtigen Motiven zu tun? Genervt rieb er sich über seine Geheimratsecken. Für einen Moment stütze er seine Ellenbogen auf dem Schreibtisch ab, an dem er Tag für Tag saß, und atmete ein paar Mal tief ein und aus, bevor er für sich selbst eine Notiz verfasste: Dringend C. D. anrufen.
Eine zarte, weibliche Stimme ließ ihn aufsehen. Seine Assistentin war unbemerkt hereingekommen.
»Verzeihen Sie, Sie haben nicht auf mein Klopfen reagiert. Ist alles in Ordnung?«
Der weiche Singsang ihrer Worte umspülte seinen schmerzenden Kopf wie Wogen aus Wärme und Licht.
Der Doktor nickte nur unbeholfen, merkwürdigerweise immer etwas eingeschüchtert von ihrer vollkommenen Gestalt.
»Ihre nächste Patientin ist da«, sagte sie zögerlich und legte eine Akte vor ihm auf den Schreibtisch. Als er aber den Namen las, wich alles, was gut und schön war, dem blanken Unheil.
»Wie geht es ihr heute?«, krächzte er, bemüht, professionell zu bleiben. Doch ein Blick in das besorgte Gesicht seiner Assistentin genügte als Antwort. Dr. Siemann schluckte schwer und atmete noch einmal tief ein und aus, bevor er zu seiner Tochter ging.
Kapitel 2
Jack spazierte durch die erleuchteten Straßen von Dublin, genoss die Anonymität, die Schwerelosigkeit, die ihm die mit Menschen überfüllten Straßen boten. Er suchte sich einen Pub, der nicht so modern war. Der nicht von Studenten belagert wurde. Der Regen hatte aufgehört, doch die Straßen glänzten noch immer feucht im Schein der Laternen. Der Pub namens Blue Post, den er betrat, war stickig und alt. Es roch nach Alkohol und Zigarren. An der Decke hingen allerlei Blechbilder mit Motorrädern und anderen Retromotiven darauf. Jack setzte sich an die Bar und bestellte sich ein Guinness. Das kräftige Gebräu ließ ihm seine Zunge schwerer werden und die Kälte wich mit jedem Schluck aus seinem Körper. Der Barmann, er nannte sich Barron, beäugte ihn skeptisch, als Jack den Finger hob und signalisierte, dass er gern noch eines hätte. Der dickliche Mann kratzte sich an seinem kahlen Kopf. Seine aschfahle Stirn runzelte sich, als er mit tiefer, rauchiger Stimme fragte, ob er etwas auf dem Herzen hätte. Jack schüttelte nur den Kopf. Barron stellte ihm einen weiteren Krug Schwarzbier auf den Tresen, zusammen mit einer Schale Erdnüsse und widmete sich wieder dem Polieren der Gläser. Jack schüttete sich gleich eine Handvoll in den Mund. Heute hatte er noch nichts gegessen, weshalb er aus Appetit erst genüsslich das Salz ableckte, bevor er sie kaute. Ihm fiel auf, dass Barron ihn noch immer mit Seitenblicken durchlöcherte. Fragend zog Jack die Augenbrauen hoch und zündete sich eine Zigarette an. Der Barmann schob freundlich lächelnd einen gläsernen Aschenbecher unter Jacks Nase und stützte seinen massigen Körper auf dem Tresen ab. Seufzend kniff er kurz die mit Krähenfüßen gespickten enzianblauen Augen zusammen.
»Hast du einen Namen, Junge?«
»Jackson Burrow.« Etwas wie Erkennen blitzte in Barrons Blick. Jack war nicht klar, wieso er seinen vollen Namen nannte. Wie aus einem Reflex heraus. Das Gesicht seines Arztes blitzte vor seinem inneren Auge auf, wie eine Erinnerung. Ein kaltes Schaudern durchlief seinen Körper und hinterließ eine Gänsehaut. Ein paar kräftige Züge an der Chesterfield beruhigten sein Gemüt wieder. Verwirrt fing er den studierenden Blick von Barron wieder auf.
»Wirklich alles in Ordnung?«, fragte dieser.
»Ja, sicher. Sagen Sie, haben Sie zufällig einen Job zu vergeben?«, platzte Jack heraus.
»Hier? In meiner kleinen Spelunke willst du arbeiten?«
Jack war sich nicht sicher, warum, aber er spürte eine Art Vertrautheit, als ob er hier ganz genau richtig wäre. Es war nicht die einladendste Atmosphäre, das Gebäude wirkte baufällig und in dem schwummrigen Licht zu arbeiten, machte doch bestimmt müde. Wieso sollte er sich überhaupt in einem Pub bewerben, wenn er sich doch von Alkohol fernhalten solle? Und warum konnte er denn nichts Nützliches machen? Eine Lehre zum Tierpfleger zum Beispiel? Jack nahm sich vor, den Arzt beim nächsten Telefonat danach zu fragen. Barron kramte etwas aus der Tasche seiner dunkelgrünen Jeans, die viel zu eng um seinen aufgeblähten Bierbauch geschnürt war. Vielleicht schnaufte er deshalb so. »Pass auf, hier habe ich zwar keinen Job für dich, aber wie wäre es hiermit?«
Er hielt kurz inne und spuckte einen gelblichen Schleimklumpen in das Spülbecken. Jack trank einen weiteren großen Schluck seines Bieres, kämpfte gegen die aufkeimende Übelkeit. Nach einem letzten tiefen Zug an seiner Zigarette, drückte er den Stummel in dem Aschenbecher aus.
»Das könnte dich interessieren«, raunte der dicke Mann ihm zu.
So eigen Barron auch war, Jack fand ihn irgendwie sehr sympathisch. Ein Lächeln huschte über seine tauben Lippen, dann strich er das Papier glatt, welches nun vor ihm auf dem Tresen lag. Es war eine Stellenbeschreibung. Die Worte auf dem Flyer schrien ihn geradezu an, griffen nach dem Band in seinem Inneren.
»Es werden schon lang keine Patienten mehr dort hingebracht, die noch irgendjemandem etwas bedeuten. Dort wird man nur die Menschen los, die sich zu einer Plage entwickeln«, sagte Barron im Flüsterton. Eine Psychiatrie. Wie passend.
»Was ist damit?«, fragte Jack, bemüht deutlich zu sprechen.
»Kein Patient kam dort je wieder raus. Es kursieren unendlich viele Gerüchte. Diese Gemäuer sind nicht mehr das, was sie mal waren, oder was sie sein sollten. Seit der großen Hungersnot damals hat sich unser Land verändert, die Menschen sind kälter geworden, industrieller.« Er spuckte diese Worte regelrecht, wie den Schleim in seinem Hals, voller Abscheu und Bedauern. »Aber dafür verdienst du umso besser. Pass auf, mein Junge, du scheinst mir ein kluger Knabe zu sein und dieses Haus braucht unbedingt mal frischen Wind. Vor allem brauchen wir, die letzten Einheimischen, unbedingt vertrauenswürdige Augen und Ohren.« Barron lehnte sich noch dichter zu ihm und seine Stimme wurde noch leiser, fast tonlos. »Verstehst du, diese Gerüchte kursieren nur, weil wir im Ungewissen gelassen werden. Niemand weiß, was da oben vor sich geht, und besonders die alten Iren …«, er deutete auf einen Tisch im hinteren Bereich des Lokals, an dem fünf ältere Männer saßen und Karten spielten, genauso grau und faltig wie Barron, eingehüllt in eine Rauchwolke, »… machen sich Sorgen.«
»Woher willst du wissen, dass du mir vertrauen kannst? Du kennst mich doch gar nicht.«
»Viel zu verlieren habe ich nicht.« Ein Schatten, getrübt von endloser Trauer, huschte über das aufgedunsene Gesicht, doch im nächsten Moment schon strahlte wieder ein warmes Lächeln darauf.
»Außerdem sagt mir meine Erfahrung, dass du ein guter Kerl bist.«
»Kann sein …« Kann sein. Wer weiß das schon.
»Und hin und wieder kommst du mal wieder hierher zum alten Barron und berichtest bei einem guten Guinness, wie es dir so ergangen ist.« Er zwinkerte Jack zu und machte sich daran, die Theke abzuwischen und die Nüsse neu aufzufüllen. Plötzlich lachte Barron laut auf, kehlig und herzlich. Jack fragte sich, was denn nun so lustig war, während der Mann zu seiner Kundschaft am anderen Ende des Raumes stapfte. Sollte er sich bewerben? Vielleicht sollte er das mit seinem Arzt besprechen. Von einer Anstalt in die nächste? Es war ein schlechter Witz. Andererseits könnte er gerade wegen seiner Vorgeschichte perfekt dafür sein. Schaden würde der Versuch bestimmt nicht. Irland war bekannt für diese Art der Unterbringung, hatte Jack gelesen. Die verrückten Iren. Er beschloss, eine Nacht darüber zu schlafen und nüchtern dann eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht würden sie ihn auch gar nicht nehmen, dachte er. Schließlich hatte er ja keine Ausbildung oder Erfahrung vorzuweisen.
»Danke, ich werde mir das durch den Kopf gehen lassen«, säuselte Jack, als Barron wieder da war, und zündete sich noch eine Zigarette an.
»Danke mir nicht zu früh, denk gut darüber nach und pass auf dich auf, Jung’.«
Der warnende, sorgende Blick des Barmanns verfolgte ihn noch den ganzen Abend. Jack war bald nach Hause getaumelt, hatte sich vor der Haustür fast in die Hose gemacht, weil er seinen Schlüssel erst nicht fand. Zum Glück kam gerade rechtzeitig die alte Frau, die über ihm wohnte, und öffnete freundlich lächelnd die Haustür. Mit seinen Nachbarn hatte er sich noch nicht allzu intensiv beschäftigt, auf jeden Fall konnte er nicht meckern. Die Frau, die ihm die Tür aufgemacht hatte, sah er öfter. Sie schien sehr nett zu sein, ein Mensch, von dem man sich gern eine Einladung zum Kaffee und Kuchen wünschen würde. Es lebte auch noch ein junges Pärchen mit einem Baby hier. Jack konnte manchmal das Kleine weinen hören, störte sich aber nicht daran. Vielleicht höchstens daran, dass hin und wieder der Kinderwagen den Hauseingang versperrte. Jack hatte aber nicht wirklich Lust, sich über etwas zu ärgern. Meistens war ihm alles einfach egal. Kam das von den Pillen? Alkohol machte ihn oft sauer und traurig, aber auch locker und gesellig. Und die Pillen machten ihn nur müde, gelangweilt. So wollte er nicht sein.
‚Solange sie dich am Leben halten, also mach hin und wirf ein!‘ Jack schreckte kurz zusammen, sein kleiner Gedankenteufel begann wieder lauter zu werden. Wie er ihn hasste. Doch … Es war sein eigener Kopf. Der Hass konnte sich nur gegen ihn selbst richten, es war seine eigene verzerrte Stimme. Frustriert ließ er sich auf seine Couch sinken. Tränen stiegen ihm in die Augen.
‚Du verdammte Heulsuse! Krieg dein’ Arsch hoch‘ Jack blinzelte ein paar Mal, schniefte und zog die kleine Dose aus der Hosentasche. Er nahm gleich zwei auf einmal, und bald schon breitete sich in seinem Kopf die vertraute Schwere aus. Ein Stupsen an seinem Oberschenkel zog seine Aufmerksamkeit auf sich.
»Hey, kleines Täubchen. Dich habe ich ja ganz vergessen.« Jack setzte den Vogel auf seinen Bauch und zu seiner Überraschung ließ er es zu. Doch nach kurzer Zeit begann die Taube wild mit den Flügeln zu schlagen und Jack sah ein, dass sie sich draußen wohler fühlen würde, und wahrscheinlich hatte sie auch Hunger. Also setzte er sie wieder auf den mittlerweile trockenen Fenstersims und beobachtete noch eine Weile, wie sie sich putzte. Die nächsten Stunden verbrachte Jack damit, eine nach der anderen zu rauchen und die schnauzbärtigen Gesichter auf den Pizzakartons anzustarren, die sich in der Ecke stapelten. Sie schienen sich irgendwann selbstständig zu machen, ganze Diskussionen führten sie plötzlich mit ihm. Der Alkohol, gemischt mit der lähmenden Wirkung der Pillen und der dominierenden Beeinflussung der italienischen Druckgestalten, brachte ihn schließlich dazu, eine Entscheidung zu treffen.
Ihr war schlecht. Dieses Hin- und Hergeschaukel. Wasser hatte sie noch nie leiden können. In einer Badewanne vielleicht, okay, aber das Meer war so unberechenbar, so wild. Die junge Frau vergrub ihre Finger in dem Gummi des Reifens, an den sie sich klammerte. Vor ein paar Stunden war sie irgendwie hier auf der Fähre gelandet, sie wusste nicht warum oder wohin sie fuhr, aber ihr Instinkt beruhigte sie. Bald wären sie da, hörte sie die Besitzer des Autos sagen, unter dem sie sich versteckte. Wenn doch nicht nur alles so schaukeln würde … Sie hielt sich eine Hand vor den Mund. Gleich würde sie brechen und ihre Tarnung würde auffliegen. Zum Glück hatte sie seit einer Weile nichts gegessen. Dann kam hoffentlich nur Galle. Die Frau wimmerte. Sie musste stark sein. Dieses winzige Flämmchen Wärme und Sicherheit, das sie in sich trug und das sie leitete, ließ Hoffnung in ihr aufkeimen. Hoffnung auf eine Zukunft, in der sie nicht mehr leiden musste. Hoffnung auf einen Sinn, auf … mehr. Noch eine Welle schaukelte die Fähre und dann konnte sie es nicht mehr halten. Grünliche Magensäure brannte sich durch ihre Speiseröhre, nur mit Mühe gab sie dabei kein Geräusch von sich. Erschöpft schloss sie die Augen und begann zu träumen. Sie malte sich im Geiste ihre Wünsche aus, von grünen Wiesen, warmen Quellen und bunten Blumen, bis hin zum Lesenlernen, Musikhören und richtiges, frisches Essen. Ihr Körper gab nach und sie fiel in einen unruhigen Schlaf.
»Sie sind 24 Jahre alt, was haben Sie denn bisher gemacht?« Callahan Doyle betrachtete Jack abschätzend durch zusammengekniffene Augen.
»Um ehrlich zu sein, noch nichts, ich …« Jack war überfordert. Der stämmige Mann sonnte sich in der Macht, die er verströmte, ergötzte sich an jedem Tropfen Schweiß, der über Jacks Schläfe rann. Je mehr er um Worte rang, desto mehr plusterte Mr Doyle sich in seinem riesigen Chefsessel auf.
»Haben Sie Ihre Zeit mit Partys und solchem Jugend-Krams vertrödelt?«
Das wird ein Reinfall. Er würde die Stelle nicht bekommen. Was hab ich mir nur dabei gedacht? Sollte er die Wahrheit sagen? Wahrscheinlich würde er nicht noch schlechtere Chancen haben, wenn er die Karten auf den Tisch legte. Ein leiser Kopfschmerz schlich sich hinter seine Augen.
»Ich habe die letzten Jahre in einer Klinik in Leipzig verbracht«, rutschte es ihm plötzlich heraus. Genugtuung blitzte in den kalten, grünen Augen des Klinikleiters auf, als hätte er auf diese Information gewartet.
»Ich … ich war Patient. Amnesie. Nach einem Unfall…« Jack rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her.Mr Doyle zog nur eine der geschwungenen, dünnen Augenbrauen hoch. Eine ausgeprägte Narbe zog sich über seine Oberlippe und ließ seinen Mund noch wulstiger erscheinen, als er ihn nun zu einem spöttischen Lächeln verzog. Jack konnte ihn nicht leiden. Bereits im ersten Moment, als die junge, blonde Frau im Vorzimmer ihn in das Büro gerufen hatte, hatte sich eine eisige Abscheu in Jacks Innern breitgemacht. Er wischte seine kaltschweißigen Hände an seinen Jeans ab und atmete tief durch. Reiß dich zusammen!
»Sie scheinen mir sehr nervös zu sein. Ist Ihnen irgendwas unangenehm?«
Nein. »Nein«, sagte er nochmal laut. »Sir, ich weiß, ich kann keine Erfahrung vorweisen, aber ich denke … Nein, ich weiß, dass ich sehr schnell lernen werde und hundertprozentiges Engagement beweisen werde.« Jacks Stimme zitterte etwas, doch er war zufrieden mit der Entschlossenheit, die er versuchte auszustrahlen. Ohne etwas darauf zu erwidern, ließ der Klinikleiter seinen musternden Blick über Jacks Gesicht schweifen, um sich nach einer Weile räuspernd aufzusetzen und aus seiner Schreibtischschublade einen daumenbreiten Papierstapel hervorzuholen. Mit einem lauten Klatschen landete er vor Jacks Nase. Er trug die Aufschrift: Arbeitsvertrag. Hatte er es tatsächlich geschafft, ihn zu überzeugen? So leicht?
»Füllen Sie alles restlos aus. Und unterschreiben Sie überall, wo ein Kreuz ist. Lesen Sie sich besonders die Verschwiegenheitserklärung gründlich durch. Sie können sich dafür Zeit lassen. Der Arbeitsbeginn wird erst in einigen Monaten sein, diesbezüglich melden wir uns nochmal bei Ihnen. Ich bin erstmal geschäftlich verreist. Bringen Sie die Papiere dann am ersten Tag mit, oder schicken Sie sie vorher per Post zu Viola, meiner Sekretärin. Nun können Sie gehen. Guten Tag.«
Sofort richtete Mr Doyle seine Aufmerksamkeit auf ein Dokument, das neben seinem Computer lag. Jack war entlassen. Er überlegte kurz, ob er sich erlauben durfte, noch Fragen zu stellen, aber gleichzeitig hätte die Atmosphäre in dem riesigen Raum nicht noch kälter werden können. Jack nahm den Papierstapel und stand auf. Seine Beine kribbelten, als wären sie eingeschlafen. Bevor er sich von dem einschüchternden, großen Mann, der nun sein Chef sein würde, abwandte, fiel sein Blick auf einen kleinen Glasdelfin, der auf dem viel zu akkurat geordneten Schreibtisch irgendwie fehl am Platz schien. Die spitze Schnauze strahlte ein warmes Funkeln aus. Inmitten von kaltem Geschäft.
Barron verschloss gerade die schweren Türen seines Pubs, als ein Piepen ertönte. Sein Handy. Mit zitternden Fingern zog er es aus der Schürze und las die Nachricht: Gut gemacht. Eine Ahnung ließ seine Beine Richtung Hintertür bewegen und tatsächlich … auf dem Kopfsteinpflaster der dunklen Gasse lag eine Akte. Wie vereinbart. Schmal und nichtssagend, aber Barron brach zusammen, als er die erste Seite aufschlug und ihr Bild entdeckte. Auf Knien sah er zum nachtschwarzen Himmel hinauf und betete still, dass sie nun endlich frei war.
Die nächsten Monate bis zu seiner Einstellung als Krankenpflegehelfer verbrachte Jack damit, sich intensiv über die Einzelheiten dieses Berufs zu informieren. Er besuchte die Bibliothek des Trinity-Colleges, wälzte Bücher über die Geschichte Irlands und die Klinik. Es wurde zu einem täglichen Ritual. Zuerst fuhr er mit der Straßenbahn zur Dawson-Haltestelle, lief an dem Musikladen vorbei, bei dem er nicht anders konnte und immer ein paar Minuten stehenbleiben musste, um sich die Musikinstrumente anzuschauen – er war fasziniert von der Vielfältigkeit der Konstruktionen, mit denen man die gleichen Melodien auf so unterschiedliche Weise interpretieren konnte –, und nachdem er mit ein wenig Inspiration seinen Geist erhellt hatte, holte er sich an der Ecke zum College Park bei einem kleinen Stand noch zwei Kaffee und lief dann weiter Richtung Bibliothek. Beim Eingang zu den mit Büchern, Schriftstücken und uralten Manuskripten gefüllten Gemäuern, die sich scheinbar auf unendliche Weiten erstreckten, gab er den zweiten Kaffee Muriel, einer der Bibliothekarinnen, die für Ordnung, Struktur und Disziplin an diesem Ort sorgten. Muriel war um die fünfzig Jahre alt, hatte graumelierte Locken, die sie meist zu einem lockeren Dutt wickelte und eine altmodische halbrunde Lesebrille, die an einer goldenen Kette um ihren Hals hing. Sie trug meist lange schwarze Hosenröcke zu farbenfrohen Blusen und passendem Schmuck. Muriel strahlte eine klassische Eleganz aus, die einladend fröhlich und dennoch professionell und unnahbar wirkte. Als Jack sie das erste Mal traf, machte sie ihn energisch darauf aufmerksam, dass er sich nicht einfach bedienen dürfe, als er im ‚Long Room‘ nach einem ledrigen, staubigen Einband mit der Aufschrift ‚The old Éire‘ griff. Er entschuldigte sich und bat sie mit seinem charmantesten Lächeln, ihn über die Regeln in diesem Gebäude aufzuklären, da er ja schließlich neu im Lande sei. Sie erklärte ihm, er wäre in der John-Stearne-Bibliothek im St. James Hospital wahrscheinlich besser aufgehoben, was medizinische Fragen anging, doch er verstand sich auf Anhieb so gut mit Muriel, dass er ihre Gesellschaft der der gestressten Medizinstudenten definitiv vorzog. Außerdem kam hinzu, dass er ohne einen Studentenausweis ohnehin nirgends Einblick bekam, und da half ihm ein guter Kontakt über diese administrative Schwierigkeit hinweg. Sie setzten sich zusammen in einen kleinen Leseraum und unterhielten sich stundenlang über alles, was sie wusste, über ihre Heimat, den Beruf eines Pflegers und die Anstalt. Ihr irischer Akzent war zwar manchmal etwas schwer zu verstehen, aber sie war sehr geduldig. Wenn er sich seine Großmutter vorstellte, dann so. Fürsorglich und warm in ihrer Art und willig, ihr Wissen und ihre Lebenserfahrung zu teilen. Sie half ihm, seine Sprachkenntnisse auszubauen, gab ihm Ratschläge, und von Tag zu Tag, kam er mehr ins Reine mit sich. Jack trank weniger Alkohol, begann sogar zu kochen und das gar nicht mal schlecht. Das Einkaufen klappte auch immer besser. Und nachts arbeitete er in der Pizzeria. Muriel erklärte ihm außerdem, wie man mit Rechnungen umging und was es mit den Steuern auf sich hatte. Sie verbrachten auch den St.-Patrick’s-Day zusammen. Gemeinsam mit Muriels Enkeln schauten sie sich die Parade an, aßen allerhand grüne Speisen und lachten bis spät in die Nacht. Von Dr. Siemann hatte Jack sich distanziert, sie telefonierten nur noch ein bis zwei Mal die Woche. Doch seine Medikamente nahm er weiterhin regelmäßig, damit die Stimme in seinem Kopf nicht zu laut wurde. Allerdings hatte er trotzdem seit ein paar Wochen jede Nacht Alpträume. Die Geisterwesen, die ihn bei seinem Entzugsversuch verfolgt hatten, suchten ihn nachts heim, sobald er die Augen schloss. Jack wachte jedes Mal gerädert auf, doch er schaffte es, nicht erneut zur Flasche zu greifen. Manchmal, wenn er tagsüber ins Träumen verfiel, saßen sie plötzlich neben ihm in der Bahn oder liefen über eine Ampel. Als würde er halluzinieren. Jack sagte sich, dass es bestimmt Nebenwirkungen waren, doch er wurde das Gefühl nicht los, dass sie ihm etwas sagen wollten. Sie sahen furchterregend aus. Hautfetzen hingen von ihren mageren Gesichtern, die Gewänder, in denen sie steckten, bestanden aus zerrissenen Lumpen, genauso grau wie ihre Haut. Die Augenhöhlen waren leer. Schwarze Löcher, die ihm Bilder des Todes einbrannten. Manchmal sah er sogar Kinder unter ihnen. Und immer dieses Blut. Überall. Er behielt es für sich. Muriel vertrieb seine Einsamkeit und baute ihn mit ihrem Witz und ihrer Klugheit wieder auf, wenn ihn an manchen Tagen die Erschöpfung packte.
»Ich bin nicht erfreut, dass du bald nicht mehr jeden Tag herkommen kannst«, erklärte sie ihm eines Tages mit einem traurigen Lächeln. »Ich halte es immer noch für keine gute Idee, dass du dort anfängst. Du weißt, ich verlor meine Schwester in diesem Höllenloch. Pass bitte auf dich auf.«
»Ich komme dich besuchen, sobald ich kann«, versprach er ihr.
Ihm würde es auch fehlen, sie nicht mehr jeden Tag zu sehen. Durch sie war er einem Leben, wie er es sich wünschte, ein Stück nähergekommen. Durch sie hatte er auch sich selbst besser kennengelernt, hatte an Selbstwertgefühl gewonnen. Er war eigentlich ein ganz guter Kerl, liebenswürdig, wenn er Muriels Worten Glauben schenken durfte. Sie war seine erste richtige Freundin in dieser neuen Welt.
Kapitel 3
6 Monate später
Der erste Tag verlief überraschend gut. Jack hatte seine Aufgaben innerhalb eines Nachmittags erledigt. Mittagessen verteilen, Medikamente vorbereiten, Vitalwerte eintragen. Nun saß er in dem kleinen, stickigen Aufenthaltsraum in einem mintgrünen Kasack und einer weißen Hose, die er in mehrfacher Ausführung gestellt bekommen hatte und trank Kaffee aus einer knallroten Rentiertasse. Der Raum war ausgestattet mit einem großen ovalen Eichenholztisch, der sich an einigen Ecken bereits stark abnutzte und zahlreiche Glasränder und Flecken aufwies. Im hinteren Teil des Zimmers waren ein paar Spinde aufgestellt, in denen Kaffee, Milch und etliche Fundsachen und Kleinkram aufbewahrt wurden. Im vorderen Teil war eine kleine Pantryküche mit einem Kühlschrank, der heißgeliebten Kaffeemaschine und einem Getränkeautomaten daneben. An sich ein gemütlicher schmaler Raum, in dem Pausen, Übergaben und allerhand Besprechungen stattfanden. Er trug den charmanten Beinamen ‚Butze‘. Im St. Caprice arbeiteten etwa 120 Menschen und es beherbergte 456 Patienten, wurde Jack erklärt. Wie das zu schaffen war, musste er noch herausfinden. Die Hände fest um die heiße Tasse gepresst, die Wärme geradezu aufsaugend, plauderte er gerade mit seinem Kollegen Aiden Collins. Ein großer, schmaler Mann Mitte 30, mit schokoladenbrauner Haut und lockigen, pechschwarzen Haaren. Sein Gesicht war kantig und scharf, doch seine Lachfältchen um die braunen Augen verliehen seinem Ausdruck Sanftheit und Güte. Er war die Pflegedienstleitung hier, ein intelligenter Kopf, der immer die Kontrolle behielt. Aiden hatte Jack heute herumgeführt und in seine Tätigkeitsfelder eingeführt.
»Läuft prima hier, ich weiß gar nicht, was alle haben«, seufzte Jack und ein Schmunzeln bildete sich auf seinen Lippen.
»Werd mal nicht überheblich, das ist dein erster Tag. Ich kann dir ´n paar Patientenstorys erzählen, wenn du willst. Ich vermute, dann kommst du ganz schnell wieder von deinem hohen Ross ´runter«, scherzte Aiden. Jack nahm das Angebot dankend an. Während er den Worten seines Kollegen lauschte und ihm das bittersüße Aroma seines Kaffees die Nerven wachrüttelte, schweiften seine Gedanken nach draußen. Es regnete noch immer. Das kalte unbändige Wetter war ungewöhnlich für diese Jahreszeit, aber es störte ihn nicht. Nach wie vor, mit jedem Tag mehr, fühlte Jack sich zu der Insel hingezogen. Die weiten grünen Wiesen, die salzige Meeresluft, die belebten Straßen der Stadt, all das löste in ihm Gefühle der Vertrautheit, der Sicherheit aus. Vielleicht kam er ja von hier. Und vielleicht gab es hier auch eine Familie, die auf ihn wartete. Ein weiteres Lächeln bildete sich bei diesem Gedanken.
»Hey, das ist nicht witzig! Ein Patient, der sich selbst sämtliche Finger abgebissen hat, bringt dich also zum Lachen?«, fragte Aiden gespielt empört. Jack schüttelte den Kopf und signalisierte ihm mit einer Handbewegung, dass er fortfahren sollte. Er erzählte von einer Patientin, deren Psychosen sie nach langer Behandlung und viel Mühe dennoch so beherrscht hatten, dass sie es schaffte, sich das Leben zu nehmen, auf brutalste Weise. Jack war klar, dass der Mann ihm Angst machen wollte, ihn testen wollte, ob er dem gewachsen war, was auf ihn zukam. Doch Jack ließ sich nicht beirren. Er war vorbereitet, hatte vergleichsweise gut geschlafen und hatte heute Morgen all sein Selbstbewusstsein zusammengekratzt, das er in seinem ramponierten Inneren finden konnte. Mit gestrafften Schultern trank er einen weiteren, großen Schluck des belebenden Gebräus.
»Weißt du, Aiden …«, begann er, räusperte sich kurz, um mit kräftigerer Stimme fortzufahren, »was auch immer mich erwartet, ich freu mich darauf.« Und das stimmte. Heute Morgen war er das erste Mal mit einem Lächeln erwacht. Trotz der Träume, trotz der Erschöpfung hatte er Aufregung und Freude empfunden. Endlich hatte er eine Aufgabe, einen Sinn, einen Rhythmus. Nun konnte sein Leben erst richtig anfangen. Erst im Bus, als er von weitem die hohen Fichten sah, die das hügelige Gebiet umkreisten, beschlichen ihn ein paar Zweifel. Nur für einen kurzen Moment. Das neblige, kalte Wetter ließ die Szenerie düster und unheimlich erscheinen, aber die Gedanken verliefen sich schnell im Matsch. Im wahrsten Sinne. Der Bus fuhr nur bis zum Waldrand und Jack musste den Rest des steinigen Weges laufen. Umgeben von den hohen dichten Bäumen und dem Geräusch des Windes, der durch die Nadeln rauschte, war er zum zweiten Mal den Hügel zwei Kilometer hinaufgestapft. Das erste Mal, als er wegen des Vorstellungsgesprächs diese Anfahrt auf sich genommen hatte, war es ihm noch deutlich weiter vorgekommen. Erneut war er überwältigt gewesen von diesem Konstrukt, welches sich hier auf mehreren Hektaren erstreckte. Die Psychiatrie bestand aus einem gigantischen Gebäudekomplex im viktorianischen Stil mit einem Hauptgebäude und zwei Nebengebäuden, alle aus grau-rotem Backstein. Das Gelände war umgeben von einem schwarzen, stählernen Zaun, mit Stacheldraht geschmückt, und vor sämtlichen Fenstern waren engstriemige Gitter angebracht. Bevor man den Eingang passierte, durchschritt man einen gewaltigen Vorhof, der mit kunstvoll angelegten Beeten und Pflastersteinwegen durchzogen war. Links führte ein Weg um die Anstalt herum, zu einem Parkplatz, wie er einem Schild entnehmen konnte. In der Mitte stand ein großer Steinbrunnen, in dem das Wasser fröhlich aus vier kleinen Düsen sprudelte, gepflegt, mit einer eleganten Elefantenstatue gekrönt. Jack waren viele Ornamente oder Schriftzeichen, vermutlich keltisch, um den Saum herum aufgefallen. Die Gärtner leisten beste Arbeit, hatte er gedacht, als er die bunten Blumensträucher bestaunte. Der Haupteingang, der sich mittig im Hauptgebäude befand, bestand aus zwei enormen Flügeltüren aus schwarzem Ebenholz, gesäumt mit in Handarbeit gefertigten Marmorfiguren. Doch trotz des distinguierten Erscheinungsbildes lag ein Schatten über diesem Berg, am Rand zur Zivilisation, abgeschnitten von jeglichen gesellschaftlichen Konventionen. Die St.-Edward-Caprice-Nervenheilanstalt war, wie Barron sagte, nicht das, was sie sein sollte. Durch ein Rütteln an seiner Schulter wurde Jack aus seinen Grübeleien gerissen.
»Wenn dich das alles nicht interessiert, sag es ruhig«, grummelte Aiden.
»Nein, tut mir leid. Es sind nur so viele Eindrücke, die ich erstmal verarbeiten muss. Ich bin dir wirklich dankbar für deine Zuwendung.«
»Schleimen brauchst du nun auch nicht, pass auf, ich hab mal erlebt …«, setzte er gerade an, als plötzlich die Tür des Gemeinschaftsraumes aufsprang. Brody Buckley stürmte herein und hielt sich die Brust. Er war, wie Aiden ihm morgens erklärt hatte, nicht nur Pfleger, sondern auch Sicherheitsbeauftragter, mit dem Schwerpunkt Überwachung. »Er hängt viel zu oft vor der Glotze«, hatte sein Kollege gemeint. Bisher gab es noch nicht viel Gelegenheit zu reden, aber dennoch war der große Mann – noch größer als Aiden – Jack eher unsympathisch. Irgendetwas an seiner Ausstrahlung signalisierte Jack, Vorsicht walten zu lassen. Er hatte dieses blasierte Glitzern in seinen Augen gesehen.
»Beruhige dich erst einmal. Du solltest mit dem Rauchen aufhören, mein Freund. Was ist passiert?«, fragte Aiden mit einer Seelenruhe. Hustend brachte Brody nur schwierig die nächsten Worte heraus.
»Schon klar, Arschloch. Wir haben eine neue Patientin. Wurde als … Notfall eingeliefert vom St. James. Als wir die Fixierung gelöst hatten, um sie umzulagern, ist sie aufgesprungen … und ins Treppenhaus geflüchtet. Wir bräuchten Unterstützung«, keuchte der stämmige Mann mit gerötetem Gesicht.
»Bin unterwegs, warum funkst du denn nicht?«, sagte Aiden gelassen, mehr zu sich selbst, und stand auf.
»Auf geht’s, Jackson. Du brauchst mal etwas Action«, grinste er. Dieser stellte die leuchtend rote Kaffeetasse auf den Tisch und lief den beiden Männern hinterher. Ein Kribbeln in seinem Bauch ließ ihn erschaudern. Aufregung, Adrenalin flutete seine Adern.
»Sag mal, ich dachte es werden keine Patienten mehr eingeliefert?«
»Doch, hin und wieder bekommen wir schon noch einen, wenn alle anderen Einrichtungen überfordert sind«, erklärte Aiden, ohne ihn anzusehen.
»Aber … werden die hier denn wieder gesund? Oder, was kann hier denn getan werden, was sonst kein anderer kann?«
Brody lief schneller voraus, Aiden schien seine Frage absichtlich zu überhören. Und während Jack hinter ihm den hell erleuchteten Flur entlangrannte, der zum Treppenhaus führte, wurde er das Gefühl nicht los, dass es keinen richtigeren Ort für ihn gab. Hier musste er sein, genau an diesem Tag, in diesem Moment.
»Jackson, Schatz, komm, wir wollen los!«, hörte er eine liebliche Stimme rufen. In dem schönen grünen Garten hingen silberne Luftballons an den Ästen eines großen Kirschbaumes, die die Zahl 12 formten. Eine Frau mit langen, blonden Locken strahlte ihn von der Terassentür aus mit einem warmherzigen, stolzen Lächeln an und winkte ihm zu. Als Jack gerade auf sie zugehen wollte, veränderte sich die Szenerie, waberte, als würde jemand mit einem nassen Pinsel über die Wasserfarben des Bildes streichen und sie verschwimmen lassen. Die Ballons waren fort. Ebenso seine Mutter. Aus einem Impuls heraus setzten sich seine Beine wieder in Bewegung, in die andere Richtung, vorbei an bunten Blumenbeeten und Gewächshäusern, Gartenzwergen im Rockabilly-Stil und einer Sitzecke neben einem Elektro-High-Tech-Grill. Bis zum Rand des Gartens, dort schlüpfte er durch ein kleines Loch im Zaun, hinter einem Brombeerstrauch, und verschwand in dem angrenzenden Laubwald. Nach zweihundert Metern etwa erreichte er das Wolfsgehege eines Zoos, der direkt am Wald lag. Jack suchte sich ein Fleckchen weiches Moos, das möglichst nah an dem hohen Zaun lag, so dass er das Summen des Stroms hören konnte, der durch die Maschendrähte floss, und studierte voller Ehrfurcht die eleganten Tiere. Wie sie sich bewegten, anmutig und stark. Wie sie fraßen, gewissenhaft und klug, und miteinander umgingen, so liebevoll und behutsam. Eine Vollkommenheit der Natur. Einer der Wölfe, so grau wie Jacks Augen, reckte die Schnauze in die Höhe und stieß einen heulenden Laut aus. Der sanfte Ton strich über sein Gesicht, materialisierte sich zu einer Hand, die ihn an der Schulter packte. Plötzlich erzitterte sein Körper und im nächsten Moment blinzelte er gegen das grelle Licht in dem Treppenhaus an, in dem er nun stand, und erfasste die Geschehnisse vor sich mit einer Mischung aus Entsetzen und Staunen. Er konnte sich nicht rühren, stand fassungslos da, während seine Kollegen zu dritt an einer mageren, knochigen, aber erstaunlich starken Frau zerrten. Sie trug einen losen Patientenkittel, der den Großteil ihres blassen, geschundenen Körpers freilegte. Ihre feuerroten Haare, verfilzt und dreckig, fielen ihr ins Gesicht. Die Männer hielten ihre Arme und Beine, versuchten ihr ein Sedativum zu spritzen, doch sie wehrte sich mit aller Kraft und schlug ihnen die Spritze aus der Hand. Dann drang aus ihrem Gekreische, das dem einer Wildkatze ähnelte, ein einzelner markerschütternder Schrei in Jacks Kopf. Alles verlor an Bedeutung in der kurzen Sekunde, in der dieser Schrei durch sein Bewusstsein hallte. Durchdringend, betäubend, voller Angst. Etwas geschah mit Jack. Etwas Echtes. Er konnte es nicht definieren. Sein Körper vibrierte, als stände er unter Strom. Seine Brust wurde enger. Ihm wurde heiß und dann wieder kalt. Sein Kopf begann zu schmerzen. Dieser Schrei veränderte sich zu einer engelsgleichen Stimme in seinem Kopf. Es war ein Hilfeschrei. Jack hatte das seltsame Gefühl, er müsse antworten, es war wie in einem Traum, in dem er ohne Stimme versuchte, zu sprechen. Sein Sichtfeld verschwamm, sein Blut kochte vor Adrenalin. Was passierte hier? Die Kollegen versuchten, sie die Stufen hinaufzuziehen. Jeder Muskel in ihrem ausgemergelten Körper war angespannt. Sie schlug und biss um sich. Doch dann erblickte sie Jack und die Zeit verlangsamte sich. Ihre grünen, mandelförmigen Augen sahen ihn mit einem Ausdruck der Überraschung an, und mit einem Mal machte alles Sinn. Warum es ihn hierher gezogen hatte. Warum er es nicht geschafft hatte, trotz aller Mühe, die Hoffnung nicht aufzugeben. Dieses Band. Ein warmes Gefühl machte sich in seiner Brust breit. Aiden tauchte auf und wedelte mit seiner Hand vor Jacks Gesicht herum. Der Geruch von Blut bahnte sich einen Weg zu seiner Nase und katapultierte ihn wieder in die Realität.
»Was … Was kann ich tun?«, fragte er zögerlich.
»Pack mit an, verdammt nochmal und starr nicht so blöd!«
Brody schrie, jemand müsse den B-52 holen. Aiden schüttelte nur den Kopf und Jack löste sich aus der Starre, sprang die Stufen hinunter. Von hinten packte er ihre wirbelnden Hände in seine und hielt sie ganz fest, damit sie niemanden mehr verletzen konnte. Und dann, als wäre der Blitz eingeschlagen, der alles zum Erliegen brächte, wurde sie auf einmal ganz still. Die plötzliche Ruhe dröhnte mit einer Präsenz, die die Luft um sie herum zerriss. Nur noch keuchender Atem war zu hören. Wie erstarrt lag die junge Frau in den Armen der Männer und sah Jack an, der ihre zitternden Hände hielt. In ihrem Blick lagen Verwirrung und Schmerz. Und Hoffnung.
»Wie … Was machst du …«, stotterte der dritte Mann, Kane McCarthy.
»Scheißegal! Handlungsfreigabe nach Protokoll 251. Mach dich an die Dokumentation, Brody. Gebt sie mir. Jack und ich bringen sie in die Iso«, wies Aiden mit stoischer Miene an und nahm die Frau den Männern ab, die vorsichtig einen Schritt zurücktraten. Jack ließ sie nicht los. Sie starrten beide wachsam auf ihre verknoteten Finger. Langsam gingen die Kollegen die letzten Stufen hinauf und liefen den Flur entlang, aus dem sie gekommen waren. Jack sah in ihre Augen. Aus der Nähe waren sie noch eindrucksvoller. Groß und klar, und in der Iris spielten kunstvolle, goldene Ornamente mit dem satten Smaragdgrün. Hypnotisierend. Er war wie in einen Bann gezogen. Das Gefühl, irgendetwas in ihm hätte sich verändert, irgendetwas hätte Besitz von ihm ergriffen, ließ nicht nach. Es wuchs, keimte wie ein Samen in seinem Innern. Sie gingen gerade durch den Versorgungstrakt, um eine neue Liege zu beschaffen. Schließlich durften sie sie nicht durch den ganzen Komplex tragen. Mit Ruhe und Vorsicht legten sie die Frau auf eine der Bahren, die am Rand standen. Jack ließ ihre Hände nicht los, während Aiden ihren Kittel zurechtlegte und sie zudeckte. Hin und wieder zuckte ihr Körper, wenn Aiden ihre Haut berührte, aber sie hielt still. Er beschaffte noch ein Muskelrelaxans, damit sie sich entspannen konnte, doch als er die Spritze an ihrem Oberarm ansetzen wollte, drückte sie wimmernd Jacks Hände.
»Können wir da nicht drauf verzichten?«
»Jackson, es würde ihr guttun, sich ein bisschen zu entspannen, und wir müssen auch auf unsere Sicherheit achten. Vertrau mir.«
Er stach zu und Tränen rannen aus ihren Augen.
»Nein, bitte hör auf, ich übernehme die Verantwortung«, entfuhr es Jack, forscher als beabsichtigt. Aiden hielt inne, sah ihn mit einem durchdringenden Blick an und drückte den Kolben bis zum Anschlag hinunter.





























