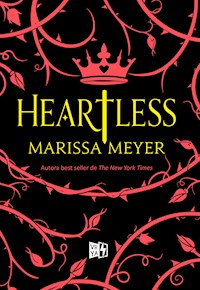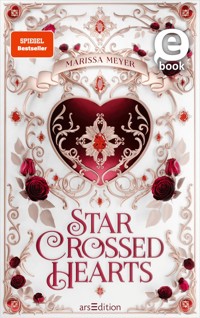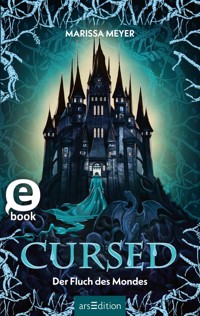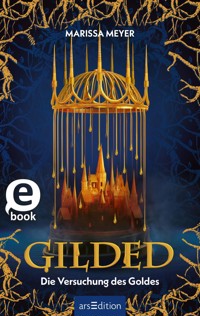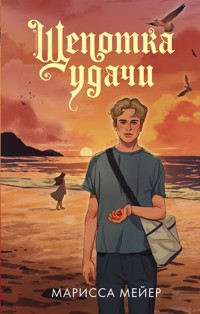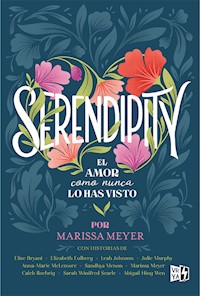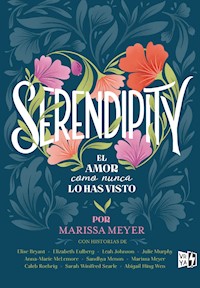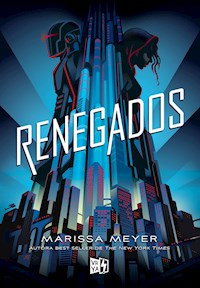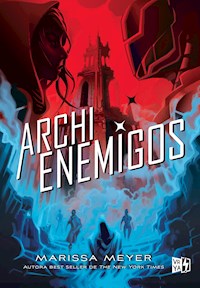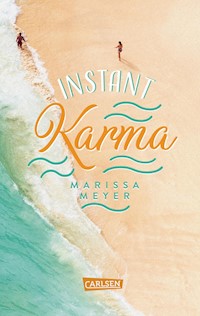
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Lovestory mit unwiderstehlichen Sommer-Vibes, viel Witz und Suchtgefahr – von der beliebten Autorin der Luna-Chroniken Prudence ist überaus strukturiert und organisiert. Ihre Ängste und Unsicherheiten bekämpft sie damit, immer und überall optimal vorbereitet zu sein. Ganz im Gegensatz zu ihrem neuen Laborpartner in Bio: Quint Erickson scheint chronisch unzuverlässig und kommt nicht mal am Tag ihrer gemeinsamen Präsentation pünktlich. Prudence' Träume von höherer Gerechtigkeit werden erfüllt, als sie den mit der plötzlichen Fähigkeit aufwacht, sofortiges Karma für die Menschen um sie herum heraufzubeschwören. Mit dieser Macht ist sie zuerst ein bisschen überfordert – und es gibt eine Person, bei der ihre Kräfte ständig nach hinten losgehen: Quint. Doch dann steht ausgerechnet er vor ihr, als Prudence in der örtlichen Rettungsstation für Meerestiere als Freiwillige anfängt. Nun müssen die beiden zusammenarbeiten. Und vielleicht ist Quint eigentlich doch ganz anders, als es auf ersten Blick scheint … Zwei wunderbar sympathische Hauptfiguren in einer Enemies-to-Lovers-Story!! »Eine hochromantische Geschichte mit dem Thema Tierrettung als Bonus. Perfekt für Fans von Rainbow Rowell und Meg Cabot!« Booklist
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Marissa Meyer
Instant Karma
Aus dem Englischen von Stefanie Frida Lemke
Prudence ist überaus strukturiert und organisiert. Ihre Ängste und Unsicherheiten bekämpft sie damit, immer und überall optimal vorbereitet zu sein. Ganz im Gegensatz zu ihrem neuen Laborpartner in Bio: Quint Erickson scheint chronisch unzuverlässig und kommt nicht mal am Tag ihrer gemeinsamen Präsentation pünktlich. Prudence‹ Träume von höherer Gerechtigkeit werden erfüllt, als sie den mit der plötzlichen Fähigkeit aufwacht, sofortiges Karma für die Menschen um sie herum heraufzubeschwören.
Mit dieser Macht ist sie zuerst ein bisschen überfordert – und es gibt eine Person, bei der ihre Kräfte ständig nach hinten losgehen: Quint.
Doch dann steht ausgerechnet er vor ihr, als Prudence in der örtlichen Rettungsstation für Meerestiere als Freiwillige anfängt. Nun müssen die beiden zusammenarbeiten. Und vielleicht ist Quint eigentlich doch ganz anders, als es auf ersten Blick scheint …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Viten
Für Dad,der unser Zuhause immer mit Musik erfüllte
1
Quint Erickson kommt zu spät.
Mal wieder.
Das sollte mich eigentlich nicht wundern. Und es wundert mich auch nicht. Es würde mich eher wundern, wenn er ausnahmsweise mal pünktlich wäre. Aber im Ernst – heute? Ausgerechnet?
Innerlich kochend trommele ich mit den Fingern auf der zusammengeklappten Schautafel auf unserem Tisch. Gedanklich bin ich halb bei der Uhr über der Tür, halb bei den Worten, die ich die ganze Woche lang auswendig gelernt habe und jetzt stumm wiederhole.
Unsere Strände und Küstengewässer sind das Zuhause einiger bemerkenswerter Arten. Fische und Säugetiere und Meeresschildkröten und …
»Haie«, sagt Maya Livingstone vorne, »wurden von den Filmstudios in Hollywood jahrzehntelang völlig falsch dargestellt. Haie sind keine Ungeheuer!«
»Außerdem«, sagt ihr Projektpartner Ezra Kent, »wer frisst hier wen? Ich meine, wusstet ihr, dass es tatsächlich Menschen gibt, die Haie essen?«
Maya sieht ihn stirnrunzelnd an. »Eigentlich nur die Flossen. Um genau zu sein.«
»Genau! Da wird Suppe draus gemacht«, sagt Ezra. »Haifischflossensuppe ist so was wie eine Delikatesse, weil die Flossen wohl gleichzeitig weich und knusprig sind. Stellt euch das mal vor! Also, ich würde sie auf jeden Fall probieren!«
Ein paar Leute im Raum machen Geräusche, als müssten sie sich übergeben – genau die Reaktion, die Ezra beabsichtigt hat. Die meisten nennen ihn EZ, ausgesprochen wie easy, und früher dachte ich, das wäre eine Anspielung auf unzählige sexuelle Abenteuer. Aber inzwischen glaube ich, der Spitzname kommt daher, dass er einen Ruf als Klassenclown weghat. Die Lehrerinnen und Lehrer an unserer Schule haben schnell gelernt, ihn und Quint nicht zusammenzusetzen.
»Wie auch immer«, sagt Maya, um das Gespräch wieder aufs eigentliche Thema zu lenken, und erzählt, auf welch grausame Weise die Haie gefangen werden und die Flossen abgeschnitten bekommen, bevor sie zurück ins Wasser geworfen werden. Ohne Flossen sinken sie auf den Meeresboden, wo sie entweder ersticken oder lebendig von anderen Raubfischen gefressen werden.
Der ganze Kurs verzieht das Gesicht.
»Und dann werden die Flossen zu Suppe verarbeitet!«, fügt Ezra hinzu, für den Fall, dass es vorher irgendwer nicht mitbekommen haben sollte.
Noch eine Minute vergeht. Ich beiße mir von innen auf die Wange und versuche, mich zu beruhigen. In meinem Kopf beginnt derselbe frustrierte Rant wie immer, zum ungefähr acht millionsten Mal dieses Jahr.
Quint. Erickson. Ist. So. Ein. Arsch.
Ich habe ihn gestern noch daran erinnert. Denk dran, Quint, morgen ist unsere große Präsentation. Du bringst den Bericht mit. Du musst mir bei der Einleitung helfen. Also bitte, bei allem, was auf dieser Welt gut und gerecht ist, bitte komm dieses eine Mal nicht zu spät.
Seine Antwort?
Schulterzucken.
Ich hab viel um die Ohren, Prudence. Aber ich geb mein Bestes.
Genau. Weil er an einem Dienstag vor halb neun so viel zu tun hat.
Natürlich kann ich die Einleitung auch ohne ihn machen. Ich habe sie schließlich auch ohne ihn geübt. Aber er bringt unseren Bericht mit. Die Ausdrucke, auf die der Rest des Kurses gucken kann, während wir reden. Die Ausdrucke, die ihre gelangweilten, desinteressierten Blicke von mir abhalten.
Der halbherzige Applaus des Kurses reißt mich aus meinen Gedanken. Ich klatsche ein-, zweimal, dann lasse ich die Hände wieder auf den Tisch sinken. Maya und Ezra klappen ihre Schautafel zusammen. Ich schaue zu Jude in der ersten Reihe, und obwohl ich nur seinen Hinterkopf sehe, weiß ich, dass er Maya die ganze Zeit angeguckt hat, seit sie aufgestanden und nach vorn gegangen ist, und sie weiter angucken wird, bis sie sich wieder hinsetzt und er keine andere Wahl hat, als entweder wegzusehen oder zu riskieren, dass alle merken, wie er sie anstarrt. Ich liebe meinen Bruder von ganzem Herzen, aber seine Verknalltheit in Maya Livingstone ist schon seit der fünften Klasse allgemein bekannt, und – ganz ehrlich – allmählich wirkt sie ein bisschen hoffnungslos.
Er hat mein vollstes Mitgefühl. Wirklich. Schließlich reden wir hier von Maya Livingstone. So ziemlich die ganze Zehnte ist in sie verknallt. Aber ich kenne meinen Bruder. Er wird niemals den Arsch in der Hose haben, sie nach einem Date zu fragen.
Also: hoffnungslos.
Armer Junge.
Aber zurück zu mir, ich bin schließlich auch ziemlich bemitleidenswert. Maya und Ezra setzen sich hin, und immer noch keine Spur von Quint. Keine Spur von den Ausdrucken, die er mitbringen sollte.
In einem Akt der Verzweiflung angle ich meinen roten Lippenstift aus der Tasche und trage schnell eine neue Schicht auf, nur für den Fall, dass er seit Beginn der Stunde wieder abgegangen ist. Ich benutze kaum Make-up, aber auffälliger Lippenstift steigert mein Selbstvertrauen sofort. Er ist meine Rüstung.
Du kannst das, sage ich mir. Du brauchst Quint nicht.
Ich spüre den Herzschlag in meiner Brust. Mein Atem geht schneller. Ich stecke den Lippenstift zurück in die Tasche und greife nach den Karteikarten. Ich brauche sie nicht, ich habe so oft geübt, dass ich schon im Schlaf von Habitaten und Umweltschutz rede. Aber sie dabeizuhaben, hilft gegen die Nervosität.
Zumindest glaube ich das. Ich hoffe es.
Bis ich plötzlich Angst bekomme, dass meine verschwitzten Hände die Tinte verschmieren und unlesbar machen könnten. Meine Nervosität schaltet wieder einen Gang hoch.
»Und damit kommen wir zu unserer letzten Präsentation des Schuljahrs«, sagt Mr Chavez und sieht mich fast mitfühlend an. »Tut mir leid, Prudence. Wir haben es so lange wie möglich hinausgezögert. Vielleicht taucht Quint ja noch auf, bevor du fertig bist.«
Ich lächle gezwungen. »Kein Problem. Ich habe eh geplant, den Großteil des Redens zu übernehmen.«
Von wegen kein Problem. Aber es ist nun mal nicht zu ändern.
Langsam stehe ich auf, stecke mir die Karteikarten in die Hosentasche und greife nach der Schautafel und dem Stoffbeutel mit Bonusmaterial. Meine Hände zittern. Ich bleibe kurz stehen und atme aus, schließe die Augen und wiederhole, was ich mir immer sage, wenn ich vor mehreren Leuten reden oder auftreten muss.
Es sind nur zehn Minuten deines Lebens, Prudence, dann ist es vorbei und du kannst es hinter dir lassen. Nur zehn Minuten. Du kannst das.
Ich öffne die Augen wieder, straffe die Schultern und gehe nach vorn.
Es ist gar nicht so, dass ich schlecht darin wäre, vor anderen zu sprechen. Tatsächlich glaube ich, dass ich sogar ziemlich gut darin bin, sobald ich erst einmal angefangen habe. Ich spreche laut und deutlich, damit alle mich hören. Ich übe meine Referate immer, bis sie mir zu den Ohren wieder rauskommen, damit ich nicht über meine Worte stolpere, und ich bemühe mich sehr, meinen Vortrag lebendig und unterhaltsam zu gestalten.
Schrecklich sind nur die Augenblicke, bevor ich anfange. Ich bin jedes Mal überzeugt, dass etwas schiefgeht. Dass ich einen Blackout habe und alles vergesse. Dass ich Schweißausbrüche bekomme. Knallrot werde. In Ohnmacht falle.
Doch sobald ich erst einmal begonnen habe, ist eigentlich alles okay. Ich muss nur anfangen … und dann, bevor ich weiß, wie mir geschieht, ist das Ganze auch schon wieder vorbei. Hinterher bekomme ich immer das Gleiche zu hören: Wow, Prudence. Du bist ein Naturtalent. Du bist so eine tolle Rednerin. Super gemacht.
Das ist Balsam für meine Seele.
Zumindest sagen meine Lehrerinnen und Lehrer so was. Die anderen beachten mich kaum.
Was absolut okay ist.
Ich brauche ein paar Momente, um alles vorzubereiten, die Schautafel aufzustellen und den Beutel mit dem Bonusmaterial zurechtzulegen. Dann ziehe ich den kleinen Rolltisch mit dem Modell heran, das ich vor Beginn der Stunde bereitgestellt und mit einem blauen Tuch bedeckt habe.
Ich halte in der einen Hand die Karteikarten und greife mit der anderen nach dem Zeigestock, den Mr Chavez immer benutzt, um auf einzelne Punkte seiner PowerPoint-Präsentationen zu deuten.
Ich lächle die Klasse an.
Versuche, Blickkontakt mit Jude herzustellen, aber er kritzelt in seinem Skizzenbuch herum und hat keinen Kanal offen für eingehende Nachrichten.
Na toll, Bruderherz. Danke für die Unterstützung.
Der Rest des Kurses starrt mich komatös vor Langeweile an.
Mein Magen krampft sich zusammen.
Fang einfach an.
Es sind nur zehn Minuten.
Du machst das schon.
Ich hole Luft.
»Ich hatte eigentlich vor, euch Handouts auszuteilen«, sage ich. Meine Stimme überschlägt sich, und ich räuspere mich, bevor ich fortfahre. »Damit ihr der Präsentation besser folgen könnt. Aber Quint sollte die Ausdrucke mitbringen und … er ist nicht da.« Ich malme mit den Zähnen und würde gern auf die Ungerechtigkeit des Ganzen hinweisen. Alle anderen waren zu zweit! Nur mein Projektpartner hält es nicht für nötig zu kommen.
»Egal«, sage ich und fahre dramatisch mit dem Zeigestock durch die Luft. »Los geht’s.«
Ich trete vor unsere Schautafel und stoße die Luft aus.
Fang einfach an.
Strahlend beginne ich mit meiner Einführung.
»Dank des hervorragenden Unterrichts von Mr Chavez« – ich mache eine Pause und zeige voller Enthusiasmus auf unseren Lehrer, der meine Geste spiegelt, wenn auch mit sehr viel weniger Begeisterung – »haben wir eines über Meeresbiologie bereits gelernt: Nämlich dass wir uns glücklich schätzen können, hier direkt vor Ort in Fortuna Beach ein prächtiges Meeresbiotop zu haben. Unsere Strände und Küstengewässer sind das Zuhause einiger bemerkenswerter Arten. Fische und Säugetiere und Meeresschildkröten und Haie …«
»Haie sind Fische«, sagt Maya.
Sofort verkrampfe ich. Bei einer gut einstudierten Präsentation ist nichts schlimmer als unnötige Unterbrechungen.
Unterbrechungen sind die Pest.
Ich setze wieder ein Lächeln auf. Kurz bin ich versucht, noch mal von vorne anzufangen, aber dann konzentriere ich mich, den Faden wiederzufinden. Fische und Säugetiere und Meeresschildkröten und Haie … »Bis hin zu den reichen Ökosystemen aus Plankton und der Pflanzenwelt in der Orange Bay. Diese Ressourcen sind ein Geschenk, und es ist unsere Verantwortung, sie nicht nur zu genießen, sondern auch zu schützen. Weswegen Quint und ich uns entschieden haben, uns bei unserem Projekt auf« – ich mache eine dramaturgische Pause – »den Meeresschutz durch Ökotourismus zu konzentrieren!«
Mit Schwung ziehe ich das blaue Tuch vom Tisch und enthülle mein selbst gebasteltes Modell der Main Street, touristischer Hotspot von Fortuna Beach, die parallel zum Strand und der Strandpromenade verläuft.
Ich blicke auf, um die Reaktionen des Kurses mitzubekommen. Ein paar Leute in der ersten Reihe recken die Hälse, um das Modell zu sehen, aber die meisten blinzeln gedankenverloren aus den Fenstern in die Sonne oder schreiben auf diskret unterm Tisch versteckten Handys Nachrichten.
Wenigstens Mr Chavez wirkt beeindruckt vom Modell. Und Jude hat endlich den Blick von seinem Skizzenbuch gelöst, schließlich weiß er aus erster Hand, wie lange ich an dieser Präsentation gearbeitet habe. Er sieht mich an und nickt mir dezent, aber aufmunternd zu.
Ich stelle mich hinter den Tisch, sodass ich von oben auf die wichtigsten Details zeigen kann. Das Adrenalin hat seine Wirkung entfaltet, und inzwischen habe ich keine Angst mehr, eine Panikattacke zu bekommen. Ich bin voller Energie. »Unser neues Tourismus-Zentrum wird das Orange Bay Resort und Spa, ein Luxushotel, dessen Kundschaft sich nach Abenteuern sehnt, aber – tada!«, ich schnipse mit den Fingern, »gleichzeitig die Umwelt schützen will.« Ich tippe mit dem Zeigestock auf das Hochhaus. »Mit den recycelten Baumaterialien und dem Wasser- und Energiesparmanagement wird das Resort das Hauptgesprächsthema der Stadt. Aber unsere Gäste kommen nicht nur, um hier zu schlafen. Sie kommen, um die Gegend zu erkunden. Weswegen Fortuna Beach an beiden Enden der Strandpromenade neue E-Bike-Leihstationen braucht« – ich tippe klackend mit dem Stock auf die kleinen Fahrradständer – »und E-Boot-Verleihe, die direkt vom Privatdock des Hotels starten.« Klack. »Aber was die Kundschaft wirklich anzieht, was Fortuna Beach zu einem Muss für unsere Ökotouristen macht …«
Die Tür zum Kursraum schwingt auf und knallt gegen die Wand.
Ich zucke zusammen.
»Entschuldigung, Mr C!«, erklingt eine Stimme, bei der sich mir die Nackenhaare sträuben. Mein Erstaunen verwandelt sich in mit Mühe zurückgehaltene Wut.
Ich umklammere den Zeigestock und sehe langsam zu Quint Erickson rüber. Er spaziert zwischen den Tischen hindurch und gibt Ezra High five, ihr übliches Begrüßungsritual.
Ein Teil von mir wünscht sich, er hätte zuerst mir ein High five zur Begrüßung angeboten. Es wäre die perfekte Gelegenheit gewesen, ihm mit dem Stock eins überzuziehen.
Mit zusammengebissenen Zähnen blicke ich auf seinen Hinterkopf, bis er endlich unseren gemeinsamen Tisch in der letzten Reihe erreicht, seinen Rucksack darauf fallen lässt und ihn öffnet. Der Reißverschluss ist so laut wie ein Düsenmotor. Dann fängt Quint an zu pfeifen – im Ernst, zu pfeifen –, während er sich durch das Chaos von Zetteln und Büchern und Stiften und in neun Monaten angehäuftem Müll wühlt, den er in seinem Rucksack mit sich herumträgt.
Ich warte. Irgendwer hustet. Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie Jude anfängt, unruhig auf seinem Platz herumzurutschen. Er hat Mitleid mit mir. Nur, dass ich aus irgendeinem Grund gar nicht leide. Normalerweise würde mich eine Unterbrechung dieser Größenordnung total durcheinanderbringen, aber im Moment bin ich viel zu sehr damit beschäftigt, den Zeigestock zu strangulieren und so zu tun, als wäre er Quints Hals. Ich könnte den ganzen Tag so dastehen, unangenehmes Schweigen hin oder her, und darauf warten, dass Quint merkt, was für eine Störung er verursacht hat.
Und genau das frustriert mich dann aber doch grenzenlos: Quint scheint das tatsächlich alles gar nicht mitzubekommen. Meinen Ärger. Dass er mich mitten in unserem Referat unterbrochen hat. Das peinliche Schweigen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob er weiß, was peinlich überhaupt heißt.
»Ha!«, verkündet er triumphierend und zieht eine neongrüne Mappe aus dem Rucksack. Sogar von hier aus kann ich erkennen, dass eine Ecke geknickt ist. Er nimmt die Ausdrucke heraus. Ich weiß nicht, wie viele Seiten es sind. Drei oder vier, wahrscheinlich doppelseitig bedruckt, denn wer verschwendet schon Papier bei einem Referat über Umweltschutz?
Zumindest hoffe ich, dass er es doppelseitig bedruckt hat.
Quint fängt an, die Handouts auszuteilen – zusammengetackerte Blätter für den Kurs und eine Ringmappe für Mr Chavez. Er macht es nicht auf die effiziente Art, eins-nehmen-Rest-weitergeben, wie ich es gemacht hätte, wahrscheinlich weil er der ineffizienteste Mensch auf Erden ist. Nein, er geht höchstpersönlich die Reihen entlang und verteilt die Handouts eins nach dem anderen. Grinst. Und lässt sich angrinsen. Er könnte ein Politiker sein, der mit seinem lässigen Bummeln und Lächeln die Massen umwirbt. Eins der Mädchen klimpert sogar mit den Wimpern, als sie das Handout entgegennimmt und Danke, Quint säuselt.
Die Knöchel meiner Finger um den Zeigestock treten inzwischen weiß hervor. Ich male mir aus, wie Quint sich den Zeh an einem Tischbein stößt oder auf verschütteten Laborchemikalien ausrutscht und sich den Fuß verstaucht. Oder, nein – noch besser –, ich stelle mir vor, wie er in der Eile die falsche Mappe mitgenommen hat und gerade zweiunddreißig Kopien eines leidenschaftlichen Liebesbriefs an unsere Direktorin Mrs Jenkins verteilt. Noch nicht mal er kann immun gegen solch eine Schmach sein, oder?
Natürlich passiert nichts davon. Meine Träume von kosmischer Gerechtigkeit werden nie Wirklichkeit. Aber ich habe mich einigermaßen beruhigt, als Quint schließlich nach vorne kommt und sich dazu herablässt, mich anzusehen. Sein Ausdruck verändert sich sofort, er nimmt eine Abwehrhaltung ein, vorgerecktes Kinn, finsterer Blick. Etwas sagt mir, dass er sich, seit er reingekommen ist, auf diesen Moment vorbereitet hat. Kein Wunder, dass er sich mit den Handouts so viel Zeit gelassen hat.
Ich versuche ein Lächeln, aber es fühlt sich mehr so an, als würde ich die Zähne blecken. »Schön, dass du es noch geschafft hast.«
Seine Mundwinkel zucken. »Ich würde mir das hier doch nicht entgehen lassen. Partner.« Sein Blick wandert zu meinem Modell, und für einen kurzen Moment sehe ich so etwas wie Überraschung auf seinem Gesicht. Es könnte sogar sein, dass er beeindruckt ist.
Und das sollte er auch. Beeindruckt, und außerdem beschämt, dass er das Modell gerade zum ersten Mal sieht.
»Nettes Modell«, murmelt er und stellt sich auf die andere Seite meiner Miniatur der Main Street. »Ich sehe, du hast die von mir vorgeschlagene Rettungsstation weggelassen, aber …«
»Mit etwas Hilfe hätte ich vielleicht auch überflüssige Wünsche berücksichtigen können.«
Er stöhnt leise. »Sich um Tiere zu kümmern, die in Folge von Tourismus und Konsum verletzt werden, ist nicht …«
Mr Chavez unterbricht unsere Zankerei mit einem lauten Husten und wirft uns einen leidenden Blick zu. »Zwei Tage noch, Leute. Ihr müsst euch nur noch zwei Tage gegenseitig ertragen. Können wir diese Präsentation bitte zu Ende bringen, ohne dass ihr euch gegenseitig an die Gurgel geht?«
»Natürlich, Mr Chavez«, sage ich, gleichzeitig mit Quints »Tut mir leid, Mr C.«
Ich sehe ihn an. »Soll ich weitermachen, oder hast du irgendwas beizutragen?«
Quint deutet eine Verneigung an und wedelt mit der Hand in meine Richtung. »Die Bühne ist ganz dein«, sagt er, bevor er noch leise hinzufügt: »Obwohl du sie ja sowieso nicht teilen würdest.«
Ein paar Leute in der ersten Reihe kichern. Oh ja, er ist unglaublich komisch. Nächstes Mal könnt ihr ja mit ihm zusammenarbeiten, dann seht ihr, wie lustig er ist.
Ich zeige wieder die Zähne.
Aber als ich mich der Schautafel zuwende, weiß ich nichts mehr.
Wo war ich?
Oh nein. Oh nein.
Jetzt ist es passiert. Mein schlimmster Albtraum. Ich wusste es. Ich wusste, ich würde alles vergessen.
Und es ist allein Quints Schuld.
Panik überkommt mich, während ich die Karteikarten hervorziehe und versuche, sie mit einer Hand durchzublättern. Resort und Spa … E-Bike-Verleih … Ein paar Karten rutschen heraus und fallen auf den Boden. Mein Gesicht ist auf einmal so heiß wie eine eingeschaltete Herdplatte.
Quint bückt sich und hebt die runtergefallenen Karten auf. Ich reiße sie ihm weg, mein Herz rast. Ich fühle die bohrenden Blicke des ganzen Kurses auf mir.
Ich hasse Quint. Für seine komplette Gleichgültigkeit allen anderen gegenüber. Für seine Weigerung, jemals pünktlich zu kommen. Für seine Unfähigkeit, irgendetwas Brauchbares zu tun.
»Ich könnte auch was sagen?«, schlägt Quint vor.
»Ich hab alles unter Kontrolle!«, fahre ich ihn an.
»Okay, gut.« Er hebt abwehrend die Hände. »Ich mein ja nur. Das hier ist auch meine Präsentation, weißt du.«
Genau. Weil er sie ja so ausführlich mit mir vorbereitet hat.
»Was wird Fortuna Beach besonders auszeichnen?«, flüstert Jude. Ich sehe ihn an und werde ruhig. Ich bin ihm genauso sehr dankbar, wie ich sauer auf Quint bin. Jude nickt mir aufmunternd zu, und vielleicht funktioniert unsere Zwillingstelepathie heute, denn ich bin mir sicher, seine Stimme zu hören: Du kannst das, Pru. Entspann dich.
Meine Angst lässt nach. Zum tausendsten Mal frage ich mich, warum Mr Chavez uns mit zugewiesenen Projektpartnern quälen muss, wo Jude und ich so ein fantastisches Team abgegeben hätten. Ohne Meeresbiologie und Quint Erickson wäre die zehnte Klasse ein Spaziergang gewesen.
2
Danke, flüstere ich Jude lautlos zu und lege die Karteikarten weg. Ich brauchte nur diese eine Erinnerung, und jetzt sind die Worte alle wieder da. Ich fahre mit meinem Vortrag fort und gebe mein Bestes, Quint zu ignorieren. Wenigstens ein paar Leute gucken auf die Handouts, sodass mich nicht alle anstarren. »Wie schon gesagt: Unser überwältigendes Angebot an Veranstaltungen und Aktivitäten wird in ganz neuem Umfang begeisterte, umweltbewusste Reisende anziehen. Die Besucher können mit privat angemieteten U-Booten den Meeresboden besichtigen. Es wird Kajaktouren zur Adelai-Insel geben, auf der sie eine eigene Robbe mit einem Sender versehen können, um ihre Bewegungen zu verfolgen, und ihr sogar einen Namen geben. Und, mein persönlicher Favorit: Wir werden wöchentlich rauschende Strandpartys veranstalten.«
Bei den letzten Worten horchen ein paar Leute auf, die vorher nur vor sich hin gestarrt haben. Ezra johlt sogar. War ja klar.
Mit neuem Selbstvertrauen fahre ich fort. »Genau. Fortuna Beach wird berühmt sein für seine regelmäßigen ausgelassenen Strandpartys, auf denen die Leute nachhaltig gefangene Meeresfrüchte und Bio-Horsd’œuvres verspeisen können und dabei andere umweltbewusste Menschen kennenlernen. Und das Beste? Alle bekommen am Anfang der Party einen Müllsack und eine Zange, um am Strand Abfall zu sammeln. Am Ende des Abends können sie ihren vollen Müllsack gegen eine wiederverwertbare Stofftasche eintauschen, die lauter handverlesene Geschenke enthält. Wie zum Beispiel …« Ich lege den Zeigestock ab und greife nach dem Beutel. »Eine BPA-freie Aluminium-Wasserflasche!« Ich ziehe die Flasche raus und werfe sie in die Reihen. Joseph fängt sie gerade so eben. »Bambus-Geschirr für unterwegs! Ein Terminkalender aus Recyclingmaterial! Shampooseife mit plastikfreier Verpackung!« Ich werfe alles in die Menge. Die Leute sind jetzt eindeutig ganz bei der Sache.
Sobald ich alle Geschenke verteilt habe, knülle ich den Stoffbeutel zusammen und schleudere ihn Mr Chavez zu, aber auf halber Strecke fängt Ezra ihn aus der Luft. Inzwischen haben alle bemerkt, dass die Sachen mit dem neuen, von mir entworfenen Logo und Slogan bedruckt sind.
FORTUNA BEACH:
GUT FÜR MICH, GUT FÜR DIE UMWELT!
»All diese Ideen und noch viele mehr sind detailliert in unserem Bericht dargestellt«, sage ich und deute auf eins der Handouts auf dem nächsten Tisch. »Zumindest nehme ich das an. Ich habe ihn tatsächlich noch nicht durchsehen können, weil er vermutlich erst zehn Minuten vor Unterrichtsbeginn fertiggestellt wurde.« Ich werfe Quint ein süßes Lächeln zu.
Seine Miene ist angespannt. Verärgert, aber auch leicht selbstgefällig. »Tja, wer weiß das schon.«
Sein Kommentar verunsichert mich, was garantiert genau seine Absicht war. Der Bericht trägt schließlich auch meinen Namen. Er weiß, dass es mich auf die Palme bringt, nicht zu wissen, was darinsteht und ob der Bericht irgendetwas taugt.
»Bevor wir zum Ende kommen«, sage ich und wende mich wieder dem Kurs zu, »wollen wir uns noch bei Mr Chavez bedanken, dass er uns so viel beigebracht hat über diese beeindruckende Welt, in der wir leben, und über die unglaublichen Meereslebewesen und Ökosysteme direkt vor unserer Haustür. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will Teil der Lösung sein und sicherstellen, dass wir unsere Meere für unsere Kinder und Enkelkinder schützen und erhalten. Und zu unserem Glück haben wir heute gesehen: Indem wir grün werden, wird Fortuna Beach zur Goldgrube!« Während ich die letzten Worte sage, fahre ich mit den Fingern der einen Hand über die Handfläche der anderen, als würde ich Geldscheine verteilen. Ich hatte Quint erzählt, wie ich den Vortrag beenden will. Er sollte den Spruch mit mir zusammen sagen, aber natürlich tut er es nicht. Er macht noch nicht mal die Geste mit den Geldscheinen mit. »Danke fürs Zuhören.«
Der Kurs fängt an zu klatschen, doch da macht Quint einen Schritt vor und hält eine Hand hoch. »Wenn ich noch eine Sache ergänzen darf?«
Ich gebe klein bei. »Wenn es sein muss.«
Er grinst mich an, dann dreht er mir den Rücken zu. »Nachhaltigkeit und Tourismus funktionieren eigentlich nicht zusammen. Flugverkehr bedeutet Luftverschmutzung, und die Menschen produzieren auf Reisen viel mehr Müll, als wenn sie zu Hause bleiben würden. Dennoch ist Tourismus natürlich gut für die regionale Wirtschaft. Wir wollen, dass Fortuna Beach dafür bekannt wird, sich gut um seine Besucher zu kümmern, aber vor allem um seine Tierwelt.«
Ich seufze. Habe ich das im Grunde nicht gerade schon gesagt?
»In dem Bericht vor euch«, fährt Quint fort, »den ihr garantiert nicht lesen werdet, aber Mr Chavez bestimmt, wird eine unserer Hauptinitiativen erläutert: die Fortuna Beach Meerestier-Rettungsstation für Meerestiere zur Top-Touristenattraktion zu machen.«
Es kostet mich enorme Willenskraft, nicht die Augen zu verdrehen. Er redet schon das ganze Jahr über seine Idee mit der Rettungsstation. Aber wer will schon den Urlaub damit verbringen, unterernährte Delfine in traurigen kleinen Becken anzugucken, wenn es die Alternative gibt, mit echten Delfinen draußen in der Bucht zu schwimmen?
»Wenn Menschen die Auswirkungen ihrer Handlungen auf die Umwelt begreifen sollen, müssen sie die Folgen dieser Handlungen sehen, weswegen wir …« Er macht eine Pause. »Weswegen ich glaube, dass jegliche Pläne zum Ökotourismus sich auf Bildung und Freiwilligenarbeit konzentrieren müssen. Der Bericht erklärt das detaillierter. Vielen Dank.«
Er dreht sich zu mir. Wir werfen uns gegenseitig verachtungsvolle Blicke zu.
Aber … das war’s. Es ist vorbei. Dieses schreckliche, nervtötende Projekt ist endlich zu Ende.
Ich bin frei.
»Danke, Quint, danke, Prudence.« Mr Chavez blättert durch Quints Bericht, und ich frage mich, ob Quint darin irgendetwas von meinen Ideen aufgenommen hat. Das Resort, die E-Bikes, die Strandpartys? »Ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, aber nur um sicherzugehen: Könntet ihr mir noch einmal sagen, was ihr jeweils zu diesem Projekt beigetragen habt?«
»Ich hab das Modell gebaut«, sage ich, »und die Schautafel erstellt und die umweltfreundlichen Merchandise-Artikel designt und bestellt. Ich würde auch sagen, dass ich die ganze Zeit über die Projektmanagerin war.«
Quint schnaubt.
Mr Chavez hebt eine Augenbraue. »Bist du anderer Meinung, Quint?«
»Oh nein«, sagt er und schüttelt vehement den Kopf. »Sie hat eindeutig alles gemanagt. Sie hat sooooo viel gemanagt.«
Ich ziehe die Augenbrauen zusammen und spüre den Konter schon auf der Zunge. Eine musste es ja machen! Es war ja nicht so, dass du irgendwas unternommen hättest! Aber bevor ich damit rausplatze, fragt Mr Chavez: »Und du hast den Bericht geschrieben?«
»Ja, Sir«, sagt Quint. »Und ihn mit den Fotos versehen.«
Unser Lehrer macht ein Geräusch, als wäre das eine interessante Information, aber ich verziehe verächtlich die Lippen. Er hat den Bericht mit Fotos versehen? Entschuldigung, aber jeder Zweitklässler kann Fotos aus der National Geographic ausschneiden und auf eine Pappe kleben.
»Wunderbar. Danke euch beiden.«
Wir nehmen beide einen anderen Weg, um zu unserem Tisch zu kommen, aber Mr Chavez hält mich auf.
»Prudence? Vielleicht solltest du den Zeigestock besser vorn lassen, oder? Es wäre mir nicht so lieb, wenn Quint so kurz vorm Schuljahresende noch aufgespießt würde.«
Der Kurs lacht. Ich versuche, mir meine Verlegenheit nicht anmerken zu lassen, während ich zurückgehe und den Stock auf die Ablagefläche der Tafel lege. Da meine Hände jetzt frei sind, nehme ich das Modell mit und trage es zu unserem Tisch.
Quint hält sich eine Hand vor den Mund und beobachtet mich. Oder er betrachtet das Modell. Ich wünschte, ich wüsste, was in ihm vorgeht. Ich wünschte, ich könnte so etwas wie Schuldgefühle an ihm ausmachen. Dass ihm bewusst ist, bei diesem Teil des Projekts kein bisschen geholfen zu haben. Oder dass er sich zumindest schämt, an diesem wichtigsten Tag des Jahres zu spät gekommen zu sein und mich allein gelassen zu haben.
Ich würde es so genießen, wenn er verlegen feststellen würde, dass mein Teil des Projekts seinen absolut in den Schatten stellt. Oder er irgendwie anerkennen würde, dass ich unsere sogenannte Partnerschaft das ganze Jahr über ertragen habe.
Ich stelle das Modell ab und setze mich. Unsere Stühle sind so weit wie möglich ans jeweilige Ende des Tisches geschoben. Mein rechter Oberschenkel hat seit Monaten blaue Flecken, weil ich damit ständig gegen das Tischbein stoße.
Quint hebt den Blick vom Modell. »Ich dachte, wir hätten uns gegen die Bootstouren nach Adelai entschieden, weil sie die See-Elefanten-Population stören würden.«
Ich sehe nach vorn zu Mr Chavez. »Wenn du willst, dass die Leute sich für die See-Elefanten interessieren, musst du ihnen welche zeigen. Und zwar keine halb toten, die auf einer medizinischen Liege mit der Flasche gefüttert werden.«
Er öffnet den Mund. Ich merke, wie er innerlich kocht, und bereite mich darauf vor, seinen nächsten bescheuerten Kommentar zu kontern. Auch in mir steigt wieder die Wut auf. Ich würde am liebsten schreien. Warum konntest du nicht pünktlich sein? Nur. Dieses. Eine. Mal?
Aber Quint schließt den Mund wieder und schüttelt nur den Kopf, also halte auch ich meine Wut zurück.
Wir verfallen in Schweigen, das Modell zwischen uns. Obwohl eins der Handouts in Reichweite von mir liegt, weigere ich mich, es zu nehmen. Aber ich sehe das Deckblatt. Zumindest hat er den Titel beibehalten, auf den wir uns geeinigt haben: »Naturschutz durch Ökotourismus in Fortuna Beach«, ein Bericht von Prudence Barnett und Quint Erickson. Meeresbiologie, Mr Chavez. Unter unseren Namen ist ein herzzerreißendes Foto von einem Meerestier, vielleicht einem Otter oder Seelöwen oder einer Robbe, ich konnte die noch nie auseinanderhalten. Das Tier ist wie eine Mumie in eine Angelschnur gewickelt, es hat sich total verheddert und an Hals und Flossen tiefe Schnittwunden. Die schwarzen Augen blicken mit dem traurigsten Ausdruck, den ich je gesehen habe, direkt in die Kamera.
Ich schlucke. Das Foto schafft es auf jeden Fall, Emotionen auszulösen, das muss ich ihm zugestehen.
»Du hast meinen Namen zuerst genannt«, sage ich. Keine Ahnung, warum ich es sage. Bei dem meisten, was ich in Quints Gegenwart von mir gebe, habe ich keine Ahnung, warum ich es sage. Er hat irgendwas an sich, was es mir körperlich unmöglich macht, den Mund zu halten.
»Ob du’s glaubst oder nicht, aber ich weiß, wie man Dinge in alphabetische Reihenfolge bringt«, murmelt er. »Ich hab schließlich die Vorschule besucht.«
»Kaum zu glauben«, gebe ich zurück.
Er seufzt.
Mr Chavez ist mit seinen Notizen auf dem Klemmbrett fertig und lächelt in die Runde. »Danke euch allen für die vielen fantastischen Präsentationen. Ich bin wirklich beeindruckt von eurer harten Arbeit und Kreativität in diesem Jahr. Morgen gibt es dann die Noten. Und jetzt hätte ich gern noch eure Abschlussberichte.«
Die anderen fangen an, in ihren Rucksäcken zu kramen. Papier raschelt und Stühle schrammen über den Boden. Ich sehe Quint erwartungsvoll an.
Verwirrt erwidert er meinen Blick.
Ich hebe eine Augenbraue.
Da reißt er die Augen auf. »Oh!« Er zieht seinen Rucksack zu sich und fängt an, das Chaos darin zu durchwühlen. »Mist. Den hab ich komplett vergessen.«
Ich glaub’s nicht.
»Du hast vergessen, ihn mitzubringen?«, frage ich. »Oder ihn zu schreiben?«
Er verzieht das Gesicht. »Beides?«
Ich verdrehe die Augen und er hebt die Hand, seine kurze Verlegenheit verfliegt bereits wieder. »Du musst es nicht sagen.«
»Was sagen?«, frage ich, obwohl mir ein ganzer Schwall an Wörtern wie inkompetent und faul und hoffnungslos durch den Kopf geht.
»Ich rede mit Mr Chavez«, sagt er. »Ich sage ihm, dass es meine Schuld ist und ich ihm den Bericht heute Abend mailen kann …«
»Nicht nötig.« Ich öffne meine Biologie-Mappe, wo der Abschlussbericht obenauf liegt, sauber getippt und mit einem Bonus-Tortendiagramm zu Umwelttoxikologie. Ich beuge mich über den Tisch und reiche den Bericht nach vorn.
Als ich mich wieder zurücklehne, wirkt Quint … wütend?
»Was ist?«, frage ich.
Er deutet auf den Bericht, der inzwischen im Stapel der anderen verschwunden ist. »Du hast mir also nicht vertraut, dass ich ihn schreibe?«
Ich drehe mich zu ihm. »Und das wohl nicht ohne Grund.«
»Sind wir nicht ein Team? Vielleicht hättest du, statt den Bericht selbst zu schreiben, mich daran erinnern können. Ich hätte es gemacht.«
»Es ist nicht mein Job, dich daran zu erinnern, deine Hausaufgaben zu machen. Oder pünktlich zum Unterricht zu erscheinen.«
»Ich war …«
Verzweifelt raufe ich mir die Haare. »Was auch immer. Es ist egal. Ich bin nur froh, dass diese Partnerschaft endlich zu Ende ist.«
Er schnaubt, und obwohl ich glaube, dass er da ausnahmsweise mal meiner Meinung ist, werde ich vor lauter Wut knallrot. Die Verantwortung für unsere Teamarbeit hat das ganze Jahr durch hauptsächlich auf meinen Schultern gelegen. Ich habe sehr viel mehr als meinen Anteil geleistet. Meiner Meinung nach bin ich das Beste, was ihm passieren konnte.
Mr Chavez nimmt die letzten Abschlussberichte entgegen. »So, ich weiß zwar, morgen ist der letzte Tag der zehnten Klasse und ihr freut euch alle auf die Ferien, aber heute ist immer noch ein Schultag. Hier sind also eure Hausaufgaben.« Der ganze Kurs fängt einstimmig an zu stöhnen, während Mr Chavez die Kappe von einem grünen Marker zieht und beginnt, auf das Whiteboard zu schreiben. »Ich weiß, ich weiß. Aber denkt doch mal nach. Das hier könnte die letzte Gelegenheit sein, an meiner überragenden Weisheit teilzuhaben. Gebt mir einen Moment, ja?«
Ich nehme einen Stift und fange an, die Hausaufgaben abzuschreiben.
Quint nicht.
Als es klingelt, ist er der Erste, der zur Tür raus ist.
3
Ich hab gar nichts gegen Hausaufgaben, so im Allgemeinen«, sagt Jude, während er träge durch sein Meeresbiologie-Buch blättert. »Aber Hausaufgaben am letzten Schultag? Daran erkennt man einen Tyrannen.«
»Ach, hör auf zu jammern«, sagt Ari hinter ihrer Speisekarte. Sie studiert jedes Mal Ewigkeiten die Karte, obwohl wir immer dasselbe bestellen. »Wenigstens habt ihr richtige Sommerferien. Wir haben endlose Leselisten und Aufgaben bekommen, damit wir über die Ferien ›beschäftigt‹ sind. Juli ist der Monat der griechischen Mythologie. Hurra.«
Jude und ich sehen sie bestürzt an. Wir sitzen zu dritt in einer Nische im Encanto, unserem Lieblingsdiner. Eigentlich ist es eine Touristenfalle in der Nähe der Main Street – durch die Fenster am Eingang ist sogar ein Hauch von Strand zu sehen –, aber voll ist es nur an den Wochenenden, was das Encanto zum idealen Treffpunkt nach der Schule macht. Weil der Mix aus mexikanischem und puerto-ricanischem Essen unfassbar gut ist. Und weil Carlos, der Besitzer, uns Gratis-Getränke und so viel Tortilla-Chips und Salsa gibt, wie wir essen können, ohne sich jemals zu beschweren, dass wir seine Tische zu lange blockieren. Ich glaube ehrlich gesagt, er mag es, wenn wir da sind, auch wenn wir immer nur zwischen drei und sechs Uhr Essen bestellen, um das Vorspeisen-Special zum halben Preis zu bekommen.
»Was ist?«, fragt Ari, als sie merkt, wie Jude und ich sie ansehen.
»Ich würde tausendmal lieber was über griechische Mythologie als über Plankton lernen«, sagt Jude mit Blick auf die Abbildung in seinem Buch.
Ari schnaubt auf die ihr eigene Ihr-kapiert-es-halt-nicht-Art. Was wir zugegebenermaßen auch nicht tun. Seit wir uns vor vier Jahren kennengelernt haben, streiten wir ständig darüber, was schlimmer ist – die angesehene Privatschule St. Agnes zu besuchen oder sich auf unserer Fortuna Beach High durchzuschlagen. Eine typische Auf-der-anderen-Seite-ist-das-Gras-immer-grüner-Situation. Jude und ich sind unendlich neidisch auf die kryptischen Kursthemen, über die sich Ari beschwert. Zum Beispiel »Wie der transkontinentale Gewürzhandel die Geschichte veränderte« oder »Der Einfluss des Heidentums auf die Traditionen moderner Religionen«. Wohingegen Ari sich nach unserer Highschool-Movie-Normalität sehnt, dem schlechten Mensa-Essen und danach, nicht jeden Tag eine Schuluniform tragen zu müssen.
Verständlicherweise.
Doch sie kann nicht abstreiten, dass St. Agnes einen Musikzweig hat, der um einiges besser ist als alles, was sie an einer öffentlichen Schule geboten bekommen würde. Gäbe es an der St. Agnes keine speziellen Kurse zu Musiktheorie und Komposition, hätte Ari ihre Eltern wahrscheinlich längst angefleht, sie wechseln zu lassen.
Jude und ich wenden uns wieder unseren Hausaufgaben zu, während Ari zu zwei Frauen am Nebentisch rübersieht, die sich ein Dessert teilen. Ari hat ihr Notizbuch vor sich und macht ihr Ich-suche-nach-dem-perfekten-Reim-für-diesen-Songtext-Gesicht. Wahrscheinlich ist es eine Ballade über Kokospudding und die erste Liebe. So ziemlich alle Songs von Ari handeln von der ersten Liebe. Oder von der schrecklichen Angst vor unerwiderter Liebe. Nie von irgendwas dazwischen. Aber das trifft wahrscheinlich auf so ziemlich jeden Song zu.
Ich lese noch mal die Hausaufgaben in der Hoffnung, dass es mich vielleicht zu einer Idee inspiriert. »Zweihundertfünfzig Wörter darüber, welche Art von Unterwasser-Adaption auch in unserem überirdischen Umfeld nützlich wäre.« Keine schwierige Aufgabe. Die sollte ich eigentlich in einer Stunde schaffen. Doch nachdem ich die letzten Abende mit dem Endspurt des Ökotourismus-Projekts verbracht habe, fühlt sich mein Gehirn an wie durch den Fleischwolf gedreht.
»Ich hab’s! Riesenhaie!«, sagt Jude und tippt mit dem Finger auf ein Bild in seinem Biologie-Buch. Es zeigt einen absolut schrecklichen Hai, dessen gigantisches Maul weit aufgerissen ist. Scharfe Zähne hat er keine, aber dafür einen riesigen Schlund, in dem sein Skelett oder Brustkorb oder was auch immer zu sehen ist, etwas, das weit in seinen Körper hineinreicht. Es erinnert mich an die Szene, als Pinocchio von einem Wal verschluckt wird. »Riesenhaie schwimmen durchs Wasser und schlucken alles, was ihnen unterkommt.«
»Und inwiefern soll das nützlich sein?«, frage ich.
»Das ist absolut effektiv. Sämtliche Nahrung, an der ich vorbeikomme, würde einfach in meinem Schlund landen. Ich müsste nie kauen.« Er setzt eine nachdenkliche Miene auf. »Das würde eigentlich ein ziemlich tolles Monster abgeben.«
»Das würde ein ziemlich ekliges Monster abgeben«, sage ich.
Er zuckt die Achseln und notiert was in seinem Skizzenbuch, das er immer dabeihat. »Du bist doch diejenige, die von Zeitmanagement besessen ist.«
Womit er recht hat. Ich grunze und blättere zum sechsten Mal durch mein Bio-Buch, während Jude unseren gemeinsamen Laptop zu sich rüberzieht. Statt ein neues Dokument zu öffnen, löscht er einfach meinen Namen obendrüber und ersetzt ihn durch seinen eigenen, bevor er anfängt zu schreiben.
»So, meine kleinen Arbeitsbienen«, sagt Carlos, als er mit einem Korb Tortilla-Chips, Guacamole und zwei Sorten Salsa an unseren Tisch kommt – süße Salsa auf Guavenbasis für Jude und mich und eine extra scharfe, pseudo-masochistische Warum-sollte-sich-das-irgendwer-antun-Salsa für Ari. »Ist die Schule noch nicht vorbei?«
»Morgen ist der letzte Tag für uns«, sagte Jude. »Ari hat seit letzter Woche schon frei.«
»Heißt das, ich bekomme euch jetzt öfter zu sehen oder seltener?«
»Öfter«, antwortet Ari und strahlt ihn an. »Wir werden hier den Sommer über praktisch wohnen, wenn das okay ist.« Ari ist in Carlos verknallt, seit wir ins Encanto gehen. Was ein bisschen seltsam erscheinen mag, wo er bestimmt fast vierzig ist. Aber er sieht sehr nach dem jungen Antonio Banderas aus, dazu kommt noch der puerto-ricanische Akzent – und der Mann kann kochen. Da ist es schon verständlich, dass sie ganz hin und weg von ihm ist.
»Ihr drei seid immer willkommen«, sagt er. »Aber nutzt das kostenlose Nachfüllen nicht zu sehr aus, ja?«
Wir danken ihm für die Chips, während er schon zum nächsten Tisch weitergeht.
Jude lehnt sich zurück und klatscht sich imaginären Staub von den Händen. »Fertig.«
Ich blicke von dem Foto eines Seeteufels auf. »Was? Jetzt schon?«
»Es sind nur zweihundertfünfzig Wörter. Und diese Hausaufgabe zählt nicht mehr. Vertrau mir, Pru, der Tyrann will damit nur unsere Loyalität austesten. Mach dir nicht so einen Kopf deswegen.«
Ich verziehe das Gesicht. Er weiß genauso gut wie ich, dass es mir unmöglich ist, mir keinen Kopf zu machen.
»Der wäre doch gut«, sagt Ari und deutet mit ihrem Tortilla-Chip auf mein Buch. Ein Tropfen Salsa landet auf der Seite. »Ups, sorry.«
Ich wische den Fleck mit meiner Serviette weg. »Ich will kein Seeteufel sein.«
»Die Aufgabe lautet ja auch nicht, wer du sein willst«, sagt Jude, »sondern was für eine Unterwasser-Adaption nützlich wäre.«
»Du hättest eine eingebaute Taschenlampe«, sagt Ari. »Das wäre doch praktisch.«
Ich summe nachdenklich. Die Idee ist gar nicht so schlecht. Ich könnte irgendwas von wegen ein Licht in dunklen Zeiten und so in den Text einbauen, was für Bio vielleicht ein bisschen zu poetisch ist, aber trotzdem. »Okay, gut«, sage ich, ziehe den Laptop zu mir und speichere Judes Dokument, bevor ich ein neues öffne.
Ich habe gerade den ersten Absatz fertig, als es vorn im Restaurant poltert. Ich drehe mich um und sehe eine Frau mit einem Handkarren, auf dem sich Lautsprecher, Elektrogeräte, ein kleiner Fernseher, ein Stapel dicker Ringmappen und Bündel von Kabeln türmen.
»Du hast es geschafft!«, ruft Carlos hinter der Bar so laut, dass auf einmal alle Gäste die Frau ansehen. Sie bleibt stehen und blinzelt, während ihre Augen sich an das dämmrige Licht gewöhnen. Carlos eilt zu ihr und nimmt ihr den Handkarren ab. »Lass mich das machen. Ich dachte, wir stellen die Sachen direkt hier auf.«
»Oh, danke«, sagt sie und streicht sich den liebesapfelrot gefärbten langen Pony zurück, der fast ihre Augen bedeckt. Den Rest der Haare hat sie zu einem hastigen Knoten gebunden, und an den Wurzeln wächst ihr natürliches Blond nach. Sie trägt auffällige Klamotten: abgewetzte, ausgeblichene Cowboystiefel, dunkle Jeans mit ebenso vielen Löchern wie Stoff, ein dunkelrotes Tanktop aus Samt und genug Schmuck, um ein kleines Schiff zu versenken. Ganz anders als die Flip-Flops und Surfshorts, die sonst um diese Jahreszeit die Main Street bevölkern.
Außerdem ist sie ziemlich schön. Umwerfend schön sogar. Aber es ist schwer zu erkennen bei der Menge an schwarzem Eyeliner und lila Lippenstift. Wenn sie aus der Gegend wäre, hätten wir sie bestimmt schon mal bemerkt, aber ich bin mir sicher, sie noch nie vorher gesehen zu haben.
»Wie ist das?«, fragt Carlos und ignoriert die Tatsache, dass ein Großteil der Gäste die beiden immer noch anglotzt.
»Perfekt. Wunderbar«, sagt die Frau mit leicht südlichem Akzent. Carlos hat an den Wochenenden oft Livemusik, und die beiden stehen jetzt auf der kleinen Bühne, wo die Bands immer spielen. Sie sieht sich in Ruhe um und zeigt auf die Wand. »Ist das die einzige Steckdose?«
»Hier ist noch eine.« Carlos zieht einen Geschirrwagen aus der Ecke.
»Ausgezeichnet.« Die Frau dreht sich im Kreis und betrachtet die überall im Restaurant hängenden Fernseher, auf denen fast immer Sport läuft. »Super. Das funktioniert. Schön ist es hier.«
»Danke. Brauchst du Hilfe beim Aufbauen, oder …«
»Nee, ich mach das schon. Ist nicht das erste Mal.« Sie scheucht ihn weg.
»Gut, okay.« Carlos macht einen Schritt zurück. »Kann ich dir was zu trinken bringen?«
»Oh. Äh …« Sie denkt kurz darüber nach. »Einen Shirley Temple?«
Carlos lacht. »Klar.«
Er geht zurück zur Bar, und die Frau fängt an, Tische zu verschieben und die mitgebrachten Geräte aufzubauen. Nach ein paar Minuten steuert sie mit dem Stapel Ringmappen den nächsten Tisch an. Unseren Tisch.
»Na, wenn ihr mal nicht die fleißige Fortuna-Beach-Jugend seid«, sagt sie mit einem Blick auf unsere Schulbücher und Laptops.
»Was wird denn das?«, fragt Ari und nickt in Richtung der Geräte.
»Der wöchentlichen Karaoke-Abend!«, sagt die Frau. »Na ja, das heute ist der erste, aber wir hoffen, dass es ein wöchentliches Event wird.«
Karaoke? Sofort habe ich Bilder von alten Leuten mit schmachtender Stimme, kreischenden Frauen mittleren Alters und einer ganzen Menge Betrunkener vor Augen, die keinen Ton treffen, und … oh nein. So viel also zu unseren ruhigen Lernsessions. Zum Glück ist das Schuljahr so gut wie vorbei.
»Ich bin Trish Roxby und heute Abend eure Gastgeberin«, fährt sie fort. Als sie unsere wenig begeisterten Mienen sieht, deutet sie über die Schulter zur Bar. »Habt ihr die Ankündigung nicht gesehen? Carlos macht schon seit ein paar Wochen Werbung.«
Ich sehe zur Bar. Es dauert einen Moment, aber dann bemerke ich es. Auf der Tafel neben der Tür steht über den Specials des Tages in krakeliger Handschrift:
KOMMTVORBEIZUMKARAOKE, DIENSTAGS 18:00, ABJUNI
»Und, seid ihr heute Abend dabei?«, fragt Trish.
»Nein«, sagen Jude und ich gleichzeitig.
Ari beißt sich auf die Unterlippe und beäugt die Ringmappe.
Trish lacht. »Es ist gar nicht so schrecklich, wie es klingt. Versprochen, es kann ziemlich viel Spaß machen. Außerdem stehen Mädchen darauf, ein Ständchen gesungen zu bekommen!«
Als Jude klar wird, dass sie mit ihm redet, fängt er an, sich zu winden. »Äh. Das ist meine Zwillingsschwester.« Er neigt den Kopf in meine Richtung, dann deutet er auf Ari. »Und wir sind nicht …« Er bringt den Satz nicht zu Ende.
»Echt? Ihr seid Zwillinge?«, fragt Trish und ignoriert, was auch immer Jude und Ari nicht sind. Sie sieht abwechselnd Jude und mich an, und dann nickt sie langsam. »Ja, klar. Jetzt seh ich’s.«
Sie lügt. Uns glaubt nie irgendwer, dass wir verwandt sind, geschweige denn Zwillinge. Wir sehen uns überhaupt nicht ähnlich. Er ist eins achtzig groß und dünn wie unser Dad. Ich bin eins fünfundsechzig und rundlich wie Mom. (Unsere Oma macht gern Witze darüber, dass ich im Mutterleib Jude seinen ganzen Babyspeck weggenommen und für mich selbst behalten hätte. Ich fand den Witz als Kind schon nicht besonders lustig, und im Lauf der Jahre ist er nicht besser geworden. Hier Augen verdrehendes Emoji vorstellen.)
Jude ist blond und extrem blass, wie ein Vampir. Er bekommt innerhalb von dreißig Sekunden einen Sonnenbrand, was nicht gerade ideal ist, wenn du in Südkalifornien lebst. Ich dagegen bin brünett und Ende Juni schon halbwegs braun. Jude hat Wangenknochen. Ich habe Grübchen. Jude hat volle Lippen, die ihn ein bisschen aussehen lassen wie ein Abercrombie-Model, auch wenn er es hasst, wenn ich das sage. Und ich? Na ja, ich habe meinen Lippenstift.
Trish räuspert sich betreten. »Okay, habt ihr schon mal Karaoke gesungen?«
»Nein«, antwortet Ari. »Aber ich hab schon mal darüber nachgedacht.«
Jude und ich wechseln einen Blick, denn wir haben tatsächlich schon mal Karaoke gesungen. Sogar oft. Als wir klein waren, haben unsere Eltern uns immer in ein Restaurant mitgenommen, wo es jeden ersten Sonntag im Monat Familien-Karaoke gab. Wir schmetterten einen Beatles-Song nach dem anderen, und mein Dad beendete »sein Set«, wie er es nannte, jedes Mal mit Dear Prudence, und dann rief er uns alle auf die Bühne für Hey Jude. Am Ende sang das ganze Restaurant – Naaaa na na … nananana! Sogar Penny stimmte mit ein, auch wenn sie erst zwei oder drei war und wahrscheinlich keine Ahnung hatte, was vor sich ging. Es war magisch.
Meine nostalgische Seite erwacht zum Leben, als ich an Dads leicht schiefe Version von Penny Lane denke oder an Moms überzogene Versuche von Hey Bulldog.
Aber dann, ich kann nicht älter als zehn oder elf gewesen sein, kam das eine Mal, als irgendein Betrunkener im Publikum rief: Vielleicht sollte das Kind weniger singen und mehr Sit-ups machen!
Wir wussten alle, wen er meinte. Und, tja, die Magie des Moments war danach so ziemlich verflogen.
Wo ich so darüber nachdenke, war das vielleicht auch der Beginn meiner Redeangst und der ständigen Angst, dass alle mich ansehen, kritisieren und nur darauf warten, dass ich mich blamiere.
»Denkt mal drüber nach«, sagt Trish und legt die Mappe neben den Tortilla-Chips ab. Sie nimmt einen Stift und ein paar Zettel aus der Tasche und legt sie dazu. »Wenn ihr einen Song findet, schreibt ihn einfach auf und gebt mir den Zettel, ja? Und wenn der Song, den ihr singen wollt, nicht dabei ist, sagt Bescheid. Vielleicht finde ich ihn online.« Sie zwinkert uns zu, dann geht sie zum nächsten Tisch.
Wir sehen die Mappe an, als wäre sie eine giftige Schlange.
»Ganz bestimmt«, murmelt Jude und fängt an, seine Sachen einzupacken. »Nicht.«
Mir geht es genauso. Noch nicht mal für Geld würde ich vor einem Haufen wildfremder Leute auf die Bühne steigen und singen. Oder auch nicht ganz so fremder Leute. Fortuna Beach ist nicht gerade groß, und es ist unmöglich, irgendwo hinzugehen, ohne irgendwen entfernt Bekanntes zu treffen. Als ich mich umblicke, sehe ich die Friseurin meiner Mutter an der Bar und an einem der kleinen Tische die Leiterin des Supermarkts an der Ecke.
Ari dagegen starrt immer noch auf die Mappe. Ihr Blick ist voller Sehnsucht.
Ich habe Ari schon singen hören. Sie singt gar nicht schlecht. Zumindest trifft sie die Töne. Und außerdem will sie Songwriterin werden. Davon träumt sie schon seit ihrer Kindheit. Und wenn sie irgendeine Form von Erfolg haben will, muss sie wohl auch mal singen.
»Mach es«, sage ich und schiebe ihr die Mappe zu.
Sie verzieht das Gesicht. »Ich weiß nicht. Was soll ich denn singen?«
»Irgendeinen Song aus den letzten hundert Jahren?«, sagt Jude.
Sie wirft ihm einen finsteren Blick zu, auch wenn sein Kommentar ihr offensichtlich schmeichelt. Ari liebt Musik. Von Jazz aus den 30ern über Achtzigerjahre-Punk bis zu modernem Indie kennt sie alles. Sie ist ein wandelndes Wikipedia der Musik. Tatsächlich wären wir uns ohne ihre Besessenheit wahrscheinlich nie begegnet. Meine Eltern haben einen Plattenladen einen Block von der Main Street entfernt, Ventures Vinyl, benannt nach der beliebten Surf-Rock-Band aus den Sechzigern. Ari fing an, dort einzukaufen, als wir in der Mittelstufe waren. Sie bekam viel mehr Taschengeld als ich, und jeden Monat brachte sie uns ihr Gespartes und kaufte davon Platten.
Meine Eltern vergöttern Ari und scherzen immer, sie wäre ihr sechstes Kind. Sie sagen, Ari allein habe sie in den letzten Jahren vor der Pleite bewahrt – eine charmante Behauptung, wenn es nicht viel zu nah an der Wahrheit wäre.
»Wir könnten ja ein Duett singen?«, sagt Ari und sieht mich hoffnungsvoll an.
Ich unterdrücke mein instinktives, leidenschaftliches Nein und deute hoffnungslos auf mein Schulbuch. »Tut mir leid, aber ich muss immer noch diese Hausaufgaben machen.«
Sie runzelt die Stirn. »Jude hat seine in zehn Minuten fertig gehabt. Komm schon. Vielleicht einen Beatles-Song?« Ich weiß nicht, ob sie es vorschlägt, weil sie weiß, wie sehr ich die Beatles liebe, oder weil es die einzige Band ist, bei der ich sicher die Texte kann. Da meine Geschwister und ich halb im Plattenladen aufgewachsen sind, wurden wir über die Jahre mit einer ziemlichen Bandbreite von musikalischem Wissen eingedeckt, doch in den Augen meiner Eltern kann keine Band der Welt es je mit den Beatles aufnehmen. Sie haben sogar jedes ihrer fünf Kinder nach einem Beatles-Song benannt – Hey Jude, Dear Prudence, Lucy in the Sky with Diamonds, Penny Lane und Eleanor Rigby.
Als ich merke, dass Ari immer noch auf meine Antwort wartet, seufze ich. »Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich muss das hier erst zu Ende bringen.« Während sie weiter durchs Songbook blättert, versuche ich, mich wieder auf die Hausaufgaben zu konzentrieren.
»Ein Shirley Temple klingt eigentlich ziemlich gut«, sagt Jude. »Will noch wer einen?«
»Ich will deine Kirsche!«, ruft Ari ihm hinterher.
»Hey, das ist mein Bruder, den du da angräbst.«
Jude bleibt stehen und sieht erst mich an und dann Ari, bevor er knallrot anläuft.
Ari und ich brechen in Lachen aus. Jude schüttelt den Kopf und geht zur Bar. Ich lege mir die Hände an den Mund und rufe ihm hinterher: »Ja, bring uns auch einen mit!«
Er winkt, ohne sich umzusehen.
Ich bin erst einen Absatz weiter, als Jude mit drei großen Gläsern voll roter, sprudelnder Limo und extravielen Cocktailkirschen in jedem wiederkommt. Ohne zu fragen angelt Ari mit einem Löffel sowohl meine als auch Judes Kirschen heraus und wirft sie in ihr eigenes Glas.
»Hallo zusammen, und willkommen zu unserem allerersten Karaoke-Abend!«, sagt Carlos in Trishs Mikrofon. »Ich bin Carlos und ich schmeiße hier den Laden. Ich freue mich, dass alle sich so gut unterhalten, und hoffe, ihr amüsiert euch heute Abend. Keine Scheu. Wir sind hier alle supernett, also kommt auf die Bühne und gebt euer Bestes! Und damit möchte ich euch unsere Karaoke-Gastgeberin Trish Roxby vorstellen.«
Es gibt schwachen Applaus, als Trish Carlos das Mikro abnimmt und er sich in die Küche zurückziehen will.
»Hey, hey, hey, willst du etwa nicht singen?«, fragt Trish.
Carlos dreht sich mit vor Entsetzen aufgerissenen Augen um. Er lacht leise. »Vielleicht nächste Woche?«
»Ich werde dich daran erinnern«, sagt Trish.
»Ich sagte vielleicht«, erklärt Carlos und verschwindet.
Trish grinst in die Runde. »Hallo, Leute, ich freue mich so, heute Abend hier zu sein. Ich weiß, niemand ist gern die oder der Erste, also werde ich anfangen. Aber bitte bringt eure Zettel hoch und lasst mich wissen, was ihr heute Abend singen wollt, sonst müsst ihr die nächsten drei Stunden allein mir zuhören.«
Sie gibt etwas in ihren Rechner ein, und dann dröhnt ein Gitarrenriff aus den Lautsprechern – Joan Jetts I Love Rock and Roll.
Ich unterdrücke ein Stöhnen. Mal im Ernst. Wie soll ich mich auf meine Hausaufgaben konzentrieren, wenn das im Hintergrund läuft? Wir sind hier in einem Restaurant, nicht auf einem Rockkonzert.
»Ähm, okay, damit habe ich nicht gerechnet«, sagt Jude.
»Ich auch nicht«, sagt Ari und nickt anerkennend. »Sie ist echt gut.«
»Das meine ich nicht«, sagt Jude und stößt mich mit dem Ellbogen an. »Pru, guck mal. Da ist Quint.«
4
Ich reiße den Kopf hoch. Das muss ein Scherz sein. Aber nein – da ist er. Neben dem Schild FREIEPLATZWAHL direkt am Eingang steht Quint Erickson. Er ist zusammen mit einem Mädchen da, das ich noch nie gesehen habe – asiatischer Abstammung, zierlich, die Haare zu zwei unordentlichen Knoten hinter den Ohren gedreht. Sie trägt Jeansshorts und ein ausgeblichenes T-Shirt mit einem Bild von Bigfoot und dem Spruch Weltmeister im Verstecken.
Anders als Quint, der zusieht, wie Trish sich die Seele aus dem Leib brüllt, ist das Mädchen ganz von etwas auf ihrem Handy gefesselt.
»Wow«, sagt Ari, beugt sich über den Tisch und senkt die Stimme, obwohl sie bei Trish Roxbys kehliger Forderung, noch eine Münze in die Jukebox zu werfen, Baby, sowieso kaum zu hören ist. »Das ist Quint? Der Quint?«
Ich runzle die Stirn. »Was meinst du mit der Quint?«
»Komm schon. Du hast das ganze Jahr über nichts anderes geredet.«
Ich gebe ein Lachen von mir, schroff und ohne Humor. »Quatsch!«
»Na ja, irgendwie schon«, sagt Jude. »Ich weiß nicht, wer von uns beiden sich mehr auf die Sommerferien freut. Du, weil du dich nicht mehr mit ihm abgeben musst, oder ich, weil ich mir nicht mehr dein Gejammer über ihn anhören muss.«
»Er ist viel süßer, als ich dachte«, sagt Ari.
»Oh ja, er ist ziemlich hot«, sagt Jude. »Alle stehen auf ihn.«
»Nur weil sein Dauergrinsen den kleinsten gemeinsamen Nenner unserer Gesellschaft anspricht.«
Jude schnaubt.
»Außerdem« – ich senke die Stimme – »sieht er gar nicht so gut aus. Diese Augenbrauen.«
»Was hast du gegen seine Augenbrauen?«, fragt Ari und sieht mich an, als sollte ich mich für meine Worte schämen.
»Ich bitte dich. Sie sind riesig«, sage ich. »Außerdem ist sein Kopf komisch geformt. Er hat irgendwie … einen Quadratschädel.«
»Bist du vielleicht ein wenig voreingenommen?«, fragt Ari und wirft mir einen amüsierten Blick zu, der mir unter die Haut geht.
»Ich sag ja nur.«
In dem Punkt werde ich nicht nachgeben. Es stimmt schon, dass Quint nicht gerade unattraktiv ist. Das weiß ich. Alle, die Augen im Kopf haben, wissen das. Aber er hat nichts Besonderes. Er hat langweilige, nichtssagende, durchschnittliche braune Augen, und auch wenn ich mir sicher bin, dass er Wimpern haben muss, sind sie mir noch nie aufgefallen. Mit seiner immerwährenden Sonnenbräune, den kurzen, welligen Haaren und dem beknackten Grinsen sieht er ziemlich genauso aus wie jeder andere Surfer-Boy der Stadt. Das heißt, absolut durchschnittlich.
Ich lege die Finger wieder auf die Tastatur, entschlossen, mich weder von Quint noch von Karaoke oder irgendwas anderem ablenken zu lassen. Das hier ist meine letzte Hausaufgabe in der zehnten Klasse. Ich schaffe das.
»Hey, Quint!«, ruft Jude und reißt die Hand hoch.
Mir klappt die Kinnlade runter. »Du Verräter!«
Jude sieht mich an und zieht eine Grimasse. »Tut mir leid, Schwesterherz. Er hat mich gesehen. Ich hab Panik bekommen.«
Ich atme langsam durch die Nase ein und wage einen Blick zum Eingang. Natürlich kommen Quint und seine Freundin schon auf uns zu. Quint grinst, wie immer. Er ist wie einer dieser blöden Welpen, die es nicht merken, wenn sie von Katzenmenschen umgeben sind. Sie nehmen einfach an, dass alle sich freuen, sie zu sehen, immer.
»Jude, was geht?«, sagt Quint. Sein Blick landet auf mir und dann auf dem Schulbuch und dem Laptop, und sein Lächeln wird angespannt. »Prudence. Wie immer hart am Arbeiten.«
»Von nichts kommt nichts«, sage ich.
Er schnippt mit den Fingern. »Weißt du was, früher hab ich das auch gedacht, aber nachdem ich ein Jahr mit dir zusammengearbeitet habe, zweifle ich langsam daran.«
Ich verenge die Augen zu Schlitzen. »War schön, dich zu treffen.« Mein Sarkasmus ist so dick aufgetragen, dass ich beinah dran ersticke. Ich sehe wieder auf den Bildschirm und brauche einen Moment, um mich daran zu erinnern, worum es bei der Aufgabe ging.
»Quint«, sagt Jude, »das ist unsere Freundin Araceli. Araceli, das ist Quint.«
»Hey«, sagt Quint. Ich sehe zwischen den Wimpern hindurch, wie die beiden sich mit Fistbump begrüßen. Da es von Quint ausgeht, sieht es wie die geschmeidigste, natürlichste Geste der Welt aus, auch wenn ich noch nie gesehen habe, wie Ari irgendwen mit Faustcheck begrüßt. »Freut mich, dich kennenzulernen, Araceli. Cooler Name. Du bist nicht bei uns auf der Schule, oder?«
»Nein, ich geh auf die St. Agnes«, antwortet sie. »Und du kannst mich gern Ari nennen.«
Ich verziehe das Gesicht, aber da ich den Kopf immer noch gesenkt habe, sehen es die anderen nicht.
»Ah, und das ist Morgan. Sie geht aufs Community College in Turtle Cove.« Quint deutet auf das Mädchen, das ein paar Schritte weiter steht und entsetzt auf die Bühne sieht. Als sie ihren Namen hört, dreht sie sich zu uns und lächelt angespannt.
»Schön, euch kennenzulernen«, sagt sie höflich, aber halbherzig.
Es folgt eine Runde unbeholfener Heys und Hallos, aber Morgans Aufmerksamkeit ist schon wieder bei der Bühne, wo ein Typ schmachtend einen Countrysong über kaltes Bier und Brathähnchen singt.
»Morgan hat gesagt, das Essen hier ist super«, sagt Quint. »Sie will unbedingt, dass ich … Wie heißen die Dinger noch mal, die ich probieren soll? Ton… Tol…« Fragend sieht er Morgan an.
»Tostones«, sagt sie und blickt wieder auf ihr Handy. Wütend bearbeitet sie mit den Daumen das Display, und ich habe die Vision von einem fiesen Schlagabtausch zwischen ihr und ihrem Freund.
»Die sind echt gut«, sagt Jude.
Quint deutet auf die Bühne. »Ich hab gar nicht mit musikalischen Darbietungen zum Essen gerechnet.«
»Wir auch nicht«, murmele ich.
»Das Restaurant will mal was Neues ausprobieren.« Ari schiebt die Mappe mit den Songs über den Tisch. »Singst du uns was?«
Quint lacht fast selbstironisch. »Nee. Ich verschone die Leute hier lieber. Täte mir leid, so früh in der Saison die Touris zu verscheuchen.«
»Alle denken, sie können nicht singen«, sagt Ari, »aber nur sehr wenige Leute sind wirklich so schlecht, wie sie glauben.«
Quint legt den Kopf schief und sieht von Ari zu mir. »Moment mal. Ihr seid befreundet?«
»Entschuldigung?«, sage ich. »Was soll denn das heißen?«
Er zuckt die Achseln. »Ich bin nur schon so an deine Kritik gewöhnt, dass es seltsam ist, einen Vertrauensvorschuss zu bekommen.«
»Hey!«, ruft Jude. »Da kommt Carlos! Gerade rechtzeitig, um uns aus dieser peinlichen Situation zu retten.«
Carlos kommt mit einem Tablett leerer Gläser vorbei. »Wollte mal nach meinem Lieblingstisch sehen. Setzt ihr euch dazu? Kann ich euch was zu trinken bringen?«
»Äh …« Quint sieht zu Morgan. »Gern. Was zu trinken wär super. Was trinkt ihr denn?« Er deutet auf unsere roten Getränke.
»Shirley Temple«, sagt Ari.
Quint guckt verwirrt. »Das ist doch eine Schauspielerin, oder?«
Ari wird munter. »Hast du den noch nie getrunken? Ich meine, ja, sie war Schauspielerin, ein Kinderstar. Aber der Drink … Du musst den probieren. Das ist pures Glück im Glas.«
»Diabetes und Würdelosigkeit im Glas«, murmelt Morgan, die immer noch mit ihrem Handy-Rant beschäftigt ist.
Quint sieht sie amüsiert und leicht mitleidig an. Es ärgert mich, dass ich den Blick kenne. Genauso hat er mich fast jeden Tag seit Beginn des Schuljahrs angesehen.
»Du und Prudence müsstet euch eigentlich ziemlich gut verstehen«, kommentiert er.
Verwirrt sieht Morgan auf, und wahrscheinlich fragt sie sich gerade, wer Prudence ist, aber statt zu fragen, sagt sie: »Warum klingt das wie eine Beleidigung?«
Quint schüttelt den Kopf. »Lange Geschichte.« Er nickt Carlos zu. »Wir nehmen zwei Shirley Temple.«
»Nein, danke«, sagt Morgan. »Ich nehme einen Iced Coffee mit Kokosmilch.«
»Alles klar«, sagt Carlos. »Sitzt ihr bei meinen Stammgästen hier?«
Quint beäugt unsere Sitznische. Sie ist groß – wahrscheinlich würden bis zu acht Leute reinpassen, wenn sie es kuschelig haben wollen. Zwei mehr passen locker rein.
Dann landet sein Blick auf mir, und ich funkle ihn so eisig an, dass er auf wundersame Weise den Wink versteht. »Nee, wir wollten eigentlich …« Er dreht sich um. Das Restaurant füllt sich schnell, aber direkt neben der Bühne ist gerade ein kleiner Tisch mit einem halb vollen Korb Tortilla-Chips und zusammengeknüllten Servietten darauf frei geworden. »Ist der Tisch frei?«
»Klar. Ich lasse ihn für euch abräumen.« Carlos deutet auf das Songbook. »Und keine falsche Zurückhaltung. Wir brauchen mehr Leute, die singen. Bringt Zettel mit euren Songs auf die Bühne. Ich zähle auf dich, Pru.«
Quint schnaubt mit einer Mischung aus Ungläubigkeit und Belustigung. Mir stellen sich die Nackenhaare auf. »Lustig«, sagt er, als Carlos zur Bar geht.
»Was ist lustig?«, frage ich.
»Die Vorstellung, dass du Karaoke singen könntest.«
»Ich kann singen«, sage ich abwehrend, bevor ich hinzufüge: »Einigermaßen.«
»Das glaube ich gern«, sagt Quint lächelnd – denn wann lächelt er mal nicht? »Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass du dich je genug locker machst, um es auch zu tun.«
Mich locker machen.
Quint weiß es nicht – oder vielleicht auch doch –, aber er hat den Finger gerade auf eine sehr wunde Stelle gelegt. Vielleicht liegt es daran, dass ich Perfektionistin bin. Vielleicht daran, dass ich mich an die Regeln halte, eine Streberin bin und eher eine Lerngruppe einberufen als auf eine Saufparty gehen würde. Vielleicht liegt es daran, dass meine Eltern mir den unglückseligen Namen Prudence – Vorsicht – gegeben haben.