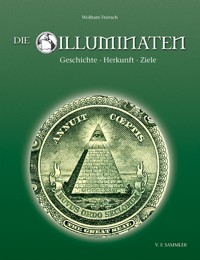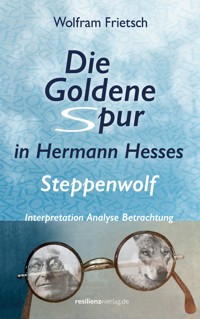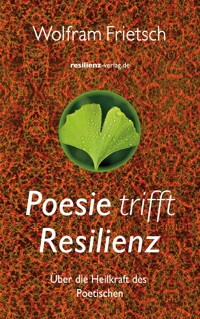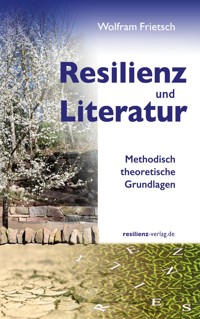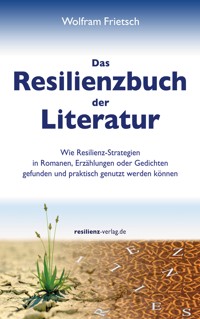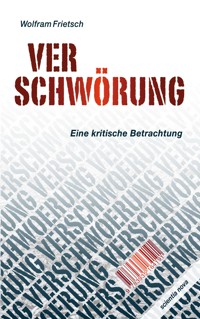Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die phänomenologische Forschung vermag mitunter eine eigenartige Sphäre zu berühren, die weit entfernt von der liegt, die sich Phänomenologie zu erforschen vorgenommen hat. In dieser Untersuchung geht es um einen philosophischen Zugang des Problemfeldes Intersubjektivität und Macht hin auf ein vergessenes bzw. unterdrücktes Diskursfeld: die Magie. In dieser Untersuchung geht es darum, ein solches Epiphänomen des menschlichen Geistes, wie es Magie darstellt, objektiv betrachten zu können. Dabei erwies sich die Phänomenologie als guter und zielführender Ansatz, um vorurteilsfrei über das forschen zu können, was "es gibt". Denn um ein Wort Shakespeares leicht zu modifizieren: "Es gibt mehr Ding im Himmel und auf Erden, als unsere Schulweisheit sich träumt." Im Umkreis der Phänomenologie von Edmund Husserl und besonders seiner Schrift "Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie" kann gezeigt werden, dass die Phänomenologie ein kongeniales philosophisches und wissenschaftliches Erklärungsmodell bereithält, um aufzuzeigen, wie ein magischer Diskurs arbeitet und wirken kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die zweite Auflage erfolgt inhaltlich unverändert, versehen mit einem Nachwort zur Neuausgabe.
Für H. S. K.
Inhaltsverzeichnis
Vorüberlegung
Phänomenologie ist Bewusstseinsphilosophie: Kleingeld wechseln
2.1. Phänomenologie ist Bewusstseinsphilosophie
2.2. Intentionaler Akt
2.3. Phänomenologie als Erkenntniskritik
2.4. Abgegrenzte Phänomenologie
2.5. Intersubjektivität
2.6. Leib als Medium
2.7. Monaden-Ich und Monaden-All
2.8. Möglichkeiten der Intersubjektivität
2.9. Intersubjektivität ist reflexiv
2.10. Diskursfeld Magie
Limesqualität und work in progress – Die Phänomenologie im Werk Edmund Husserls
3.1. Einfluss der Phänomenologie
3.2. Ein meditierend-mäandernder Schreibstil
3.3. Radikaler Zweifel
3.4. In und mit der Welt
3.5. Epoché
3.6. In-Bezug-Setzen
3.7. Evidenter Aufweis
3.8. Bewusstsein als Akt
3.9. Objektivität von Welt
Die Vermessung der Lebenswelt: Krisis und Phänomenologie
4.1. Mathematisierung der Welt
4.2. Entstehung der
Krisis
4.3. Renaissance und Wissenschaft
4.4. Philosophie in ihrem Ursprung
4.5. Transzendentalismus
4.6. Urteilsenthaltung
4.7. Transzendentales Ich
4.8. Transzendentales Ego.
4.9. Absoluter Subjektivismus.
4.10. Andere Lösungsversuche.
4.11. Letztbegründung von Wissenschaft
4.12. Lebenswelt
4.13. Vorgegebene Welt
4.14. Vermessung der Lebenswelt
4.15. Gemeinschaft der Wissenschaftler als Menschen.
4.16. All-Verbundenheit
4.17. Zusammenfassung
Das Subjekt in der objektiven Wissenschaft
5.1. Voraussetzung
5.2. Encyclopaedia Britannica
5.3. Subjektphilosophie
5.4. Bewusstsein und Sein
5.5. Daseiende Welt
Fremderfahrung und Icherfahrung: Ego – alter ego
6.1. Der Andere
6.2. Die Primordialsphäre
6.3. Die Ähnlichkeit des Leibes
6.4. Apperzeption
6.5. Ichbegriff und Monade
6.6. Menschengemeinschaft und Urmonade
6.7. Monadengemeinschaft
6.8. Eigenes und Fremdes
6.9. Welthorizont und Monaden-All
6.10. Zusammenfassung
Evidenz als Erkenntnisraum – Letztbegründung von Erkenntnis
7.1. Subjektorientiertheit
7.2. Metaphysik und Transzendenz
7.3. Solipsismus
7.4. Evidenz – Urteil und Anschauung
7.5. Evidenz auf Bewährung
7.6. Evidenz und Wahrheit
7.7. Evidenz und Lebenswelt
Magische Grammatologie: Die Magie der Monade
8.1. Magie ohne Begriff
8.2. Kosmische Sympathie
8.3. Magie als ritualisierter Optimismus
8.4. Magie als System der Wechselwirkung
8.5. Magie und Zauberei
8.6. Magie und ihre Epigonen
8.7. Die Kräfte, wie sie heimlich wirken
8.8. Welcher Wille geschehe?
8.9. Wissenschaft: Manipulation und Phantasmen
8.10. Magie online
Das Magische der Magie: Magische Diskursfelder und ihr Medium, ihr Raum und ihre Verwirklichung
9.1. Magische Evidenz
9.2. Magie als Vorbedingung von Magie
9.3. Magie als Bewusstseinsphänomen
9.4. Eidetische Magie
9.5. Phänomenologische Wissenschaft
9.6. Magie als Begreifendes
9.7. Magie als intentionaler Akt
9.8. Magie als intentionaler Bewusstseinsaspekt
9.9. Magie als Phänomen
9.10. Magie und ihre Trägersubstanz
9.11. Magie als Wirksamkeits-Was
9.12. Magische Kennzeichnung
9.13. Magie als magischer Äther
9.14. Ontische Magie
9.15. Magisches transzendentales Bewusstsein
9.16. Magisches Denken ist Seins-
hörig
9.17. Intersubjektivität als magischer Prozess
9.18. Satelliten-Magie
9.19. Magische All-Matrix
9.20. Magie und Appräsentation
9.21. Medium cogito
9.22. Magischer Urgrund
9.23. Der Raum des magischen Denkens
9.24. Ergebnis und Ausblick
9.25. Was wir wissen:
9.26. Was wir nicht wissen:
Nachwort zur Neuauflage
Literatur
1. Vorüberlegung
Die phänomenologische Forschung vermag mitunter eine eigenartige Sphäre zu berühren, die weit entfernt liegt von der, die sich Phänomenologie vorgenommen hat zu erforschen, die aber gleichwohl zum Bewusstsein als Bewusstseinsakt und damit als Phänomen gehört.
Die als intentionale Akte zu beobachtenden oder aus der Literatur ableitbaren Phänomena zum Problemfeld Intersubjektivität und Macht bzw. Machtausübung, verstanden als Einflussnahme im weitesten Sinne, sind auf den ersten Blick einsichtig, handelt es sich dabei doch um Kommunikation, appellative Aktionen oder um mediale Prozesse oder Produktionsverhältnisse. Ungeachtet dessen kann die Evidenz des Aufweises ihrer Ergebnisse und der Beobachtung ihrer Wirksamkeit dann ungenügend sein, wenn aus dem eigenen Selbstverständnis heraus eine Appräsentation und Interaktion notwendig sein wird. Das will sagen, dass Beispiele für die objektive Beobachtung von Prozessen, bei denen eine grundsätzliche und ausnahmslos gültige Annahme der Bedingung von Intersubjektivität und gleichzeitiger Einflussnahme – Einflussnahme im Sinne von Macht, Machtstrukturen oder Machtvoraussetzungen verstanden – im Aufzeigen zwar signifikant ist, aber in Reinform schwer zu finden sein wird.
Kommunikation beispielsweise erfüllt zwar im Allgemeinen diese Voraussetzungen, weicht aber in einem wesentlichen Punkt ab, dem der Selbsteinschätzung. So spricht man (oder kann man sprechen) von dem Umstand der gewollten Nicht-Beeinflussung, sozusagen einer gewaltfreien oder machtfreien Kommunikation. Der von Jürgen Habermas angeführte Begriff der „herrschaftsfreien Kommunikation“ verdeutlicht dies. Andererseits nennt Michel Foucault diesen utopisch, weil für ihn jede Kommunikation bereits ein „Machtspiel“ ist und damit eine „neutrale“ Position nicht möglich scheint.1 Auch bei Beispielen aus der Medienwelt, die aus ihrem Selbstverständnis heraus den Wunsch oder den Willen der Nicht-Beeinflussung zumindest geltend machen, wird sich Widerspruch regen, wenn der Wunsch „nur“ zu informieren oder „bloß“ die Wahrheit zu sagen, als unterschwellige Suggestion freigelegt werden kann. Der Schein muss zwar unter allen Umständen gewahrt bleiben und der Anspruch auf Neutralität ist Programm, dennoch ist jeder Schein scheinbar und jede Neutralität mit etwas anderem besetzt, was zur Folge hat, dass überall dort, wo Bezogenheit im Sinne von Intersubjektivität gegeben ist, Machstrukturen zumindest vermutet werden und noch weniger geleugnet werden können, wobei es mittlerweile müßig ist, einen solchen offensichtlichen oder verborgenen Leugnungsprozess thematisieren zu wollen.
Um Intersubjektivität und Macht in Reinheit und programmatischem Selbstverständnis studieren und beobachten zu können, kann das Augenmerk auf ein Diskursfeld gerichtet werden, das unbeachtet geblieben, nichtsdestoweniger aber beides unauflöslich miteinander verbindet und dies sowohl vom eigenen Selbstverständnis, wie auch von einer äußeren unbeteiligten Wahrnehmung bzw. Einschätzung her. Es handelt sich um die ganze Breite magischer Diskurssysteme in ihrer grundsätzlichen Signifikanz als magische Diskursfelder, wobei das Augenmerk auf magisches Bewusstsein im Sinne „wilden Denkens“ (Lévi-Strauß) gelegt werden wird und von einem esoterischen oder magischesoterischen Diskurs abgegrenzt werden soll, gleichwohl dessen Denkformation hier mit hineinspielen muss, was in der „Natur der Sache“ liegt.
Ein magisches Diskursfeld konstituiert sich in ihrem Selbstverständnis ausschließlich auf der Basis von Intersubjektivität und Macht in der Absicht der gegenseitigen Beeinflussung. Der mögliche Einwand der vollzogenen Reduzierung von Magie auf Macht ist ein scheinbarer, will er doch nahe legen, dass Magie neben Macht weitere Perspektiven biete, was nicht zu leugnen ist. Jedoch wird dabei übersehen, dass mit Macht auch das Machbare gemeint ist und sich Magie damit sehr wohl wieder identifizieren wird und muss, denn jedes magische Wort, jeder magische Gedanke, jeder magische Akt und jede magische Überlegung ist – auch in ihrer reinsten Unschuld – auf das Machbare ausgerichtet. Selbst der im magischen Modus verankerte, implizierte oder als möglich angeführte Erkenntniszugewinn oder Erkenntniszuwachs ist als magischer Akt der Macht- bzw. Machbarkeitsperspektive destruierbar und dekonstruierbar.
An einem magischen Diskursfeld sind beide Aspekte – Macht und Intersubjektivität – deutlich ablesbar. Die sich daraus ergebenden Schlüsse können für die Phänomenologie signifikant sein, weil hier ein Anschauungsobjekt als Bewusstseinsakt vorliegt, der sowohl diachron wie synchron relevant ist.
Durch grundlegende wissenschaftlich relevante Studien zu Aspekten des magischen Diskursfeldes im Umfeld der Ethnologie wurde ein breites, wissenschaftliches Niveau erreicht, das Studien zu Magie von jener Anrüchigkeit befreit, die ihr in naiver Weise anhängen.2 Zu nennen sind hier vor allem für die Ethnologie: James George Frazer3, Edward E. Evans-Pritchard4, Claude Levi-Strauss5; für die Soziologie: Max Weber6, Emile Durkheim7, Marcel Mauss8, Norbert Elias9, Hans Peter Duerr10; für die Psychologie: Sigmund Freud11 und C. G. Jung12; für die Religionswissenschaft: Mircea Eliade13, Bronislaw Malinowski14, H. G. Kippenberg15, Ioan P. Culianu16 und allgemein in Geschichte oder Volkskunde: Will-Erich Peuckert17, Georg Luck18 und Margarethe Ruff 19.
Magie mag gegenaufklärerisch sein, die Erforschung magischer Strukturen und ihre Freilegung im Prozess der Bergung sind es jedoch nicht. Nicht mehr bedarf es der Rechtfertigung, sich mit diesem Themenfeld zu beschäftigen, weil eine solche Beschäftigung im wissenschaftlich-aufklärerischen Interesse liegen muss.
Es bedarf nun sehr wohl der Erklärung, warum ausgerechnet Phänomenologie im Umkreis von Edmund Husserls Schrift Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie in einen solchen Zusammenhang gebracht werden kann.
Festzustellen ist, dass dies erst einmal nicht phänomenologisch immanent erklärt werden kann. Weder ihr Anspruch noch ihre Untersuchungen noch ihre philosophischen Überlegungen prädestinieren Phänomenologie auf den ersten Blick für eine Analyse eines magischen Diskursfeldes. Im Gegenteil: nichts läge zunächst ferner.
Dadurch aber, dass „Magie“ als Bewusstseinsakt erfahrbar und als Phänomen erfassbar ist, kann auch ein magischer Diskurs, vorausgesetzt er lässt sich adäquat fassen und beschreiben, phänomenologisch untersucht werden.
Als Vorverständnis kann von daher formuliert werden, dass magische Operationen per definitionem intersubjektiv sind, ja sie werden davon bestimmt, getragen und gestützt. Evident ist es, von Macht, Intersubjektivität und Magie in einem Atemzug zu sprechen.
Der Anspruch auf Intersubjektivität von Magie ist – von außen gesehen – erst einmal unerklärlich, fragwürdig und wird abgesprochen, ignoriert oder schlichtweg geleugnet. Vom magischen Selbstverständnis her ist Intersubjektivität aber eine Grundkonstante.
In einem phänomenologischen Horizont können sich nun Magie und Phänomenologie über die Intersubjektivität berühren und unvermutet stützen, dann, wenn das wissenschaftliche Erklärungsmodell (Phänomenologie) mit der vor-wissenschaftlichen Selbsteinschätzung (Magie) zusammentreffen kann, im Sinne eines Erklärungs- und Erläuterungsversuches sowie der Stützung und Falsifizierung einer – in diesem Falle der phänomenologischen – Thesis oder/und Beobachtung.
Wenn die der Magie beigegebenen Signifikanten anders konnotiert werden, und zwar im Sinne von „Macht“ und „Intersubjektivität“, kann die gewohnte Signifikant-Konnotation „Magie“ umgangen werden. Magie als das ergänzend Andere von Macht im Sinne der Einflussnahme und Magie auf der Basis der Intersubjektivität kann nun phänomenologisch sinnvoll, eingebettet in die Husserlsche Phänomenologie, betrachtet werden. Damit wird nicht Magie als solche, sondern ihre attributiv beigegebene Grundkonstante der Intersubjektivität – die, wie wir gesehen haben auf Macht fußt – in einem phänomenologischen Diskurs untersuchbar, beschreibbar und erklärbar. Das Diskursfeld Magie wird auf ihre Grundkonstante zu gereinigt und damit phänomenologisch erfasst.
Die sich wechselseitig ergebenden Erhellungen und Bestätigungen sowie Erklärungen und Erläuterungen stellen die Grundpfeiler dieser Untersuchung dar. Dazu müssen aber einerseits die phänomenologischen Voraussetzungen abgeklärt und die magischen Komponenten angezeigt werden, ehe von einem Ergebnis gesprochen werden kann.
Dann kann gezeigt werden, dass die Phänomenologie Husserls ein kongeniales philosophisches und wissenschaftlich objektives Erklärungsmodell abgibt, um aufzuzeigen, wie ein magischer Diskurs arbeitet und wirken kann. Ein solches Erklärungsmodell wird reflexiv auf die Phänomenologie rückwirken. Es geht also um eine wissenschaftliche Objektivierung des magischen Diskurses unter phänomenologischer Methode und, als Nebenprodukt, von völlig unvermutet anderer Seite, um eine Stützung des Intersubjektivitäts-Diskurses der Husserlschen Phänomenologie durch ein magisches Diskursfeld, was nichts anderes bedeutet, als dass dies in einen historischen Bezug zu setzen und in einem solchen zu sehen ist. Der synchrone und diachrone Zug der Husserlschen Phänomenologie wird also exemplarisch zu bestätigen sein, wenn er durch ein Drittes angewandt – hier das magische Diskursfeld – ausgewiesen wird.
Die folgenden Kapitel zeigen die signifikanten Aspekte der Husserlschen Phänomenologie auf, um dann das Diskursfeld Magie darzulegen. Notwendigerweise ist dabei eine Begrenzung sinnvoll. Wir beschränken uns bewusst auf die Phänomenologie im Umkreis der Husserlschen Krisis und auf ein Magieverständnis, das allgemein und unmittelbar einsichtig ist.
Die sich daraus ergebenden Kritikpunkte und weiterführenden Mehrwerte an Erkenntnis sind nicht nur willkommen, sondern fest eingeplant. Dahingehend fühlt sich diese Untersuchung dem Limes-Charakter phänomenologischer Arbeitstechnik verpflichtet, dass sie eingedenk ihrer Unzulänglichkeit Zeugnis ablegt von Gedanken, Vorstellungen und Ergebnissen, ohne den Anspruch zu gering oder die Erwartung zu hoch halten zu wollen.
Verkehrt wäre es, diese Arbeit im Sinne einer theoretisch-phänomenologischen Auseinandersetzung, wie in Hinblick auf eine esoterisch-magische Beschäftigung zu lesen. Beides ist aus verständlichen Gründen nicht gewollt und nicht zu leisten. Vielmehr soll eine gangbare und bewegliche Schneise in das Dickicht phänomenologischer Erkundung einerseits und magischer Forschung andererseits geschlagen werden. Geht es doch um einen philosophischen Zugang und eine philosophische Durchdringung des Problemfeldes Intersubjektivität und Macht, in Bezug auf ein vergessenes oder unterdrücktes Diskursfeld; das der Magie. Daran müssen die hier gewonnenen Erkenntnisse und diese Untersuchung sich messen lassen.
Edmund Husserl (1859–1938) um 1900
© gemeinfrei: http://dic.academic.ru/pictures/wiki/fi les/69/EdmundHusserl.jpg
1 Vgl. dazu: Jürgen Habermas: Theorie des kommunikativen Handelns, 2 Bde., Frankfurt a. M. 1988. Und: Michel Foucault: Dits et Ecrits. Band IV. Frankfurt a. M. 2005. Sowie weiter dazu (Auswahl): Michel Foucault: Sexualität und Wahrheit, 3 Bände, Frankfurt a. M. 1983 f.
2 Für weitere Literaturhinweise vgl. das Kapitel über Magie und das Literaturverzeichnis.
3 James George Frazer: Der goldene Zweig. Das Geheimnis von Glauben und Sitten der Völker. Reinbek bei Hamburg 1994.
4 Edward E. Evans-Pritchard: Hexerei, Orakel und Magie bei den Zande. Frankfurt a. M. 1988.
5 Claude Levi-Strauss: Das wilde Denken. Frankfurt a. M. 1976.
6 Max Weber: Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie. 4 Bände. Tübingen 1920–21.
7 Emile Durkheim: Die elementaren Formen des religiösen Lebens. Frankfurt a. M. 1981.
8 Marcel Mauss: „Entwurf einer allgemeinen Theorie der Magie“. In: Soziologie und Anthropologie. Bd. 1. Frankfurt a. M. 1989.
9 Norbert Elias: Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen. Bände 1 und 2. Frankfurt a. M. 1976 ff.
10 Hans Peter Duerr: Der Mythos vom Zivilisationsprozeß. Fünf Bände. Frankfurt a. M. 1994–2005.
11 Sigmund Freud: Totem und Tabu. Frankfurt a. M. 1981.
12 C. G. Jung: Gesammelte Werke. Düsseldorf 2004. Insbesondere: Wandlungen und Symbole der Libido.
13 Mircea Eliade: „Geschichte der religiösen Ideen“. Ders.: „Das Okkulte und die moderne Welt“. In: Der magische Flug. Sinzheim 2000.
14 Bronislaw Malinowski: Magie, Wissenschaft und Religion. Und andere Schriften. Frankfurt a. M. 1973.
15 H. G. Kippenberg und B. Luchesi (Hg.): Magie. Die sozialwissenschaftliche Kontroverse über das Verstehen fremden Denkens. Frankfurt a. M. 1978.
16 Ioan P. Culianu: Eros und Magie in der Renaissance. Frankfurt a. M. 2001.
17 Will-Erich Peuckert: Gabalia. Ein Versuch zur Geschichte der magia naturalis im 16. bis 18. Jahrhundert. Berlin 1967.
18 Georg Luck: Magie und andere Geheimlehren in der Antike. Stuttgart 1990.
19 Margarethe Ruff: Zauberpraktiken als Lebenshilfe. Magie im Alltag vom Mittelalter bis heute. Frankfurt a. M. 2003.
2. Phänomenologie ist Bewusstseinsphilosophie: Kleingeld wechseln
Der Andere ist für mich ebenso, aber sein Für-sich ist zugleich mein Für-mich, in Form meiner Potenzialität der Appräsentation. Aber er selbst appräsentiert in mir und ich in ihm. Ich trage alle Anderen in mir als selbst appräsentierte und zu appräsentierende und als mich selbst ebenso in sich tragend. Edmund Husserl, Späte Texte über Zeitkonstitution (1929–1934), S. 56
Husserls Werk, das von Eugen Fink treffend als „Entwicklungsschrifttum“ bezeichnet wird, ist weder abgeschlossen noch vollendet. In einem gewissen Sinne wächst es auch nach seinem Tode weiter.20 Dies liegt in der Natur der phänomenologischen Betrachtung und der Unabschließbarkeit der phänomenologischen Analyse.21 Zu komplex wäre der Blick des Phänomenologen, wollte er alle Perspektiven und alle Aspekte als Phänomen integrieren. Trotz allem besteht aber dieser Anspruch als Limesqualität hin zu uneingeschränkter Erkenntnis und im Sinne des Festhaltens am Programm der Phänomenologie als „absolute Wissenschaft“.
Im phänomenologischen Sinne kann jede Wahrnehmung ein Akt des Bewusstseins im Sinne einer phänomenalen Erfassung als Momentaufnahme des erkennenden Subjekts sein, die mit anderen verglichen werden kann, wodurch wir eine Fülle an Bewusstseinsprotokollen bezogen auf diesen Wahrnehmungsakt erhalten. Das Erscheinende und vermeintlich Ganze wird also zerlegt und wiederum zerlegt, reflektiert und wiederum reflektiert.
Was wir erkennen, ist ein Ausschnitt eines Gegenübers im Vermeinen, ein Ganzes vor uns zu haben. Dieses Ganze wird durch einen Richtungs- oder Perspektivenwechsel in Frage gestellt und ein neues Ganzes entsteht. Alles ist für sich und mit sich identisch und dennoch lehrt die Erfahrung, dass dies eine brüchige Identität ist – ein filigranes Netz an Entsprechungen – die eine vermeintliche Einheit spiegeln.
Edmund Husserl zeigt, dass jedem Bewusstseinsakt eine Fülle weiterer zugrunde liegt. Die verschiedenen Bewusstseinsweisen sind auf weitere rückführbar oder von anderen ableitbar. Dem naiven Haben-der-Dinge liegt ein komplexes Wechselspiel in der Zeit zugrunde, das diese Statik als vermeintlich und damit als dynamisch enttarnt. Und doch erscheint es so, als ob man gerade einen Augenblick erhaschen würde aus dem unendlichen Bewusstseinsstrom. Die Reflexion meistert die Fülle der Eindrücke nicht.
Der momentane Akt der Wahrnehmung entschwindet in Erinnerung, wird in der Reflexion aus der Vergangenheit in eine erinnerte Gegenwart geholt und auf Evidenz geprüft, die sich nie einstellen wird, weil die Erinnerung des Erinnerten und das Gewahrwerden des vermeintlichen Gegenübers immer differieren müssen.
Die integrale Schachtelung oder Zerlegung der phänomenologischen Methode hinkt hinterher und doch wird ein sinnstiftendes Evidenz-Moment deutlich. Die Methode scheint mühsam und der Weg absurd kafkaesk: zu lang, zu breit, zu weit ... gleichwohl kristallisieren sich im Strom des Bewusstseins Konstanten heraus, die programmatisch erfasst, Phänomenologie zu einer objektiven, auf Evidenz insistierenden Wissenschaft werden lassen. Ihr Blick ist nicht nur auf Zerlegen und Teilen, sondern auf Reflexion und Integration, auf Begriffsbildung und Methodologie gerichtet.22 All das macht Sinn, dann, wenn aus der Reflexion eine Gedankenkette wird, die wiederum als solche erkennbar ist:
Wenn Husserl in Seminarübungen zu sagen liebte, er wolle die „großen Scheine“ der Systemphilosophien „in Kleingeld wechseln“, so konnte dies dort mit Recht gelten für seine Rückfrage von anspruchsvollen Theoremen auf die schlichten, elementaren Sachverhalte. In den Forschungsmanuskripten ,wechselt er nicht in Kleingeld‘, denn so kleine ‚Münzen‘ sind gar nicht im Umlauf, er löst noch das kleinste Kleingeld auf in einen Nuancenreichtum, den erst seine Reflexion herausreißt“ 23 (Eugen Fink, Nähe und Distanz, 220).
Der Wechsel führt zum Identischen unter dem Verschiedenen, denn letztlich ist es einerlei, ob ich zwei Fünfer oder einen Zehner in der Hand halte. Schwierig wird es, wenn der Wechsel einseitig erfolgt – ein zu wenig in der Wechselkunst – oder zu viel, ein Überschuss, der verarbeitet werden will. Unterm Strich bleibt in der Summe eine Bindung, die rückbindet und vorausahnen lässt. Eine gemeinsame Basis wird auszumachen sein, die trotz subjektiver Reflexion intersubjektiv sein muss. Erst damit erhält Phänomenologie den Status einer objektiven Wissenschaft.
2. 1. Phänomenologie ist Bewusstseinsphilosophie
Die Phänomenologie Edmund Husserls ist nicht objekt- oder gegenstandsorientiert. Phänomenologie ist Bewusstseinsphilosophie und auf Analyse und Untersuchung von Bewusstseinsstrukturen ausgelegt. Phänomenologie ist subjektorientiert, aber weder subjektiv noch egozentrisch. Phänomenologische Methode ist kein Empfindsamkeitsprotokoll oder autoerotische Befindlichkeitsstudie.
Programmatisch ist es für die Phänomenologie, „objektive Wissenschaft“ zu sein mit dem Ziel, eine rationale und vernünftige Methodologie zur Erkenntnis von Welt und Mensch herauszubilden. Dabei schlägt Edmund Husserl die Richtung ein, indem er von der Annahme der Korrelation von Bewusstsein und Welt ausgeht.
Im Bewusstsein – das immer Bewusstsein von etwas ist – wird das Seiende als Wahrnehmendes, Erkennendes, Erinnerndes usw. vergegenwärtigt. Die Welt kann daher nur als Korrelat von Bewusstseinsleistungen in Hinblick auf ein erkennendes und wahrnehmendes Bewusstsein vorhanden sein.
Objekte ohne erkennendes Subjekt sind sinnlos ebenso wie Aussagen über Objekte, die nicht bewusstseinsmäßig erfasst werden können. Objektive Erkenntnis ist immer auf ein erkennendes Bewusstsein rückbezogen oder rückzubeziehen.
Unsere Alltagswelt – von der wir ein Teil sind – ist die Quelle unserer Erkenntnis. Doch um diese wissenschaftlich auszuwerten, bedarf es einer besonderen Leistung und Methodik. Die Phänomenologie hat hierfür ein Instrumentarium entwickelt, um im intentionalen Bewusstseinserlebnis – dem Bewusstseinsakt oder intentionalen Akt – die Akte oder Phänomene und der ihnen entsprechenden Gegenstände zu beschreiben und zu bestimmen.
2. 2. Intentionaler Akt
Jeder Bewusstseinsakt kann intentionaler Akt sein. Intentional meint die Beziehung und Vergegenwärtigung von Erkennendem im erkennenden Bewusstsein. Gleichgültig ist, ob es sich bei diesem Akt um ein Ding, etwas Erinnertes oder einen Bewusstseinsaspekt handelt. Als Phänomen für das jeweilige Bewusstsein ist allein entscheidend, dass es in „meinem“ Bewusstseinserleben vorhanden ist.
Erst das Bewusstsein ermöglicht Sinnstiftung und erlaubt Aussagen über die Welt. Erklärtes Ziel der Phänomenologie bleibt der Nachweis des Einklangs zwischen Welt und Vorstellung im Sinne einer Evidenz der transzendentalen Subjektivität mit der rationalen Struktur von Welt.
2. 3. Phänomenologie als Erkenntniskritik
Phänomenologie ist Erkenntniskritik dadurch, dass die konstituierenden Bewusstseinsleistungen auf eine allgemeine, logische und intersubjektive Struktur als eine transzendentale Phänomenologie ausgerichtet werden. Da wird Alltagswelt ausgeklammert, abgeschattet oder mittels Epoché oder transzendentaler Reduktion auf einen allgemeinen Sinn hin auszurichten sein.
Husserl, der sich gegen Szientismus, Naturalismus, Relativismus, Skeptizismus und Irrationalismus wendet, sucht durch seinen eidetischen Ansatz, seine transzendentale Phänomenologie, die wissenschaftliche Basis der Erkenntnis im Sinne einer Ausrichtung auf absolute Erkenntnis zu gewinnen. Diesem Ideal ist und bleibt die Phänomenologie verpflichtet.
Da es als ausgemacht gilt, dass eine Korrelation zwischen dem subjektiven, bewusstseinsmäßigen Erfassen und den Phänomenen als erkannte Gegenstände besteht, konzentriert sich die transzendentale Phänomenologie auf diesen Akt und überprüft ihn hinsichtlich seiner Evidenz.
2. 4. Abgegrenzte Phänomenologie
Edmund Husserl grenzt die Phänomenologie scharf vom Neukantianismus, dem Psychologismus und dem Historismus ab. Es geht ihn nicht um empirische Abstützung, denn die Regeln der Logik sind nicht empirisch oder psychologisch ableitbar. Regeln können verändert werden. Logische Sätze sind notwendige Wahrheiten im Sinne einer „absoluten“ Gültigkeit. Sie sind unveränderlich.
Auf Empirie sich gründende Ergebnisse sind nur bedingt aussagefähig. Möglich wäre es, dass sich empirische Verhältnisse ändern. Die logischen Gesetze müssen davon unberührt bleiben. Logik bedarf keiner empirischen oder psychologischen Abstützung.
So wie der Historismus in Skeptizismus umschlägt, eben weil alles „historische Wahrheit“ und damit relative Wahrheit wird, so führt der Psychologismus in einen Relativismus, ohne erkennbare logische Strukturen. Ebenso wenig kann es sinnvoll sein, die Realität als dingliche anzuerkennen und vorauszusetzen, ohne zugleich einen Zugang zu ihr zu haben.
Husserl zeigt, dass es um die „Sachen selber geht“ und dass die Phänomene als intentionale Akte vorliegen, die dann auf ihre Evidenz und Appräsentation hin geprüft werden müssen. Der Vorwurf des Subjektivismus greift daher nicht. Viel eher ist es üblich, eine Wirklichkeit zu konstruieren, deren Konstruktion vorausgesetzt aber nicht durchschaut wird.
Allein die im Bewusstsein ablaufenden Prozesse selber können erkannt, analysiert und beschrieben werden. Es sind die Phänomene selber auf die es ankommt, denn diese sind direkt und unmittelbar einsichtig und zugänglich. Bei der Analyse der Bewusstseins-Gegenstände hat man sich aber aller Mutmaßungen und Voreingenommenheiten zu enthalten.
Die Phänomenologie will das Wesen einer Sache unvoreingenommen betrachten und wird damit dem Ideal einer wissenschaftlichen Durchdringung gerecht, weil sie in der Subjektivität sich ihrer Subjektivität bewusst ist und gleichzeitig von ihr abstrahieren will. Es geht allein darum, was sich als Phänomen anbietet, eben um die Sache selbst.
Wenn ich mich aber auf einen Gegenstand als Objekt ausrichte, so entschwindet er mir im nächsten Moment. Ich habe lediglich ein Bewusstseinsbild („intentionaler Akt“) von ihm. Mittels meiner Reflexion erschließt sich jedoch das Objekt als Phänomen und in einem nächsten Schritt kann ich die Evidenz dieses Phänomens mit der Dingwelt anstreben.
2. 5. Intersubjektivität
Ab 1905, also vier Jahre nach dem Erscheinen der Logischen Untersuchungen, für die das Ich in seiner Umfassendheit als Problem noch kein Thema war,24 begann Husserl, sich mit dem Problem der Intersubjektivität zu beschäftigen.25 Das führte er bis in die 1930er-Jahre hinein fort. Dokumentiert ist alles in drei Ergänzungsbänden mit insgesamt weit über 1000 Seiten.
Die ersten Aufzeichnungen von 1905 zeigen, wie Husserl die Identität des Ich problematisiert und ihm bewusst wird, dass es sich im Bewusstseinsfluss konstituiert, dass das „Ich“ sich im Wandel erfährt und den Zusammenhang dieser Momente als Ich zu konstituieren sucht.26 In diesem „Werden“ trifft man auf den Anderen als von einem selbst Verschiedenen: „Das Bewusstsein des einen sei ein anderes als das des anderen. Ich frage: Setzt diese Verschiedenheit nicht voraus die Möglichkeit adäquater Wahrnehmung derselben? Setzt sie nicht die Möglichkeit letzter Einlösung voraus, und bedeutet das etwas anderes als adäquate Wahrnehmung?“ (Hua XIII, 3).
Husserl kehrt nun den Vorgang der Fremdwahrnehmung um, indem er argumentiert, dass gerade die Verschiedenheit die Ähnlichkeit bedinge. Schon früh konstituiert er die Möglichkeit der Verständigung im Sinne der Annäherung, Abstimmung und „Einfühlung“ auf den Anderen als Eigener und Fremder. Und doch ist das Ich kein Einzel-Ich und nur auf sich beschränkt, sondern immer ausgerichtet auf das Andere als das erfahrbare Fremde.27 Einfühlung in das Gegenüber und Analogisierung des Leibes des Anderen sind wesentliche Bedingungen für die Fremderfahrung des „Ich im Dort“, des eigenen Leibes zum anderen Leib.
2. 6. Leib als Medium
Der Leib ist nicht identisch mit dem Körper. Er ist das Medium des Ich als Instrument der Apperzeption und der Wahrnehmung eines anderen Leibes sowie dessen Analogisierung mittels Einfühlung.28 Das besagt, dass das Ich sich nicht im Körper-haben erschöpft, sondern im Leib den Anderen als Leib erfährt und damit analogisiert. Denn der andere Leib ist kein fremder, sondern ein ähnlich eigener.
Die „Apperzeption des fremden Seelenlebens“ als Setzung des anderen steht für Husserl also schon früh als Möglichkeit und ahnende Gewissheit fest.29 Doch es sollte Jahre dauern, ehe er das auch philosophisch adäquat zu lösen vermochte. Möglich ist immer die Täuschung, die aber durch „Evidenz des Unterschiedes“ durch Reflexion und Begründung überwunden werden soll.30
2. 7. Monaden-Ich und Monaden-All
Husserl kommt bereits 1908 in einer Beilage31 auf die Monade zu sprechen, die dann als Monaden-Ich und Monaden-All den Ichbereich erweitern wird. Auch wird angedacht, ob die Gemeinschaft der Subjekte nicht dadurch Intersubjektivität bedingen, weil Subjekte aufeinander bezogen sind und „bei der Konstitution des einheitlichen Raumes“ mitwirken. Wird nicht die Einheit der Außenwelt gerade als denknotwendig vorausgesetzt und gleichzeitig als sich dabei konstituierender Raum?32
Mit der Möglichkeit der Fremderfahrung stößt die Phänomenologie schon früh in die philosophisch zu verstehende absolute All-Perspektive vor als rationale und konsequente Fortführung der Einbettung des Anderen und des Eigenen. Die folgenden Jahre sind der philosophischen Klärung gewidmet, so dass sich langsam ein System – oder zumindest die Voraussetzung eines Systems – herauskristallisiert.
2. 8. Möglichkeiten der Intersubjektivität
Die Frage, die uns hier vordergründig interessiert, ist nicht die nach der Möglichkeit der Fremderfahrung durch die Eigenerfahrung, denn solches kann Husserl evident nachweisen, sondern nach den Möglichkeiten, die sich durch Intersubjektivität in ihrer Ableitung und Facette philosophisch durchdrungen ergeben.
Intersubjektivität setzt notwendigerweise eine gemeinsame Basis voraus. Husserl findet diese Basis im Spätwerk in der „Lebenswelt“ und im Frühwerk in seinem Ausspruch: „Zu den Sachen selbst!“ Hier wie dort ist eine gemeinsame Basis reflektierbar, die „Wechselkurse“ erlaubt, die Reflexionen gestattet und die Solipsismus und Non-Kommunikation – sowohl für den menschlichen Bereich wie auch für und mit der Dingwelt – ausschließt.
Gerade die Rückbezüglichkeit auf das erkennende Subjekt scheint genau das Gegenteil der Vorannahme zu bewirken, in dem Subjektivität letztlich den anderen erreicht und Phänomenologie als „objektive Tatsachenwissenschaft“ sich etablieren kann. Und doch ist es das Ich, das als bewusstseinstragendes Medium Evidenz feststellen und Präsenz bewirken muss.
2. 9. Intersubjektivität ist reflexiv
Den Anderen wahrzunehmen und im intentionalen Akt einzuverleiben ist etwas, das notwendigerweise eine Verbindung voraussetzt. Jene Verbindung ist die Möglichkeit der Kontaktierung im Sinne einer Übertragung und Gegenübertragung. Diese wiederum muss nicht nur passiv rezipierend, sondern kann auch aktiv manipulativ sein. Anders gesagt: Intersubjektivität ist reflexiv.
Die phänomenologische Methode liefert eine kongeniale These zur passiven Intersubjektivität und damit auch – im analogen Umkehrschluss – bei näherer Betrachtung eine Hypothese zur aktiven Manipulation.
Manipulation des Andern ist im höchsten Maße Fremdbestimmung. Fremderfahrung und Fremdbestimmung sind nur durch ihre Verlaufsrichtung voneinander geschieden.
Fremdbestimmung als Manipulation haftet auch einem magischen Akt an. Der theoretische Rahmen der Fremdbestimmung im magischen Denken, der magischen Weltsicht oder eben der Magie kann auch umgekehrt proportional zur Fremderfahrung beschrieben werden.
2. 10. Diskursfeld Magie
Magie oder magisches Denken basiert von ihrem Selbstverständnis her auf der Voraussetzung und der Bedingung von Intersubjektivität und erteilt – wie die Phänomenologie auch – einer solipsistischen und nonkommunikativen Haltung per definitionem eine Absage. Magie ist Kommunikation und Intersubjektivität.
Sowohl Phänomenologie wie auch Magie implizieren eine – aktiv-manipulative oder passiv-rezeptive – Beeinflussung des Anderen, was hier synonym für Machtausübung oder Machtstruktur steht. Dies setzt Vorannahmen voraus, die immer wieder angedeutet aber nicht mittels eines auf absolutes Wissen aus seiendes philosophischen System erklärbar und transparent gemacht werden können. Mittels der Phänomenologie Husserls wird aber der begriffliche und philosophische Rahmen dargeboten.
Phänomenologie funktioniert als Medium der Begründung und der Aufklärung magischer Vorannahmen. Gründet sich Magie immer noch auf metaphysische Grundannahmen, so macht die Phänomenologie deutlich, inwieweit diese nichts anderes als transzendentale Notwendigkeiten sind, die weder geheimnisvoll noch ungewöhnlich in Funktionsweise, Absicht und Möglichkeit sich darbieten. Das wissenschaftliche Instrumentarium zur Durchdringung magischer Denkvorgänge und magischer Weltsicht als Magie ist phänomenologisch gegeben. Die auf dieser Basis beruhende wissenschaftliche Durchdringung der Magie ist eine hier durchzuführende.
20 „Das phänomenologische Schrifttum Edmund Husserls ist, im Ganzen gesehen, ein Entwicklungsschrifttum. Es gibt keinen Text, kein Buch, in dem diese Philosophie ihre endgültige und vollständige systematische Darstellung gefunden hätte.“ (Fink, Nähe und Distanz, 45)
21 „Das verhindert bereits die prinzipielle Unabschließbarkeit, Korrekturbedürftigkeit und Korrekturfähigkeit phänomenologischer Analyse. Nicht zuletzt auch darin lebt Husserls Phänomenologie aus dem Geist strenger Wissenschaft: ‚Es ist der Stolz, sogar das Recht der Phänomenologie, auch irren zu dürfen.‘ Wohl steht auch die Phänomenologie wie alle Wissenschaft unter der Idee der Wahrheit; sie bleibt ihr ständiges Regulativ. Eben deshalb aber verbleiben alle ihre Erkenntnisse ‚wesensmäßig in Relativitäten‘, und auch die transzendentalphänomenologische Erforschung ‚der letzten‘ Gründe und Ursprünge bringt es zu absolut unumstößlichen Einsichten, und zwar aus ihr selbst einsichtigen Wesensgründen, nicht.“ (Ströker, 67)
22 Eugen Fink beschreibt diesen Vorgang so: „Im natürlichen Leben leben wir auf die Dinge hin, wir identifizieren sie in einer Vielzahl von Perspektiven und Aspekten, achten dabei jedoch nicht auf die Aspekte. Wir durchleben das Mannigfaltige im Hinblick auf das Identische. Husserl kehrt diese Lebenseinstellung um; er dröselt in einer minutiösen Akribie die gegenständlichen Sinneinheiten auf, bezieht sie zurück auf die Mannigfaltigkeit der identifizierten Bewußtseinsweisen und löst selbst noch die Bewußtseinsakte auf, zerfasert die Akte in die Phasen, die Phasen in die fließenden Zeitmomente, vollzieht eine gigantische Vivisektion des Bewußtseins. Eine unheimliche Schärfe der Beobachtung, eine Subtilität der Analyse, der es auf winzigste Sinn-Nuancen ankommt, äußern sich darin, daß Husserl Hunderte von Parallelanalysen durchführt. Mit einer Entschiedenheit, die an Besessenheit grenzt, hält er die analysierende Reflexion gegen das Stromgefälle des Bewußtseinslebens fest, arbeitet geradezu Bewußtseins-Differentiale heraus und kommt so im Gegenstoß gegen die Verschließungstendenz immer tiefer in den Grund des sinnschöpferischen Lebens zurück“ (Fink, Nähe und Distanz, 219 f).
23 In dem Sinne erweist sich Derrida als würdiger Nachfolger Husserls, dessen feinsinnige und detaillierte philosophische Methodik ebensolches „Wechselgeld“ bis hin zu Falschgeld beinhaltet.
24 Vgl. dazu: Hua XIII, XXIV.
25 Vgl. dazu: Hua XIII, XXII.
26 Vgl. dazu: Hua XIII, 1.
27 „Es ist also nicht so, dass ich erst solipsistisch meine Dinge und meine Welt konstituiere, dann einfühlend das andere Ich erfasse, das für sich solipsistisch als seine Welt konstituierend erfasst wird, und dass dann erst die eine und andere konstituierte Einheit identifiziert würde, sondern meine Sinneinheit ist dadurch, dass die indizierte fremde Mannigfaltigkeit nicht geschieden ist von meiner, eo ipso dieselbe wie seine eingefühlte. Erst wenn ich den Andern als konstituierendes Ich für sich betrachte, finde ich das Sinngebilde als von ihm konstituiert und rechne es ihm und seiner Immanenz zu“ (Hua XIV, 10).
28 „Ein äusserer Körper wird als ‚ein Leib‘ apperzipiert und nicht bloss als ein Körper. Er wird so apperzipiert vermöge seiner typischen Ähnlichkeit mit meinem Leib, zusammenhängende Geschehnisse an ihm analog äusseren Geschehnissen an meinem Leib, die eine Parallele in meiner ‚Innerlichkeit‘ haben und dies demgemäss am dortigen Körper mitfordern“ (Hua XIV, 3).
29 „Fremdes Bewusstsein nehme ich auf Grund der Einfühlung an. Man könnte sagen: Es ist doch ein Analogisieren und setzt seinem Wesen nach als eine letzte Erfüllung die Möglichkeit adäquater Wahrnehmung voraus. Also die Möglichkeit muss bestehen, dass mein Einfühlen sich in einem Wahrnehmen der Erlebnisse des Anderen letzterfüllt. So, wie ein Bildglaube sich erfüllt, wenn ich die Sache selbst sehe und als die bildlich gemeinte erkenne. Nun, in diesem Falle meint das Bildvorstellen eine Dingsache, die ihre Stelle in der Welt hat, also dazu gehört eine Vorstellung, die mich intentional auf einen gewissen Weg hinweist, auf dem ich zur ‚Sache‘ selbst hingehen und sie selbst sehen kann“ (Hua XIII, 8 f).
30 „So unterscheide ich also im Sinn der individuellen Unterscheidung mein Bewusstsein von dem eines Anderen auf dem Grunde der wirklich und eigentlich vollzogenen Reflexion auf der einen Seite und Einfühlung auf der anderen. Mit der Einfühlung ist Setzung vollzogen. Natürlich kann die Setzung falsch sein, der Andere ist gar keine Person, es ist ein lebloses Ding, eine Puppe u. dgl. Aber die Evidenz des Unterschiedes gründet in den Apperzeptionen und nicht in der Setzung. Und der Unterschied ist wirklich, wenn die Setzung berechtigt ist. Ob sie es aber ist, das hängt von der Begründung ab, und diese fordert keineswegs das Unmögliche, dass ein anderes Bewusstsein mein Bewusstsein sein soll“ (Hua XIII, 4).
31 Hua XIII, 5.
32 „Es fragt sich, ob nicht die Beziehung auf andere Subjekte auch mitwirkt bei der Konstitution des einheitlichen Raumes. Jedenfalls haben wir diese eigentümlichen Identifikationen, in denen von mir gesehene und von dem Andern als gesehen (in korrelativen Erscheinungen) supponierte Dinge identifiziert werden und so Dinge zu Gemeindingen von vielen Ich werden. Viele Ich – ein Raum, eine Zeit, eine Dingwelt für alle“ (Hua XIII, 11).
3. Limesqualität und work in progress: Die Phänomenologie im Werk Edmund Husserls
Wie, wenn wir hingingen und Anfänger würden, nun, da sich vieles verändert […] Eine veränderte Welt. Ein neues Leben voll neuer Bedeutungen. Ich habe es augenblicklich etwas schwer, weil alles zu neu ist. Ich bin ein Anfänger in meinen eigenen Verhältnissen. Rainer Maria Rilke, Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge
Die Phänomenologie Edmund Husserls (1859–1938) ist wie kaum eine andere Philosophie prägend für die europäische Geistesgeschichte. Namen wie Martin Heidegger33, Edith Stein34, Jean Paul Sartre35, Maurice Merleau-Ponty36, Ludwig Landgrebe37, Eugen Fink38, Paul Ricoeur39, Emmanuel Lévinas40, Jacques Lacan41 oder Jacques Derrida42 sind mit der Phänomenologie und mit Husserls Werk verbunden.43 In der jüngeren Vergangenheit haben sich so unterschiedliche Philosophen wie Theodor W. Adorno44, Ortega Y. Gasset45, Nikolas Luhmann46, Karl Popper47, Eric Voegelin48, Jean Gebser49, Hermann Schmitz50, Jürgen Habermas51 oder Karen Gloy52 mit Edmund Husserls Ideen auseinandergesetzt.53 Boris Groys sieht Husserls Philosophie als einen auf Absolutheit ausgerichteten Entwurf einer auf absolutes Wissens hin angelegten Philosophie an, der weder widerlegt noch überholt sei.54
Es gibt Husserl-Institute in Freiburg55, Köln56, Leuven57, Paris58 und New York59