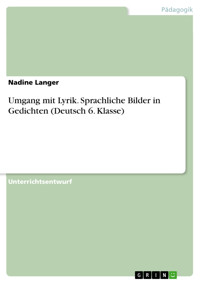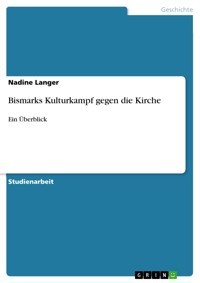13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2015 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 2,0, Universität Rostock (Philosophische Fakultät), Veranstaltung: Proseminar, Sprache: Deutsch, Abstract: Im Fokus der Arbeit steht der fünfte veröffentlichte Zamonien-Roman von Walter Moers „Der Schrecksenmeister“, der 2007 veröffentlicht wurde, und die Intertextualität, die sich darin verbirgt. Der Prätext des Romans „Der Schrecksenmeister“ ist das Märchen „Spiegel das Kätzchen“ aus der Buchreihe von Gottfried Keller „Die Leute von Seldwyla“. Wenn die Inhalte beider Werke gegenübergestellt werden, lässt sich relativ schnell erkennen, dass es sich nicht nur um eine Anlehnung an Kellers Märchen handelt, sondern der gesamte Plot weitestgehend übernommen wurde und in die zamonische Welt eingefügt wurde. An dieser Stelle stellt sich dann die Frage inwieweit dabei noch von Intertextualität und nicht aber vom Abschreiben zu sprechen ist. Im Folgenden soll diese Problematik geklärt werden, unter anderem auch im Zusammenhang mit der Intertextualitätsthematik von Gérad Genette, mit dessen Hilfe die Einordnung in das literarische Feld der Hypertextualität deutlich gemacht werden soll, was eine kritische Auseinandersetzung mit der Thematik erleichtert. Im Weitern soll auch gezeigt werden welche weiteren Prätexte es gibt und welche Rolle sie spielen. Walter Moers, geboren am 24.05.1957 in Mönchengladbach, gilt als erfolgreicher deutschsprachiger Autor. Seit mehreren Jahren veröffentlicht, der nur selten in der Öffentlichkeit auftretende Autor, seine parodiegefüllten Werke. Schon 1988 wurde er mit der Herausgabe von der Geschichte um den Käpt`n Blaubär bekannt, die durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Medien publik wurde. Grundlegend sind seine Comics und Geschichten durch Satiren und Parodien geprägt. Hinzu kommt, dass in seiner Romanreihe, rund um Geschichten über den fiktiven Kontinent Zamonien, eine Fülle an Intertextualität und Intermedialität zu finden sind. Dies allein würde für eine literaturwissenschaftliche Betrachtung ausreichen. Aber auch die Art des Schreibens, ausgezeichnet durch Verweise, Anspielungen auf Fremdtexte, diverse Wortspiele und Anagramme, die dem Leser Aufschluss über die Zusammenhänge der literarischen Welt geben können, und auch die Vielzahl von Illustrationen, die sich durch die Bücher ziehen, zeichnen diese Romanreihe besonders aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Autorenschaft: Gottfried Keller, Hildegunst von Mythenmetz und Walter Moers
3. Intertextualitätsbegriffe und deren Bedeutung für den Roman
4. „Spiegel das Kätzchen“ vs. „Der Schrecksenmeister“
5. Intertextuelle Bezüge
5.1. Echo das Krätzchen
5.2. Der Baum der Erkenntnuss
5.3. Die Schreckseneichen
6. Fazit
7. Quellen- und Literaturangaben
1. Einleitung
Walter Moers, geboren am 24.05.1957 in Mönchengladbach, gilt als erfolgreicher deutschsprachiger Autor. Seit mehreren Jahren veröffentlicht, der nur selten in der Öffentlichkeit auftretende Autor, seine parodiegefüllten Werke. Schon 1988 wurde er mit der Herausgabe von der Geschichte um den Käpt`n Blaubär bekannt, die durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Medien publik wurde. Grundlegend sind seine Comics und Geschichten durch Satiren und Parodien geprägt. Hinzu kommt, dass in seiner Romanreihe, rund um Geschichten über den fiktiven Kontinent Zamonien, eine Fülle an Intertextualität und Intermedialität zu finden sind[1]. Dies allein würde für eine literaturwissenschaftliche Betrachtung ausreichen. Aber auch die Art des Schreibens, ausgezeichnet durch Verweise, Anspielungen auf Fremdtexte, diverse Wortspiele und Anagramme, die dem Leser Aufschluss über die Zusammenhänge der literarischen Welt geben können, und auch die Vielzahl von Illustrationen, die sich durch die Bücher ziehen, zeichnen diese Romanreihe besonders aus. 1999 erscheint das erste Buch der Zamonien-Reihe, „Die 13 ½ Leben des Käpt`n Blaubär“. Moers schuf hier eine Verbindung zu seinen Jugendbüchern und brachte so einen Übergang zu einer „Abenteuerversion, die speziell für Erwachsene gedacht ist.“[2] Der Autor präsentiert seiner Leserschaft eine phantastische, fiktive Welt mit einer Vielzahl von Fabelwesen, die er durch die kreativsten Benennungen in seinem Buch „Zamonien. Entdeckungsreise durch einen phantastischen Kontinent“, wie in einer Art Lexikon, zusammenbringt. Im Fokus soll der fünfte veröffentlichte Zamonien-Roman stehen: „Der Schrecksenmeister“, der 2007 veröffentlicht wurde, und die Intertextualität, die sich darin verbirgt. Einen Aufschluss darauf, zeigt sich schon bei der Betrachtung des Untertitels: „Ein kulinarisches Märchen aus Zamonien von Gofid Letterkerl. Neu erzählt von Hildegunst von Mythenmetz. Aus dem Zamonischen übersetzt und illustriert von Walter Moers“. Allein an dieser Stelle wird die literarische Spannbreite sichtbar, die der Autor mit diesem Roman abdeckt. Dabei findet sich auch der Verweis darauf, dass es einen Prätext geben muss, dieser ist von dem Autor Gofid Letterkerl. Das Anagramm was sich dahinter verbirgt ist leichter zu erkennen als an manch anderen Stellen im Roman. Hierbei handelt es sich um den Autor Gottfried Keller, der eine Spiegelung zu dem Autor des fiktiven Prätextes sein soll. Also befindet sich der Leser zwischen Fiktion und Realität, die aber auf eine einzigartige Weise dargestellt wird. Im weiteren Verlauf wird auf diese Problematik weiter eingegangen.
Der Prätext des Romans ist das Märchen „Spiegel das Kätzchen“ aus der Buchreihe von Gottfried Keller „Die Leute von Seldwyla“. Wenn die Inhalte beider Werke gegenübergestellt werden, lässt sich relativ schnell erkennen, dass es sich nicht nur um eine Anlehnung an Kellers Märchen handelt, sondern der gesamte Plot weitestgehend übernommen wurde und in die zamonische Welt eingefügt wurde. An dieser Stelle stellt sich dann die Frage inwieweit dabei noch von Intertextualität und nicht aber vom Abschreiben zu sprechen ist. Im Folgenden soll diese Problematik geklärt werden, unter anderem auch im Zusammenhang mit der Intertextualitätsthematik von Gérad Genette, mit dessen Hilfe die Einordnung in das literarische Feld der Hypertextualität deutlich gemacht werden soll, was eine kritische Auseinandersetzung mit der Thematik erleichtert. Im Weitern soll auch gezeigt werden welche weiteren Prätexte es gibt und welche Rolle sie spielen.