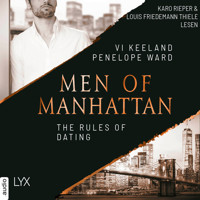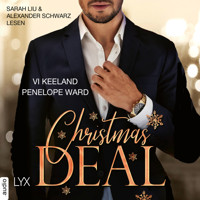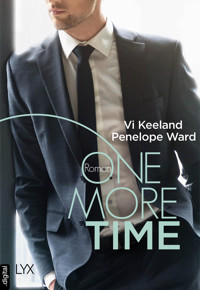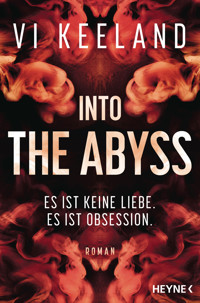
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Spiel mit der Moral, das in einen gefährlichen Abgrund führt
Nach einem tragischen Verlust ist die erfolgreiche New Yorker Psychiaterin Dr. Meredith McCall nur noch ein Schatten ihrer selbst – bis sie auf Gabriel Wright trifft, der mit ihrem schmerzvollsten Kapitel verbunden ist. Wie kann er so unbeschwert weiterleben, während ihr Leben in Scherben liegt? Aus der zufälligen Begegnung wird schnell eine düstere Obsession.
Als Gabriel schließlich unwissend in ihrer Praxis auftaucht, steht Meredith vor einer Entscheidung, die alles gefährdet – ihre Karriere, ihre Moral und ihre geistige Gesundheit. Was als harmlose Neugier begann, wird zu einer gefährlichen Anziehung, die sie in den Abgrund reißt. Doch was sie über Gabriel erfährt, könnte alles zerstören, woran sie je geglaubt hat. Und die wahre Katastrophe steht noch bevor.
Spice-Level: 4 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
VI KEELAND
INTOTHE ABYSS
ROMAN
Aus dem Amerikanischen von Nicole Hölsken
WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN
Die Originalausgabe THEUNRAVELING erschien erstmals 2024 bei Atria/Emily Bestler BooksDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe 11/2025
Copyright © Vi Keeland
Copyright © 2025 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Redaktion: Friederike Römhild
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-32023-2V002
www.heyne.de
Für Kennedy, der noch vor mir an dieses Buch glaubte
KAPITEL 01
JETZT
Genau so haben wir uns früher auch angesehen. Ehe du gegangen bist und alles kaputtgemacht hast.
Der Mann legt der lächelnden Frau den Schal um den Hals, dann beugt er sich vor und gibt ihr einen Kuss auf die Nasenspitze. Gewaltsam reiße ich den Blick vom Schaufenster los und setze meinen Weg fort. Vielleicht hilft es mir ja, eine weitere Meile zu laufen – um einen freien Kopf zu kriegen und wieder klar denken zu können. Und mir zu überlegen, was ich mit dem restlichen Tag anfangen soll. Mit meinem restlichen Leben.
Noch einen Block, dann zwei. Hinter einer Menschentraube an der Ampel bleibe ich stehen. Eine Frau schaut auf ihr Handy nach der Uhrzeit, ein Kind schwankt unter dem Gewicht seines Schulranzens voller Bücher, ein Geschäftsmann in einem Fünftausend-Dollar-Anzug geifert in sein Telefon, dass irgendein Geschäft geplatzt ist.
Er ist wütend. Braucht vermutlich eine Therapie. Wie die meisten von uns. Wie ich auch.
Ganz besonders ich.
Ein halbwüchsiges Mädchen raucht einen Joint, während sie zur Musik in ihren Kopfhörern mit dem Kopf wippt. Ein Typ um die zwanzig in Baggy-Jeans und T-Shirt bemüht sich offensichtlich, cool zu bleiben und sich nicht anmerken zu lassen, dass er sich eigentlich den Arsch abfriert.
Eines jedoch unterscheidet all diese Menschen deutlich von mir – sie scheinen alle irgendein Ziel zu haben.
Aber wahrscheinlich sehe ich auch so aus, als hätte ich eines. Die Kunst, so zu tun, als ob, beherrsche ich neuerdings schließlich aus dem Effeff, stimmt’s?
Aber die anderen werden schon bald bei ihren Familien oder ihrem Hund oder ihrem Videospiel zu Hause sein, während ich immer noch durch die Straßen laufe. Auf der Suche nach irgendetwas, ohne zu wissen, wonach. Immerhin bin ich noch nicht völlig durchgeknallt und weiß, dass ich es vielleicht nie finden werde.
Vielleicht sollte ich mir einen Hund anschaffen. Dann hätte ich zumindest einen Grund für all diese Spaziergänge. Den müsste ich natürlich füttern. Müsste mich jeden Morgen früh aus dem Bett schälen, um mit ihm Gassi zu gehen, damit er mir nicht die Teppiche ruiniert. Ihm Liebe und Zuneigung schenken.
Ich schlucke den Kloß in meinem Hals herunter. Dazu wäre ich momentan nicht fähig. Und auf Letzteres könnte ich mich schon gar nicht einlassen.
Als die Ampel auf Grün umschlägt, lasse ich mich von der voranbrandenden Menge über die Straße tragen. Dann biege ich um irgendeine Ecke, und Sekunden später lande ich in einer Wohnsiedlung. Ich werde langsamer, weshalb mich ein Passant überholt. Wieder einer, der ein Ziel hat.
Ein Windstoß bringt die Blätter zum Rascheln, und die gelben und orangenen Farben eines Ginkgo-Baumes regnen auf mich herab. Beinahe hätten wir hier in Gramercy Park gewohnt – in einem dieser Sandsteinhäuser. Mit einem hellblau gestrichenen Eingangsbereich und einem Praxisfenster mit Blick auf die Stadt. Ob alles anders gekommen wäre, wenn wir uns für dieses Haus statt für die Wohnung entschieden hätten? Hätte unser Leben dann eine andere Richtung eingeschlagen, und stündest du dann genau in diesem Augenblick neben mir?
Ich lasse mich von meiner Fantasie davontragen. In diese Gegend zieht man, wenn man eine Familie gründen will. Vielleicht hätten wir mittlerweile ein Baby. Vielleicht hätte ich mir ein Jahr freigenommen. Vielleicht wäre ich aufmerksamer gewesen und hätte gemerkt, wie schlecht es wirklich um uns stand. Wenn du immer noch hier wärst, wärest du momentan vermutlich gerade unterwegs – auf dem Weg zu einem Spiel in Michigan oder Kanada. Meine Praxis würde florieren, statt einen langsamen Tod zu sterben. Vielleicht hätten wir uns ein Au-pair genommen. Vielleicht … nur vielleicht.
Wieder ein Windstoß, der schneidend durch meinen offenen Mantel fährt. Hastig ziehe ich ihn zu und binde den Gürtel enger um die Taille. Ich bin schon seit Stunden unterwegs und sollte wirklich heimgehen. Aber warum?
Die Äste der Bäume schaukeln hin und her. Blätter wehen über meine Schuhe. Ein einzelnes gelbes wirbelt nach oben und verfängt sich in meinem Haar. Ich strecke die Hand danach aus, um es herauszuziehen, als ein Taxi nur wenige Zentimeter an mir vorbeizischt und der Fahrtwind mich wie ein Schlag ins Gesicht trifft. Mist. Ich habe nicht mal gemerkt, dass die Ampel rot ist. Ich weiche auf den Bürgersteig zurück und pralle mit einer Person zusammen. Beinah falle ich hin.
»Ma’am? Geht es Ihnen gut?«
Eine Frau um die zwanzig im Burberry-Trenchcoat, die eine Zweijährige in passender Jacke und mit Zöpfen auf der Hüfte trägt. Ein weiteres Kleinkind liegt in einem Vintage-Kinderwagen und nuckelt am Daumen.
Ein flüchtiger Blick auf das, was hätte sein können. Was nie sein wird – und zwar deinetwegen.
Ich lange in meine Manteltasche und streiche über den Schlüsselanhänger. Deinen Schlüsselanhänger. Der mich an all unsere Hoffnungen und Träume erinnert. Er beruhigt mich. Zumindest soweit mich dieser Tage überhaupt irgendetwas beruhigen kann.
»Ma’am?« Die Frau hatte ich schon wieder vergessen. Sie tritt näher. »Geht es Ihnen gut?«
Ich wende den Blick ab. Ihre kleine Familie kommt meinen Träumen zu nah. Ich bin untröstlich. »Bestens. Danke.«
Ich kehre auf dem gleichen Weg zurück, den ich gekommen bin, nur schneller als eben. Ich flüchte. Doch wovor? Egal. Ich starre auf den grauen Asphalt hinab, dann in den grauen Himmel hinauf. Im Schaufenster erhasche ich einen Blick auf mein Spiegelbild – ein bleiches, schmales Gesicht, zu ausgeprägte Wangenknochen, ein allzu kantiges Kinn. Leere Augen, die früher einmal leuchtend grün waren, doch jetzt stumpf geworden sind und ebenfalls grau wirken. Ich sollte mir Strähnchen machen lassen, um mein Straßenköterblond ein wenig aufzupeppen.
Über einer Tür klingelt eine Glocke und weckt meine Aufmerksamkeit. Im Fenster entdecke ich ein junges Paar. Die beiden lächeln schüchtern vor sich hin und umfassen ihre Kaffeebecher aus Pappe mit den Händen. Ich husche hinein, stelle mich an, verliere mich erneut in der Anonymität der Großstadt.
Blinzelnd schaue ich mich um. Hier war ich noch nie, an dieser Ecke, in diesem Coffeeshop. Ist der neu? Ich habe gar nicht bemerkt, wie sehr sich die Welt um mich herum im letzten Jahr verändert hat.
Die Menschen in der Schlange rücken auf, und ich lasse mich mitziehen. Du hättest diesen Ort gehasst. Die grelle Beleuchtung, den Lärm der Gespräche von ungefähr dreißig Leuten, das Zischen des Kaffeevollautomaten beim Milchaufschäumen, das Surren des Mahlwerks. Und dass man sieben Dollar für einen Kaffee zahlt.
»Guten Tag. Was kann ich für Sie tun?« Die Frau mit klebrigem Lächeln und blondem Pferdeschwanz giert ein wenig zu sehr nach meiner Bestellung.
»Kaffee. Schwarz, bitte.« Ich zahle bar, nehme das Wechselgeld entgegen und rücke in der Schlange langsam weiter. Mein Blick bleibt an einem Cranberry-Orangen-Scone hängen. Ich versuche mich daran zu erinnern, ob ich heute schon etwas gegessen habe.
»Meredith? Kaffee, schwarz«, ertönt eine Stimme.
Ich ziehe einen Handschuh aus, um den Pappbecher in die Hand zu nehmen und die Wärme in meine Haut ziehen zu lassen, während ich mich im Raum nach einem freien Tisch umsehe. Es gibt nur einen einzigen – in der Nähe des Ausgangs mit Blick auf die Straße. Immerhin kann ich die Leute draußen beobachten. Auf den Gehsteigen wimmelt es von Passanten, Touristen mit Einkaufstüten in den Händen, die zu den Hochhäusern hinaufstarren, und Einheimische, die vor sich hin grummeln, wenn sie ihnen ausweichen müssen. Innerhalb weniger Minuten kommen und gehen unzählige Menschen. Ein Meer aus Gesichtern, so viele, dass sie ineinander verschwimmen.
Aber dann … kommt mir plötzlich eines vertraut vor. Da ist ein Gesicht in der Menge, das ich kenne.
Ich beuge mich vor, ignoriere die Tischkante, die sich in meine Rippen bohrt, während ich den Mann anstarre. Unwillkürlich wandert meine Hand auf meine Brust, als das Erkennen in Bestürzung umschlägt. Und mein Herz wild davongaloppiert.
Das kann doch nicht wirklich er sein.
Oder doch?
Olivfarbene Haut, dunkler Bart, schlanke Gestalt. Während er in sein Handy spricht, verziehen sich seine Lippen zu einem Lächeln. Dann lacht er, die Art von Lachen, die seine ganze Brust zum Vibrieren bringt, während er den Kopf in den Nacken legt und zum Himmel emporlächelt. Wenn er es wäre, würde er nicht lachen – er könnte gar nicht lachen. Immerhin hat er erheblich Schlimmeres durchgemacht als ich.
Ich drücke meinen Becher so stark zusammen, dass der Kaffee überschwappt und mir die Hand verbrüht. Als ich den Schmerz spüre, sehe ich die rote Haut.
Es fühlt sich gut an. Das Brennen erfüllt mich mit einem seltsamen Gefühl der Erleichterung.
Keine normale Reaktion. Später werde ich sicher genauer darüber nachdenken und sie stundenlang analysieren. Aber im Moment … kann ich nur wieder zum Fenster hinaussehen. Er ist erheblich interessanter.
Ich springe vom Stuhl auf, werfe den Kaffee, den ich kaum angerührt habe, in den nächsten Mülleimer und bin innerhalb weniger Sekunden zur Tür hinaus, die polternd hinter mir ins Schloss fällt. Der Mann schreitet den Bürgersteig hinab, schlängelt sich zwischen den Fußgängern durch, sodass es leicht ist, ihn nicht aus den Augen zu verlieren und ihm zu folgen – und so haste ich hinterher.
Es ist, als würde ich einem Geist hinterherjagen.
Nur dass nicht er derjenige ist, der gestorben ist.
Sondern sie.
Wir stecken hier fest. In der Vorhölle.
Ich. Und er.
Gabriel Wright. Als ich ihn das letzte Mal sah, fühlte ich mich fast genauso wie jetzt. Betäubt. Distanziert. Ungläubig. In jener Nacht.
Wieder lasse ich die Hand in meiner Tasche abtauchen, taste nach deinem Schlüsselanhänger, der mir dabei helfen soll, die schlimmen Erinnerungen abzuschütteln. Aber mir bleibt keine Zeit, um mich zu beruhigen, denn ich drohe zurückzufallen. Ich beschleunige meinen Gang, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren. Gabriel umrundet eine Ecke, die Hände in den Taschen vergraben. Er verlässt Gramercy und schlägt den Weg nach Süden Richtung East Village ein. Wir sind nicht die einzigen beiden Personen, die hier entlanglaufen. Ich laufe hinter drei Frauen her, an deren Ellbogen übergroße Einkaufstaschen hängen – wie Trophäen, die sie von der Jagd mit nach Hause bringen. Touristen. Sie sind die perfekte Tarnung für meine eigene Jagd.
Ich will wissen, was er tut, wohin er geht. Warum er ausgerechnet hier ist, und vor allem – erneut habe ich sein Gesicht vor Augen, lachend, lächelnd – ob er wirklich glücklich ist? Sogar glücklich genug, um zu lachen. Um nach dem, was du getan hast, tatsächlich wieder Freude zu empfinden?
An einem Zeitungsstand vor uns bleibt Gabriel stehen. Ein Schwall von Anzugträgern ergießt sich aus einem Gebäude auf den Gehsteig hinaus. Es ist jetzt kurz nach sieben. Seit neun Uhr morgens bin ich unterwegs und wandere umher. Ich sollte nach Hause gehen. Mir etwas zu essen kommen lassen, mir eine Beschäftigung suchen …
Aber ich kann mich nicht von ihm losreißen. Ich presse das Handy ans Ohr, um mein Gesicht zu verbergen, während er den Blick über den Gehweg schweifen lässt und darauf wartet, bis er an der Reihe ist. Er hebt die Hand, zahlt die Zigaretten mit seinem Handy – irgendeine Marke in einer weißen Packung – und verstaut sie in seiner Hosentasche.
Plötzlich will ich ihm unbedingt näher sein. Wahrscheinlich würde er mich nicht erkennen. Wir sind uns nie begegnet – oder einander zumindest nie offiziell vorgestellt worden. Nein. Wir sind lediglich zusammen durch die Hölle gegangen – nur wenige Räume voneinander entfernt.
Du in dem einen.
Seine Frau und sein Kind in dem anderen.
Ich schlucke die Galle herunter, die der Kaffee auf nüchternen Magen und der Stress in die Kehle steigen lässt, und renne beinahe über den Bürgersteig – einem Mann hinterher, von dem ich mich definitiv fernhalten sollte.
Gabriel bleibt noch einen Augenblick lang am Zeitungskiosk stehen. Lächelt wieder. Plaudert mit dem Mann hinter dem Tresen.
Ich weiche einen Schritt zurück, lehne mich an die Backsteinwand eines Gebäudes und hole ein kleines Notizbuch hervor, in dem ich meine To-do-Listen notiere. Schon seit Wochen, vielleicht Monaten habe ich nichts mehr darin notiert. Schließlich hat es keinen Zweck, eine To-do-Liste zu führen, wenn es nichts zu tun gibt. Aber jetzt kritzele ich los.
Gabriel Wright.
Nochmals überprüfe ich die Uhrzeit auf meinem Handy, als sei dies ein besonderes wichtiges Detail, und schreibe dann weiter.
Donnerstag, 19:13 Uhr
Geht die East 15th Street entlang. Bleibt am Zeitungsstand an der Ecke stehen.
Raucher.
Lachend. Lächelnd. Glücklich?
Das letzte Wort macht mich stutzig. Allein die Vorstellung von Glück kommt mir heute wie eine Fabel oder gar ein Märchen vor. Wie ein Traum, an dem jedes kleine Mädchen, das in einem verkorksten Elternhaus aufwächst, teilhaben möchte, obwohl es tief im Herzen weiß, dass alles nur erfunden ist.
Gabriel schenkt dem Kioskmann ein herzliches Lächeln und wendet sich ab, um davonzuschlendern, sorglos und unbeschwert. Am liebsten würde ich ihn packen und anschreien: »Bist du wirklich glücklich?« oder vielleicht auch: »Ich weiß, dass du nur so tust, als ob. Du bist nur besser darin als ich. Du kannst dich unmöglich wieder erholt haben. Nicht nach allem, was wir dir angetan haben.«
Das kapiere ich nicht.
Ihn kapiere ich nicht.
Als er seine Schritte beschleunigt, setzt mein Herz einen Schlag aus. Ich muss ihm weiter folgen. Nein, ich habe das dringende Bedürfnis, ihm weiter zu folgen. Zum ersten Mal seit Monaten habe ich das Gefühl, ein Ziel zu haben. Eine Sehnsucht bricht weit in mir auf, wie ein Loch, das mich ganz und gar verschlucken könnte. Wie? Warum?
Ich schaue mich um, verschmelze wieder mit der Menge und fange den Blick einer jungen Frau mit langem blondem Haar und den Armen voller Bücher auf. Sie sieht aus, als wolle sie etwas zu mir sagen, doch dann wird mir klar, dass sie vermutlich nur hofft, dass ich ihr verdammt noch mal aus dem Weg gehe. Wie alle anderen in dieser Stadt außer mir, so ist auch sie in Eile. Doch nun habe ich ebenfalls ein Ziel.
Zum ersten Mal seit dir.
Keine Ahnung, wohin mein Weg führt oder was geschieht, wenn ich an diesem Ziel ankomme.
Aber ich weiß, dass ich diesem Mann folgen muss.
KAPITEL 02
DAMALS
»Beinahe hätte ich’s vergessen – ich habe eine Überraschung für dich.« Ich schlüpfte aus dem Bett und öffnete die Schublade meiner Kommode.
»Komm wieder her.« Connors Stimme klang gleichzeitig barsch und spielerisch. »Ich hab auch eine Überraschung für dich. Eine große.«
Ich kicherte, verbarg meine Überraschung in meiner Handfläche und die Hände hinter dem Rücken. »Ich weiß, wie sehr du dich vor ein paar Wochen darüber geärgert hast, deinen Schlüsselanhänger mit dem Gretzky-Trikot verloren zu haben.«
»Den hat mir mein Coach zu meinem sechsten Geburtstag geschenkt. Den habe ich sogar Wayne Gretzky an dem Abend gezeigt, als ich ihn kennenlernte und in die Profiliga aufstieg. Damals hat er mir versichert, dass man eines Tages auch Schlüsselanhänger mit meiner Trikotnummer mit sich herumtragen würde.«
Lächelnd holte ich die Hände hinter meinem Rücken hervor und öffnete die Faust. »Nun, Mr. Gretzky ist ein kluger Mann.«
Connor setzte sich in seinem Bett auf. »Heiliger Strohsack. Wo hast du den denn her?«
»Ich habe ihn anfertigen lassen.«
Die Augen meines Ehemannes füllten sich mit Tränen. Er nahm die winzige Nachbildung seines blau-roten New-York-Steel-Trikots mit der Glückszahl siebzehn in die Hand und fuhr mit dem Finger darüber.
Ich deutete darauf. »Allerdings hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Siehst du, dass die rote Farbe beinahe in den blauen Bereich auszubluten scheint und viel zu breit geraten ist? Ich wollte einen neuen Anhänger anfertigen lassen, aber ich konnte es einfach nicht abwarten, ihn dir zu geben.«
Connor lächelte. »Das ist keine Farbe. Sondern das Blut meines Gegners. Lass keinen neuen machen. Mir gefällt er so, wie er ist.«
»Das ist noch nicht alles. Der Typ, der den Anhänger gemacht hat, will sich die Rechte sichern, um ihn zu vermarkten. Ich habe ihm die Nummer deines Agenten gegeben, und jetzt handeln die beiden tatsächlich einen Vertrag aus. Für den Anfang würde er eine halbe Million herstellen. Stell dir doch nur all die sechsjährigen Jungen vor, die mit diesem Schlüsselanhänger herumlaufen und davon träumen, eines Tages wie du zu sein.«
Connor zog mich an sich und umfing meine Wange mit der Hand. »Danke. Ein wunderbarer Gedanke.«
Ich rieb meine Nase an seiner. »Gern geschehen.«
»Ich will dir auch etwas schenken, Mer.«
Ich grinste und verdrehte gespielt entnervt die Augen. »Das hatten wir doch schon.«
»Ach ja? Tatsächlich?« Ohne Vorwarnung hob er mich vom Bett und in die Luft. Ich schrie auf, und Connor setzte mich rittlings auf seinen Schoß. »Weißt du noch, was ich dir bei meinem Heiratsantrag gesagt habe?«, fragte er.
»Was denn?«
»Ich habe dir gesagt, dass ich mir mein Leben lang immer nur eines gewünscht habe: eine Hockey-Meisterschaft zu gewinnen. Aber seit dem Tag, an dem ich dich kennengelernt habe, ist das nicht mehr genug. Ich brauche drei Dinge. Dich. Die Meisterschaft. Und eine Familie. Zu meinem Glück hast du mich geheiratet. Und vor sechs Monaten wurde mein Traum vom Hockey-Championship wahr. Nun fehlt nur noch eines, um mein Leben vollkommen zu machen: eine Familie. Ich will ein Kind haben. Ich weiß, dass ich wegen der Spiele häufig unterwegs bin, aber wann immer ich zu Hause bin, werde ich dich voll und ganz unterstützen. Versprochen. Willst du von mir ein Kind bekommen, Mer?«
Ich hielt mir die Hand vor den Mund. »Wirklich?«
Er nickte. »Wirklich. Ich weiß, dass du gerade erst deine Praxis so aufgebaut hast, wie du es wolltest. Deshalb könnte ich verstehen, wenn du noch warten willst. Aber ich bin bereit, sobald du es bist, Baby. Mehr als bereit.«
Connor hatte recht. In den letzten Jahren, seit ich mich selbstständig gemacht hatte, hatte ich mir den Arsch aufgerissen. Ich hatte in gleich zwei Krankenhäusern und dem Psychiatrischen Zentrum gearbeitet, hatte die schlimmsten Bereitschaftsdienste übernommen, nur um Patienten überwiesen zu bekommen. Jetzt einen Schritt zurückzutreten, würde nicht leicht sein. Aber gab es überhaupt jemals einen perfekten Zeitpunkt, um ein Kind zu bekommen?
»Ich könnte eine Teilzeitpsychiaterin als Aushilfe einstellen. Vielleicht eine Mom, die gern wieder arbeiten würde, aber nur halbtags Zeit hat oder so.« Ich nickte. »Ich kriege das schon hin. Wir kriegen das hin.«
Connors Lippen verzogen sich zu einem breiten, jungenhaften Grinsen. »Wir kriegen ein Baby«, flüsterte er.
Die Vorstellung raubte mir ein wenig den Atem. Ich schluckte. »Wir kriegen ein Baby.«
»Als Erstes will ich einen Jungen. Dann ein Mädchen. Und dann vielleicht noch drei oder vier weitere Jungen.«
»Oh … immer mit der Ruhe, mein Großer. Das wären dann fünf oder sechs Kids. Wie wär’s, wenn wir erst mal mit einem anfangen und abwarten, wie es läuft? Immerhin wird sich unser Leben durch das Kind schlagartig verändern.«
»Ganz wie du willst, meine Schöne.« Er strich mir eine Locke hinters Ohr. »Aber es wird eine gute Veränderung sein. Ich sehe nichts als glückliche Tage vor uns, und zwar für den Rest unseres Lebens.«
KAPITEL 03
JETZT
Zum ersten Mal einzutreten, ist am schlimmsten.
Den Flur hinabzugehen, vorbei an den geschlossenen Türen, hinter denen sich Menschen wie ich verbergen, bereit, eine Diagnose über jemanden zu stellen, der ihnen noch vor einer Stunde völlig fremd war. MD, PsyD, PhD – Neurologen, Psychiater, Psychologen – allerlei hochtrabende Bezeichnungen und Titel, die den Namen beigefügt sind. Natürlich war mir immer klar gewesen, wie einschüchternd es für meine Patienten sein musste, meine Praxis zu betreten, aber wie schlimm es tatsächlich sein konnte, hatte ich damals nicht wirklich verstanden. Bis heute. Nachdem sich die Ärztin selbst in eine Patientin verwandelt hat.
Mit dem Aufzug fahre ich in den dritten Stock hinauf. Dieses Gebäude sieht genauso aus wie alle anderen Bürogebäude – billig, grober Teppichboden, neutral gestrichene Wände, schwere Feuerschutztüren und zu viel Stille. Vor meinem Ziel bleibe ich stehen. 302b. Noch während ich darüber nachdenke, ob ich hineingehen soll, klingelt mein Handy. Auf dem Display erscheint der Name Jake. Mein Bruder. Ich drücke auf »Ablehnen« und nehme mir vor, ihn später zurückzurufen. Obwohl ich schon jetzt weiß, dass ich das wahrscheinlich nicht tun werde. Er will sich erkundigen, ob ich klarkomme – wie alle anderen auch, die sich gelegentlich bei mir melden. Nur dass mein Bruder mich einfach zu gut kennt. Also versuche ich, nur an guten Tagen dranzugehen, an denen ich ihm am ehesten glaubwürdig weismachen kann, dass ich glücklich bin. Allerdings sind solche Tage in letzter Zeit rar gesät.
Ich hole tief Luft und stecke das Handy wieder in die Manteltasche zurück, um erneut die Tür meines neuen Therapeuten anzustarren. Drinnen wartet ein Mann, den ich noch nie gesehen habe. Ein Fremder, dem ich erzählen soll, wie ich mich fühle. Dr. Keith Alexander. Obwohl ich die Tür noch nicht einmal geöffnet habe, wird mir übel, und ich spüre, wie mir Galle die Kehle hinaufsteigt. Meine Handflächen sind schweißfeucht. Ich wische sie an meinen Jeans ab und wünsche mir, dass das Chaos in meinem Kopf nachlässt, wenigstens ein bisschen.
Gestern haben sich meine Gedanken nicht überschlagen. Sie waren langsam. Quälend langsam wie eine Schnecke. Ich brauchte geschlagene zwanzig Minuten, um mir eine Tasse Tee zu kochen, eine Stunde, um mich fertig zu machen und die Wohnung zu verlassen. Selbst das Anziehen der Schuhe war anstrengend. Doch jetzt surrt jeder einzelne Nerv in mir, als hätte ich ein Dutzend Tassen Kaffee getrunken.
Gabriel. Ich habe Gabriel Wright gesehen.
Und er war glücklich.
Aber daran darf ich in diesem Moment nicht denken. Für diesen Mann muss ich einigermaßen normal sein. Er wird irgendetwas in sein Notizbuch kritzeln und ein »Hm-hmm« von sich geben oder ein »Darüber sollten wir ausführlicher reden«. Ich sehe ihn schon vor mir – um die fünfzig oder sechzig, graues Haar, perfekt in seiner Rolle aufgehend.
Meine Hand berührt den Türknauf. Er besteht aus poliertem Chrom, also kein Originalteil in diesem schäbigen Gebäude. Es ist kalt. Ich zögere, mein Magen knurrt. Ich habe Hunger.
Ich kann mich kaum daran erinnern, wann ich zum letzten Mal überhaupt irgendetwas gespürt habe, schon gar nicht Hunger. Bis gestern.
Ich stoße die Tür auf, und ein Mann von etwa Mitte zwanzig oder Anfang dreißig blickt auf. Er ist nicht älter als ich selbst. Dunkelblondes Haar, gebräunte Haut und ein einladendes, offenes Lächeln. Anscheinend ist Casual Friday, denn er trägt Jeans und ein blaues T-Shirt, das ihm wie angegossen sitzt, sodass man die definierten Muskeln darunter kaum übersehen kann. Ein Notizbuch liegt offen auf seinem geräumigen Schreibtisch – anscheinend sein Terminkalender. Vermutlich ist das Dr. Alexanders Assistent.
»Hallo. Ich habe um halb sieben einen Termin.«
»Sie müssen Meredith Fitzgerald sein.«
»Meredith McCall«, berichtige ich. »Ich benutze jetzt wieder meinen Geburtsnamen, hatte ihn aber noch nicht geändert, als …« Ich verstumme. Wenn Dr. Alexanders Assistent die Details nicht kennt, werde ich sie ihm jetzt wohl kaum auf die Nase binden. »… als ich den Termin vereinbart habe«, beende ich den Satz.
»Ah.« Er richtet sich kerzengerade auf und schenkt mir ein freundliches Lächeln. »Nun ja, Dr. McCall, dann kommen Sie doch herein.«
Erst als ich an ihm vorbei in seinen Behandlungsraum trete, wird mir klar, dass hinter dem Schreibtisch in der Ecke niemand sitzt. Auch auf der Ledercouch oder dem passenden Sessel ist kein älterer Arzt zu sehen. Denn der junge Mann, den ich fälschlich für seinen Assistenten gehalten habe, ist Dr. Keith Alexander. Hitze steigt mir ins Gesicht.
Wie oft hat man mich schon für eine Assistentin gehalten, nur weil ich jung und attraktiv war? Unzählige Male. Außerdem entspricht er nicht dem Bild des Arztes, den ich erwartet habe. Wie soll ich ausgerechnet mit ihm über meine erdrückende Schuld sprechen oder darüber, wie sehr ich meinen Ehemann vermisse, während ich mir gleichzeitig wünsche, ihm nie begegnet zu sein?
Ich atme aus und setze mich zögernd auf die Kante der Couch. Anders als die cremeweißen Wände in meinem eigenen Büro sind diese hier in Blau- und Grautönen gestrichen. Ein moderner weißer Tisch mit Holzplatte steht auf einem Perserteppich. Einige Meter entfernt fällt mir das Milchglasfenster auf. Tagsüber badet es seine Patienten vermutlich im Sonnenlicht.
»Ich bin Dr. Keith Alexander. Freut mich, Sie heute Abend kennenzulernen.« Er nimmt mir gegenüber Platz, schlägt die Beine übereinander und faltet die Hände im Schoß.
Trotz seines offenen, einladenden Lächelns sehe ich nicht ihn – sondern mich selbst, die sich ihren eigenen Patienten gegenüber genauso verhält. Nur jetzt nicht mehr. Nicht nach allem, was geschehen ist. Vorläufig muss meine Praxis ohne mich klarkommen.
Sein Räuspern holt mich in die Gegenwart zurück. »Kann ich Ihnen einen Kräutertee anbieten? Wasser?«
»Nein danke.« Ich stelle meine Tasche neben mir ab und schäle mich mühsam aus meiner Jacke. Hinter ihm entdecke ich die Uhr. 18:32 Uhr. Nur noch achtundfünfzig Minuten. Ich zwinge meine Lippen zu einem Lächeln, das vermutlich mehr einer Grimasse gleicht. »Oh, ehe ich es vergesse.« Ich öffne den Reißverschluss meiner Tasche und hole den in der Mitte zusammengefalteten Zettel heraus. »Das hier ist für Sie – zur Unterschrift.«
Er beugt sich vor und nimmt mir das Schreiben aus der Hand. »Was ist das?«
»Das ist für Office of Professional Misconduct – für die Dienstaufsichtsbehörde des Gesundheitsministeriums. Sie müssen nur das Datum eintragen, an dem ich mit der Therapie begonnen habe, und unterzeichnen. Eigentlich soll ich erst kommende Woche damit anfangen, was dem Ausschuss wohl zeigen wird, dass ich mich der Strafmaßnahme bereitwillig füge.«
Dr. Alexander greift nach einem Stift auf dem Beistelltisch neben sich. Er schiebt die Brille die Nase hinunter und überfliegt das Dokument, ehe er das heutige Datum einträgt und unterschreibt.
»Hier, bitte sehr.« Lächelnd gibt er mir das Blatt zurück. »Und ich bedaure, dass Sie Ihren Besuch hier als Strafmaßnahme betrachten. Ich verspreche Ihnen, mein Bestes zu geben, damit es sich nicht so anfühlt.«
»Ich … ich meinte nicht …«
Er winkt ab. »Schon gut. Ich verstehe ja. Wahrscheinlich würde es mir genauso gehen, wenn ich gezwungen wäre, einen Psychiater aufzusuchen, statt freiwillig zu kommen.«
»Danke, dass Sie das sagen. Aber ich wollte es eigentlich wirklich nicht so formulieren.«
»Schon gut. Haken wir das ab.«
»Okay.«
Wir schauen einander eine ganze Weile in die Augen. Es ist definitiv kein behagliches Schweigen.
»Also … diese ganze Situation ist ganz schön peinlich, oder?«, sage ich. »Eine Therapeutin, die eine Therapie macht.«
»Überhaupt nicht. Ich bin der Auffassung, dass alle Therapeuten eine Therapie machen sollten, zumindest gelegentlich. Genau wie wir uns einmal im Jahr körperlich durchchecken lassen, sollte ein regelmäßiger, mentaler Check-up vorgesehen sein.« Er tippt sich an den Kopf. »Wie war Ihr Tag?«
Ich ringe mir ein weiteres, nervöses Lächeln ab. »Gut. Und Ihrer?«
»Sehr gut, danke. Irgendwelche Pläne für das Wochenende?«
Ich unterdrücke ein Seufzen. Er macht Small Talk. Versucht, mir die Befangenheit zu nehmen, ehe er sich auf die eigentlichen Probleme stürzt.
»Nein«, antworte ich. »Es fällt mir momentan schwer …« Nach allem, was passiert ist, überhaupt irgendetwas zu tun. Ein Leben ohne meinen Ehemann zu planen. Vor Mittag aus dem Bett aufzustehen. »… mir irgendetwas vorzunehmen«, beende ich den Satz.
»Verstehe.« Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie er sein Gewicht verlagert und dann seine Taktik ändert. »Na ja, dann kommen wir gleich zur Sache. Wie kommen Sie nach der Tragödie, die Sie vor sieben Monaten erlebt haben, zurecht?«
Nach meiner Tragödie. Als sei mein Leben ein Shakespeare-Drama und kein Zugunglück.
Ein monotones Rauschen erfüllt mein Hirn. Ich mühe mich immer noch damit ab, die einfache Tatsache zu begreifen, dass ich jeden Morgen allein aufwache. Dr. Alexanders Sprung ins kalte Wasser überfordert mich, geht zu schnell. Ich muss erst sicherstellen, dass ich überhaupt den Kopf über Wasser halten kann, ehe ich zu schwimmen anfange.
Ich schlucke. »Könnten wir vielleicht erst mal über etwas anderes als über meinen Ehemann sprechen?«
Da, eine einfache Bitte. Ein Wunsch, den man leicht respektieren kann. Wenn meine Patientin das zu mir gesagt hätte, hätte ich nur genickt und die Frage fallen lassen. Und genau das tut auch Dr. Alexander.
»Okay, na gut, was haben Sie heute so gemacht? Können Sie mir davon erzählen?« Seine Stimme klingt sanft und freundlich. Der Ton geht mir auf die Nerven, und mein Blick wandert wieder zur Uhr. 18:35 Uhr.
Noch fünfundfünfzig Minuten.
»Wie sieht ein Tag im Leben von Dr. Meredith McCall aus?«
»Na ja, vorhin habe ich einen Spaziergang gemacht«, antworte ich. »Einen langen Spaziergang. In letzter Zeit mache ich das beinahe jeden Tag.«
»Und wie war das? Waren Sie an irgendeinem interessanten Ort?«
»Im Park«, sage ich. »Und ich habe mir einen Kaffee im Coffeeshop geholt.« Ich halte inne, ehe auch noch der Rest aus mir hervorbricht – wo ich Gabriel Wright zum zweitem Mal in Folge gesehen habe und ihm wieder eine Stunde lang gefolgt bin. Vielleicht sogar länger. Jedenfalls so lang, dass ich beinahe nicht mehr pünktlich hier erschienen wäre. »Dann habe ich ein paar Einkäufe gemacht«, beende ich meinen Tagesbericht mit einer Lüge.
»Oh? Lebensmittel oder …?« Dr. Alexander legt den Kopf schief, um Interesse zu bekunden.
»Eigentlich war es vornehmlich ein Schaufensterbummel.« Wieder ein gezwungenes Lächeln. Ich ertappe mein Bein dabei, wie es auf und ab wippt, und lege die Hand aufs Knie, um es zu beruhigen.
Er hält einen Stift in der Hand, ein kleines, gebundenes Notizbuch liegt in seinem Schoß. Bislang habe ich ihn noch nichts notieren sehen – ganz anders als ich, wenn ich Patientengespräche führe. Ich mache mir immer jede Menge Notizen.
Schreibt er nicht mit, weil er weiß, dass ich lüge?
Ihn anzulügen, ist vielleicht keine so gute Idee. Ebenso wie ich hat er vermutlich ein Gespür dafür, wann seine Patienten nicht die Wahrheit sagen. Und sind Lügen nicht teilweise überhaupt erst für dieses ganze Schlamassel verantwortlich? Ich spüre einen immer größeren Druck in mir, bis mir schließlich die Frage herausrutscht: »Ist alles, was ich hier sage, vertraulich? Ich meine, ich kenne natürlich die Regeln der ärztlichen Schweigepflicht. Aber müssen Sie Einzelheiten unserer Sitzung an die Dienstaufsichtsbehörde weitergeben, weil mir die Besuche hier vorgeschrieben wurden?«
Ich habe bei der Anhörung so viele Papiere unterzeichnet, ohne sie überhaupt gelesen zu haben. Vielleicht habe ich ja jegliches Recht auf Privatsphäre verloren – wie so viele andere Dinge auch, die ich deinetwegen verloren habe. Womöglich will er in dem Notizbuch auf seinem Schoß nicht so sehr den Gesprächsablauf festhalten, sondern eher das, was er in seinen Bericht schreiben muss. Womöglich …
»Was in diesem Raum gesprochen wird, ist vertraulich«, unterbricht seine Stimme meine Grübeleien. »Ich muss melden, wenn Sie nicht zu unseren Sitzungen erscheinen, aber was Sie mir erzählen, unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht, genau wie bei jedem anderen Patienten, den wir behandeln.«
Meine ineinander verkrampften Hände entspannen sich. Ich hole tief Luft und lasse mich auf der Couch zurücksinken.
»Okay.« Spontan entscheide ich, dass Ehrlichkeit wohl die beste Strategie ist. Zumindest hier, hinter den Mauern des Therapeutenzimmers. »Ich bin spazieren gegangen, aber ich war nicht shoppen. Stattdessen habe ich meinen Tag damit verbracht, jemandem zu folgen.«
»Zu folgen? Sie meinen, Ihnen ist jemand vorausgegangen? Oder sind Sie jemandem ohne dessen Wissen gefolgt?«
»Ohne dessen Wissen.«
Er nickt mit nichtssagender Miene – das haben wir in unserer Ausbildung beide gelernt. Seit Neuestem ist dies das einzige Gesicht, das ich der Welt zur Schau stelle, denn Mimik offenbart der Welt unsere Gefühle, und ich habe keine, scheine innerlich tot zu sein.
»Na gut. Und wem sind Sie heute gefolgt?«
»Dem Ehemann einer toten Frau.«
Dr. Alexander wölbt die Augenbrauen. Seine Maske ist verrutscht. Er lässt den Stift in seinen Fingern kreisen, dann senkt er ihn auf das Notizbuch herab und kritzelt etwas hinein, ehe er wieder aufblickt. »Erzählen Sie mir mehr.«
Eine ganze Weile schaue ich ihn nicht mehr an, sondern beobachte die sich im Wind wiegenden Bäume vor dem Fenster. Als ich endlich antworte, meide ich den Blickkontakt immer noch. »Er heißt Gabriel Wright, ist der Ehemann der Frau, die getötet wurde, und der Vater des getöteten Kindes.«
Dr. Alexander denkt schweigend über das nach, was ich ihm gerade offenbart habe. Ich spüre seinen Blick auf mir, kann ihn aber nach wie vor nicht ansehen. Zumindest noch nicht.
»Sind Sie Mr. Wright heute zum ersten Mal gefolgt?«
Ich schüttele den Kopf. »Zum zweiten.«
»Wann war das erste Mal?«
»Gestern.«
»Und aus welchem Grund haben Sie das getan?«
Ich zucke mit den Schultern. »Keine Ahnung. Ich habe ihn gestern zufällig von einem Coffeeshop aus entdeckt. Überraschend und definitiv nicht geplant. Er wirkte … glücklich. Also bin ich ihm hinterhergegangen. Und heute wollte ich mich vermutlich davon überzeugen, dass das Ganze kein Zufall war. Ob ich ihn nicht vielleicht einfach nur in einem besonderen Augenblick entdeckt habe, nachdem er zum Beispiel gerade eine gute Nachricht bekommen hat. Ich war neugierig, ob er danach doch einen niedergeschlagenen, deprimierten Eindruck machen würde.«
»Und war er das? Deprimiert? Beim zweiten Mal, meine ich?«
Wieder schüttele ich den Kopf. »Er kam mir … normal vor. Aber das kann doch einfach nicht sein.«
»Warum?«
»Wie könnte er das sein? Wie könnte er nach allem, was er verloren hat, wieder glücklich sein? An manchen Tagen wache ich in Schweiß gebadet auf und habe das Foto vor Augen, das am Morgen nach dem Unfall in der Zeitung veröffentlicht wurde. Eine Plane über einem winzigen Körper. Ein Hello-Kitty-Plüschtier wenige Zentimeter daneben auf dem Boden. Welche Bilder mögen ihn nach dem Aufwachen jeden Morgen aufs Neue heimsuchen? Nachdem er ein unschuldiges Kind und die Liebe seines Lebens verloren hat? Er hat ihr während einer Aufführung des Sommernachtstraums einen Antrag gemacht.«
Dr. Alexander macht sich weitere Notizen. »Lassen Sie mich an dieser Stelle nachhaken. Ich habe Ihre Fallakte gelesen, die der medizinische Ausschuss mir hat zukommen lassen. Aber darin finden sich keine Details über die Familie der Opfer. Kannten Sie die Familie Wright schon vor dem Unfall?«
»Nein. Wir sind uns nie begegnet.«
»Wie können Sie dann über den Heiratsantrag von Mr. Wright so genau Bescheid wissen?«
Ich blicke auf und sehe dem Arzt zum ersten Mal in die Augen. »Google. Gabriel Wright lehrt an der Columbia University. Als Englischprofessor, der sich auf Shakespeare spezialisiert hat. Dieser besondere Heiratsantrag wird in seiner Biografie erwähnt. Darin bezeichnete er seine Frau als seine Julia. Während er heute früh seine Seminare gab, saß ich unter einem Baum und habe alles gelesen, was die Suchmaschine hergab. So habe ich mir beim Warten die Zeit vertrieben.«
Dr. Alexanders Augen huschen zwischen meinen hin und her. »Wenn Sie sich vorher nie begegnet waren, wie konnten Sie Mr. Wright dann erkennen, als er Ihnen gestern über den Weg lief?«
»Ich hatte ihn durchaus schon mal gesehen. Am Abend des Unfalls hielt ich mich im Krankenhausflur auf, als der Arzt ihm den Tod seiner Frau und seines Kindes mitgeteilt hat. Er brach schluchzend auf dem Boden zusammen. Dieses Gesicht könnte ich niemals vergessen. Nur um sicherzugehen, bin ich ihm gestern trotzdem nach Hause gefolgt und habe dort die Namen auf den Briefkästen in der Lobby seines Wohnhauses gecheckt. Er war es.«
»Okay. Also haben Sie gestern zufällig Mr. Wright getroffen und wiedererkannt. Sie sind ihm gefolgt, weil Sie neugierig wurden, nachdem Sie ihn lächeln sahen. Ist das korrekt?«
»Ja.«
»Und heute? Wieso sind Sie ihm erneut gefolgt?«
»Ich bin heute früh zu seinem Wohnhaus zurückgekehrt und habe dort auf ihn gewartet, bis er rauskam.«
»Wie früh?«
»Spielt das eine Rolle?«
»Nein.« Dr. Alexander lächelt. »Wenn Sie es vergessen haben, ist es unwichtig. Aber falls Sie sich daran erinnern, wüsste ich es gern. Das heißt, falls es Ihnen nicht unangenehm ist.«
Ich hole tief Luft. »Ich habe mein Haus um vier Uhr morgens verlassen und mir einen Kaffee geholt. Wahrscheinlich war es etwa halb fünf, als ich mich vor seinem Haus postierte.«
Wieder notiert Dr. Alexander sich etwas. »Sie sind ihm also gestern gefolgt, weil Sie bei Mr. Wright Anzeichen für Glücksgefühle wahrgenommen haben. Sie wollten wissen, ob es sich um eine flüchtige Empfindung handelt oder nicht. Die Antwort auf diese Frage scheinen Sie bekommen zu haben. Weshalb also haben Sie ihn heute noch einmal im Auge behalten? Welche Informationen haben Sie sich sonst noch erhofft?«
»Ich weiß es nicht genau.« Ich schüttele den Kopf. »Vermutlich kann ich nur einfach nicht glauben, dass er das wirklich alles hinter sich gelassen hat und einfach weiterlebt. Also bin ich zurückgekehrt, um nach Rissen in seiner Fassade zu suchen.«
»Für psychische Genesung gibt es keinen festen Zeitrahmen. Sicher wissen Sie das von Ihren eigenen Patienten. Verluste zu verarbeiten, fühlt sich für jeden Menschen anders an. Wir alle trauern auf unterschiedliche Weise.«
»Das weiß ich, aber …«
Dr. Alexander wartet darauf, dass ich weiterspreche, aber ich schweige. Ich kann ihm nicht widersprechen, denn er hat recht. Zumindest theoretisch. So steht es in den Lehrbüchern. Jeder Mensch erholt sich in seinem eigenen Tempo. Dennoch weiß ich tief im Herzen, dass Gabriel Wright nicht so einfach alles hinter sich gelassen haben kann. Ein Teil des Heilungsprozesses nach einer Tragödie ist Akzeptanz, und Akzeptanz erfordert Vergebung. Doch manche Dinge im Leben sind nun mal unverzeihlich. Das kann Dr. Alexander nicht verstehen, auch wenn er es zu verstehen glaubt. Man muss es erleben, um es wirklich zu begreifen. Und heute habe ich einfach nicht die Kraft für eine solche Art der Diskussion.
Ich ringe mir ein weiteres Lächeln ab. »Sie haben recht. Wir sind alle unterschiedlich.«
»Glauben Sie, dass Sie das, was immer Sie dazu getrieben hat, ihm zu folgen, überwunden haben?«
Ich zucke mit den Schultern. »Wahrscheinlich.«
Aber eine Frau, die nicht vorhat, einen anderen Menschen weiterhin zu observieren, kauft sich vor ihrer Therapiesitzung wohl kaum einen dunklen Hoodie und ein Basecap. Und wahrscheinlich auch kein Minifernglas.
»Dr. McCall?«
Als ich ihn meinen Namen sagen höre, schaue ich wieder aus dem Fenster, fasziniert vom Wogen der Bäume. Was für ein friedlicher Anblick. Meine eigene Praxis liegt zu hoch, um sie sehen zu können.
Er lächelt herzlich, als ich ihm endlich den Blick zuwende. Ich mustere sein Gesicht. Er scheint mich nicht im Geringsten zu verurteilen. »Ist es okay, wenn ich Sie Meredith nenne statt Dr. McCall?«
»Natürlich.«
»Großartig.« Er nickt. »Wie dem auch sei, Meredith, ich glaube, wenn Sie immer noch neugierig auf Mr. Wright sind, sollten Sie lieber mit mir darüber sprechen, statt sich erneut an seine Fersen zu heften. Abgesehen davon, dass es illegal ist, jemanden zu stalken, und Sie bereits Probleme mit der Behörde haben, glaube ich, dass Sie mit dem Feuer spielen, wenn Sie sich emotional so sehr in die Frage verstricken, ob der Überlebende der Opfer Ihres Ehemannes glücklich ist.«
»Gabriel Wright ist nicht nur eines der Opfer meines Mannes.«
Dr. Alexanders Brauen ziehen sich zusammen. »Was ist er dann?«
»Er ist auch der Ehemann meiner Opfer.«
KAPITEL 04
DAMALS
»Hey, Irina.« Ich nahm meinen üblichen Platz ein, zwei Reihen hinter der Plexiglasbarriere, und wickelte meinen Schal vom Hals, während ich das Eis nach Connor absuchte. Als ich ihn unversehrt dort entdeckte, konnte ich wieder freier atmen.
Meine Freundin sah zu mir hinüber und kniff die Augen zusammen. »Alles okay mit dir?«
»Ja. Ich habe jetzt nur schon den ganzen Morgen so ein komisches Gefühl. Ohne theatralisch klingen zu wollen, aber es fühlt sich wie eine böse Vorahnung an. Gegen Mittag hatte ich es vergessen, weil ich mich um meine Patienten kümmern musste. Aber auf dem Weg zur Arena kehrte es zurück.« Ich ließ mich von der Stuhlkante nach hinten sinken. »Albern, ich weiß.«
»Es ist nicht albern. Böse Vorahnungen habe ich dauernd.«
»Echt?«
Irina grinste. »Ja, und zwar normalerweise immer etwa zehn Minuten, bevor meine zwei Jahre alten Zwillinge aufwachen.«
Ich lachte. »Na, das verstehe ich.«
»Du kommst doch sonst nie zu spät«, fuhr sie fort. »Bist du mit der Linie A stecken geblieben? Die hat schon die ganze Woche Probleme mit den Weichen. Mich hat das heute Morgen eine ganze Stunde gekostet.«
Mein Blick folgte Connors Zickzackkurs, während seine Skates ins Eis schnitten. »Nein. Der Zug war pünktlich. Aber mein letzter Patient war neu, da hat es etwas länger gedauert.«
»Hast du denn nicht auch einen dieser Timer? Wie im Kino?«
»Ich habe eine Uhr, aber wenn jemand aufgewühlt und in Schwierigkeiten ist, kann ich den Betreffenden schließlich nicht so einfach rausschmeißen. Deshalb halte ich mich nicht immer an die vorgegebene Zeit.«
Irina rieb sich über ihren Siebenmonatsbauch. »Shit. Ich täte das. Zum Teufel, wenn ich könnte, würde ich sogar das hier rausschmeißen. Die wahre Schwierigkeit besteht nämlich momentan darin, nicht dauernd in die Hose zu machen.«
Ich lachte, was sich gut anfühlte. Alles war in Ordnung. Das Spiel war bald zu Ende, wir würden uns ein paar Drinks genehmigen, und nachdem wir das Spiel mit Sex gefeiert hatten, würde ich neben meinem Ehemann einschlafen. Ja, sogar nach so einem Spiel hatte er noch jede Menge Energie. Bei dem Gedanken musste ich noch breiter lächeln.
»Apropos Schwierigkeit«, fügte sie hinzu. »Geteiltes Leid ist halbes Leid. Wann kommt ihr beiden endlich in den Quark und fangt an, kleine Eishockeyspieler in die Welt zu setzen?«
Ich zögerte, mein Lächeln verblasste. Tagein, tagaus zu vermeiden, persönliche Informationen preiszugeben, war mir in Fleisch und Blut übergegangen. Aber Irina war eine Freundin, keine Patientin. Sie und ich saßen nun schon seit vier Hockey-Saisons nebeneinander. Ihr Ehemann war Ivan Lenkov, einer von Connors Teamkameraden und engsten Freunden. Außerdem waren Irina und Ivan vor Kurzem in eine Wohnung in unserem Gebäudekomplex gezogen. Wir alle hatten zwar alle Hände voll zu tun – sie mit ihrer immer größer werdenden Familie und ich mit meiner Praxis –, aber obwohl wir so eingespannt waren, trafen wir uns mindestens einmal im Monat zum Abendessen. Wenn wir unsere Ehemänner nicht begleiten konnten, sahen wir uns zusammen sämtliche ihrer Auswärtsspiele im Fernsehen an.
»Tatsächlich habe ich letzten Monat die Pille abgesetzt.« Ich biss mir auf die Unterlippe. »Ich bin ziemlich aufgeregt. Aber auch nervös.«
»Oh, wow. Na ja, wenn Connors Sperma ebenso sportlich ist wie der Rest, bist du womöglich schon mit Drillingen schwanger.«
Ich kicherte. »Mach keine Witze. Auch nur ein einziges Kind mit unserem vollen Terminkalender unter einen Hut zu kriegen, ist schon Herausforderung genug.«
Das Gebrüll der Menge zog unsere Aufmerksamkeit wieder aufs Eis. Connor war nun Schulter an Schulter mit einem Abwehrspieler. Mit einer Hand kontrollierte er den Puck unter seinem Schläger, während er mit der anderen seinen Widersacher in Schach hielt. Es erstaunte mich immer wieder, wie viele Dinge diese Kerle gleichzeitig zuwege brachten, während sie auf einer drei Millimeter breiten Kufe balancierten. Connor segelte so mühelos über das Eis, als sei es genauso leicht wie gehen. Vermutlich war es das für ihn auch.
Sekunden später kündigte der Buzzer die Pause an. Connor folgte seinen Mannschaftskollegen vom Eis, sah sich aber nochmals nach mir um. Zwar konnte ich sein Gesicht nicht genau erkennen, war aber sicher, dass er mir zuzwinkerte. Wärme durchflutete mich, und ich winkte.
»Ihr beiden …« Irina verdrehte die Augen. Ich hatte gar nicht bemerkt, dass sie mich beobachtete. »… werft euch nach wie vor verliebte Blicke zu.«
Ich verschwieg ihr, dass mein Ehemann, der Mann, mit dem ich nun schon beinahe zehn Jahre zusammen war, mir heute grundlos Blumen geschenkt hatte. Tiefviolette und cremefarbene Hortensien. Meine Lieblingsblumen.
Ich stand auf. »Kommst du während der Pause mit in die Suite?« Die Suite war unsere Abkürzung für jenen Bereich der Spielerfrauen, zu dem nur die Ehefrauen oder die festen Freundinnen, die von einer Ehefrau eingeladen wurden, Zutritt hatten. Eigentlich hatte ich nicht viel dafür übrig. Aber Irina war gern dort. In letzter Zeit allerdings mehr wegen des kostenlosen Essens als wegen der Gesellschaft. Und für mich gab es dort Wein.
Irina hakte mich unter. »Dann führ uns mal zu den Würstchen im Schlafrock, Mädel.«
Achtzehn Minuten später saßen wir wieder auf unseren Plätzen. Das gegnerische Team lag mittlerweile in Führung, und wir umklammerten unsere Sitzkanten, reckten die Hälse und hofften, dass das Team Steel wieder punkten würde.
Allzu lang mussten wir nicht darauf warten. Nach einem Foul durch die Gegner wurde ein Penalty verhängt, und Connors Team übernahm wieder die Kontrolle. Nachdem der Spielstand plötzlich wieder ausgeglichen war und sie zudem einen Spieler mehr auf dem Eis hatten, erwachte die zuvor ruhige Menge wieder zum Leben. Irina und ich sprangen auf. Mir schlug das Herz bis zum Hals, als Connor den Puck ergatterte. Er skatete das Mittelfeld hinab, wobei die scharfen Klingen seiner Kufen bei jedem Beinwechsel Eis aufstieben ließen. Als er das Netz erreicht hatte, holte er mit dem Schläger aus.
Doch aus dem Nichts tauchte ein Verteidiger auf und rammte Connor von links, hart genug, dass er durch die Luft geschleudert wurde.
»Connor!«, schrie ich unwillkürlich auf.
Danach geschah alles wie in Zeitlupe.
Ein weiterer Verteidiger näherte sich von rechts.
Connor ruderte mit den Armen in dem Versuch, sich auf den Sturz vorzubereiten.
Aber gegen die Schwerkraft konnte er nun mal nichts ausrichten.
Er schlug auf das Eis auf. Hart.
Ein Bein nach vorn ausgestreckt, das andere nach hinten verdreht, auf eine Weise, wie sich kein Bein je verbiegen sollte.
Mein Ehemann schrie auf, so laut, dass sein Schmerzenslaut im Stadion widerhallte.
Die Menge verstummte.
Eine Sekunde lang bekam ich keine Luft mehr. Dann stürzte ich auf die Eisfläche hinunter.
Ich mochte Psychiaterin sein, war also alles andere als eine Notfallärztin, aber ich hatte Medizin studiert. Und ich wusste genug, um zu wissen, dass wir nun auf direktem Weg ins Krankenhaus fahren würden.
KAPITEL 05
JETZT
Nach einer Woche kenne ich seinen Stundenplan. Ich stehe früh auf und laufe durch die Straßen Manhattans, die langsam um mich herum erwachen. Aber ich habe keine Eile. Ich schlendere. Ich weiß, dass ich Zeit habe, ehe Gabriel sein Wohnhaus verlässt.
Kaffee an dem Stand an der Ecke. Die Schlagzeilen überfliegen, während ich auf einen Bagel warte. Die sich ständig verändernden Blätter dabei beobachten, wie sie erst gelb, dann orange, dann rot werden, jeden Tag ein wenig mehr. Ich kaue auf einem dicken Pumpernickel-Bagel mit Frischkäse und Räucherlachs herum und denke an Dr. Alexander und seinen Rat, Gabriel nicht weiter zu stalken. Ich betrachte es nicht als Stalking. Nicht wirklich. Schließlich habe ich keine bösen Absichten. Ich muss nur einfach wissen …
Ich schlucke den Bissen herunter und halte inne, stelle es mir vor: Gabriels Gesicht, das vor Glückseligkeit leuchtet.
Ich muss wissen, ob dieses Gefühl real ist.
Ich wickele den Rest des Bagels in das Papier ein und werfe es in den nächsten Mülleimer. Mein restlicher Kaffee geht denselben Weg und gibt ein volltönendes Scheppern von sich, als er auf den Boden trifft. Zwei Häuser weiter gibt es eine Buchhandlung, und nach einem schnellen Blick auf die Uhr – Gabriel wird erst in etwa zwanzig Minuten hier vorbeikommen – schlüpfe ich hinein. Der Laden hat gerade erst aufgemacht. Hinter dem Ladentisch sind die beiden Buchhändlerinnen in ein leises Gespräch vertieft, während sie Bücher einsortieren. Ich gehe an ihnen vorbei zu den anderen Bücherregalen.
Wie du das Leben erreichst, das du dir wünschst.
Geheimnisse einer glücklichen Ehe.
Das Leben ist hart. Gewöhn dich dran.
Das letzte Buch könnte glatt von mir sein …
Mein Blick bleibt an einem Aufsteller neben der Kasse hängen. Er ist fast leer – bis auf ein paar spiralgebundene Notizbücher mit leuchtenden Farbklecksen. Regenbogen und Sonnenaufgänge und dergleichen.
Eines davon nehme ich in die Hand. Auf dem Cover steht: Es ist nie zu spät, um ein neues Kapitel zu beginnen. Ich starre den Spruch an und mache eine kurze Zeitreise in die Vergangenheit, als ich noch eigene Patienten hatte. Meist riet ich ihnen, sich ein Tagebuch zu kaufen und jeden Tag hineinzuschreiben – als Teil ihrer Therapie. Dr. Alexander hat mir keine Aufgabe dieser Art gegeben, aber eine kleine, selbst auferlegte Hausaufgabe kann sicher nicht schaden. Ich blicke zur Kasse hinüber, wo die beiden Buchhändlerinnen noch immer plaudern, ohne den Kunden Beachtung zu schenken. Spontan treffe ich eine Entscheidung und verstaue das Tagebuch in meiner Tasche. Mein Herz pocht laut, Blut rauscht heiß in meine Ohren. Ich habe noch nie etwas mitgehen lassen. Und bin sicher, dass sich in meiner Brieftasche ein paar Hundert Dollar befinden, ganz zu schweigen von den zwei oder drei Kreditkarten. Keine Ahnung, warum ich das verdammte Notizbuch stehle, aber mit jedem Schritt auf dem Weg zum Ausgang habe ich das Gefühl, vor Anspannung gleich zu zerspringen. Draußen angelangt, laufe ich fast schon im Powerwalk weiter bis zur Straßenecke, wo ich rechts abbiege und in den Eingang eines Ladens schlüpfe, der noch nicht geöffnet hat. Und dann kann ich nicht anders. Ich lächele. Es fühlt sich belebend an.
Bis sich mein Herzschlag wieder beruhigt hat, vergehen ein paar Minuten. Beim Blick auf die Uhr sehe ich, dass es Zeit ist. Also begebe ich mich auf meinen Beobachtungsposten, Station eins auf meiner täglichen Gabriel-Wright-Tour. Wie üblich kommt er pünktlich auf die Minute heraus.
Ihm unentdeckt zu folgen, ist ziemlich einfach. Der morgendliche Ansturm von Menschen, die zur Arbeit, ins Gym, zur U-Bahn wollen, bietet mir Deckung. Er schreitet den Gehweg hinab, die Hände durch Lederhandschuhe geschützt tragen nichts. Er schlägt den Weg in nördliche Richtung ein. Ich lasse ihn vorübergehen, warte fünf Sekunden, dann setze ich mich ebenfalls in Bewegung.
Innerhalb weniger Minuten weiß ich, wohin er will – dorthin ist er auch gestern gegangen. Statt den Weg zur Columbia University zu nehmen, biegt er links ab, und danach gleich noch einmal. Diesmal bleibe ich auf der anderen Straßenseite stehen und halte mir das Handy an die Wange, wobei ich mich ein wenig von ihm abwende. Er betritt den roten Backsteinbau mit den unzähligen kleinen Fenstern, in dem ein Lagerhaus, der Manhattan Mini Storage, untergebracht ist, und verschwindet hinter einer Glastür. Es flammt das gleiche Licht wie gestern auf. Dieses Mal zähle ich nach – es brennt hinter dem zwölften der winzigen Fenster von der Eingangstür aus. So weit, ihm bis ins Haus zu folgen, bin ich bislang noch nicht gegangen. Ich habe zu viel Angst davor, entdeckt zu werden. Obwohl ich natürlich neugierig bin, was er dort drinnen macht. Viele New Yorker haben Lagerabteile. Bei den winzigen Wohnungen ist das oft dringend notwendig. Aber gestern kam und ging er mit leeren Händen. Ob er irgendwelche Kisten aussortiert? Dinge umräumt? Nach etwas Speziellem sucht? Worum es sich auch handeln mag, offenbar hat er es noch nicht gefunden. Vielleicht ist er deshalb heute noch einmal hergekommen.
Der Wind frischt auf und peitscht mir das Haar ins Gesicht. Ich binde es im Nacken zusammen, um anschließend einen vorsichtigen Blick zum Himmel zu werfen. Es war den ganzen Morgen über bewölkt, aber nun sind die Wolken dunkler geworden. Durch die hohen Bauten um mich herum wirkt die Umgebung plötzlich klaustrophobisch – als könnte mir der Himmel buchstäblich auf den Kopf fallen und mich unweigerlich unter sich begraben. Als Gabriel schon wenig später wieder auftaucht, pulsiert mein Blut erneut wild durch meine Adern – genau wie vorhin, als ich das Notizbuch in die Tasche schmuggelte und die Buchhandlung als Diebin verließ. Auch heute hat er nichts in der Hand und macht sich auf den Weg stadtauswärts Richtung Columbia – ich beeile mich, um ihn nicht aus den Augen zu verlieren.
Sein Stundenplan ist dienstags und donnerstags identisch. Nachdem er also im Gebäude verschwunden ist, weiß ich, dass ich jetzt zwei Stunden Zeit habe, ehe er zur Mittagspause wieder erscheint. Ich setze mich auf eine Bank, hole das gestohlene Notizbuch heraus und krame in meiner Tasche nach einem Stift. Das Gelände ist voller Studierender auf dem Weg in ihre Seminare. Sie umklammern ihre Taschen oder haben Rucksäcke auf den Schultern. Nur wenige scheinen für diesen kühlen Herbsttag warm genug gekleidet zu sein.
Plötzlich spüre ich, dass mich jemand beobachtet. Ein stetiger Blick. Ich schaue auf und sehe mich suchend um. Entdecke aber nur ein paar Mädchen aus einer Studentenverbindung – allesamt wasserstoffblond –, von denen mir keine besondere Aufmerksamkeit schenkt. Wahrscheinlich bilde ich mir den Blick nur ein. Könnte sein, dass ich nach meiner Aktion in der Buchhandlung ein wenig paranoid bin, zumal ich hier herumsitze und darauf warte, dass ein Mann wieder herauskommt, der keine Ahnung hat, dass ich ihn verfolge. Ich schaue mich noch einmal um, beobachte aber nur Collegestudenten, die den Campus überqueren.
Ich schiebe den Gedanken beiseite und schreibe über die vergangene Woche. Darüber, wie ich im Coffeeshop saß und zufällig Gabriel entdeckte und ihm folgte. Darüber, dass ich mich frage, wie lange er wohl weiter so tun kann, als sei er glücklich. Über das zwölfte Fenster im Manhattan Mini Storage und über die Columbia University, den weitläufigen Campus inmitten des brechend vollen Upper Manhattans.
Als Gabriel die Treppe herunterhüpft, mutmaßlich in die Mittagspause, ist irgendetwas anders. Ich bemerke es sofort – sein Schritt ist leichter, sein Körper vorgeneigt, sein Blick fokussiert. Er will nicht einfach nur in die Cafeteria, um sich ein Sandwich zu holen. Er geht irgendwohin, um irgendetwas zu tun.
Und ich will wissen, was es ist.
Fünf Minuten später öffnet er die Tür zu einem italienischen Café am Rande des Campus, und ich kann nicht widerstehen, sondern husche hinter ihm hinein. Angesichts des Risikos, das ich damit eingehe, läuft mir ein Schauer über den Rücken, und ich bekomme Gänsehaut. Drinnen ist es dunkler, die Beleuchtung gedämpft, Kunstpflanzen in den Ecken. Viereckige Tische mit rot-weiß karierten Tischtüchern. Nischen und Tische, und eine Frau am Empfang, die etwa zehn Jahre älter ist als ich.