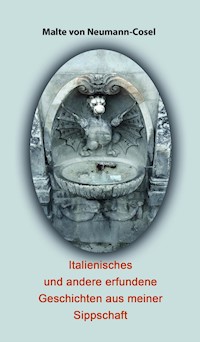
Italienisches und andere erfundene Geschichten aus meiner Sippschaft E-Book
Malte von Neumann-Cosel
12,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kurzgeschichtensammlung
- Sprache: Deutsch
Überraschende, einfühlsame und komische Geschichten über beherzte Alte, die mitten im Leben stehen, politisch korrekte Doktorspiele, RollatorverweigerInnen, entschlossene Albino-Tanten, Gastarbeiter mit hellseherischen Fähigkeiten, ein entscheidendes Examen an der Universität von Parma und andere bunte Episoden, die mitten aus der gottgegebenen und menschengemachten Familie von Wandel, Wendepunkten und Werten im Leben erzählen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
MALTE VON NEUMANN-COSEL
***
ITALIENISCHES UND ANDERE ERFUNDENE GESCHICHTEN AUS MEINER SIPPSCHAFT
© 2021 Malte von Neumann-Cosel
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7482-9194-7
Hardcover:
978-3-7482-9195-4
e-Book:
978-3-7482-9196-1
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Die Figuren, Namen und Orte der Geschichten sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit realen Begebenheiten, Schauplätzen oder Personen ist rein zufällig.
Alle Fotos im Text, sowie das Umschlagsbild, das einen römischen Brunnen im Trastevere zeigt, sind vom Autor.
Inhaltsverzeichnis
Sonnenblumen
Conny Zettelmann
Am Stock
Albinella
BAP
Die Dauerkarte
„Silenzio“
„Habe ich immer meine ganze Geld dabei“
„Für Ihre Frau“
„Keine Ahnung ohne Ahnen“
Für M.E.
Sonnenblumen
Bei meiner Mutter ist vieles entsetzlich, grässlich, scheußlich, hässlich oder schrecklich. Es gibt eine entsetzlich lange Reise, eine grässliche Erkältung über 10
Tage mit einem scheußlichen Husten, hässliches Wetter oder einen schrecklichen Unfall.
Wenn sie schreibt, benutzt sie immer noch häufig statt des Punktes am Satzende lieber ein Ausrufezeichen.
Meine Mutter, „die Mother“, wie wir sie nennen, ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein Spitzname ist, ist über 90. Unsere Anrede ist eine Reminiszenz an die 60er-Jahre; London war damals der Nabel der Welt. Es swingte, oder sagt man, es swang? Wenn man mich mit acht gefragt hätte, wo ich hinwill, hätte ich mit Sicherheit „Carnaby Street“ geantwortet. Wie gesagt, die Mother ist jetzt über 90, und ich mache mir Sorgen, wann es soweit sein wird. Ich musste ich mich schon mehrere Male darauf vorbereiten.
Leider nützt schützende Vorbereitung in diesem Zusammenhang wenig, es wird mich treffen. In meiner Jugend habe ich gerne „Die 2“ geguckt, und es gab da einen „Herrn Hochwohlgeboren“, Lord Brett Sinclair, und einen Danny Wilde. War es Roger Moore oder Tony Curtis, der sagte: „Den Schwinger sah er wohl, doch fehlt ihm jetzt das linke Aug’?“
Das Gesicht meiner Mutter ist zwischen 65 und 85 fast unverändert geblieben. Sie alterte nicht oder nicht sichtbar. Als sie 85 war, schenkte sie mir zu meinem Geburtstag ein besonderes Portrait von sich. Im Gesicht, mit Augen, die dich direkt ansahen, spiegelte sich eine besondere Mischung von Neugier und Wachheit mit einem Schuss Frechheit. Ungewöhnlich, ein Bild von sich hatte sie noch nie verschenkt. Wollte sie sich verabschieden?
Ihr ganzes Leben lang hat sie immer versucht, ihre fünf Kinder gleich zu lieben, und sie hat relativ früh verstanden, dass sie sie dazu unterschiedlich behandeln musste. Eines war sicher: Wenn sie anfing, jedem ihrer Kinder ein Bild zu schenken, würde sie niemals sterben, bevor nicht jedes Kind ein Bild hätte. Ich rief meine Schwester an und erkundigte mich vorsichtig. Meine Mutter hatte mir im Januar als Letztem das Bild geschenkt.
Vor einigen Jahren, kurz nachdem ich 40 geworden war, erklärte mir meine Mutter, dass ihre Familie einmal zu den wohlhabendsten in Estland gezählt wurde. Für mich war das überraschend. Nie zuvor war davon gesprochen worden. Bis dahin wusste ich nur, dass sie meine Mutter, die Jüngste, zu Verwandten geben mussten, weil sie nicht genug Geld hatten. Später, erst kurz vor ihrem Tod, fand ich heraus, dass ihre ältere Schwester auch nicht zu Hause aufgewachsen war.
In dieser Sippe konnten sich Löcher auftun, in denen alle Sicherheiten urplötzlich verschwanden. Stattliche Häuser gingen in Flammen auf oder versanken, erstaunlich beweglich, mit dem Land, den Tieren, den Freunden und dem ganzen Geld, in einem tiefen Abgrund.
Bei meiner Mutter war das Loch etwas kleiner geworden. Es hatte auch an Hunger eingebüßt. Es fraß keine Häuser, Freunde und Staatsbürgerschaften mehr, nur etwas Geld.
Als Kind hatte ich manchmal grundlos Angst, wir könnten von einem Moment auf den nächsten arm sein.
Früher hat meine Mutter oft von ihrer Mutter – für uns Kinder Omama – erzählt.
Sie ist mit 91 gestorben, aber nicht bevor sie ihr drittes Urenkelkind auf dem Schoß gehalten hatte. Manchmal sehe ich sie genau vor mir. Sie hatte keine grauen Haare, sondern bis zum Schluss schwarzes Haar mit weißen Strähnen.
Es kam der Sommer des Jahres, in dem meine Mutter im September selbst ihren 91sten feiern sollte. Wir sitzen am Tisch, und plötzlich fängt meine Mutter an, von ihrer Mutter zu erzählen. Ich sage: „Eigentlich musst du mindestens ausgleichen, sonst wäre das ja ein schwaches Bild, oder?“ Sie richtet sich auf, es ist, als sei ein Nachbrenner eingeschaltet worden, der kurzzeitig alle ihre Knochen erwärmt. Ihre Augen blitzen, aber sie antwortet nicht.
Einige Monate gewonnen. Ich weiß nicht, wie oft sich ihr Gesicht in der letzten Zeit geändert hat. Jedes Mal, wenn ich komme und denke, so, jetzt kann es nicht mehr älter aussehen, überrascht sie mich aufs Neue.
Eine Nichte wurde schwanger. Es sollte im Sommer kommen – das dritte Urenkelkind.
Im Frühjahr sitze ich mit meiner Mutter am Tisch, die Unterhaltung verläuft, wie so oft, in den letzten Monaten schleppend. Öfters macht sie einen abwesenden Eindruck. Zunehmend habe ich das Gefühl, dass sie nicht mehr so viele Dinge wirklich interessieren. Das Laufen fällt ihr nach dem Schlaganfall immer schwerer. Der Rhythmus ist verloren gegangen, und sie muss ihn auf der Stelle trippelnd finden, bis sie loslaufen kann. Im Haus kann sie nur noch auf einem großen elektrischen Sessel sitzen, der sie praktisch so wieder ausspuckt, dass sie direkt auf den Füßen steht.
Ich beuge mich zu meiner Mutter und sage: „Gell Mother, du willst auch noch dein drittes Urenkelkind auf dem Schoß halten?“ Ein Ruck geht durch ihren Körper, sie richtet sich auf und sieht mir mit blitzenden Augen ins Gesicht: „Natürlich.“ Das heißt, in diesem Moment habe ich wieder einige Monate gewonnen. In der Zeit kurz nach ihrem 92. Geburtstag kommt meine Nichte mit der Kleinen zu Besuch. Einmal Gleichstand und gleichzeitig einmal die Nase vorn. Wir brauchen eine neue Sensation, ein neues Ziel – einen erneuten Gewinn.
Ein andermal sitzen wir zum Tee am großen Esstisch. Ich bin verspätet gekommen. Ein grässlicher Stau. Früher saßen wir immer an diesem Tisch, auch zum Frühstück, aber seit einiger Zeit bleibt sie zum Frühstück lieber in der Küche. Wir unterhalten uns ein bisschen über das hässliche Maiwetter. Dann wird nicht geredet. Es ist aber kein Schweigen, das sich über uns senkt und nach unten drückt, sondern es ist eine sich nach allen Seiten vergrößernde Wüste in der Nacht mit einem Himmel voller Sterne, die die Dunkelheit mit ihrem Licht erwärmen.
Plötzlich fällt mir der Eurojackpot ein, in dem sich über die Wochen der maximal mögliche Gewinn angesammelt hat: 90 Millionen Euro. Eine schier unvostellbare Summe. Das Lottolädchen, in dem ich noch ein Feuerzueg gekauft hatte, war mit lauter Schildern gepflastert gewesen, die auf den größtmöglichen Gewinn hingewiesen. Ich erkläre meiner Mutter die Gewinnmodalitäten dieses Spiels, bei dem man fünf richtige Zahlen aus 50 und zwei aus 10 auswählen muss. Dann erläutere ich ihr das Prinzip des Jackpots, der hier überzulaufen drohte. Ihre Augen sind wach, und an zwei Zwischenfragen merke ich, dass sie mir folgt. Nach einer kleinen Pause schwatze ich los:
„Stell dir vor, du hättest die 90 Millionen Euro gewonnen.“ Sofort geht ein Ruck durch ihren Körper, der sich deutlich aufrichtet. Mit wachen Augen dreht sie sich ungewöhnlich flott in meine Richtung. Die Antwort kommt verblüffend rasant, fast wie aus der Pistole geschossen:
„Ein entsetzlicher Gedanke.“
Drei Wochen später bin ich wieder bei ihr zu Besuch. Das Gesicht hat sich wieder verändert und ist nochmal deutlich älter geworden, das Gehen hat sich verschlechtert, und sie kommt jetzt sogar nicht einmal mehr aus dem Elektrosessel auf die Beine. Sie kann keine Schubladen mehr aufziehen, keine Briefe öffnen, die Unterschrift dauert lange und wird zunehmend krakeliger.
„Du musst mir helfen.“ Sie dirigiert mich in ihr Schlafzimmer, in dem auch ihr Schreibtisch steht. Zuerst kommt rechter Hand eine Kommode, auf der viele Fotografien ihrer Kinder, Enkel und Urenkel stehen – in Fachkreisen wird vom „Altar“ gesprochen. Sie setzt sich mühsam an den Schreibtisch und deutet auf den Aktenschrank zwischen den beiden Möbelstücken. Er hat ein graues Rollo und Plastikfächer. Wir sollen gemeinsam jedes Fach durchsehen. Sie sagt, es sei für sie so schwer zu ertragen, dass sie nicht mehr allein aufräumen könne. Das ist schrecklich. Ich selbst habe sie an diesem Aktenschrank noch nie gesehen und hatte bis heute geglaubt, dass er leer sei. Es finden sich unter anderem alte Rechnungen, Glückwünsche zu Weihnachten und zum Geburtstag, Lieferscheine und Gebrauchsanweisungen von Dingen, die schon lange entsorgt sind, Flüssiggasrechnungen, die über fünf Jahre auf dem Buckel haben, und Policen von abgelaufenen Lebensversicherungen.
In einer mittleren Schublade findet sich ein dicker Packen Dokumente ihrer Familie mit einem fast 200 Jahre alten Briefwechsel irgendwelcher Vorfahren, von denen ich nicht die geringste Ahnung hatte. Es ging wohl um irgendetwas Militärisches. Plötzlich wird mir klar, dass die Ahnung von den Ahnen kommt, und ich schmunzle. Meine Mutter fragt mich, was so lustig ist.
„Ach nichts, mir ist nur was eingefallen.“
Wir finden auch noch viele Postkarten und unzählige Bilder aus dem Magazin „Geo“, das sie regelmäßig liest. Es gibt auch abgerissene Blätter mundgemalter Kalender, gemischt mit alten Notizbüchern und einer Unmenge von Pferdebildern. Wir sehen uns jedes Bild und jede Postkarte an, und sie entscheidet: Daumen rauf oder Daumen runter. Pferde, Häuser, Landschaften – alles weg. Sie will nur die Blumen aufbewahren. Bei dieser Gelegenheit frage ich sie nach ihrer Lieblingsblume.
„Sonnenblumen!“
Conny Zettelmann
Nach dem Einkaufen auf dem Markt hatte ich den Briefkasten geleert und die Post mit der dicken Samstagszeitung neben den Kohl und die Brokkoli gesteckt. Erst später, nachdem alles im Kühlschrank verstaut war und ich mich gemütlich hingesetzt hatte, um die Allgemeine zu lesen, fiel der Brief, der sich zwischen ihren Seiten versteckt hatte, auf den Tisch – schwarz umrandet. Wer war gestorben? Ich riss ihn auf und las, dass Conny Zettelmann gestorben war.
Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt dennoch, wenn es plötzlich Nacht ist. Doch was immer bleibt und nie erlischt, sind die Erinnerungen. Der Ehemann, die Schwester und Freunde trauerten, aber in der Anzeige war nicht die Rede von Kindern.
Von Freunden hatte ich gehört, dass sie über längere Zeit wohl Probleme mit dem Alkohol gehabt habe, in den letzten Jahren jedoch trocken gewesen sei. Vor etwas mehr als einem Jahr hatten wir uns das letzte Mal gesehen.
Auf einem 55-sten Geburtstag hatte ich Silvi getroffen. Wir waren in der gleichen Clique gewesen. Rauchen, Flaschendrehen und Nächte durchmachen. Wir erinnerten uns an einen ziemlich engen Partykeller. Alle hatten sich an den Händen gefasst und liefen immer schneller im Kreis zu der Woodstock-Version von I’m going home von Ten Years After, bis der Kreis sich mithilfe der Physik verkleinerte. Dr. Schwarz, unser Physiklehrer, wäre begeistert gewesen. Die angewandte Trägheit der Masse. Wir hatten ja doch etwas verstanden. Durfte das letzte Pärchen dann als Gewinner einen Schmuse-Blues tanzen? Wir wussten es nicht mehr.
Nach einer Weile kam die Sprache auf Freunde aus der alten Zeit, und Silvi erzählte mir, dass sie Conny Zettelmann getroffen hatte. Conny hieß eigentlich Cornelia, aber den Namen hatte sie gehasst und nur auf Conny gehört. Die meisten ihrer Freunde hatten immer gedacht, dass diese Abkürzung ihr richtiger Name war. Wir wohnten damals im selben Block, sie in Nummer 36 und wir in der 38.
Silvi gab mir eine Adresse und die Telefonnummer. In der nächsten Woche dachte ich andauernd an die alten Zeiten und an das, was uns verbunden hatte. Oder verband es uns noch? Nach diesen Tagen setzte ich mich an einem Freitagabend hin und schrieb ihr einen Brief. Es fühlte sich an, als ob ich gar nicht selber schrieb, sondern es mehr aus mir herausfloss.
Liebe Conny,
eine kleine Vorbemerkung: In diesem Brief gibt es kein Geplänkel und kein Vorspiel der Konventionen, ich glaube, dafür kennen wir uns zu lange. Wenn Du das liest, ist es ein gutes Zeichen, denn d.h., Du lebst, und es gab Zeiten, an denen ich mir sicher war, dass Du als Gefangener des Lebens das selbige nicht überlebst. Es heißt auch, dass Du einigen Fratzen ins Gesicht geguckt hast. Mit Sicherheit hast Du keine von Ihnen bestellt. Mir fallen einige Bilder ein …
Ich sehe einen ungelenken Jungen, 5 oder 6 Jahre alt, auf seinem kleinen blauen Fahrrädchen mit weißen Rollerreifen. Wenn es „gehalbt“ hatte, betrachtete er immer gern die vielen vorüberrauschenden Menschen, Fahrräder und Automassen auf der Leuschnerstraße. Vor der Nummer 36 hielt er an und blickte dieKarl-Müller-Straße hinunter, auf der die größten Massen von Anilinern, ausgespuckt von Tor 2, in Richtung Feierabendhaus unterwegs waren.
Plötzlich wurde es laut und die Tür ging auf. Ein Mann prügelte eine Frau vom 3. Stock hinunter auf die Straße. Er war besoffen, und die blonde hübsche Frau wehrte sich nicht sehr. Ich habe es nie vergessen!
Pferdeschwänze können sehr praktisch sein, und sie erinnern ältere Männer bestimmt an Schulmädchen. Wenn man immer einen Pferdeschwanz tragen muss, darf man sein Haar nicht offenlassen. Es darf sich nicht frei entfalten. Es war ihm keinesfalls gestattet, flatternd den Wind einzufangen.
Unvorstellbar damals, dass dieses Haar – wie auch immer – eines Tages grau und dann auch noch stoppelkurz werden könnte.
Ein anderes Bild sind zwei Kinder, gleiche Gewichtsklasse, sie sind vielleicht 7 oder 8 Jahre alt, ein Junge und ein Mädchen, und sie kämpfen gegeneinander – monatelang, der Kampf ist immer unentschieden. Es ist kein Unentschieden in letzter Minute, sondern ein tiefer Ausgleich, keiner der beiden würde dem anderen jemals die Schmach der Niederlagewünschen. Dieses kämpfende Unentschieden ist die angewandte perfekte Umsetzung eines männlich/weiblichen Solidaritätsprinzips.





























