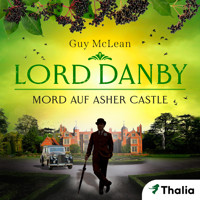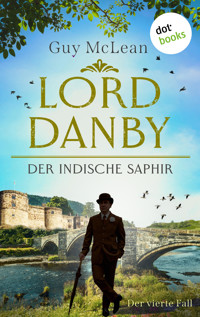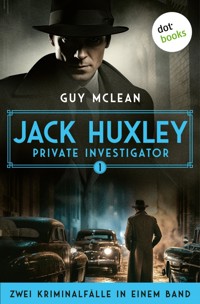
Jack Huxley, Private Investigator: Das seltsame Verschwinden der Cynthia Foy & Weniger als Nichts E-Book
Guy McLean
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine humorvoll-ironische Hommage an die Hardboiled Detectives der 40er Jahre. DAS SELTSAME VERSCHWINDEN DER CYNTHIA FOY: Hollywood 1940. Privatdetektiv Jack Huxley soll die verschwundene Geliebte eines Filmbosses aufspüren. Ein scheinbarer Routineauftrag. Doch schon bald macht Huxley einer Menge Leute eine Menge Ärger, wirbelt reichlich Dreck auf, doch seinem eigentlichen Auftragsziel kommt er kein bisschen näher. Dann führt eine Spur ihn buchstäblich in die Wüste und dort beginnen die Dinge aus dem Ruder zu laufen … WENIGER ALS NICHTS: Eine Frau will wissen, was ihr Ehemann so treibt – für Jack Huxley ist das Alltagsgeschäft. Doch egal, wie viele Zigaretten er nachts auf seinem Beobachtungsposten raucht, er kann nichts Verdächtiges feststellen. Der Ehemann scheint der größte Langweiler der Geschichte zu sein. Stattdessen muss Huxley sich plötzlich mit den Schergen eines undurchsichtigen Milliardärs herumschlagen, dem Huxley wohl irgendwie auf den Schlips getreten sein muss … Der Auftakt der »Jack Huxley«-Reihe voll abstruser und ebenso undurchschaubarer Verbrechen. Für Fans der American-Noir-Klassiker von Raymond Chandler und Dashiell Hammett.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Eine humorvoll-ironische Hommage an die Hardboiled Detectives der 40er Jahre.
DAS SELTSAME VERSCHWINDEN DER CYNTHIA FOY: Hollywood 1940. Privatdetektiv Jack Huxley soll die verschwundene Geliebte eines Filmbosses aufspüren. Ein scheinbarer Routineauftrag. Doch schon bald macht Huxley einer Menge Leute eine Menge Ärger, wirbelt reichlich Dreck auf, doch seinem eigentlichen Auftragsziel kommt er kein bisschen näher. Dann führt eine Spur ihn buchstäblich in die Wüste und dort beginnen die Dinge aus dem Ruder zu laufen …
WENIGER ALS NICHTS: Eine Frau will wissen, was ihr Ehemann so treibt – für Jack Huxley ist das Alltagsgeschäft. Doch egal, wie viele Zigaretten er nachts auf seinem Beobachtungsposten raucht, er kann nichts Verdächtiges feststellen. Der Ehemann scheint der größte Langweiler der Geschichte zu sein. Stattdessen muss Huxley sich plötzlich mit den Schergen eines undurchsichtigen Milliardärs herumschlagen, dem Huxley wohl irgendwie auf den Schlips getreten sein muss …
Doppelband-Originalausgabe August 2025
Der enthaltende Band »Das seltsame Verschwinden der Cynthia Foy« erschien bereits 2023 im Self-Publishing, © Stefan Lehnberg.
Copyright © dieser Doppelband-Originalausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Redaktion: Ralf Reiter
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/Tartila und AdobeStock/Jahan Mivovi, NEW STUDIO
eBook-Herstellung: dotbooks GmbH unter Verwendung von IGP (rb)
ISBN 978-3-98952-992-2
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people . Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected] . Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Guy McLean
Jack Huxley, Private Investigator
Das seltsame Verschwinden der Cynthia Foy & Weniger als Nichts
dotbooks
Das seltsame Verschwinden der Cynthia Foy
Der erste Fall für Jack Huxley
Teil 1 – Fragen
Kapitel 1
Mein Name ist Jack Huxley und wenn Sie das hier lesen, kann das nur eins bedeuten: Ich bin tot. Entweder das oder mein Anwalt Moe Greenberg hat mich beschissen. Eins von beidem, jedenfalls sollte dieser Bericht in seinem Tresor verwahrt werden, bis ich zwanzig Jahre unter der Erde bin. Wenn ich’s recht bedenke, wäre mir die zweite Variante lieber, dann würde ich nämlich noch leben. Aber Moe ist ‘ne ehrliche Haut, dem ich keinen allzu großen Schmu zutraue. Also wie’s aussieht, bin ich tot. Schade eigentlich, denn ich war ein ziemlich anständiger Kerl, sagen manche. Gibt natürlich auch einige, die Ihnen genau das Gegenteil beschwören würden. Mir kann’s egal sein, ich bin ja tot.
Doch genug der Vorrede. Angefangen hat das alles 1940. Im August, um präzise zu sein. Das mit dem August weiß ich noch so genau, weil es der verfluchteste August seit Menschengedenken war. Wer sich nicht erinnert, hat ihn nicht erlebt. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich mag‘s heiß; aber es gibt eine Grenze. Heiß wie Ava Gardner ist gut, heiß wie in der Hölle ist verdammt lästig. Besonders wenn man, wie ich, viel unterwegs ist. Ich bin – oder war, ich vergesse immer wieder, dass ich tot bin – Privatermittler. Zumindest ich nenne mich so. Die meisten würden mich wohl als Detektiv bezeichnen, aber Schnüffler und dreckige Ratte höre ich auch nicht gerade selten. Meine Detektei in Los Angeles ist keine von den arrivierten, keine von denen mit Teakholztäfelungen und großen Ölgemälden von Schiffen oder Offizieren, die auf ‘nem Pferd sitzen und ‘nen Säbel hochhalten, wie in arrivierten Anwaltskanzleien, keine Detektei, zu der man mit Anliegen kommt, von denen jeder wissen darf. Mein Büro rangiert eine ganze Ecke weiter unten in der Nahrungskette, aber in der Regel kann ich mich nicht beklagen. Ich komme einigermaßen zurecht. Wissen Sie, ich bin wie die etwas weiter entfernte Apotheke, zu der Sie gehen, wenn Sie etwas brauchen, das zu verlangen Ihnen vor Ihrem üblichen Apotheker zu peinlich ist. Und den Leuten ist verdammt viel peinlich, soviel ist mal sicher. Nicht nur der Apotheker soll nicht alles wissen, sondern auch Ehemänner, Ehefrauen, Väter, Mütter, Söhne, Töchter, Arbeitgeber, die Polizei und nicht zu vergessen das Finanzamt; und jetzt raten Sie mal, zu wem man dann geht. Richtig! Sie glauben gar nicht, was für feine Herrschaften schon nervös auf der Kante meines abgewetzten Kundensessels rumgerutscht sind. Ich nenne natürlich keine Namen, nur so viel: Ein paar von denen kennen Sie aus der Zeitung oder von der Leinwand. Und wie es der Zufall – oder wer auch immer – will, geht es in meinem Bericht ebenfalls um eine Person, die Sie von der Leinwand kennen könnten. Allerdings nur, wenn Sie verdammt scharfe Augen haben. Ich hab nicht viel übrig für Tanzrevuen, aber wie man hört, ist dieser Busby Berkeley, der gefragteste Choreograph Amerikas und die Girls, die in seinen Filmen herumhopsen, sind die schönsten der schönen. Schön genug, um Hauptrollen zu spielen, aber stattdessen treten sie nur in Armeestärke auf, so dass kaum eine von ihnen zu erkennen ist. Es sei denn, wie gesagt, man hat verdammt scharfe Augen. Was mich zu meinem Auftraggeber bringt. Das Mädchen, das der Glückliche entdeckt hatte, spielte in Gold Diggers of 1937 mit und war recht attraktiv, wenn man auf Brünette steht. Ihr Name war Cynthia und der Mann war verrückt nach ihr. Und mit verrückt meine ich Gummizellen-verrückt. Außerdem war er fünfunddreißig Jahre älter als sie, was er aber damit wettzumachen wusste, dass er ein hohes Tier bei Paramount war. So weit so gut. (Für ihn.) Abgesehen davon war er verheiratet. Das war schon weniger gut. Und zwar für alle Beteiligten. Mich eingeschlossen. Doch der Reihe nach. Es war einer dieser Montage, wo ich daran dachte, die Schnüffelei an den Nagel zu hängen. Es war Hochsommer. Sauregurkenzeit. Meine Stimmung war mies. Seit mehreren verdammten Wochen hatte sich kein verdammter Klient in mein verdammtes Büro in Downtown verirrt und ich fragte mich nicht zum ersten Mal, warum ich im August überhaupt hier meine Zeit verschwendete, nur wegen der schwachen Aussicht darauf, dass eventuell doch jemand aufkreuzen könnte. Nach gar nicht mal so viel Nachdenken fiel mir der Grund dann doch ein: Geld. Ich war knapp bei Kasse. Wie gesagt, ich verdiene nicht schlecht, aber professionelle Pokerrunden können ganz schön ins Geld gehen, zumindest solange man gelegentlich verliert. Aber das ist nun mal Lehrgeld, ich werde mit jedem Spiel besser, die Zeit arbeitet für mich. Das große Geld kommt eines Tages. Aber bis es soweit ist, muss ich wohl noch ‘n Weilchen durch Schlüssellöcher gucken.
Es war kurz vor zehn, ich hatte noch nicht gefrühstückt und entsprechende Laune. Kurz erwog ich, zum Deli an der Ecke zu gehen und mir ein Pastramisandwich zu holen, konnte mich aber nicht dazu aufraffen. Stattdessen langte ich nach meinem Ronson-Feuerzeug und zündete mir die zehnte oder zwanzigste Chesterfield an. Ich kann mich nicht an die verdammten Glimmstängel gewöhnen, ich war immer ein Lucky-Strike-Mann, aber wenn man den Werbeplakaten glauben darf, empfehlen neun von zehn Ärzten Chesterfield und gegen eine solche Quote kann man nichts machen. Ich erwog gerade die Vorteile und Nachteile davon, es für heute gut sein zu lassen, als meine Sekretärin, Miss Sunshine, einen Klienten in mein Büro führte. Ein paar Worte zu meiner Sekretärin: Sie kennen ja sicher die Redewendung »Nomen est omen«, oder? Also die traf auf Miss Sunshine in keiner Weise zu. In früheren Jahren hatte ich Sekretärinnen gehabt, auf die der Name gepasst hätte. Auch mir hatten die Damen prima gepasst. Aber meinen Klienten nicht. Es scheint eine menschliche Schwäche zu sein, dass man peinliche Angelegenheiten nicht gern mit fremden Menschen bespricht, die besonders attraktiv sind. Viele Menschen scheint das abzuschrecken und so hatte es sich in meinen Anfangsjahren manch potentieller Klient, während er in meinem Vorzimmer vor den Augen meiner damaligen Sekretärinnen warten musste, plötzlich anders überlegt und das Weite gesucht. Miss Sunshine hingegen war über fünfzig, verströmte die Ernsthaftigkeit und Freudlosigkeit einer notariellen Beglaubigung und sah auch genau so aus. Und als wenn das alles noch nicht genug gewesen wäre, war sie auch noch Vegetarierin.
Als sie an diesem Morgen einen gewissen Mr. Deveraux in mein Büro führte, machte mein Herz einen Salto, denn ich bin lange genug im Geschäft, um zu wissen, wenn ein lukrativer Fall vor mir steht. Mr. Deveraux machte seinem eleganten französischen Namen alle Ehre. Sein hellgrauer Anzug war aus feinstem Zwirn und ohne jeden Zweifel maßgeschneidert, seine teuren Schuhe waren blitzblank gewienert und seine Fingernägel waren manikürt. Getrübt wurde das Ganze allerdings nicht unerheblich durch sein Gesicht. Der Mann sah aus wie ein Frosch. Von der Farbe mal abgesehen. Durchaus einer der elegantesten Frösche von ganz Hollywood, aber nichtsdestoweniger ein Frosch. Auch seine Bewegungen hatten etwas eindeutig Froschartiges. Ich bot ihm einen Sessel an. Er nahm auf eine förmliche Art Platz, als wolle er vermitteln, dass er in Detekteien keineswegs ein und aus ging. Dann drehte er sich um, offenbar um sich zu vergewissern, dass Miss Sunshine die Tür von außen geschlossen hatte, und leckte sich nervös über die Lippen. »Zunächst muss ich darauf bestehen, dass alles, was ich Ihnen erzähle ... «
»... absolut vertraulich ist. Sie haben mein Wort drauf.« Ich setzte mein beruhigendstes Gesicht auf.
Deveraux presste die Lippen zusammen und nickte gewichtig. Ich schwieg und wartete, dass er endlich zur Sache kam.
»Gut, Mr. Huxley. Ich habe einen Auftrag für Sie, einen kleinen, sollte Sie nicht allzu lange in Anspruch nehmen. Darf ich fragen, was Sie für Ihre Dienste verlangen?«
»Mein Tagessatz ist fünfundzwanzig Dollar plus Spesen. Und acht Cents pro gefahrene Meile.«
Deveraux blies die Backen auf und stieß die Luft aus. »Und Ihr Satz, wenn Sie nur einen halben ...?«
»Fünfundzwanzig Dollar.«
»Und dieses Gespräch, zählt das bereits als ...?«
»Das ist gratis. Aber vielleicht kommen Sie einfach zur Sache.«
Deveraux zog ein cremefarbenes Taschentuch hervor und tupfte sich die Stirn und die Halbglatze ab. Dann begann er, zunächst stockend, mit der Zeit jedoch immer ausführlicher, seine Geschichte zu erzählen. Es war der Klassiker: Meine Frau versteht mich nicht, junge wunderbare Frau kennengelernt, die mich liebt, ich lass mich scheiden, blablabla, oder in seinem Fall quakquakquak. Für ihn natürlich eine ganz große Sache, aber ich höre sie zum circa einmillionsten Mal. Es ist nur öde. Und nicht nur das. Alle seine Annahmen sind falsch. Erstens: Seine Frau versteht ihn viel besser, als er ahnt, das ist ja das Problem. Zweitens: Junge wunderbare Frauen, die sechzigjährige Frösche lieben, erweisen sich meistens als doch nicht so wunderbar, wie die Frösche zunächst glauben. Drittens: Er lässt sich garantiert nicht scheiden. Meine Sympathien liegen eindeutig bei seiner Ehefrau, die ich sehr gut verstehen kann; ich mag Froschgesicht auch nicht, aber das spielt keine Rolle, ich bin ja nicht mit ihm verheiratet. Die Vorstellung, dass man seine Klienten mögen muss, schlägt man sich als Privatschnüffler ziemlich schnell aus dem Kopf.
Dann fingerte Deveraux etwas aus seiner Brieftasche und legte es auf seinem Knie ab. »Die Sache ist die: Meine ... also ... die junge Frau ist verschwunden.«
»Seit wann?«
»Seit fünf Tagen, fünfeinhalb, wenn man die erste Nacht noch dazuzählt.«
»Fünfeinhalb Tage.« Ich steckte mir eine Chesterfield an. »Das muss noch nichts heißen, Mr. Deveraux. Vielleicht nur ein kleiner Ausflug, ohne Bescheid zu sagen?«
Deverauxs Empörung war nur zur Hälfte gespielt: »Sie kennen Cynthia nicht, sowas würde sie nie tun.«
Auch dieser Satz ist ein Klassiker, den ich nicht zum ersten Mal höre. Ich kommentiere ihn schon lange nicht mehr. »Okay, ich brauche ein paar Angaben. Name der vermissten Person?«
Deveraux beugte sich beflissen vor. »Cynthia Foy.«
»Haben Sie ein Bild von ihr, das wäre hilfreich.«
Er nahm das Etwas, das er aus seiner Brieftasche geholt hatte vom Knie und händigte es mir in etwa so feierlich aus, als sei es ein Friedensvertrag zwischen zwei Großmächten. Es handelte sich um eine Porträtaufnahme einer stark geschminkten Frau, die ich auf Mitte zwanzig schätzte. Schwer zu sagen, da es eine professionelle Aufnahme war, wie sie Schauspieler und welche, die sich dafür halten, anfertigen lassen. Diese Photographen arbeiten mit allen möglichen Tricks, raffinierte Beleuchtung, bestmögliche Aufnahmewinkel und anderes. Und hinterher wird das Ganze noch retuschiert. Aber selbst unter Zuhilfenahme all dieser Kunstgriffe konnte die Aufnahme Cynthias Schwachstelle kaum verbergen, ihre Hakennase. Das erklärte, warum sie nur eine von vielen bei Busby Berkeley war und keine Hauptrollen spielte.
»Das Bild benötige ich für meine Nachforschungen, keine Sorge, Sie bekommen es anschließend zurück.« Ich steckte es in meine Innentasche. Deveraux nickte ergeben. Als nächstes zog ich meinen Notizblock zu mir ran und nahm einen Bleistift. »Wo haben Sie Cynthia zuletzt gesehen?«
Deveraux schoss die Antwort ab wie ein Musterschüler. »In meinem ...nun ...Apartment.«
»In Ihrem – Apartment?« Ich ließ die Frage vielsagend in der Luft hängen
Deveraux sah zerknirscht drein. »Was soll man machen? Gewissermaßen als kleine Zuflucht vor meiner Frau. Sie kennen sie nicht, sie ist ein Ungeheuer.«
»Da bin ich sicher. Und wann war das?«
»Dienstagabend.«
»Hatten Sie Streit?«
»Streit, überhaupt nicht. Was wollen Sie damit an...? Wir streiten nie.« Er sah mich an, als hätte ich ihm einen unsittlichen Antrag gemacht. Ich ignorierte es. »Gratuliere. War Cynthia in irgendeiner Weise anders als sonst?«
»Anders? Was ...?«
»Nervös, ängstlich, besorgt, etwas in der Art.«
»Das hätte ich ganz sicher bemerkt.«
»Sicherlich. Haben Sie irgendeine Vermutung, wo Cynthia sein könnte?«
»Nein. Und sie ist auch seitdem nicht am Set aufgetaucht. Inzwischen hat man sie umbesetzt. Das beweist doch, dass sie nicht freiwillig verschwunden ist. Da muss doch etwas passiert sein.«
»Waren Sie bei ihrer Wohnung?«
»Natürlich, zweimal, es macht niemand auf.«
»Sie haben keinen Schlüssel?«
»Wozu denn? Es ist keine gute Gegend. Wir treffen uns lieber bei mir.«
»Adresse?«
Er nannte sie mir.
»Telefonnummer?«
»Meine oder Cynthias?«
»Beide.«
»Cynthia hat kein Telefon und dies ist meine Nummer im Büro.« Er reichte mir eine Firmenvisitenkarte von Paramount mit goldgeprägter Schrift. »Ich muss ja wohl nicht hinzufügen, dass Sie kein Wort hierüber gegenüber meiner Sekretärin verlieren.«
Ich schoss einen passenden Blick ab. »Wo liegt Ihr Apartment?«
Er nannte mir die Adresse und ich notierte sie mir.
»Gut, wann ist Cynthia bei Ihnen aufgebrochen?«
Er überlegte. »Das wird so gegen zehn gewesen sein.«
»So genau wie möglich bitte.«
»Gegen Viertel nach zehn, spätestens halb elf.«
»Yellow Cab?«
»Ja, ich spendiere ihr immer ein Taxi, die Straßen sind abends nicht sicher.« Er sah mich an, als hätte er einen Orden verdient.
»Reizend von Ihnen.« Ich überflog meine Notizen und fragte mich, ob ich was vergessen hätte, aber mir fiel nichts ein.
»Okay, ich melde mich bei Ihnen, wenn ich mehr weiß. Ein Tagessatz und weitere fünfundzwanzig Dollar für Spesen sind als Vorschuss fällig.« Deveraux zog seine Brieftasche hervor und zählte mir das Geld in Fünfdollarscheinen und mit leidender Miene auf den Tisch. Eine Minute später war er verschwunden. Nur sein etwas zu süßliches Rasierwasser hing noch in der Luft.
Kapitel 2
Mein erster Weg führte mich zum Yellow Cab Service, Los Angeles. Erstens reine Routine. Klienten erzählen viel, aber nicht immer ist alles wahr. Ich würde feststellen, ob Cynthia tatsächlich von Deverauxs Apartment aufgebrochen war, wie er angab. Auch die Uhrzeit würde ich überprüfen. Zweitens: Selbst wenn seine Angaben stimmten, musste sie nicht unbedingt nach Hause gefahren sein, wie Deveraux glaubte. Wenn ich Glück hatte, würde man mir einen anderen Ort nennen und mit geradezu unverschämt viel Glück würde sie sich immer noch dort aufhalten. Fall gelöst. Okay, so einfach war es bislang selten gewesen, aber ich bin nun mal ein unverbesserlicher Optimist.
Die Zentrale des Yellow Cab Service Los Angeles liegt in einem hässlichen Backsteingebäude, das die Rückwand eines großen Innenhofes mit Hunderten von Cab-Parkplätzen bildet, die aber nur nachts besetzt sind. Außenstehende haben dort keinen Zutritt. Außer Polizeibeamten, die aber dort nicht besonders gern gesehen sind, denn die stehlen einem mit vielen Fragen nur die Zeit, und außer Privatdetektiven, die dort ausgesprochen gern gesehen sind, denn sie bezahlen gut für Antworten. Warum auch nicht? Das sind für uns Spesen. Der erste Dollar verschaffte mir Zutritt beim Pförtner, dem alten Sal. Er hielt mir sogar mit dem einen Arm, den er noch hat, die Tür auf, wie es der Türsteher vom Waldorf-Astoria auch nicht besser hingekriegt hätte. Ich mochte Sal. Ich kletterte in dem schmucklosen Treppenhaus zwei Stockwerke nach oben, zog die schwere Stahltür auf und befand mich im Herzen des Yellow Cab Services, der Telefonzentrale, einer kargen Betonhalle mit einem ellenlangen Switchboard, an dem nebeneinander etwa dreißig Telefonistinnen saßen. Fast wie die Hühner auf der Stange und so ähnlich hört es sich auch an, denn sie redeten alle gleichzeitig. Wenn ich hier arbeiten müsste, würde ich innerhalb eines Tages zur Flasche oder Waffe greifen. Je nachdem, was schneller zur Hand wäre. Aber den Mädchen schien es nichts auszumachen. Ihnen gegenüber befand sich in einem etwas erhöhten Glaskasten der diensthabende Schichtleiter, der alles überwachte und den Gesamtüberblick hatte. Vor allem hatte er Das Buch. Das Buch, in dem jede einzelne Taxifahrt genau eingetragen wurde. Für uns Privatermittler hatte Das Buch in etwa so viel Bedeutung wie die Bibel für einen Priester. Das wusste natürlich jeder Schichtleiter, und auch welche Macht ihm daraus erwuchs, aber solange ich und meine Kollegen in Begleitung unserer kleinen rechteckigen Papierfreunde kamen, gab es da keine Probleme. An diesem Tag hatte Gladys Dienst. Reibeisenstimme, Reibeisengesicht und Reibeisenlaune, sie erinnerte mich ein bisschen an Boris Karloff. Ich betrat den Glaskasten und kniff meine Augen zusammen. Irgendwo hinter dem Zigarettenqualm war Gladys schemenhaft zu erkennen. Ein »Hallo, Gladys« und ein Fünfdollarschein verschafften mir ein gekrächztes »Wann und wo?«
Ich reichte ihr einen Zettel mit allen Angaben. Gladys nahm einen tiefen Zug und blätterte einige Seiten in dem riesigen Buch zurück, dann glitt ihr nikotingelber Finger über die langen Spalten. »Gefunden. Anruf ging bei uns ein um zweiundzwanzig Uhr elf. Adresse stimmt.«
So weit so gut, Deveraux hatte also die Wahrheit gesagt. Ich unterdrückte einen Hustenreiz. »Und wohin ging die Fahrt?«
»Kann ich nicht sagen.«
»Gladys, fünf Dollar sind mehr als ...«
»Ich kann’s nicht sagen, weil es nicht dasteht.« Gladys‘ Laune wurde noch einige Grade reibeisenhafter. Sie zeigte auf die Stelle. »Überzeug dich gefälligst selbst.«
Ich überzeugte mich gefälligst selbst, sie hatte recht.
»Hm, etwas seltsam, oder?«
»Überhaupt nicht. Das war für den Fahrer die letzte Fuhre an diesem Tag. Jetzt hat er Urlaub. Die Fahrtziele für diesen Tag erhalten wir erst, wenn er wieder zum Dienst kommt.«
»Wann ist das?«
Gladys erhob sich ächzend und studierte einen großen Dienstplan, der an der Rückwand des Glaskastens befestigt war.
»Heute. Zwölf Uhr. Wenn du fünfzehn Minuten vorher da bist, kannst du ihn erwischen, bevor er seine erste Tour hat. Sein Name ist Pat.«
Ich sah auf die Uhr. Noch knapp zwei Stunden. »Ich werde da sein.«
Kapitel 3
Es wäre nicht das erste Mal, dass eine angeblich vermisste Person quietschvergnügt in der eigenen Wohnung hockt und einfach nur ihre Ruhe haben will. Also machte ich mich auf den Weg zu Cynthias Apartment. Es lag am Stadtrand und ich brauchte fast vierzig Minuten, bis ich meinen Wagen direkt davor abstellte. Normalerweise parke ich bei beruflichen Besuchen gerne etwas abseits; manchmal ist es von Vorteil, erst entdeckt zu werden, wenn man an die Tür klopft, aber in dieser Gegend schien es mir ratsam, meinen Chrysler scharf im Auge zu behalten. Er war nicht mehr der Jüngste, aber weit und breit die einzige Wertsache, die zu sehen war. Offenbar lebte Cynthia nicht in einer Wohnung, sondern in einem billigen zweistöckigen Motel. Wahrscheinlich liebte sie es unkompliziert. Eine Haltung, die mir ziemlich sympathisch war. Ich stieg aus und stellte fest, dass es wohl ein verdammt heißer Tag werden würde. Das, kombiniert mit der Tatsache, dass ich immer noch nichts gegessen hatte, trug nicht gerade zur Verbesserung meiner Laune bei. Der ganze Komplex bestand aus zwanzig Wohnungen. Es sah ordentlich aus, aber das Gebäude wartete seit mindestens zehn Jahren sehnsüchtig auf einen neuen Anstrich. Laut Deveraux lag die Wohnung von Cynthia im Obergeschoss. Ich stieg die Metalltreppe zu dem nach vorne offenen Gang hoch, dann ging ich zur neunten Tür und klopfte an. Zunächst leise und höflich. Ich wartete dreißig Sekunden. Dann klopfte ich erneut, immer noch höflich, aber diesmal laut. Laut genug, um eine Schlafende aufmerksam werden zu lassen oder eine, die unter der Dusche steht. Diesmal wartete ich kürzer. Dann klopfte ich zum dritten Mal. Jetzt sehr laut und herrisch. Die Art, bei der man auf der anderen Seite der Tür sofort weiß, dass es jetzt nur zwei Alternativen gibt, um Schlimmeres zu vermeiden: Sofort aufmachen oder sich umgehend durchs Badezimmerfenster verdrücken. Aber über das Badezimmerfenster machte ich mir hier im ersten Stock keine Sorgen. Ich lauschte an der Tür, aber es war nicht der kleinste Laut zu hören.
»Kann ich helfen, Mister?«
Ich drehte mich zu der Stimme um und entdeckte unten einen schlaksigen jungen Mann mit schütterem Haar, der einen Besen in der Hand hatte und halbwegs freundlich zu mir hochblinzelte.
»Keine Ahnung. Können Sie?«
»Sind Sie von der Polizei?«
»Was, wenn ja?«
Der Schlacks grinste raffiniert. »Sie sind nicht von der Polizei.«
Ich lachte. »Stimmt genau, aber vielleicht können Sie mir ja trotzdem helfen, Sie arbeiten doch hier, oder?«
»Ich bin der Manager. Worum geht’s denn?«
Ich stutzte innerlich. Wie ein Manager sah der Mann nun wirklich nicht aus. »Der Manager, das hab ich mir doch gleich gedacht. Und wie heißen Sie?«
Der Schlaks zögerte. »Harold.«
»Okay, Harold, ich mache mir etwas Sorgen um Cynthia.« Ich zeigte mit dem Daumen auf die Tür hinter mir. »Sie war seit mehreren Tagen nicht bei der Arbeit und hat auch nicht angerufen. Wissen Sie irgendwas?«
»Sind Sie ihr Arbeitgeber?«
»Nicht die Spur, nur ein Freund.«
Harold kratzte sich am Kopf. Offenbar überlegte er.
»Wie wär’s, wenn Sie mir einfach die Tür aufschließen, damit ich mich überzeugen kann, dass alles in Ordnung ist«, half ich ihm auf die Sprünge.
»Bei Ihnen piept’s wohl, Mister. Ich kann Ihnen doch nicht aufschließen.«
»Klar können Sie, das ist ein Notfall, Harold. Was, wenn Cynthia gestürzt ist und hilflos im Badezimmer liegt? Wenn sie stirbt, weil Sie sich geweigert haben zu helfen, haben Sie mächtig Ärger an der Backe, das kann ich Ihnen sagen.«
Wieder kratzte sich Harold am Kopf. Ohne das schien er nicht denken zu können. »Hm, seit mehreren Tagen nicht bei der Arbeit, sagen Sie?«
»So ist es.«
»Und nicht angerufen?«
»Korrekt.«
»Hm.« Es war wieder Zeit fürs Kopfkratzen. Offenbar hatte Harold sich entschieden, mir aufzuschließen, und pokerte nun um die Konditionen. Daran sollte es nicht scheitern.
»Für Ihre Unannehmlichkeiten würde ich Sie natürlich entschädigen, Harold.« Ich fischte zwei Fünfer aus meiner Brieftasche und zeigte sie ihm. Harold schien angenehm überrascht. »Okay, ich hol den Schlüssel.« Das tat er jedoch nicht, sondern stieg die Treppe hinauf. Oben angekommen, bemerkte er meinen fragenden Blick. Er zeigt auf die erste Tür. »Mein äh Büro.« Ich ging zu ihm und gab ihm das Geld. Ich hatte so eine Ahnung, dass Harold so gut wie kein Gehalt bekam, hier umsonst wohnte und dafür alle Aufgaben übernahm, die anfielen. Eher ein Mädchen für alles als ein Manager. Wahrscheinlich ein ziemlich guter Deal für den Besitzer. Harold zog einen Schlüssel aus der Hosentasche, dann zögerte er. Offenbar hatte er etwas dagegen, dass ich das Innere seines »Büros« zu Gesicht bekäme. Ich guckte gleichgültig in die Luft. Widerstrebend schloss Harold die Tür auf. Ein muffiger Geruch schlug mir entgegen. Harolds Büro war ein normales Motelzimmer, das er mit einem Kanarienvogel in einem Käfig und etwa fünfhundert Fruchtfliegen teilte. Das Bett war nicht gemacht und überall lag verkrumpelte Kleidung herum. Was immer Harold hier managte, sein Zimmer war es jedenfalls nicht. Während er den Schlüssel für Cynthias Zimmer von einem Wandbrett nahm, wartete ich im Türrahmen. Anschließend verschloss er, aus Gründen, die mir bis zum Ende aller Tage ein Rätsel bleiben werden, sorgfältig die Tür zu seiner Müllkippe. Dann forderte er mich auf, ihm zu folgen. Dreißig Sekunden später standen wir in Cynthias Zimmer. Weitere dreißig Sekunden brauchte ich, um festzustellen, dass sie nicht da war. Ich sah im Bad, im Schrank und unterm Bett nach. Mehr Versteckmöglichkeiten gab es nicht. Das Zimmer war weder besonders ordentlich noch besonders unordentlich. Normal bewohnt eben. Im Bad stand eine Zahnbürste und Schminkzeug, im Kleiderschrank fand ich einen großen Koffer und ein paar billige Kleider. Verreist schien sie also nicht zu sein. Ich sah mich nach Hinweisen um. Jetzt war es Harold, der im Türrahmen stand. Er blickte ständig um sich und schnitt Grimassen. Offenbar war ihm nicht wohl bei der Aktion. »So, Mister, alles okay, sie ist nicht verletzt, gehen wir.«
»Gleich, Harold. Gleich«, beruhigte ich ihn. Ich hielt Ausschau nach Post, Notizen, Fahrplänen oder irgendetwas, was mir brauchbare Hinweise über ihren Verbleib liefern könnte. Ich entdeckte nichts, aber ich hatte das Gefühl, dass hier irgendetwas nicht stimmte, es war ganz offensichtlich, aber ich kam nicht drauf. Ich war schon im Begriff, Harolds Wunsch nachzukommen, als mir doch noch etwas auffiel. Unten auf der Bodenleiste in der Nähe der Tür befand sich ein blutiger Handabdruck. Es war eine kleine Hand, keinesfalls von einem ausgewachsenen Mann. Das änderte die Sache. Ich sagte Harold nichts und verließ das Zimmer. Wenn ich jetzt eins nicht brauchen konnte, dann bei der Polizei stundenlang Fragen beantworten, was ich im Zimmer eines potentiellen Mordopfers zu suchen hatte. Harold schloss die Tür ab, irgendetwas ging dabei in seinem Kopf vor, das war ihm anzusehen. Ich schüttelte ihm die Hand. Als ich losließ, stellte ich fest, dass er mich weiter festhielt. Er sah mir eindringlich in die Augen. »Falls Sie Miss Foy treffen, würden Sie sie dann daran erinnern, dass sie die Miete für diese Woche noch nicht bezahlt hat?« Es lag etwas Flehendes in seiner Stimme, fast tat er mir leid.
Ich klopfte ihm auf die schmale Schulter »Mach ich, Harold.« Dann gab ich ihm meine Karte mit der Bitte, mich sofort anzurufen, wenn Cynthia auftauchen oder sonst irgendetwas Bemerkenswertes geschehen würde. Er versprach es und verschwand in seinem Kabuff, während ich mich auf den Weg zu meinem Auto machte. Hinter mir hörte ich eine zaghafte Frauenstimme. »Wissen Sie, wo Cynthia ist?«