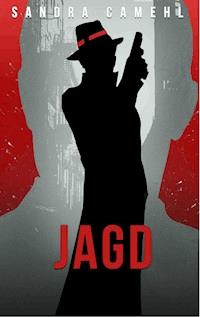
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Chicago ist ein gefährliches Pflaster: Gewalt und Verbrechen bestimmen das Leben der Menschen, Intrigen und Mord sind an der Tagesordnung. Der Privatdetektiv Victor Duva muss das am eigenen Leib erfahren, als seine Frau auf offener Straße erschossen wird. Jahre später trägt seine Suche nach dem Mörder endlich Früchte, aber worauf er dabei stößt, ist viel größer und gefährlicher als er geahnt hat. Doch am Ende stellt sich die Frage, wer Duvas größter Feind ist: Die anderen oder er selbst? Unerwartet sieht er sich einem alten Feind gegenüber, der seine persönliche Fehde gegen den letzten Detektiv der Stadt zu Ende bringen will und dabei vor nichts zurückschreckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Wie tötet man einen Menschen? Es ist eine Sache, nur
davon zu träumen, aber es ist eine völlig andere Sache,
wenn du es mit deinen eigenen Händen tun musst.“
Antonio Salieri in „Amadeus“ (1984)
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Ein stinknormaler Mord
Auf die Rache
Der Mann hinter der Maske
On the Road Again
Vaterliebe
Taliah
Alles nur Show
List und Lügen
Alte Feinde
Verschenktes Vertrauen
Enttarnt
Vater und Sohn
„Halte es geheim. Bewahre es gut.“ – Gandalf
Die Verlierer der Welt
„Na schieß doch. Du würdest mir einen Gefallen tun.“ - Rick Blaine, Casablanca
Säuberung
Nadelstiche
„All meine Freunde sind in den Kampf gezogen. Ich würde mich schämen, zurückgelassen zu werden. Ich will kämpfen.“ – Merry
Good Boy, Bad Boy
Wiedersehen macht Freude
Unter Kollegen
Man trifft sich immer zweimal im Leben
Tränen im Regen
Hoffnung
Das Geständnis
Dead End
Asche und Rauch
„Ich hatte Hoffnung. Gott, das hält mich am Leben.“ – Miranda Priestley, Der Teufel trägt Prada
„Way Down We Go”– Kaleo
„Es ist nicht vorbei, bis es vorbei ist.“ – Yogi Berra
Prolog
„Es ist deine eigene Schuld.“
Die Stimme des Mannes war trotz des heulenden Windes klar und deutlich zu hören. Sintflutartig zog sich der Regen vom Himmel herab und ließ die Konturen der schwarzen Gestalt verschwimmen. Emotionslos blickte der Fremde sein Gegenüber an, einen zitternden Mann, der einen halben Meter vor einem Abgrund stand und an dem eine Bö nach der anderen zerrte. Trotzdem schien er keine Angst zu haben, denn die Tiefe würde nicht sein Tod sein.
„Nein, warte! Wir können doch über alles reden!“, brüllte der Unglückliche, aber seine Worte wurden ihm von den Lippen gerissen und in die Nacht hinausgetragen. Als Antwort erhielt er nur ein müdes Lächeln, und das Letzte, was er sah, war die tiefschwarze Mündung einer Pistole, die auf seine Brust gerichtet wurde.
Der darauf folgende Knall ging im Heulen des Windes unter. Den Bruchteil einer Sekunde später wölbte sich der Rücken des am Abgrund Stehenden nach hinten. Sein rechter Fuß suchte noch sicheren Halt, doch da war nichts mehr außer Luft und Leere. Die Schlagkraft des Schusses katapultierte ihn über die Kante des Hochhauses, und gnadenlos zog ihn die Schwerkraft hinunter, bis er auf dem Boden aufschlug.
Die Mündung rauchte noch, als der Schütze seine Waffe wegsteckte und gemächlich das Dach überquerte. Als er an der Tür angekommen war, zog er seine Handschuhe aus und kramte in der Manteltasche nach drei durchsichtigen Kunststoffquadraten. Behutsam schälte er sie auseinander und platzierte den ersten dicht neben dem Türgriff. Er strich über den Fingerabdruck, und während er seine Arbeit verrichtete, pfiff er munter vor sich hin. Dieses Prozedere wiederholte er noch einmal auf der anderen Seite der Tür und am Treppengeländer. Dann machte er sich an den Abstieg. Unten angekommen schenkte er der Leiche, die mit grotesk verdrehten Gliedmaßen im Schlamm lag, nicht einen Blick. Der Regen spritzte von dem leblosen Gesicht ab und vermengte sich mit dem Blut, das aus dem Loch in der Brust des Toten floss. Mit schmatzenden Schritten spazierte sein Mörder am Ufer des Chicago River entlang, bis die Dunkelheit ihn verschluckte.
Ein stinknormaler Mord
In aller Frühe hatte ein dringlicher Anruf den Police Captain Patrick Meister, den alle wegen seiner extremen Vorliebe für Star Trek nur Kirk nannten, aus dem Schlaf gerissen. Ein paar Teenager, die sich unerlaubterweise auf einer stillgelegten Baustelle aufgehalten hatten, waren dort buchstäblich über eine Leiche gestolpert. Weitere Details hatte die Zentrale ihm vorerst nicht durchgegeben. Natürlich war er sofort aus dem Bett gesprungen und hatte sich in seinem alten Chevrolet auf den Weg gemacht, das Haar noch zerzaust und die Augen klein und verschlafen. Für seinen geliebten Kaffee blieb diesen Morgen keine Zeit, obwohl jede Pore seines übermüdeten Körpers nach dem heißen Gebräu schrie.
Als er schließlich am Tatort vorfuhr, war bereits überall Absperrband gezogen worden. An jeder Ecke standen Polizisten, Männer in weißen Anzügen machten sich am Tatort zu schaffen, und die hübsche Rechtsmedizinerin Erika Rain beugte sich über die Leiche. Kirk hasste Leichen. Vor allem ihren Geruch, bei dem sich ihm ständig der Magen umdrehte. Selbst nach acht Jahren in seinem Beruf hatte er sich partout nicht an den Anblick und Geruch gewöhnen können, und er bezweifelte stark, dass sich jemals etwas daran ändern würde. Obwohl sich alles in ihm sträubte, biss er die Zähne zusammen und trat näher.
Die Arme und Beine des Toten standen in unnatürlichen Winkeln vom Torso ab. Unter dem zerschmetterten Kopf hatte sich eine rote Blutlache gebildet, und die Augen waren in entgegengesetzte Richtungen gedreht. Eines schielte missbilligend hinüber zu der Rechtsmedizinerin, aber die ließ sich davon nicht im Geringsten beeindrucken. Aufmerksam untersuchte sie das Loch, das in der Brust des Toten klaffte. Kirk schluckte schwer und zwang sich zu einem professionellen Gesichtsausdruck, der wohl nicht sehr überzeugend war, denn die Medizinerin warf ihm einen mitleidigen Blick zu.
„Todesursache?“, fragte Kirk mit, wie er glaubte, fester Stimme.
„Guten Morgen erst mal.“
„Ja, dir auch einen guten Morgen. Woran genau ist der Mann gestorben?“ Er riss den Blick von der riesigen Wunde los, die eindeutig zu viel vom Innenleben des Toten preisgab, und fixierte die Medizinerin.
„Theoretisch gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens könnte er an den Folgen des Sturzes gestorben sein. Dafür sprächen sein Schädel, der schwere Verletzungen aufweist, und sein Rückgrat, das wohl mehrmals gebrochen ist.“ Voller Tatendrang wollte sie ihm die Kopfwunde zeigen, aber er winkte rasch ab.
„Und zweitens?“
„Zweitens wäre da noch die Schusswunde in seinem Brustkorb.“ Mit einem Finger fuhr sie den Rand des Einschusslochs nach, als ob nicht jeder mit halbwegs gesunden Augen den Krater in der Brust des Mannes sehen konnte. „Die Lunge ist praktisch kaum mehr vorhanden, und das Herz hat wahrscheinlich auch einiges abbekommen. Es muss eine Waffe mit sehr hoher Durchschlagskraft gewesen sein.“ Es wunderte Kirk immer wieder aufs Neue, wie diese zarte Person in so einem nonchalanten Ton über zerfetzte Eingeweide und zertrümmerte Schädel sprechen konnte.
„Also ist er an den Folgen des Schusses gestorben?“
Rain nickte, stand auf und strich sich den Rock glatt. „Ich vermute, dass die Wucht des Schusses ihn von der Kante dort oben befördert hat. Entweder ist er sofort gestorben oder erst auf dem Weg nach unten.“
Kirk legte den Kopf in den Nacken. Das Gebäude hatte fünf Stockwerke, und man konnte sich nur allzu leicht vorstellen, wie jemand nach einem Sturz vom Dach wie eine überreife Tomate auf dem Boden aufprallte.
„Genaueres kann ich aber erst nach der Obduktion sagen.“
„Natürlich. Vielen Dank.“
Sie packte ihre Gerätschaften ein und drückte Kirk zum Abschied kurz den Arm. „Versuche, dich diesmal nicht zu übergeben, okay?“
Kirk wollte ihr einen giftigen Blick zuwerfen, aber ihm war in der Tat etwas mulmig. Stattdessen winkte er sie unwirsch davon und presste sich einen Finger an die Schläfe, während er über die Informationen und Eindrücke, die er bisher gesammelt hatte, nachdachte.
Die Frage, wieso sich jemand die Mühe machen und in diese verlassene Gegend am äußersten Stadtrand fahren sollte, nur um jemanden zu erschießen, hatte er sich bereits auf dem Weg hierher gestellt. Gab es nicht einfachere Wege, jemanden aus dem Weg zu räumen? Wozu dieser Aufwand? Eine symbolische Tat? Hatte er es etwa mit einem Fanatiker zu tun? Er hoffte inständig, dass es kein religiöses Ritual gewesen war. Solche ausufernden Ermittlungen wollte er lieber seinen übermotivierten Kollegen überlassen.
„Haben wir schon irgendwelche Spuren?“, wandte er sich an einen Kollegen der Spurensicherung, der ihn mit blutunterlaufenen Augen anblinzelte. Für ihn war es offenbar eine durchzechte Nacht gewesen, und die Tatsache, dass er in aller Herrgottsfrühe einen Tatort untersuchen musste, stimmte ihn nicht wirklich froh. Als er sprach, wehte Kirk eine Alkoholfahne entgegen.
„Bisher nicht. Aber wir sind ja auch noch nicht lange beschäftigt.“
Kirk runzelte die Stirn und überlegte, ob er etwas zum derzeitigen Gesundheitszustand des Kollegen sagen sollte, entschied sich dann aber dagegen. Er bedankte sich nur und wollte sich an den Aufstieg des Hochhauses machen, als er eine Bewegung aus dem Augenwinkel wahrnahm. So unauffällig wie möglich entfernte er sich vom Tatort und überquerte die Baustelle. Überall lagen verrottende Bretter, Steine und verrostetes Bauwerkzeug herum. Die perfekte Kulisse für einen Mord. Er schauderte.
Victor Gayoski Duva war trotz seiner Größe und der auffälligen Garderobe so schwer auszumachen wie die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen. Er war von oben bis unten in Schwarz gekleidet, und zu seinem bodenlangen Mantel trug er einen breitkrempigen Hut, der sein blasses Gesicht vor neugierigen Blicken abschirmte. Zu sehen war nur der schmallippige Mund, der in scheinbar immerwährender Missbilligung verkniffen war. Seine eigentümliche Art, mit hochgezogenen Schultern und leicht nach vorn gebeugt durch nächtliche Gassen zu schleichen, hatte ihm den Spitznamen Hurple eingebracht. Als Kirk vor ihm stehen blieb, hob der Privatdetektiv den Kopf. Eine bemerkenswert krumme Nase ragte dem Polizisten entgegen.
„Duva“, begrüßte er den Mann knapp.
„Irgendetwas Interessantes?“
„Noch nicht. Die Spurensicherung ist noch dran.“
Sein Gegenüber hob eine Braue. „Wieso hast du mich dann herbestellt?“
„Ich dachte, du würdest dir den Tatort vielleicht anschauen wollen. Solange er noch … frisch ist.“
Ein verächtliches Schnauben war zu hören. „Bei dem Wetter werdet ihr ohnehin nichts Brauchbares mehr finden.“
„Optimismus ist für dich ein Fremdwort, oder?“
Duva ging nicht auf diesen Seitenhieb ein. „Personendaten?“
„Henry Butchers, neununddreißig Jahre alt. Er war Bankangestellter an der Federal Reserve Bank of Chicago. Kein hohes Tier. Ledig, hatte aber bis vor Kurzem eine Beziehung zu einer gewissen Shondra Banks. Die Kollegen sind bereits auf dem Weg zu ihr.“
Duva nickte wortlos und ließ seine Adleraugen über den Tatort schweifen. „Zuerst müssen wir seine Bankdaten prüfen. Hatte er Schulden, eine schmutzige Affäre, irgendwelche Geheimnisse?“, fuhr Kirk fort und machte sich im Geiste eine Liste, die mit jeder Sekunde länger wurde.
„Jeder hat ein dreckiges Geheimnis“, murmelte Duva und fuhr sich rasch mit der Zunge über die Lippen.
„Das werden wir herausfinden. Wir werden ihn durchleuchten wie eine Klarsichtfolie.“ Bei dieser Bemerkung meinte Kirk die Andeutung eines Lächelns auf Duvas Gesicht zu sehen. Doch dieser Eindruck war so schnell verflogen wie er gekommen war.
„Für mich sieht das wie ein stinknormaler Mord aus. Was soll ich also hier?“, wiederholte der Detektiv seine Frage und vergrub die Hände tief in den Manteltaschen.
„Ein… ein stinknormaler Mord?“
„Ich sehe hier nichts Besonderes.“
„Außer einer Leiche vielleicht.“ Kirk schloss kurz die Augen und presste sich Daumen und Zeigefinger fest auf den Nasenrücken, um die Kopfschmerzen, die sich langsam anbahnten, einzudämmen. „Er ist nicht durch den Sturz vom Hochhaus ums Leben gekommen, sondern wurde erschossen“, erklärte er. „Fast die ganze Brust ist aufgerissen. Es muss sich also um eine großkalibrige Waffe handeln.“
„Nur weil es eine große Wunde ist, muss es noch keine Kalaschnikow gewesen sein. Meistens verursachen die unscheinbarsten Waffen den größten Schaden“, klärte Duva ihn auf. „Es wird sicherlich nicht schwer sein, die Bauart und den Käufer herauszufinden.“
„Für dich, meinst du wohl?“
Duva zuckte mit den Schultern und zog die Nase hoch. „Soll ich euch helfen oder nicht?“
Kirk sträubte sich schon allein wegen seiner Ehre als Hüter des Gesetzes dagegen, einen im Untergrund agierenden Privatdetektiv zu den Ermittlungen hinzuzuziehen, besonders wenn es sich dabei um einen Detektiv mit solch schwierigem Charakter handelte. Trotzdem brauchte er diese Kratzbürste von einem Genie, denn Kirk ahnte, dass es sich um einen sehr heiklen Fall handelte, bei dem er jede Unterstützung gebrauchen konnte. „Melde dich einfach bei mir, wenn du Genaueres weißt.“
Damit wandte Kirk sich ab und kehrte zum Tatort zurück. Dort rückte man bereits mit einer Trage an, um die Leiche in die Gerichtsmedizin abzutransportieren. Kurz bevor er das Absperrband erreicht hatte, drehte er sich noch einmal um. Gegen den kalten Wind hatte der Detektiv seinen Mantelkragen hochgeschlagen, und mit hochgezogenen Schultern schritt er am Ufer des Chicago Rivers entlang. Unvermittelt blieb er stehen und wandte den Kopf nach rechts in Richtung des Flusses. Gebannt starrte er in das sprudelnde Wasser. Etwas musste seine Aufmerksamkeit erregt haben. Gerade wollte Kirk zu ihm gehen, um sich zu erkundigen, ob er etwas entdeckt hatte, das den Augen der anderen verborgen geblieben war. Doch da warf Duva dem Polizisten einen Blick über die Schulter zu und beeilte sich, vom Schauplatz des Verbrechens fortzukommen.
Auf die Rache
Nur mit Boxershorts und T-Shirt bekleidet stand Darron Randolphs vor dem ovalen Spiegel in seinem Badezimmer und betrachtete sein Gesicht. Im künstlichen Licht des fensterlosen Raumes sah seine ohnehin blasse Haut noch kränklicher aus. Seine tief in den Höhlen vergrabenen Augen ließen ihn ständig böse dreinblicken, selbst wenn er relativ guter Laune war. Er vermittelte den Eindruck eines Tod bringenden Rächers. Oft hatte er sich das zu Nutze gemacht, um Leute einzuschüchtern und so Dinge aus ihnen herauszubekommen, die sie sonst niemals preisgegeben hätten. Gut möglich, dass sie sogar Dinge gestanden hatten, die sie gar nicht getan oder gewusst hatten, nur um seiner bedrohlichen Gesellschaft zu entkommen.
Probehalber zog er einen Mundwinkel nach oben und versuchte sich an einem Lächeln, das aber eher wie ein Zähnefletschen aussah. Resigniert gab er auf und ließ den Mundwinkel an seinen angestammten Platz zurücksinken. Nachdem er sich etwas Gel in die haarige Katastrophe auf seinem Kopf geschmiert hatte, klebte das schwarze Haar nun an seiner Schädeldecke und schimmerte stark in dem künstlichen Licht. Er warf seinem Spiegelbild einen skeptischen Blick zu.
„Besser“, versuchte er sich zu überzeugen und nickte dabei bekräftigend. Dann mähte er sich den dichten Bart ab. Ein hohlwangiges Gesicht, das von jahrelangem Alkoholmissbrauch zeugte, kam zum Vorschein. Er fragte sich, ob er nicht besser damit beraten gewesen wäre, den Bart stehen zu lassen. Das Wenige, das er sich noch an Barthaar gegönnt hatte, fühlte sich rau und stoppelig an. Eine perfekte Beschreibung seiner Selbst.
Mental gestärkt durch seine Verwandlung vom Obdachlosen zum zivilisierten Mann tapste er barfuß durch die dunkle Wohnung. Überall lagen leere Chipstüten, Coladosen und anderer undefinierbarer Müll herum. Er würde eine Haushaltshilfe einstellen müssen. Neben dem, was er vorhatte, blieb keine Zeit für Banalitäten wie Aufräumen oder Putzen. Auf dem Bett lag ein gewöhnlicher Anzug mit passendem Hemd und Schuhen. Randolphs überlegte, wie lange er schon keinen solchen Anzug mehr getragen hatte, aber es wollte ihm partout nicht einfallen. Es war wohl zu lange her.
Vor dem großen Spiegel im Schlafzimmer begutachtete er den Faltenwurf des Anzugs und jeden einzelnen Knopf seines Hemdes. Erst als er mit dem Ergebnis vollkommen zufrieden war, knöpfte er sein Jackett zu. Gerade wollte er sich zum Gehen wenden, da fiel sein Blick auf etwas, das auf dem Boden unter einem Haufen alter Wäsche lag. Er bückte sich und zog eine verblichene Akte hervor, aus der etliche lose Papiere zu Boden flatterten, darunter auch ein Foto. Mit zitternden Händen hob er es auf, um sich das Bild genauer anzusehen. Sein Gesicht verzerrte sich zu einer zornigen Fratze.
„Victor. Gayoski. Duva.“
Jedes einzelne Wort presste er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und seine Kiefer mahlten aufeinander. Seine Hand ballte sich zur Faust und zerknüllte dabei das Foto. Mit einer ruckartigen Bewegung schleuderte er es von sich und spürte, wie sein Körper vor Wut bebte. Seine Fingernägel gruben sich schmerzhaft in die Handflächen, und erst als ein metallener Geschmack seinen Mund erfüllte, entspannte er sich wieder. In seiner Rage hatte er sich auf die Zunge gebissen. Mit weit ausgreifenden Schritten durchquerte er die Wohnung und spuckte Blut ins Waschbecken. Das wütende Rot schrie ihn förmlich an, was ihn nur noch mehr anstachelte. Seine Wut war wiedergekehrt und brodelte tief und beständig in ihm.
Das Lokal, in dem Randolphs auf seine Verabredung wartete, hatte sich über die Jahre sehr stark verändert. Früher waren hier ehrliche Geschäftsleute nach einem anstrengenden Arbeitstag herein gewankt, hatten ein oder am besten gleich zwei Bier bestellt und sich mit anderen Männern lautstark über die heiße Bedienung hinter dem Tresen ausgelassen. Von dieser angenehm ordinären Atmosphäre war nicht das Geringste mehr übrig geblieben. Jetzt saßen hier Neureiche mit hässlichem Schmuck beladen und stocherten lustlos in ihren veganen Salaten herum, unterhielten sich über eine neue Kunstausstellung, die in der Stadt zu besuchen war, und nippten betont elegant an ihrem Rotwein. Missmutig beobachtete Randolphs sie und verspürte ein schmerzhaftes Ziehen in der Magengegend. Als er merkte, wie seine Hände zu zittern begannen und sein Mund trocken wurde, wandte er sich rasch ab und verfluchte im Stillen alle Menschen, die in seiner Gegenwart dem Alkohol frönten.
„Verzeihen Sie bitte, Sir“, näselte plötzlich ein Kellner, der unbemerkt neben ihm aufgetaucht war, woraufhin Randolphs heftig zusammenzuckte. „Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen?“
„Eh … ja“, erwiderte Randolphs lahm. „Ja. Ich hätte gerne ein Seven Up. Aber bitte in einem Whiskeyglas.“
Die Bedienung warf ihm einen maximal befremdeten Blick zu. „Wie bitte?“
„Seven Up im Whiskeyglas. Was ist daran nicht zu verstehen?“ Randolphs‘ Worten war sein Unmut deutlich zu entnehmen, also quittierte der Pinguin seine Order mit einem artigen Lächeln und zog dann in Richtung der Küche davon. Mit der Rechten fuhr sich Randolphs über das frisierte Haar, als müsste er prüfen, ob noch jede Strähne an ihrem Platz war, und ließ den Blick weiter durch den Raum schweifen. Die Eingangstür öffnete sich, und ein kalter Luftstoß wehte herein.
Alles an dem Mann, der soeben das Lokal betreten hatte, wirkte kantig. Die Frisur, der Schwung der Brauen, das Kinn und seine gesamte Statur waren kantig. Man musste befürchten, einen blauen Fleck davonzutragen, sobald man ihn berührte. Er machte aber ohnehin nicht den Eindruck, als wäre er ein Freund von körperlichem Kontakt. Er war ein Fels. Kantig, kalt und hart.
Karl Jaikovsky, der nur Jaiko genannt wurde, wechselte ein paar Worte mit dem Portier, der ihm steif zunickte und ihn zu Randolphs Tisch am hinteren Ende des Raumes führte. In seinen Augen, deren Iris viel zu hell waren, um als menschlich durchzugehen, war keinerlei Gefühlsregung zu erkennen, als sie Randolphs ins Visier nahmen. Dieser erhob sich und wartete geduldig, bis sein Gast am Tisch angekommen war. Der aschgraue Mantel mit den dick ausgepolsterten Schultern verstärkte den Eindruck eines Steinquaders. Er ließ sich aus dem Mantel helfen und zog die schwarzen Lederhandschuhe aus, bevor er Randolphs die Hand zum Gruß reichte. Der Händedruck war stark, als wollten die beiden die Kräfte des jeweils anderen messen. Beide Männer nahmen Platz und ließen einander keine Sekunde aus den Augen. Bald begannen Randolphs Augen zu tränen, und er musste als Erster den Blick senken, was ihm gewaltig gegen den Strich ging.
„Ich war ziemlich überrascht, dass Sie mich angerufen haben“, brach Jaiko das Schweigen. Bevor Randolphs zu einer Antwort ansetzen konnte, kehrte der Kellner mit seiner Bestellung zurück und servierte ihm seine Limonade im Whiskeyglas.
„Einen doppelten Scotch mit der gleichen Menge Wasser und drei Eiswürfeln, bitte“, bestellte Jaiko, und der Kellner zog ob dieser ebenfalls sehr speziellen Order die Brauen zusammen.
„Sie sehen scheiße aus“, stellte Jaiko trocken fest, als er sich sein Gegenüber genauer ansah. Er warf einen vielsagenden Blick in das mit Limonade gefüllte Whiskeyglas. „Ich frage mich, wieso.“
„Jeder hat seine Laster“, wich Randolphs ihm aus und nahm einen großen Schluck Limonade. „Am besten wir lassen den Smalltalk und kommen gleich zum Geschäftlichen. Das erspart uns beiden sehr viel Zeit und Nerven.“
Aber Jaiko ging nicht darauf ein, sondern musterte den um etliche Jahre älteren Mann eingehend. Noch nie hatte Randolphs sich derart unwohl gefühlt. Jetzt verstand er die Menschen, die sich unter seinem durchdringenden Blick gewunden hatten. „Für einen Moment dachte ich, dass mich jemand verarschen will.“ Jaiko beugte sich vor und durchbohrte Randolphs mit seinem eisigen Blick. „Zuerst hielt ich Sie für einen Geist. Darron Randolphs, der von den Toten auferstanden ist.“ Er warf den Kopf in den Nacken und lachte donnernd. Randolphs Nackenhaaren sträubten sich, und er nickte bloß, als würde er den Witz verstehen und ihn für gut befinden. Sofort wurde Jaiko wieder ernst. „Nach dem Vorfall vor vierzehn Jahren waren Sie wie vom Erdboden verschluckt. Ihretwegen wäre ich fast im Knast gelandet.“ Seine Augen sprühten tödliche Funken, und am liebsten hätte Randolphs eine Waffe bei sich gehabt. Nur als Vorsichtsmaßnahme.
„Ja.“ Er räusperte sich. „Das stimmt. Aber Sie haben sicher nicht vergessen, wer Sie letztendlich vor dem Gefängnis bewahrt hat.“
„Nein“, knurrte Jaiko finster. Offenbar war die Stimmung an ihrem Tisch so feindselig, dass der Kellner in Windeseile das Whiskeyglas vor Jaiko abstellte, wobei er beinahe den Inhalt über den Tisch verteilte. Rasch befeuchtete Randolphs seine Kehle mit dem billigen Zuckerwasser. „Sie sind mir nichts schuldig. Ich hätte Sie fast in den Knast gebracht, konnte Sie aber noch davor bewahren. Das soll wohl genügen.“
„Wir sind quitt. Was wollen Sie also von mir?“, brachte Jaiko das Gespräch endlich auf den Punkt.
„Einen Gefallen.“
„Niemand fordert von mir Gefallen ein.“
„Dann werde ich eben der Erste sein“, gab Randolphs trocken zurück.
„Sie haben echt Eier.“
„Das Kompliment kann ich nur zurückgeben.“
Jaiko zog einen Mundwinkel nach oben. „Worum handelt es sich also? Sie wissen, dass ich aus diesem Geschäft schon vor Jahren ausgestiegen bin.“
„Was sehr löblich ist. Sie haben Ihr Leben offenbar in den Griff bekommen. Meinen Glückwunsch.“ Er machte eine wirkungsvolle Pause. „Die Frage ist nicht, worum es geht, sondern um wen.“ Er zog etwas aus seiner Jackentasche und legte es in die Mitte des Tisches.
Es bereitete Randolphs das reinste Vergnügen, die Veränderung im Gesicht des sonst so reservierten Mannes zu verfolgen. Jegliche Farbe wich aus seinen Wangen, als hätte er tatsächlich einen Geist gesehen. Seine Nasenflügel begannen zu beben, und er presste die Lippen fest aufeinander, als müsste er die Worte, die aus ihm herausbrechen wollten, krampfhaft zurückhalten.
„Ich dachte mir schon, dass Sie sich freuen würden, Ihren alten Freund wiederzusehen“, sagte Randolphs und lächelte süffisant. Jaiko reagierte nicht, sondern starrte so konzentriert auf die Fotografie, als wollte er diese mit der bloßen Kraft seiner Gedanken in Flammen aufgehen lassen. Es zeigte einen großen, breitschultrigen Mann, der an einen Baumstamm gelehnt auf einen bestimmten Punkt starrte, der außerhalb des Aufnahmebereichs lag. In Gedanken versunken hatte er wohl nicht bemerkt, dass ihn jemand verfolgt und fotografiert hatte. Seine dunklen Augen blickten düster drein, während er die schmalen Lippen zu einem Strich zusammenpresste. Unter dem Hut ragten pechschwarze Haare hervor, die das blasse Gesicht noch geisterhafter erscheinen ließen. Alles in allem war er keine Erscheinung, der man nachts auf einer verlassenen Straße begegnen möchte.
Nach einer gefühlten Ewigkeit riss Jaiko endlich den Blick los, und sein Gesichtsausdruck war eine Mischung aus Wut und Hass.
„Egal, was Sie vorhaben“, presste er hervor, „ich bin dabei.“
Jetzt grinste Randolphs breit und erhob sein Glas zum Toast. „Auf die Rache.“ Glückselig schüttete er die grüne Flüssigkeit den Rachen hinunter.
Der Mann hinter der Maske
Aus den Lautsprechern der Double Cross Lounge schallte gemütlicher Smooth Jazz, zu dem sich die Gäste des Kinzie Hotels gedämpft unterhielten. Das Licht war gedämmt und trug so zu der angenehmen Atmosphäre bei. Ausschließlich elegant gekleidete Männer und Frauen von Welt hatten sich zu dieser späten Stunde eingefunden, um in die betörende Gesellschaft ihresgleichen einzutauchen. An der Bar tummelten sich Männer, die hübschen Frauen einen Drink ausgaben oder ihren Kummer in Alkohol ertränkten, den sie sich wie Wasser die Kehlen hinunterkippten. Ein solches Exemplar, das bereits sehr betrunken war, beugte sich gerade weit über den Tresen, um Duva mit seinem leeren Glas vor der Nase herum zu wedeln.
„Hörst du mir überhaupt zu?“, fragte der Betrunkene lallend und schaute ihn vorwurfsvoll an. „Meine Frau hat mir auch nie zugehört. Da hätte mir schon etwas auffallen müssen“, lamentierte er weiter über seine gescheiterte Ehe. Der Detektiv presste die Lippen zusammen und umklammerte das Glas, das er soeben abtrocknete, fester als nötig. Seit Stunden hatte er sich nun schon das Gejammer dieses Mannes anhören müssen, dessen Frau ihn mit ihrem Therapeuten betrogen hatte. Jener Therapeut, zu dem sie gegangen waren, damit er ihre Ehe retten würde. In dieser Hinsicht hatte der Therapeut eindeutig versagt.
Damit der bemitleidenswerte Mann endlich den Mund hielt, füllte Duva sein Glas wieder auf und hoffte inständig, dass er damit aus seiner unfreiwilligen Rolle als stummer Zuhörer entlassen war. Doch der Mann dachte gar nicht daran, sondern nahm seine Schimpftirade auf seine Frau und den Therapeuten wieder auf. Resigniert trocknete Duva ein Glas nach dem anderen ab, während er scheinbar gleichgültig immer wieder in eine Ecke der Lounge hinüberblickte.
Dort hatte es sich ein Mann in hellblauem Anzug mit zwei freizügig gekleideten Damen gemütlich gemacht. Ihm haftete etwas Südländisches an, und tatsächlich hatte Duvas Recherche ergeben, dass seine Familie aus Italien stammte. Obwohl er in den Staaten unter dem Namen Matthew Daniels gemeldet war, lautete sein richtiger Name Mattheo Danesi. Alles deutete darauf hin, dass er Teil der Mafia in Chicago war. Die kleine Gesellschaft hatte bereits zwei Champagnerflaschen geleert und war im Verlauf des Abends zu den härteren Sachen übergegangen. Je mehr Alkohol sie tranken, desto lauter und ausgelassener wurden sie. Es fehlte nicht mehr viel und die Rothaarige saß auf seinem Schoß. Die andere Frau füllte immer wieder sein Glas auf.
„… hat er uns geraten, beim, naja, Sie wissen schon …“ Er legte sich mit dem Oberkörper auf den Tresen und flüsterte die nächsten Worte, als wären sie ihm peinlich: „Beim Sex mal etwas anderes auszuprobieren. Etwas Gewagteres. So was wie in diesem Buch. Wie hieß das noch gleich?“ Der Betrogene runzelte die Stirn, während er versuchte, in der zähen Masse seiner Gedanken die Antwort zu finden. Man konnte ihn förmlich denken sehen. „Dieses Sex-Buch, auf das alle Frauen so stehen.“ Er schnipste mit den Fingern und schaute Duva erwartungsvoll an. Der seufzte tief.
„Shades of Grey?“
Begeistert klatschte er in die Hände. „Genau das! Jedenfalls meinte dieser Mistkerl, das würde das Feuer neu entfachen“, lallte der Betrogene weiter, und seine Augen schimmerten verräterisch. „Stattdessen vögelt er selber meine Frau.“ Eine Träne kullerte seine Wange hinunter, aber er machte sich nicht die Mühe, sie wegzuwischen.
In diesem Augenblick erhob sich Daniels, und mit je einer Frau an seiner Seite durchschritt er die Lounge in Richtung Ausgang. Duva schnappte sich ein Rotweinglas, füllte es rasch auf und balancierte es auf einem Tablett. Behutsam schlängelte er sich an ein paar Gästen vorbei und kreuzte fast den Weg des Italieners, als jemand ihn unsanft am Arm packte.
„Ich war noch nicht fertig, Mann!“, brüllte der Betrunkene ihn an, und in seiner Rage und Trunkenheit stolperte er über seine eigenen Füße und rempelte heftig gegen Duva. In hohem Bogen segelte das Rotweinglas vom Tablett, der Inhalt schwappte über den Rand und durchtränkte den feinen Stoff des Anzugs. Duva konnte einen Sturz verhindern und prallte stattdessen gegen den Mafioso. In der allgemeinen Verwirrung und Aufregung bemerkte niemand Duvas Hand, die bei dem Zusammenstoß für den Bruchteil einer Sekunde unter dem Hemdkragen des Mannes verschwand.
Aller Augen waren auf die Szene in der Mitte der Lounge gerichtet, aber nach allgemeinem Kopfschütteln und abfälligen Worten über die Inkompetenz des Personals widmete man sich wieder den eigenen Angelegenheiten. Daniels Mund klaffte in einem runden O auf, und mit genauso runden Augen starrte er von dem Rotweinfleck zu Duva und wieder zurück.
„Weißt du eigentlich, wie teuer dieser Anzug war?“, brüllte er und schüttelte ungehalten die beiden Damen ab, um sich bedrohlich vor Duva aufzubauen. Dass er um einiges kleiner als der vermeintliche Barkeeper war, hielt ihn nicht davon ab, sich aufzuplustern und eine Schimpftirade über Duva niedergehen zu lassen. Der Detektiv entschuldigte sich immer wieder, während der Betrunkene mit leerem Blick danebenstand. Offenbar begriff er noch immer nicht, weshalb dieser Mann so einen Aufstand machte.
„Jetzt halten Sie mal die Klappe und lassen den Mann hier in Ruhe!“, brüllte der Betrunkene plötzlich, und der andere Mann verstummte mitten in seinen Drohungen, mit Duvas Vorgesetzten sprechen zu wollen.
„Wie bitte?“
Der Betrunkene trat näher und zeigte auf den Rotweinfleck. „Wenn Sie mich fragen, verschönert das diesen babyblauen Anzug sogar. Hätten Sie nicht diese zwei Damen bei sich, könnte man meinen, Sie wären vom anderen Ufer.“ Er gab dem völlig perplexen Mann einen brüderlichen Klaps auf die Wange. „Kaufen Sie sich mal etwas Anständiges.“
Es dauerte einen Moment, bis Daniels seine Sprache wiedergefunden hatte. Sofort holte er tief Luft, um seine Wut nun über den Betrunkenen hereinbrechen zu lassen, aber da schaltete sich die Rothaarige ein, die ungeduldig am Arm des Mannes zupfte.
„Lass uns endlich gehen. Das hier kannst du morgen immer noch klären.“ Verführerisch strich sie ihm mit einem Finger über die Wange und presste ihre knallroten Lippen auf seinen Mund. Das schien ihn tatsächlich zu beruhigen, und er fuhr sein Temperament etwas herunter, was ihn aber nicht davon abhielt, Duva und dem Betrunkenen einen tödlichen Blick zuzuwerfen. Sie zogen ab, und über die Schulter zwinkerte die Rothaarige Duva zu. Dann waren sie verschwunden.
„He“, sprach der Betrunkene Duva an, der sich daran machte, die Glasscherben aufzusammeln. „Mach dir nichts draus, Kumpel.“ Er klopfte ihm auf die Schulter und kehrte an seinen Platz an der Bar zurück, als wäre nichts geschehen. Duva schnaubte verhalten. Der Mann hatte keine Ahnung, wie sehr er ihm gerade geholfen hatte.
Als er die Sauerei weggeräumt und seine Arbeit als Barkeeper wieder aufgenommen hatte, trat jemand an den Tresen und legte eine kalkweiße Pranke auf die Steinplatte. Duva sah auf und erblickte einen Mann, dessen eisblaue Augen unverwandt auf ihn gerichtet waren. Trotz der Wärme in der Lounge hatte er seinen Mantel anbehalten. Die Lederhandschuhe hielt er in der anderen Hand, als wollte er gleich wieder aufbrechen. Vermutlich hatte er es eilig und brauchte nur schnell einen Drink zwischendurch.
„Guten Abend, Sir“, begrüßte Duva ihn pflichtbewusst. „Was darf ich Ihnen bringen?“
Einen Augenblick lang schwieg der Gast und musterte Duva nur mit einem unergründlichen Blick, der langsam unangenehm wurde. Dann brach seine emotionslose Miene, und er lächelte. „Einen doppelten Scotch mit der gleichen Menge Wasser und drei Eiswürfeln.“
„Gerne.“ Duva wunderte sich nicht über diese überaus genaue Bestellung. Es gab viele Menschen, die ihre persönliche Lieblingsmischung durch etliche Versuche gefunden hatten, und sie ließen in dieser Hinsicht auch nicht mit sich reden. Er mischte also den bestellten Drink und stellte das volle Glas vor den Herrn im Mantel. „Lassen Sie ihn sich schmecken.“
Doch der Mann machte keine Anstalten, zu trinken. Stattdessen starrte er Duva nur wortlos an. Sein Gesicht war hart wie Stein, und es hätte Duva keineswegs gewundert, würde er sich auch genauso kalt anfühlen. Instinktiv vermied der Detektiv es, dem merkwürdigen Fremden den Rücken zuzudrehen, und behielt ihn stets im Auge. Nach einer gefühlten Ewigkeit nahm der Fremde endlich einen großen Schluck aus seinem Glas. Dann führte er langsam die Hand in Richtung der Innentasche seines Mantels. Instinktiv spannte Duva sich an und umklammerte den Griff des Messers, mit dem er gerade Limetten schnitt.
Verstohlen beobachtete er den Mann, dessen Hand nun in seinem Mantel verschwunden war. Er hatte kein gutes Gefühl dabei. An diesem Fremden haftete eine düstere und unberechenbare Aura, die ihm ganz und gar nicht gefiel. Jeden Moment rechnete er damit, dass der Mann eine Pistole hervorziehen würde, und jeder Muskel in seinem Körper war derart angespannt, dass die Sehnen am Hals hervortraten und sich die Knöchel weiß färbten.
Ein einfaches Feuerzeug kam zum Vorschein, und der Mann hielt es hoch. „Darf man hier rauchen?“, fragte er. Duva sah ihn perplex an, dann nickte er stumm und stellte einen Aschenbecher vor ihn hin. Gemächlich rauchte der Mann eine Zigarette, trank dabei seinen Scotch und verließ dann ohne ein weiteres Wort die Lounge. Duva sah ihm nach und war erleichtert und besorgt zugleich. Erneut wurde ihm bewusst, was für merkwürdige Gestalten in Chicago herumliefen. Sich selbst schloss er von dieser Gruppe nicht aus.
On the Road Again
Wegen der Eiseskälte hatten sich die Menschen in dicke Mäntel und Schals gehüllt und beeilten sich, ins Warme zu kommen. Jaiko saß schon seit zwei Stunden in seinem BMW und schlürfte einen Kaffee nach dem anderen. Früher einmal mochte ihm diese Überwachungsarbeit gefallen haben, immer den Nervenkitzel zu spüren und der Gefahr ausgesetzt zu sein. Jetzt aber war er dieser Arbeit überdrüssig geworden und fragte sich, ob er nicht doch eine falsche Entscheidung getroffen hatte, als er Randolphs wahnwitzigem Plan zugestimmt hatte.
„Immer noch keine Bewegung“, nuschelte eine gedämpfte Stimme in sein Ohr. Jaiko warf einen Blick in den Rückspiegel und sah einen Obdachlosen auf einer Parkbank sitzen. „Geduld“, ermahnte Jaiko seine Leute. Er hatte Duvas Tagesablauf, so sonderbar dieser sein mochte, bis ins kleinste Detail auskundschaftet, und es war nur eine Frage der Zeit, bis er endlich sein Haus verlassen würde.
„Um die Alte ist gesorgt?“, fragte er noch einmal nach. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
„Die ist beim Bingo.“ In der Stimme des Mannes war eindeutig Verachtung herauszuhören.
Jaiko kniff die Augen zusammen und meinte gefährlich ruhig: „Ich spiele sehr gerne Bingo, Landon. Wollen Sie mir damit etwas Bestimmtes sagen?“
Der arme Kerl am anderen Ende der Verbindung stammelte rasch: „Nein, Boss, natürlich nicht. Bingo ist super. Ich wollte nur sagen, dass uns die alte Dame noch eine ganze Weile keine Probleme bereiten wird.“
„Da“, unterbrach ein anderer ihre Diskussion.
Jaiko richtete sich abrupt in seinem Sitz auf. Die vergilbte Tür, das Zentrum ihrer Aufmerksamkeit, schwang auf und ein komplett in Schwarz gekleideter Mann mit Hut trat auf die Straße. Er warf einen Blick in beide Richtungen, bevor er mit hochgezogenen Schultern den Gehweg entlang marschierte. Einen Augenblick später schlenderte ein Pärchen in dieselbe Richtung davon.





























