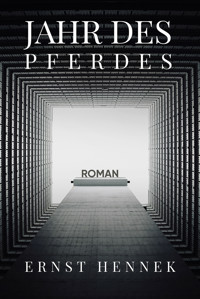
4,99 €
4,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit dem Arbeitsamt im Nacken fiel die Entscheidung für das Studium leicht. Studenten wurden in Ruhe gelassen, zumindest vorerst. Irgendetwas Kreatives musste es aber schon sein. Architektur hörte sich gut an,fühlte sich gut an und war auch für Leute mit mittelmäßigem Antrieb zu schaffen. Und danach? Einen Plan gab es nicht, nur eine grobe Richtung. Asien. China. Bei dem Wort schwang immer ein Hauch von Abenteuer mit, das Unbekannte, ein Karl-May-Roman ohne Indianer, aber voller seltsamer Begegnungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Das Jahr des Pferdes
*
Ernst Henneck
Um ehrlich zu sein: Ich war schon immer irgendwie faul, nicht wirklich dumm, aber faul. Wobei faul vielleicht nicht das richtige Wort war, ökonomisch wäre besser oder energiesparend. Ich wollte nie unnötige Energie in etwas stecken, von dem ich wusste, dass es mir nichts bringt. In meinen alten DDR-Schulzeugnissen, in denen die Lehrer damals noch ihre Einschätzungen über die Schüler hinterließen, stand jedes Jahr sinngemäß: „Er könnte so viel mehr erreichen, wenn er sich nur ein bisschen anstrengen würde“. Aber warum sollte ich, wenn die Anstrengung nicht zu einem proportionalen Niederschlag in den Ergebnissen führte? Und mal ehrlich, bei den meisten Dingen im Leben tat sie das nicht. Diese Einstellung zog sich wie ein roter Faden durch mein bisheriges Leben. Ich glaube, es lag daran, dass ich nie ein wirkliches Ziel hatte, keinen richtigen Plan fürs Leben. Viele meiner Freunde hatten eine klare Vorstellung davon, wie ihr Leben verlaufen sollte, oder sie hatten zumindest eine Ahnung. Schule, Ausbildung, Beruf, Frau, Kind und wenn es wirklich gut läuft, ein Haus. Zusammen einen Kredit abbezahlen, die Wohlstandssimulation des kleinen Mannes. Ich wusste nur, was ich nicht wollte. Von dem, was ich wollte, hatte ich nicht den blassesten Schimmer. Ich ließ immer alles auf mich zukommen und entschied dann, ob ich es wollte oder nicht. Die meisten Dinge wollte ich nicht. Sie würde mir die Stütze streichen, wenn ich nicht diese oder jene Arbeit annähme, erklärt die Frau von der Arbeitsvermittlung, ich müsse jetzt mal was tun. Lange konnte ich mich darum drücken, aber jetzt machte sie Ernst. Ich bin doch gerade erst raus aus der Schule, ich brauch noch etwas Zeit, „Sie wissen doch, wie das ist“. Ich setzte mich auf die kleine Bank vor dem Coswiger Bahnhof. Sie befand sich direkt vor der Unterführung, die zu den Gleisen führte, und lag immer im Schatten. An diesem Morgen war der Platz verwaist, die Welle des morgendlichen Berufsverkehrs abgeebbt. Ich wollte nicht irgendeine Arbeit machen, in irgendeinem Büro versauern, Papier hin und her schieben. Oder noch schlimmer, etwas Körperliches tun. Während der Ferien hatte ich mal in einer Fabrik gearbeitet, die Metalldeckel für Einlegegurken und Joghurtbecher bedruckte. Meine Aufgabe war es, an einem Fließband zu stehen und Kartons mit den Deckeln zu füllen, die langsam auf einem Fließband an mir vorbeikrochen. Die Deckel fielen einfach hinten vom Band, ich musste nur ab und an einen neuen Karton drunterstellen. Das war so monoton, dass ich schon nach kurzer Zeit begann, die Zeit nur noch in Kartons zu messen. Acht Kartons zur Mittagspause, 50 bis zum Feierabend. An der Maschine neben mir standen Frauen, deren Aufgabe es war, die Deckel, die aus der Druckmaschine kamen, optisch auf Fehldrucke und Verunreinigungen zu prüfen. Diese Frauen standen den ganzen Tag am Band und starrten auf die vorbeifahrenden Deckel. Was war das? Ein blauer Fleck, wo er nicht hingehörte? Dann fischten sie die noch heißen Deckel entweder mit der Hand oder mit einer Art kleinem Rechen vom Band. Während ich auf den vollen Karton wartete, schaute ich immer wieder zu ihnen hinüber und wurde depressiv. Ich könnte das nicht, dann lieber Selbstmord. Aber schnell müsste es gehen, also kein Aufhängen oder Pulsadern aufschneiden, das ließe Zeit zum nachdenken, und dann würde man vielleicht zu dem Ergebnis kommen, es noch mal versuchen zu wollen, aber dann wäre es zu spät. Zu lang darüber nachgedacht, kein Blut mehr in den Adern. Und dann würde man sich nochmal ärgern, bevor man stirbt. Ich wollte mich nicht ärgern.
Beim rumwühlen im Rucksack fand ich ein kleines Heftchen, das mir irgendjemand von der Berufsberatung mitgegeben haben musste, eines von den kleinen, die in jedem Arbeitsamt auslagen und in dem all die Berufe, die man in Deutschland irgendwie lernen konnte, aufgelistet waren. Das Ding musste ich wohl schon ewig mit mir herumschleppen, mindestens ein halbes Jahr, ich hatte es immer vermieden, reinzuschauen, wahrscheinlich aus Angst, mich für irgendetwas da drin entscheiden zu müssen. Entweder interessierte es mich nicht, und wenn doch, dann würde es ja eh nichts werden. Damals, kurz nach der Schule, träumte ich in einem Anflug von Wahnsinn davon, Regie zu studieren. Ist natürlich nichts geworden. Ich hatte auch keine Ahnung von Film, Filmgeschichte, Filmtheorie, Filmsonstwas gehabt. Es klang interessant und kreativ und ich wollte was Interessantes und Kreatives machen. Mutter hatte mich zu dieser Zeit mal zum Tag der offenen Tür an die Film-Uni Babelsberg gefahren. Ich wollte mich einfach mal umschauen, einen Eindruck gewinnen von der Schule, den Leuten, der Gesamtsituation. Als wir dann so über den Campus liefen, wir beide, war es mir aber doch zu peinlich, mit „Mama“ da zu sein, sodass ich an keiner der freien Veranstaltungen und Probevorlesungen teilnahm. Später fand ich es schade, dass aus dem Filmdingens nichts wurde. Ich hatte es zwar nie wirklich versucht, aber es ist ja auch nichts geworden, also war es ok. Jetzt saß ich hier vorm Bahnhof, hielt das kleine Heftchen in der Hand und blieb beim Durchblättern gleich am Anfang hängen. A wie Architektur, das klang auch irgendwie kreativ. Vielleicht wäre das was. In Dresden konnte man Architektur studieren, an der Uni und der HTW. An die Uni konnte ich nicht, aber für die HTW hatte ich den passenden Abschluss. Wer in den Studiengang wollte, musste den richtigen Notendurchschnitt haben, und auf der Webseite hieß es außerdem, man müsse eine Aufnahmeprüfung bestehen. Die Prüfungsaufgabe lautete „Brücke“. Die Einreichung sollte maximal das Format DIN A3 haben, konnte aber alles sein: Fotocollagen, Malereien, Zeichnungen, Bilder von Modellen etc. Meine Idee war eine Werbung für eine imaginäre dritte Welt-Hilfsorganisation. Unsere Familie hatte mal ein afrikanisches Kind, das uns von World Vision zugewiesen wurde. Das funktionierte so: Man überwies 10 Euro im Monat und dafür malte uns ein armes Kind ein Bild. Man durfte dem Kind auch Dinge nach Afrika schicken, von teuren Schulmaterialien, Stiften usw. wurde aber abgeraten. Die anderen armen Kinder würden dann neidisch und eventuell auch aggressiv, hieß es. Das war die Idee. Selbstgemachte Printwerbung für eine erfundene NGO. Auf meiner selbstgebastelten Werbung sah man die Hände meiner Eltern, die einander die Handgelenke umgriffen. Mein Vater hatte sich mal das Handgelenk gebrochen, war aber eine Woche lang weiter zur Arbeit gegangen, als ob nichts wäre. Wir überzeugten ihn dann, zum Arzt zu gehen. Jetzt hat er Schrauben in der Hand und sein Gelenk sieht aus, als ob man ihm eine Walnuss unter die Haut implantiert hätte. Also perfekt für die Dritte Welt. In die Mitte des Handkreises hatte ich das berühmte Blue-Marble Foto der Erde kopiert, dazu ein Logo einer imaginären Hilfsorganisation erfunden und das Ganze anschließend als Postkarte ausgedruckt. Brücke mal anders definiert, als humanitäre Brücke von Mensch zu Mensch. Die beiden Professoren, welche die Einladungsgespräche führten, waren ganz aus dem Häuschen.
„Sie denken out of se Box, das gefällt mir“, gratuliert mir einer. Auf dem Tisch vor ihm ausgebreitet lagen einige der anderen eingereichten Arbeiten, viele von ihnen zeigten, genau, Brücken. Ich war der älteste meines Jahrgangs, alle anderen kamen direkt von der Schule oder hatten höchstens ein Jahr Warteliste hinter sich. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft war ein länglicher Bau gleich hinter dem Hauptbahnhof, hinter dem auch die Studentenstadt begann. Bibliothek, Mensa, Wohnheime, Studentenwerk und alles andere was dazugehörte, destilliert auf der anderen Seite der Gleise. Äußerlich ein ordinärer Verwaltungsbau und auch innerlich nicht sonderlich weltbewegend, war sie doch für die nächsten Jahre mein zweites Zuhause. Das erste Zuhause befand sich 15 Gehminuten entfernt, ebenfalls an den Gleisen. Budapester Straße, gleich hinter der Brücke. 8. Stock, 10 m². Küche und Bad im Flur. Tag der offenen Tür im Studentenwohnheim. Mutter fuhr mich hin, sie hatte sich inzwischen mit meiner Entscheidung Student zu werden, abgefunden und wollte das Zimmer auch mal sehen. Im Treppenhaus wimmelte es von Jack-Wolfskin-Anoraks. Es gab nicht wirklich viel zu sehen. Ein langer Gang, Neonlicht, fleckige Auslegeware. Links eine kleine Kochnische mit Kochplatte und Minikühlschrank, die sich fünf Leute teilen mussten. Eine Tür weiter, das Bad. Die Zimmer befanden sich gegenüber, auf der rechten Seite. Immer wieder tropften ältere Paare mit westdeutschen Dialekten aus den Zimmern und drängten sich, unsicher nickend und lächelnd, an uns vorbei.
„Oh, das ist ja schön.“, entfuhr es Mutter in einem Ton, der das Gegenteil meinte. Schön? Was sich vor mir auftat, fühlte sich an wie ein Schlag in die Magengrube. Aber nicht irgendeiner, ein richtiger Schwinger, einer, in den man sich mit dem ganzen Oberkörper reinlegt.
„Bissl klein isses ja.“ Ich war mir nicht sicher, was ich erwartet hatte. Ich glaube ich hatte gar nichts erwartet, aber ich hatte gehofft. Das war der Fehler. Ich hätte nicht hoffen sollen, hoffen auf ein größeres Zimmer. Es war klein. So breit wie das Bett lang war. Das Fußende des Bettes befand sich direkt neben der Tür, das Kopfende an der Wand gegenüber. Oder andersherum. Neben dem Kopfende wartete ein kleiner Beistelltisch mit Schubladen, daran angeschlossen zwei Schreibtische, dann das Fenster. Das war es. Bett, Beistelltisch, Schreibtisch und ein Stuhl. Gegenüber den Schreibtischen, auf der Türseite, befand sich, in eine Wandnische eingelassen, ein Regal und ein flacher Kleiderschrank. 10 Quadratmeter artgerechter Minimalkonsens. Aber wie hieß es doch so schön: Lehrjahre sind keine Herrenjahre, vielleicht galt das auch fürs Studium. Das ganze Paket kam für 200 Euro monatlich, inklusive Heizung, Strom und Internet. Vielleicht war es ja doch irgendwie angemessen. Ich brauchte noch eine Weile, um mir die Situation schönzureden. Es war ja nicht für immer.
Erster Tag. Willkommenstag. Die
Begrüßungsveranstaltung fand im Foyer eines der oberen Stockwerke, welches von den Architekturstudenten für Präsentationen und die allseits gefürchteten Kritiken genutzt wurde, statt. Manch einer hatte auch hier wieder seine Eltern dabei. Sämtliche auf den ersten Blick katalogisierbaren Stereotypen hatten sich eingefunden: die Schöne mit Hochhackigen und Ballerina-Haltung, die Dralle, die ihre Drallheit in einer etwas zu engen Bluse versteckte, die Öko-Tussi mit Dutt und viel zu großem und viel zu weitmaschigem Strickpullover, die Architektentochter, der Künstler, der Handwerker, der muskulöse Posterboy, das Genie und der Alte (Ich). Die Willkommensrede wurde vom selben Professor gehalten, der schon meine Bewerbungsarbeit gut fand, was ich wiederum gut fand. Ein Hauch von erstem Schultag lag in der Luft. Und wie am ersten Schultag hatte ich brav meine Tasche gepackt. Dreiseitiger Architektenmaßstab aus Metall, verschiedene Dreiecke aus Plastik, Fallbleistifte in verschiedenen Härten, zwei unterschiedlich weiche Radiergummis, Malerkrepp, Zirkel, Cuttermesser und eine lange Rolle Skizzenpapier. Später noch einen ausziehbaren Plastiktornister zum Umhängen für die großen Pläne. Der Tornister gehörte zum Architekturstudenten wie die Antifa-Faust zum bettelnden Punk, er war das ultimative Erkennungszeichen. Die Vorlesungen variierten sehr in ihrer Zähigkeit. Architekturgeschichte fühlte sich an wie Mao Am, direkt aus dem Kühlschrank und fand zu allem Überfluss morgens bei zugezogenen Vorhängen statt. Aufstehen, Kaffeeinjektion, im Nassgrau zur Vorlesung und da wieder in den Schlafmodus. Der Macht, mit der die Gravitation meine Augenlider runterzog, hatte ich nichts entgegenzusetzen. Versuche, mich wach zu zwicken oder vor der Vorlesung einen Teelöffel Kaffeepulver zu kauen, halfen nur kurzzeitig. Immer wieder zuckten auf Händen ruhende Köpfe in Position und entschwanden unter monotonem Geschichtsrauschen der italienischen Architektur des 15. Jahrhunderts wieder ins Land der Träume. Ich konnte mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, wissen zu müssen, wer Bartolommeo war. Säulen, Kolonnaden, klassische Gliederung waren heutzutage verpönt. Von Symmetrie ganz zu schweigen. Und selbst bekannte Köpfe aus der Neuzeit, wie Le Corbusier, waren bei Licht betrachtet eher Negativbeispiele. Mit der Interpretation von Gemälden stand ich ebenfalls auf Kriegsfuß. Erstens interessierte ich mich nicht für Gemälde und zweitens gaukelte der Begriff „Interpretation“ eine nicht vorhandene Vielfalt der möglichen Ergebnisse vor. Hier sollte nichts interpretiert, sondern nur nacherzählt werden, was irgendjemand, irgendwo, irgendwann in irgendeinem Buch vorerzählt hatte. Interpretationen sind Quark. Die Professoren ließen sich in zwei Kategorien unterteilen, in jene, welche noch eine echte Arbeit neben der Uni hatten, und solche, die Vollzeit professierten. Die mit der Arbeit waren die Interessanteren, konnten sie doch ihre Lehre mit mehr als hypothetischem Bücherwissen untermauern. Manche der Vollzeitprofessoren benutzten noch einen Overheadprojektor oder, wie die Insider sagten, Polylux. Inklusive alter Folien, auf denen Preisangaben in DM halbherzig durchgestrichen und mit ungefähren Euro-Angaben ersetzt waren. Vor den Prüfungen machte sich der Stress so richtig bemerkbar. Einmal durchgefallen, gab es die Barmherzigkeit eines zweiten Versuches, wenn man es dann verhaut, war es das. Mehrere Jahre und tausende Euro für nichts. Bafög musste ja trotzdem zurückgezahlt werden und zusätzlich galt man als Versager. Bestenfalls bemitleidet von jenen im Freundeskreis, die eine Ausbildung gemacht hatten und jetzt schon richtiges Geld verdienten.
„Siehste, hab ich doch gewusst, der schafft’s nich.“
Prüfung war Krieg, hier ging es um alles: Leben oder Sterben, Zukunft oder Untergang. Speziell wenn eine Prüfung Mathe enthielt oder Chemie, Physik oder Interpretation. Von meinem Schulwissen hatte ich mich schon lange getrennt. Meine Kommilitonen, die alle mehr oder weniger frisch von der Schule kamen, waren da im Vorteil. Ich war nur im Stress. Stress, der sich irgendwann auch anderweitig bemerkbar machte.
Der Fremde, der sich hinter meinem Vorhang versteckte, stand jetzt ganz still, aber ich konnte ihn sehen. Da! Er hatte sich wieder bewegt. Die Schatten der Stuhlbeine schlichen über den Boden, wurden zu Händen, die unter dem Schreibtisch verschwanden. Ich blieb ganz still. Vielleicht hatte der Typ hinter dem Vorhang noch nicht gemerkt, dass ich ihn gesehen hatte. Angst kroch zu mir ins Bett. Wie sind die ins Zimmer gekommen? Was wollen die? Schlafparalyse, war das Wort, das Google ausspuckte. Schlafparalyse, eine Art temporäres Wachkoma, bei dem ein Teil des Gehirns schon wach war, während der andere noch schlief. Man sah Dinge, Licht und Schatten begannen zu leben. Man selbst war nur passiver Beobachter. Hier kam der zweite Teil des Wortes ins Spiel, Paralyse. Man konnte sich nicht bewegen, nicht schreien, sich nicht bemerkbar machen, Arme und Beine klebten am Bettlaken wie zerkochte Spaghetti. Zum Beifahrer im eigenen Bewusstsein degradiert. In Gedanken warf ich meinen Körper mit den weichen Armen und Beinen hin und her, in der Hoffnung, davon aufzuwachen. Manchmal funktionierte es, die lebendigen Schatten waren verschwunden. Was war das? Die Tür lag nicht im Schloss, war einen Spalt breit geöffnet. War doch jemand im Zimmer? Dann wurde mir klar, die Spaghettiarme herumzuwerfen hatte doch nicht funktioniert, ich war immer noch in der Paralyse. Das Problem bei meiner Schlafparalyse war, dass man oft nur scheinbar aufwachte, nur um festzustellen, dass man sich immer noch im Traum befand. Ein Traum im Traum. Inception. Während der Prüfungsphasen traten diese Schlafstörungen immer wieder auf. Auslöser: Stress. Nicht immer so schlimm, aber auf alle Fälle seltsam. Als wirksames Gegenmittel für die Schlafparalyse stellte sich mein kleiner Kofferfernseher heraus, den ich nachts irgendwann einfach laufen ließ. Der Mann hinter dem Vorhang ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Das Studium verging wie im Flug. Man sagt ja oft, die Zeit an der Uni sei die beste Zeit im Leben und komme nie wieder. Dasselbe galt auch für die Schule. Im Grunde galt das für jede Zeit außer der Arbeitszeit. Es war so weit, Zeugnisübergabe oder Abschlussübergabe oder wie man das an der Uni nannte. Die feierliche Zeremonie, bei der man das Papier überreicht bekam, das sagte, dass man auf der Uni war und jetzt wer ist. Ich bin nicht hingegangen, man musste dankbar sein und Leute sehen, die man nicht sehen wollte. Ich hatte mich schon immer gegen solche Anlässe gesträubt, auch bei der Jugendweihe. Damals haben mich meine Eltern gezwungen, ein knallrotes Jackett zu tragen.
„Das sieht toll aus, man erkennt dich auf jedem dem Foto sofort“, war der offizielle Grund für diese Kindesmisshandlung. Zwischen all den normal angezogenen stach ich heraus wie ein bunter Hund. Vielleicht auch ein Grund, warum ich keinen Geburtstag mehr feierte. Da stand man auch immer im Fokus und musste ständig freundlich sein und sich für Geschenke bedanken, die man nie haben wollte. Und vor allen Dingen musste man Rechenschaft ablegen.
„Und? Sonst so?“
„Schon Pläne?“
„Haste schon ne Stelle?“
„Wann kommen denn die Enkel?“
Plötzlich fand ich mich da wieder, wo ich vor sechs Jahren gestartet war. Zurück auf Anfang. Wollte ich eigentlich wirklich als Architekt arbeiten? Die Antwort auf diese Frage war schwerer zu beantworten, als ich dachte. Letztendlich hatte nur studiert, weil mir das Amt im Nacken saß. Eine richtige Leidenschaft für den Job hatte ich ehrlich gesagt nie. Einer meiner Professoren sagte mal.
„Du musst brennen für den Job, sonst gehste kaputt.“
Ja, es machte Spaß zu entwerfen, aber Entwerfen war nur der geringste Teil der Arbeit. Nach dem Entwerfen kamen das Zeichnen der Pläne und der Details, die DIN-Normen, das Baugesetzbuch, die Bauordnung, die Kommunikation und Organisation mit all den Beteiligten, Elektrikern, Schreinern, Klempnern und so weiter. Und unglaublich viel telefonieren, ich mochte nicht telefonieren. Das Klingeln des Telefons löste in mir Panikattacken und Herzrasen aus. Brachte das Klingeln doch meist Probleme, wenn alles gut lief, rief nie jemand an, nur wenn es Probleme gab. Und Probleme gab es am Bau immer. Ich war mir nicht sicher: Wollte ich das wirklich?
Die Frau beim Arbeitsamt sagte mir, dass ich jetzt schon über ein halbes Jahr arbeitslos sei und mein Abschluss deshalb fast wertlos wäre. Dieses Konzept war mir neu. In der Uni hatten wir Austauschstudenten aus Amerika, die hier ihren Bachelor machten und dann einfach mal sehen wollten, was das Leben so brachte.
„Traveling Europe“ war einer der Pläne.
Für die war der Abschluss etwas, was man hatte und dann auch später im Leben immer wieder benutzen konnte, wie eine gute Armbanduhr oder ein gutes Paar Schuhe. In Deutschland sah man das offenbar ein bisschen anders. Hier hatte der Uniabschluss die Lebensdauer einer Scheibe Mortadella. Als ob ich alles, was ich vor ein paar Monaten noch wusste, plötzlich vergessen hätte oder sich die Branche in der kurzen Zeit so weiterentwickelt und verändert hätte, dass das Wissen aus dem Studium auf einen Schlag zu nutzlosem Ballast degradiert worden wäre. Du kannst mich mal, du dumme Kuh! Plötzlich war der verdammte Druck wieder da: Entweder irgendeinen Scheißjob annehmen oder die Stütze war weg. Irgendetwas anderes, irgendwas nicht Normales, irgendwas nicht Depressives und vielleicht auch irgendwas woanders, irgendwas neu. Ich habe nie verstanden, warum man hier so früh die Schubladen aufmachen musste, Leute einsortieren. Label drauf, fertig. Du bist nun das oder das, bis zum Ende deines Lebens. Wer möchte denn bis zum Lebensende nur eins sein? Der Wunsch nach der großen Welt, das Fernweh, existierte schon immer irgendwo in meinem Kopf, ganz hinten, versteckt in einer Ecke, an der man nur selten vorbeikam. Aber wenn man mal da war, blieb man gerne eine Weile. Die Realität sorgte aber dafür, dass der Wunsch schnell wieder in der Schublade verschwand: schnell weitergehen, weg aus der dunklen Ecke, hier gab es nichts zu sehen. Man machte so etwas einfach nicht, diese Träumereien. Werd erwachsen, Mensch! Mach stattdessen was Anständiges, Junge! Nimm dir ein Beispiel an Holger oder Maik, die haben schon die Ausbildung fertig und fahren ein eigenes Auto. Ausbildung, Arbeit, Heirat, Kind waren der Goldstandard für den Weg durchs Leben. Dagegen war ja auch nichts zu sagen, außer dass ich wusste, dass ich das nicht wollte. Ich bin noch nicht bereit für Arbeit und Heirat, für ein Kind erst recht nicht. Ich wollte nochmal nach hinten in die seltsame Ecke und ein bisschen in der Schublade wühlen. Vielleicht hatte dieses Verlangen ja was mit der Kindheit zu tun, die meisten Dinge hatten ja was mit der Kindheit zu tun, zumindest die psychologischen. Vielleicht aber auch was mit dem Aufwachsen in der DDR, wobei das ja unter Kindheit fiel. DDR-Kindheit halt. Damals fuhr die Familie immer an den Balaton oder zu den Eltern meines Vaters nach Komlò, den Rest der Welt gabs nur auf Fotos und Dias. Aber in Ungarn gab's mehr vom Rest der Welt als Zuhause, sogar den Terminator, auf Englisch mit ungarischen Untertiteln. Ich konnte weder Ungarisch noch Englisch, aber das war egal, es war der Terminator. Schießereien und Explosionen machten in jeder Sprache Spaß. Und wo kam der her? Hollywood? Amerika? Mit Hochhäusern, die bis in den Himmel reichten, Autos, die klangen wie Donnergrollen, schnurgeraden Straßen bis zum Horizont, Hamburger und Coca-Cola. Wenn ich irgendwann groß bin, wollte ich all das sehen. Jetzt meldete sich der Wunsch lautstark zurück. Ich war jung, wenn nicht jetzt, wann dann? Aber wohin? Dahin, wo es aussah wie zu Hause, man aber nur eine andere Sprache sprach, wollte ich nicht mehr. Von Amerika hatte ich genug gesehen und gehört, Cola und Burger gab’s jetzt auch hier, den Terminator sowieso und die Donner-Autos waren auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Ich wollte irgendwohin, wo es ganz anders war. Asien oder die Emirate. In den Emiraten wurde doch viel gebaut, wegen des Öl-Gelds, aber da war nur Wüste, kein Alkohol und die Scharia. Vielleicht doch nicht der richtige Ort. Blieb noch Asien. Ich folgte damals mehreren Leuten im Internet, die quer durch Asien reisten und Videos davon machten. Mir gefiel, was ich in deren Videos sah: moderne Städte, glitzernde Hochhausfassaden, freundliche Leute, gutes Essen und überhaupt mal was anderes. China befand sich gerade in den letzten Ausläufern einer Boomphase, in der eine Unmenge internationaler Architekturfirmen versuchte, im Land Fuß zu fassen und noch etwas davon zu profitieren. Eine Art Goldgräberstimmung hatte sich in den letzten Jahren breitgemacht, aberwitzige Summen flossen in sinnlose Projekte und auch mittelmäßig talentierten Architekten wurden die Projekte aus den Händen gerissen. Da könnte ich eine Chance haben. Meine Klasse war das obere Mittelfeld, zu mehr, so hatten schon die DDR-Lehrer erkannt, fehlte der Antrieb. China schien eine gute Wahl zu sein, um noch einige Jahre Berufserfahrung in internationalen Projekten zu sammeln. Projekte in Größenordnungen, wie man sie in Deutschland niemals sehen würde. Viel mehr als der gebaute Quadratmeter reizte mich aber der Abenteueraspekt. Nicht zuletzt schien da jeder eine Chance zu bekommen, wenn er nur ausländisch aussah. Die Expat-Foren quollen über von Arbeitsangeboten im Social-Media-Bereich und als Englisch-Lehrer, für Architektur aber sah es ziemlich mau aus. Den Inseraten nach zu urteilen, arbeiteten 95 Prozent der Ausländer in Asien als Englischlehrer und der Rest im Marketing. Die meisten davon waren Backpacker oder anderweitige Lebenskünstler, die mit dem Ich-will-die-Welt-sehen Traum losgezogen waren und sich auf diese Art und Weise über Wasser hielten. Dennoch dauerte es nicht lang, bis ich meine erste Stelle fand, als Praktikum ausgeschrieben, aber im Grunde ohne zeitliche Begrenzung und sogar mit ein wenig Bezahlung. 5000 RMB plus freies Wohnen und Essen. Umgerechnet war das nicht viel, aber wenigstens etwas. Der zukünftige Arbeitsplatz sollte sich in Hangzhou befinden. Hangzhou? Wie die meisten Nichtchinesen hatte ich von Hangzhou noch nie etwas gehört. Konnte auf Zuruf höchstens mit Shanghai und Peking dienen. Bei meinen Recherchen erfuhr ich, dass Hangzhou eine schöne Stadt mit jeder Menge Geschichte war, aber auch schön und auch noch nah bei Schanghai und auch schön. Das Schlüsselwort war schön. In jedem Artikel, den ich über Hangzhou gelesen, und in jedem Video über Hangzhou, das ich gesehen hatte, kam es mehrfach vor. Mit einem der ultramodernen ICE-Kopien war es von Hangzhou aus nur rund eine halbe Stunde bis nach Shanghai. Unter Shanghai konnte ich mir schon mehr vorstellen, die Skyline am Fluss und ein französisches Viertel gab es auch. Aber die Skyline, die musste man sehen und fotografieren. Am besten als Selfie, zum Beweis, dass man da war. Hangzhou war mit seinen rund 10 Millionen Einwohnern im chinesischen Vergleich relativ klein. Aber das, was ich im Internet sah, weckte meine Abenteuerlust, ich war bereit. Das Architekturbüro, welches die Stelle anbot, nannte sich SGB Architects. Eigentlich wurde die Stelle nicht von SGB Architects angeboten, sondern von Natasha. Natasha arbeitete für eine russische NGO, das behauptete sie zumindest. Eine NGO, die den einzigen Zweck hatte, Leute aus dem Westen an chinesische Firmen zu vermitteln und dafür einen kleinen Obolus zu kassieren. Das Ganze wirkte auf den ersten Blick seltsam und änderte sich auch beim zweiten Blick nicht. Sie machte den Eindruck einer Ein-Mann-Operation in Moskau, St. Petersburg, Wladiwostok oder sonst wo auf der Welt. Vielleicht war ihr Name noch nicht einmal Natascha, vielleicht war sie noch nicht einmal eine Sie. Der Papierkram, den „Sie“ mir schickte, sah zumindest offiziell aus, mit Namen, Adressen, Gehalt und jeder Menge roter Stempel mit dem Kommunistenstern.
Mein Ziel war nicht ausschließlich China, sondern ganz Asien oder meinetwegen die ganze Welt. Nur eines wollte ich nicht, wie einige meiner Kommilitonen, in deutschen Großraumbüros unter sterilem Neonlicht versauern. Immer wieder hörte ich im Freundeskreis Geschichten, die mich schaudern ließen. Ein ehemaliger Kommilitone hatte direkt nach dem Studium in einer relativ bekannten und großen Firma angeheuert, er bearbeitete seitdem nur den Brandschutz, ein anderer machte nur Ausschreibungen. Das war im Grunde das Hochschul-Äquivalent zum Fließband. Kreativität: null. Ein bekannter deutscher Architekt hatte mal in einem Interview erklärt, warum moderne deutsche Architektur so hässlich ist. Es gibt kaum mehr Platz für Kreativität, stattdessen werden nur noch DIN-Normen abgearbeitet. Ich wusste nicht wirklich, was ich wollte, aber was ich nicht wollte, wusste ich sicher. Hochschul-Fließband. Wenigstens machte man im Ausland neue Erfahrungen: neues Essen, neue Sprache, all das fühlte sich an wie eine Art Bonus auf das Gehalt, auch wenn das Gehalt niedriger war als in Deutschland. Ganz Asien versprach Abenteuer, auch Vietnam und Thailand waren auf meinem Radar. Ich hatte mal eine Reisendoku gesehen, in der erzählt wurde, dass man in Vietnam mit Kalaschnikows und Panzerfäusten schießen konnte. Und für 100 Dollar extra gab’s eine Kuh als Ziel. Vietnam hatte das niedrigste Lohnniveau von allen asiatischen Ländern auf meiner Liste. Im Gegenzug waren auch die Lebenshaltungskosten sehr niedrig. Thailand wiederum klang wie eine gute Alternative zu China, nicht so abgeschottet, zumindest in den großen Städten mehr englisch sprechende Einheimische und aufgrund der Vermarktung als Touristenziel viel mehr Ausländer und internationales Publikum. Der Abenteuerfaktor wäre etwas geringer, dafür der Urlaubsfaktor größer. In Thailand gab es allerdings die königliche Liste der verbotenen Berufe. Jene Berufe, die für Ausländer tabu waren und nur von Einheimischen ausgeübt werden durften. Darauf enthalten waren unter anderem auch jegliche Art von Design- und Architekturleistungen. Das Einzige, was Ausländer hier problemlos arbeiten konnten, war, man ahnte es, Englisch-Lehrer. Dennoch waren die Internetforen voll mit dubiosen Stellenangeboten, auf die man schon beim ersten Anschreiben eine Zusage bekam. Man musste nur noch 299 Dollar überweisen, dann ginge es ganz schnell. Offenbar gab es genug Menschen, die sich von der Verheißung eines Lebens im Urlaubsparadies blenden ließen und auf diese Inserate hereinfielen. Die armen Schweine standen in der Abgezocktenhierarchie ganz unten. Noch weit unter denen, die ihre „Lebensgefährtin“ in Thailand nur vom Videochat her kannten und regelmäßig die Hälfte ihres Gehaltes an die neue „Familie“ überwiesen. Diese Leute hatten zumindest Videochats mit einer richtigen Person, die anderen hatten außer einem leeren Versprechen gar nichts. Hangzhou hingegen war real, zumindest soweit ich es einschätzen konnte. Natascha stellte den Kontakt mit Stavros her, einem Griechen, der im Architekturbüro die Entwurfsabteilung leitete und nebenbei für das Anheuern neuer Ausländer zuständig war. Über Skype erzählte Stavros mir ein bisschen über das Büro.
„The Boss wants Westerners, he can sell more projects that way”, der Ausländer als verkaufsfördernde Maßnahme. Warum nicht? Ich war mir so sicher, wie man es nur sein kann. War bereit, ins kalte Wasser zu springen. Stand schon in Köpperstellung am Beckenrand, bereit einzutauchen. Hoffentlich wird's kein Bauchklatscher.
Ganz schön warm hier.
Hangzhou
Es gab nichts Schlimmeres, als auf dem Mittelsitz gefangen, kurz nachdem das Essen serviert worden war, aufs Klo zu müssen. Die Lebensweisheit aus mehreren Langstreckenflügen lautete daher: nur noch einen Sitz am Gang. Der Fensterplatz war etwas für Amateure und der Mittelsitz für Masochisten. Die Profis saßen am Gang. Diesmal war der Mittelplatz leer und wurde von der Fenstersitzerin als Parkfläche für eine Art MP3-Player im Kofferradioformat benutzt. Passend dazu trug sie übergroße Astronautenkopfhörer und fiel schon kurz nach dem Start in den Tiefschlaf. Ich nahm mir jedes Mal vor, wach zu bleiben, hatte schon alles versucht: Koffeintabletten, Energiedrinks, selbst das gute alte „Vorschlafen“. Nichts davon half, denn jedes Mal, wenn die Kabine kurz nach dem Essen nur noch von den Sitzbildschirmen in ein schummriges Zwielicht getaucht wurde, fingen auch die Augenlider an schwer zu werden. Nur die Angst zu schnarchen hielt mich noch einige Zeit wach. Es gab Fisch, der vergeblich versuchte, sich auf einem Bett aus zerkochtem Reis räkelnd, als Fleischalternative anzupreisen. Lachs, Forelle, Zander? Die Erklärungen der Stewardess fielen ins Leere. Das Pärchen gegenüber einigte sich darauf, dass sie nichts isst, er dafür aber doppelt. Ein Mädchen mit dicken Beinen in der Reihe dahinter wollte nur Kekse, der Vater neben ihr ergänzte mit einem Bier. Ein schütterer Herr, der vor dem Pärchen saß, hatte Rührei mit Kartoffeln. Misstrauisch stocherte er in der gelben Masse. Verschloss das Fresspaket anschließend wieder und nahm mit einem Pudding vorlieb.
An der Bordtoilette warteten schon zwei Frauen, eine hatte noch ihr Nackenkissen um, die andere machte im Fußraum der Notausgangssitze Dehnübungen und offenbarte dabei unfreiwillig ihre Kompressionsstrümpfe. Die Männer, denen sie ihren ungelenken Nymphen-Tanz präsentierte, stellten sich schlafend.
Aus dem klaustrophobischen Gewusel der Immigrationsschlange und des Koffer-Karussells entkommen, betrat ich die große Halle, von der aus sich die nicht enden wollenden Ströme der Ankömmlinge in alle Herren Winde verteilten. Meine nächste Mission lautete, das Büro zu finden. Ich hatte mir die Adresse auf Englisch und auf Chinesisch ausgedruckt, auch die Telefonnummer vom Büro. Allerdings störte das Sperrfeuer an neuen Impulsen meine Synapsen, sodass ich komplett vergaß, eine neue SIM-Karte zu kaufen. Wer denkt denn auch an sowas? Ich trottete einfach den Menschenmassen hinterher, folgte der Herde, dem Ausgang entgegen. Mit jedem Schritt kam die Tropennacht näher, bis die hechelnden Klimaanlagen des Flughafens schließlich den Kampf verloren und sich die dumpfe Hitze wie ein warmer Lappen um mich legte. Auf der anderen Seite der automatischen Schiebetür erstreckte sich ein großer, überdachter Vorplatz. An einem Ende warteten Menschenschlangen in Labyrinthen aus Absperrbändern auf ihr Taxi. Am anderen Ende wuselten einige Männer hin und her, fingen vermeintlich wahllos die Menschen, die aus den großen Glastüren tropften, ab und versuchten, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Eine Dame im dunkelblauen Hosenanzug und leicht schimmernder seidener Weste, die einige Schritte vor mir ging, ließ den Kontaktversuch routiniert mit einer Handbewegung abperlen. Der Mann nahm seine Niederlage kaum zur Kenntnis, versuchte es noch einmal, diesmal jedoch an einem Geschäftsmann, der einen hellgrauen Dreiteiler trug, die Ärmel seines schneeweißen Hemdes bis zu den Ellenbogen zurückgefaltet, mit der rechten Hand einen mattschwarzen Carry-on ziehend und die hellgraue Anzugjacke am Zeigefinger der linken Hand leger über den Rücken drapiert. Wie bei der Frau zuvor scheiterte der Fremde auch hier, nur dass dazu nicht einmal eine Handbewegung nötig war.
„Hello.”
Ich drehte mich um, einer der Fremden stand jetzt neben mir. Ein Mann mit schütterem Haar, um die 40 und geschätzt einen Kopf kleiner als ich.
„You taxi?”, fragte er mich, mit einem Lächeln, das den schlechten Zustand seiner Zähne erahnen ließ.
„Oh, no need!”, antwortete ich. Er ließ nicht locker und deutete auf das Stück Papier mit der chinesischen Adresse, welches ich in den Händen hielt.
„Taxi go, good price!", auffordernd streckte er mir seine Hand entgegen.
„Show!”, etwas unwillig zeigte ich ihm den Zettel.
„Office!” Er zog eine kleine Brille mit einem
abgebrochenen Bügel aus seiner Hosentasche, kniff die Augen zusammen, nickte.
„Yes, good, come!”, er deutete in Richtung Parkplatz.
„Come!" Mit einer einladenden Geste drückte er mich sanft, aber bestimmt in Richtung seines Autos.
„Wait, money, how much?”, fragte ich, mich innerlich schon ergebend. Ich wusste ja nicht einmal, was die Taxifahrt im richtigen Taxi kostete.
„200”, antwortete er nickend.
„Good price”, wirklich? Müde ergab ich mich nun vollends und folgte ihm zum Auto. Für einen Moment kamen mir die Artikel auf den Reise-Webseiten, die ich zur Vorbereitung gelesen hatte, wieder in den Sinn. Alle warnten vor den illegalen Taxis, den Männern, die einen vor der Tür ansprachen und einen „guten“ Preis boten. Unbedingt meiden, hieß es. Dem Typen nachzugeben und Ja zu sagen fühlte sich augenblicklich wie ein Fehler an. Aber obwohl ich mir dessen bewusst war, konnte oder wollte ich nichts machen. Ein seltsames Gefühl. Ich hatte mich der Situation vollkommen grundlos ergeben. Dann erinnerte ich mich an eine Doku, die ich vor dem Abflug geschaut hatte. Es ging um Polizeiverhöre in den USA und die amerikanische Eigenart, dass Polizisten in den USA den Verdächtigen anlügen dürfen. Dem unschuldigen Verdächtigen wurde über Stunden immer wieder vorgelogen, dass man Beweise gegen ihn hätte und dass, wenn er jetzt gestehen würde, er eine geringere Strafe bekäme. Die meisten sind irgendwann gebrochen und haben alles Mögliche gestanden. So fühlte ich mich jetzt: etwas getan, von dem ich wusste, dass es nicht richtig war, aber jetzt war es geschehen und nun folgte ich dem Fremden willenlos und still zu seinem Auto. Zu meiner Überraschung war ich nicht der einzige. Als wir näher kamen, konnte ich im Beifahrersitz den Umriss einer weiteren Person erahnen. Während der Alte mein Gepäck in den Kofferraum wuchtete, stieg ich ein und blieb stumm sitzen, auch der andere sagte nichts. Momente später schwang der Glatzkopf sich auf den Fahrersitz und lachte.
„No Problem.”
Es fing an zu regnen, als wir den endlosen Parkplatz verließen. Fette Tropfen klopften erst einzeln und zögerlich an die Scheiben, nur um Momente später zu einem Flächenbombardement anzuwachsen. Die auf dem warmen Asphalt zerplatzenden Tropfen verwandelten sich in einen feinen Nebel, der die Lichter der Hochhäuser in einen romantischen Weichzeichner legte. Die Autobahnen wandten sich wie Eingeweide durch den Betondschungel. Bald trennte sich unsere Fahrspur von den anderen, machte einen Schlenker nach rechts, um sich alsbald durch schmale Betonstelzen zu fädeln, dann steuerte der Wagen, in dem Totenstille herrschte, eine Ausfahrt an. Plötzlich schoss mir das Adrenalin in Kopf und Glieder, riss mich aus meiner Lethargie, die Müdigkeit war verschwunden. Ich hatte Fotos vom Büro gesehen und auch sicherheitshalber bei Google Maps nachgeschaut. Das Büro befand sich in einem Hochhaus an einer belebten Straße mit vielen Geschäften. Das, was ich draußen in der nassen Dunkelheit vorbeirauschen sah, war das absolute Gegenteil. Wir bogen jetzt in eine Art Industriepark ein, der sich unter der aufgestelzten Autobahn befand. Draußen konnte ich außer einigen dunklen Lagerhäusern nichts ausmachen, überhaupt nichts. Das war es, schoss es mir durch den Kopf. Die schlagen dich zusammen und rauben dein Zeug. Hatte ich nicht über solche Fälle gelesen? Vielleicht klauen sie auch noch meine Organe. Verdammter Idiot, warum bin ich nur in dieses Auto gestiegen? Die Fahrt verlangsamte sich. Durch den dichten Regen konnte ich die Umrisse eines Wohnhauses erkennen, unter dessen Wellblechvordach sich die Silhouetten einiger Menschen zusammendrückten. Als eine der Silhouetten an einer Zigarette zog und den Platz unter dem Vordach für einen Moment in ein schwaches Orange tauchte, konnte ich vier bis fünf Männer zählen, die auf den Stufen saßen. Der Fahrer fuhr einen Kreis und parkte das Auto so, dass die Männer unter dem Blechdach jetzt im Rückspiegel auftauchten. Mit einem „Klack“ sprangen der Kofferraum und die beiden Fahrertüren auf. Der Glatzkopf und der andere, der schon im Beifahrersitz gesessen hatte, verschwanden blitzschnell hinter dem Auto in der Dunkelheit und begannen im Kofferraum zu hantieren. Nach einem Poltern sah ich einen der beiden schwer beladen in Richtung Haus laufen.
„Die haben meinen Koffer!”, fest entschlossen, nicht kampflos aufzugeben, riss ich die Tür auf und stand nach zwei wackeligen Schritten am Kofferraum.
„Hey”, was anderes fiel mir in diesem Moment nicht ein. Der Alte sah mich verdutzt an. Mein Blick fiel in den offenen Kofferraum. Er war noch da, mein Koffer war noch da. Noch bevor ich mich für meine Dummheit schämen konnte, wedelte der Alte mit den Armen.
„OK.“ Ich nickte zustimmend.
„OK”
Er bestätigte.
„OK, OK”, schloss den Kofferraum und nahm wieder auf dem Fahrersitz Platz. Den Rest der Fahrt schämte ich mich still auf der Rückbank. Später erfuhr ich von einem Kollegen, dass die 200 RMB, die ich für das illegale Taxi bezahlt hatte, nicht so sehr über dem normalen Preis lagen. Die Abzocke hielt sich in Grenzen. Mittlerweile war es kurz vor Mitternacht und draußen tobte der stärkste Monsun seit zehn Jahren. Die Fenster im Bürogebäude waren dunkel, außer im Treppenhaus und in der Lobby. Ein Sicherheitsmann saß einsam hinter etwas, das wie eine Mischung aus einer abgenutzten kleinen Kanzel, einem Podium und einem Campingtisch aussah. Darauf befand sich eine kleine China-Flagge und eine der gläsernen nachfüllbaren Teeflaschen, die hier offenbar jeder hatte. Mit einem unsicheren „Hello” versuchte ich, das Eis zu brechen. Er nickte nur. Ich hielt ihm den Zettel mit dem Namen der Firma entgegen und deutete mit dem Zeigefinger an die Decke.
„Is this here?”
Er nickte erneut, kramte eine einlaminierte Liste hervor, sagte etwas auf Chinesisch und tippte auf einen Namen in der Liste, dann lachte er. Das Büro befand sich im 12. Stock gleich links vom Fahrstuhl und war mit einem Rollgitter verschlossen. Natürlich war es verschlossen, es war kurz vor Mitternacht, selbst die Chinesen würden um diese Uhrzeit nicht mehr arbeiten. Ich nahm auf einem der beiden Loungesessel in der Fahrstuhl-Lobby Platz und versuchte, Schübe aufkommender Panik zu unterdrücken. Bis zum nächsten Morgen hier vor dem Fahrstuhl in einem der Stühle schlafen? Unmöglich. Ich beschloss, irgendwo ein günstiges Hotel zu finden. Ohne Sprachkenntnisse oder Internet war das zwar praktisch unmöglich, aber trotzdem. Was sich hinter den kryptischen Zeichen der Neonreklamen, die überall aus den Hausfassaden wuchsen, verbarg, blieb vorerst ein Rätsel. Restaurants, Massage-Shops, Teehäuser, Versicherungsbüros, Ärzte, Spielhöllen. Alles, nur kein Hotel. Mein Rollkoffer wurde mit jedem Monsun-Tropfen, den er in sich aufsog, schwerer. Meine Jacke und Hose waren sowieso schon vollgesogen, an einen Schirm hatte ich, genauso wie an eine SIM-Karte, gar nicht erst gedacht. Auf der anderen Seite der Straße versuchten eine Handvoll Passanten, den Regen unter einem Gebäudevorsprung abzuwarten. Einige der kleinen Läden hinter ihnen hatten noch auf. Vielleicht sollte ich einfach was zu essen kaufen und hier warten? Zwei Mädchen traten kichernd auf den Fußweg, eine öffnete ihren viel zu großen Regenschirm, der sich mit einem Fauchen aufplusterte, dann verschwanden sie in der Nacht.
„I want it that way … tell me why.“ Waren das etwa die Backstreet Boys? Etwas abseits in der Dunkelheit, nur durch den Bildschirm seines Telefons beleuchtet, sang einer der Wartenden sich die Seele aus dem Leib.
„Tell me why …“ Von den anderen, die hier vor dem Regen Schutz suchten, offenbar vollkommen ignoriert, als Teil des normalen Wahnsinns einer Millionenmetropole. Er bemerkte, dass ich ihn bemerkt hatte, und kam langsam näher.
„Hi, I am Starry", stellte er sich vor.
„I am Andrew”, antwortete ich erleichtert und verwundert. Verwundert über den seltsamen Namen, der selbst für chinesische Verhältnisse komisch klang, erleichtert über das Englisch.
„Nice singing”, schloss ich an.
„Backstreet Boys, from america”, er präsentierte mir stolz seine Playlist mit englischen Songs. Eigentlich hasste ich Smalltalk, versuchte ihm zu entkommen, wann immer es ging, aber in diesem Moment war ich für alles dankbar, was meine Gedanken von der momentanen Situation ablenkte. Schnell fokussierte sich der Small Talk auf mich, meinen Koffer und den schlimmsten Monsun seit Jahren.
„I have no place to go, no hotel, no internet.“ Ohne zu zögern begann Starry, auf seinem Telefon zu wischen.
„No problem, I will find. Wait.“
Ein weiterer junger Mann, den auch Starry nicht kannte, trat aus dem Dunkel und setzte sich neben mich. Zu dicht, um sich für mein westeuropäisches Verständnis von Privatsphären noch gut anzufühlen. Der Fremde sagte kein Wort, lächelte und nickte nur. Er war kleiner als ich, und der kugelrunde Bauch, der aus seinem engen T-Shirt ragte, passte so gar nicht recht zu seiner dünnen Gestalt. Er hatte die nassen Haare in einen perfekten Seitenscheitel gelegt und über seiner Oberlippe zeichnete sich ein schüchterner Flaum ab. Die Backstreet Boys setzten gerade zur fünften Wiederholung an, als Starries Kopf hochschnellte.
„Here this one!”, aufgeregt präsentierte er mir das Hotel, das er gerade gefunden hatte.
„Oh no.“
„What?”
„No Foreigners”, erklärte er mir. Chinesische Hotels mussten ihre Gäste bei der lokalen Polizeistation anmelden. Selbst wenn man im vergleichsweise offenen Hongkong ein Hotelzimmer suchte, konnte es passieren, dass man mit einem „Mainland Chinese Only“ konfrontiert wurde. Kurze Zeit später sprang er auf wie ein Bluthund, der eine Fährte aufgenommen hatte. Dem GPS gehorchend, ab und an aufschauend, dann wieder den Kopf gesenkt. Wir wechselten auf die andere Straßenseite, dann über eine große Kreuzung. Das Hangzhou, dem wir uns jetzt näherten, bestand aus höheren und moderneren Gebäuden. Glatte Fassaden ohne Klimaanlagenkompressornischen und Wellblech Vordächer.
„Here, Over there!” Starry zupfte an meinem Arm und deutete auf eine chinesische Leuchtreklame, die in der Ferne über dem Gehweg schwebte.
„Hotel?“, fragte ich. „How much?”
Er antwortete nicht, stattdessen griff er meinen Koffer.
„Come on, over there.“
Der Regen hatte sich mittlerweile beruhigt, nur noch vereinzelt machten sich die fetten Tropfen auf den metallenen Vordächern bemerkbar. Der namenlose Andere folgte uns wie ein Schatten. Starrys Fährte endete unerwartet vor einem Restaurant und er, gerade noch selbstsicher, schien jetzt verloren. Sein Blick wanderte vom Bildschirm seines Telefons zur strahlend gelben Neonbeleuchtung des Restaurants und zurück auf den kleinen Bildschirm.
„Wait”, er verschwand im hinteren Teil des Restaurants und ließ mich und den seltsamen Stummen zurück. Der legte urplötzlich seinen Arm über meine Schulter und blieb ansonsten still. Was soll das? Ist es das, was ich denke? Ich bewegte mich auch nicht, tat so, als ob ich es nicht bemerkt hätte. Dann standen wir stumm vor dem Restaurant. Kurz darauf erschien Starry wieder und winkte uns aufgeregt herein. Gott sei Dank, er hatte die Spur wieder aufgenommen. Ich griff hastig nach meinem Koffer. Am hinteren Ende des Gastraumes befand sich eine schmale Treppe, die nach oben führte. Am oberen Treppenabsatz empfing uns ein kniehohes Tischlein, dahinter eine dünne, durchgelegene Matratze ohne Bezug, einige bunte Wolldecken sowie die obligatorische gläserne Teeflasche. Auf den Decken ergab sich ein dicklicher Mann mit Koteletten, auf der Seite liegend, den Kopf auf den Arm gestützt, dem hypnotischen Flimmern seines Telefons, das er an der Rückseite des kleinen Tisches positioniert hatte. Als wir uns dem Ende der Treppe näherten, richtete er sich widerwillig auf und zog ein Klemmbrett hinter dem Tisch hervor. Die Zimmerliste.
„Here, put your name and passport number.”, instruierte Starry.
„How much is the room?“
„250”, antwortete er. Das wären um die 30 Euro, ein akzeptabler Preis für meine aktuelle Situation. Das Zimmer selbst machte einen überraschend professionellen Eindruck, es besaß eine kleine Nasszelle gleich neben der Eingangstür und zu meiner großen Überraschung eine Toilette im westlichen Stil. Ein Bett im Queen-Size-Format und ein großer Fernseher. Dem Stummen schien es auch zu gefallen, hatte er sich doch unauffällig zur Tür hineingepresst und musterte jetzt das Bad.
„Tomorrow when you leave, give the key to the guy.“
„Do I need to sign anything?“
„No, no, everything ok.“
Zum Abschied programmierte mir Starry seine Telefonnummer ins Telefon. Wenn ich Probleme hätte, solle ich anrufen, er könne immer helfen. Gut zu wissen.
Das Büro befand sich nur wenige Straßenzüge vom Hotel entfernt. Die Stadt wirkte bei Tag freundlicher, fast schon unschuldig. Arbeiter in gelben Warnwesten und Spitzhüten aus Stroh entfernten die letzten Überbleibsel des gestrigen Monsuns. Mit selbstgebauten Besen, die aus einem geraden Stück Holz bestanden, an dessen Ende ein Bündel Zweige befestigt war. Arbeiter auf dem Weg zur Schicht hielten kurz an einem Baozi-Stand an. Diese handtellergroßen, gedämpften Teigbälle, meist mit verschiedenen Arten Fleisch oder Gemüse gefüllt, waren hier das Äquivalent zur Käsesemmel. Statt Kaffee gab es entweder Tee oder Saft, der aus einer Art Bohnen hergestellt wurde und an Milch erinnerte. Einer von ihnen hatte sein Hemd bis zur Brust hochgerollt und strich sich mit der Hand immer wieder kreisförmig über seinen entblößten Bauch. Die nasse Hitze von gestern Abend war wieder da und ließ die Sachen auf der Haut kleben. Der Sicherheitsmann im Erdgeschoss war noch derselbe wie gestern Abend, aber das Rolltor vor dem Büroeingang war verschwunden. Dahinter kam eine Art Lobby zum Vorschein, in der Mitte drei Herman-Miller-Designer-Stühle, die um einen kleinen ovalen Glastisch positioniert waren. Die rechte Seite bestand aus einer raumhohen Fensterfront, auf der linken, führte eine Treppe hinauf auf eine zweite Ebene. Dort befand sich ein Landschaftsarchitektenbüro. Der Eingangsbereich war mit dunklem Holz vertäfelt. Eine raumhohe Tür am anderen Ende der Lobby führte ins Reich des Bosses. Hier formten zwei ausladende, cremefarbene Ledersofagarnituren einen legeren Gesprächs- und Verhandlungsbereich. Eine Wand war komplett von Nischen aus dunklem Holz bedeckt, welche mit geschnitzten Jade-Drachen, Erster-Preis-Trophäen, wie man sie von den Bundesjugendspielen kennt, einigen vertrockneten Blumen, Büchern, einem Tee-Set, übergroßen Jubiläumsmünzen und anderen Staubfängern gefüllt war. Auf der anderen Seite führte eine Tür, die fast unsichtbar in der Wand saß, zum eigentlichen Büro des Bosses. Gesehen hatte ich es persönlich nie, aber Stavros versicherte mir, dass es existierte. Der Boss selbst empfing mich nur zweimal in seinem Vorzimmer, an meinem ersten Tag und etwas später, als ich gefeuert wurde. Mit ihm selbst hatte ich, abgesehen von diesen zwei Begegnungen, nie etwas zu tun, ich kannte nicht mal seinen Namen. Am Eingang des Büros führte ein schmaler Korridor vorbei an einer Teeküche und einem Besprechungsraum, der keine Türen hatte. Stattdessen betrat man ihn, durch drehbare Wandpaneele, die auf einem Gelenk saßen. Der Besprechungsraum selbst war simpel gehalten: ein langer Tisch für zehn bis zwölf Personen, an der Wand ein großer Bildschirm für Präsentationen und längsseits des Tisches die Glasfassade, die sich zur Straße hin öffnete. Am Ende des schmalen Korridors weitete sich der Raum und die Stimmung veränderte sich mehr in Richtung Großraumbüro. Fünf von ihren Bildschirmen hypnotisierte Chinesen hatten sich sporadisch in vier parallelen Tischreihen verteilt, über denen sich zwei gigantische Klimaanlagen in die Decke verbissen. Hinter den Tischreihen stapelten sich Kisten mit Materialproben und bergeweise Herstellerkataloge. Auf der rechten Seite führte eine türblattlose Doppeltür in einen zweiten, deutlich kleineren Raum mit vier einzelnen Arbeitsplätzen, die allerdings über den Luxus der Glasfassade und somit Tageslicht verfügten.
„Ahh there he is, I thought we lost you.” Das Rumpeln meines Koffers musste Stavros alarmiert haben. Er schnellte aus dem Nebenzimmer und begrüßte mich freundlich.
„Come I will introduce you to the others.” Mittlerweile stand auch Georgios im Flur. Georgios und Stavros kannten sich von der Uni und waren Freunde. Um nicht der einzige Ausländer im Büro zu sein, lockte Stavros erst Georgios und später noch seine Bekannte, Nikoletta, nach China.
„Hey man, how are you doing?”
„When did you arrive?”
„It was late last night and the gate was down.“ Stavros sah Georgios fragend an.
„We waited for you till after ten or so.”
„Yes, my flight had a delay and then I had no SIM card to call you guys“, versuchte ich in wackeligem Englisch zu erklären.
„No problem, we will get everything you need, but first you settle in.” Sanft, aber bestimmt schob er mich in das große Büro.
„Listen everybody, this is Andrew from germany, say hello!” Eines nach dem anderen lösten sich die Gesichter von den Bildschirmen und schauten auf. Eine unkoordinierte Mischung aus „Hi“, „Hello“ und „Hey” formte sich zu einem schüchternen Willkommensgruß.
„Hey everybody", ebenso schüchtern hob ich meine Hand, um den Gruß zu erwidern.
„Nice to be here.“ Stavros begann mir unverzüglich die anwesenden chinesischen Kollegen mit Namen vorzustellen und ebenso unverzüglich vergaß ich ihre Namen wieder. Das chinesische Abenteuer fühlte sich jetzt an wie der erste Tag an einer neuen Schule.
„Listen, man”, warf Stavros plötzlich ein.
„You must be exhausted. Ting will bring you to the house. You can rest a little bit and then start work tomorrow.” Gegen etwas Ruhe und Akklamation konnte ich nichts einwenden.
„Sure.“ Wer war Ting nochmal?
---ENDE DER LESEPROBE---





























