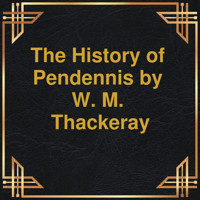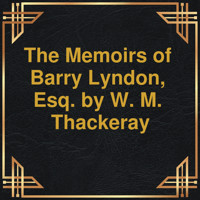Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Begegnen Sie mit diesem Roman der Londoner Gesellschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts! Im Zentrum der Handlung stehen dabei die beiden Protagonistinnen Amelia und Becky, die auf ganz unterschiedliche Weise als junge Frauen ihr Leben zu jener Zeit gestalten. Autor William Makepeace Thackeray verfasste mit "Jahrmarkt der Eitelkeit" (im Original: "Vanity Fair, or, a Novel without a Hero") einen amüsanten Gesellschaftsroman, der bis heute zu einem der meistgelesenen Werke der englischsprachigen Literatur zählt. Dies ist der zweite Band einer zweiteiligen Ausgabe.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 734
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
W.M. Thackeray
Jahrmarkt der Eitelkeit, Band 2
Übersezt von Christoph Friedrich Grieb
Saga
Jahrmarkt der Eitelkeit, Band 2
Übersezt von Christoph Friedrich Grieb
Titel der Originalausgabe: Vanity Fair, or, an Novel without a Hero
Originalsprache: Englisch
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1855, 2022 William Makepeace Thackeray und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728353387
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
35. Kapitel
Witwe und Mutter
Die Nachricht von den Schlachten von Quatre-Bras und Waterloo kam zu gleicher Zeit nach England. Die »Gazette« veröffentlichte zuerst das Ergebnis der beiden Schlachten, und ganz England bebte in Triumph und Furcht. Später folgten dann Einzelheiten, und nach der Verkündigung der Siege kam die Liste mit den Verwundeten und Gefallenen. Wer kann die Angst beschreiben, mit der dieses Verzeichnis gelesen wurde! Man stelle sich vor, welche Gefühle von Begeisterung und Dankbarkeit, von Schmerz und Verzweiflung in fast allen Dörfern und Häusern herrschten, als die Siegesbotschaft aus Flandern kam und man die Verlustlisten der Regimenter durchging und erfuhr, ob der teure Freund und Verwandte davongekommen oder gefallen war. Jeder, der sich die Mühe machen will, die damaligen Zeitungen noch einmal durchzugehen, muß selbst jetzt, nach so langer Zeit, dieses atemlose Gefühl der Erwartung haben. Die Verlustliste wird täglich weitergeführt, man unterbricht mittendrin, wie bei einer Erzählung, deren Fortsetzung in der nächsten Nummer erscheint. Man male sich die Gefühle aus, wenn die Zeitungen frisch aus der Druckerpresse einander folgten; und wenn man in England wegen einer Schlacht, in der nur zwanzigtausend unserer Leute kämpften, so außer sich kommen konnte, so halte man sich vor Augen, in welcher Lage sich ganz Europa vor zwanzig Jahren befand, als die Menschen nicht zu Tausenden, sondern zu Millionen kämpften. Jeder, der einen Feind niederstreckte, verwundete ein anderes, unschuldiges Herz in der Ferne furchtbar.
Die Nachricht, die jene berühmte »Gazette« den Osbornes brachte, versetzte der ganzen Familie und ihrem Oberhaupt einen schrecklichen Schlag. Die Mädchen gaben sich rückhaltlos ihrem Schmerz hin. Den gramgebeugten alten Vater machten das Schicksal und der Kummer noch niedergeschlagener. Er bemühte sich, zu denken, daß der Junge für seinen Ungehorsam gestraft worden sei. Er wagte es nicht, zu gestehen, daß ihn die Strenge des Urteils erschreckte und daß sich sein Fluch zu schnell erfüllt hatte. Zuweilen schauderte er vor Entsetzen, als ob er der Urheber des Verhängnisses sei, das er auf seinen Sohn herabbeschworen hatte. Früher hatten wenigstens noch Möglichkeiten zur Aussöhnung bestanden. Die Frau des Jungen hätte sterben oder dieser selbst zurückkommen und sagen können: »Vater, ich habe gesündigt.« Jetzt aber gab es keine Hoffnung mehr. Er stand auf der anderen Seite des unüberwindlichen Abgrundes und verfolgte seinen Vater mit trüben Augen. Dieser erinnerte sich des gleichen Blickes, als sein Sohn einmal im Fieber gelegen hatte und jedermann dachte, daß der Junge sterben würde. Er lag damals stumm im Bett und starrte düster vor sich hin. Guter Gott, wie der Vater sich damals an den Arzt klammerte und mit welch verzweifelter Angst er ihm überallhin gefolgt war; was für eine Last war ihm vom Herzen gefallen, als der Junge die Krisis überwunden hatte und seinen Vater mit erkennenden Augen ansah! Jetzt aber gab es weder Hilfe noch Heilung, noch eine Aussicht auf Versöhnung; vor allem aber keine demütigen Worte, um die wütende gekränkte Eitelkeit zu besänftigen und das vergiftete zornige Blut wieder in seinen natürlichen Fluß zu bringen. Es läßt sich schwer sagen, welcher Schmerz das Herz des stolzen Vaters am meisten zerriß – daß sein Sohn sich jetzt außer Reichweite seiner Verzeihung befand oder daß ihm die Entschuldigung, die sein Stolz erwartet hatte, entgangen war.
Welche Empfindungen der finstere alte Mann auch hegen mochte – er vertraute sich niemandem an. Niemals erwähnte er des Sohnes Namen gegenüber seinen Töchtern; der älteren gab er den Befehl, alle weiblichen Mitglieder des Hauses in Trauer zu kleiden, und den männlichen Dienstboten befahl er, sich ebenfalls in tiefes Schwarz zu kleiden. Alle Gesellschaften und Vergnügungen wurden natürlich abgesagt. Seinem zukünftigen Schwiegersohn, dessen Hochzeitstag schon festgesetzt worden war, machte er keine Mitteilung. Aber in Mr. Osbornes Miene lag etwas, was Mr. Bullock hinderte, Fragen zu stellen oder irgendwie auf die Heirat zu drängen. Er flüsterte zuweilen mit den Damen darüber im Salon, wohin der Vater nie kam. Er hielt sich ständig in seinem Studierzimmer auf, und das Vorderhaus blieb über die normale Trauerzeit hinaus geschlossen.
Etwa drei Wochen nach dem 18. Juni erschien ein Bekannter von Mr. Osborne, Sir William Dobbin, mit sehr blassem und verstörtem Gesicht in Osbornes Haus am Russell Square und bestand darauf, den Herrn sprechen zu müssen. Man führte ihn in das Zimmer des Alten, und nach einigen Worten, die weder der Sprecher noch der Hausherr verstanden, holte er einen Brief mit großem rotem Siegel aus einem Umschlag hervor. »Mein Sohn, Major Dobbin«, sagte der Alderman etwas zögernd, »hat mir durch einen Offizier vom ...ten Regiment, der heute in der Stadt ankam, einen Brief geschickt. Meines Sohnes Brief enthält auch einen für Sie, Osborne.« Der Alderman legte den Brief auf den Tisch, und Osborne starrte den alten Herrn ein paar Sekunden schweigend an. Seine Blicke erschreckten den Abgesandten, und nachdem er den gramgebeugten Mann eine Weile schuldbewußt angesehen hatte, eilte er ohne ein weiteres Wort hinaus.
Der Brief war in Georges wohlbekannter kühner Handschrift verfaßt. Es war der, den er vor Tagesanbruch des 16. Juni kurz vor dem Abschied von Amelia geschrieben hatte. Das große rote Siegel zeigte das angemaßte Wappen mit dem Motto »Pax in bello«, das Osborne aus dem Adelskalender entnommen hatte und das dem Herzoghaus gehörte, dem verwandt zu sein der eitle alte Mann sich vergeblich einzureden suchte. Die Hand, die den Brief unterschrieben hatte, würde niemals wieder Feder oder Schwert führen. Das Petschaft, womit er gesiegelt war, hatte man Georges Leichnam auf dem Schlachtfeld geraubt. Der Vater wußte nichts davon, sondern saß da und starrte mit entsetzlicher Leere darauf. Als er ging, um ihn zu öffnen, fiel er beinahe hin.
Hattest du je einen Streit mit einem teuren Freund? Wie dich seine Briefe aus der Zeit der Liebe und des Vertrauens abschrecken und tadeln! Was für eine düstere Trauer rufen dir die feurigen Beteuerungen toter Zuneigung hervor! Was für eine lügnerische Grabinschrift über der Leiche der Liebe sind sie doch! Was für finstere, grausame Kommentare über Leben und Eitelkeit! Die meisten von uns haben Schubladenvoll davon erhalten oder geschrieben. Es sind Gespenster, die wir aufbewahren, aber meiden. Osborne zitterte lange vor dem Brief seines toten Sohnes.
Der Brief des armen Jungen beinhaltete nicht viel. Er war zu stolz gewesen, die Zärtlichkeit, die er im Herzen fühlte, zu zeigen. Er sagte nur, daß er am Vorabend einer großen Schlacht seinem Vater Lebewohl sagen und feierlich dessen Beistand für die Frau – vielleicht auch das Kind –, die er zurückließ, erbitten wolle. Er gestand zerknirscht, daß er durch sein ausschweifendes, verschwenderisches Leben bereits einen großen Teil seines kleinen mütterlichen Vermögens vergeudet habe. Er dankte seinem Vater für den früher bewiesenen Großmut, und er versprach ihm, daß er sich des Namens George Osborne würdig erweisen werde, mochte er nun im Felde fallen oder überleben.
Seine englische Art, sein Stolz, vielleicht auch Verlegenheit, hatten ihn daran gehindert, mehr zu sagen. Sein Vater konnte den Kuß nicht sehen, den George auf die Überschrift seines Briefes gedrückt hatte. Mr. Osborne ließ das Schriftstück mit dem bittersten, tödlichsten Schmerz getäuschter Liebe und Rache fallen. Immer noch liebte er den Sohn und vergab ihm nicht.
Etwa zwei Monate später jedoch bemerkten die jungen Damen, als sie mit ihrem Vater zur Kirche gingen, daß er sich auf einen anderen Platz setzte als sonst, wenn er zum Gottesdienst kam, und von seinem Kissen aus blickte er auf die Mauer über ihnen. Das veranlaßte die jungen Mädchen, ebenfalls in die Richtung zu schauen, in die der düstere Blick des Vaters deutete, und sie erspähten an der Wand ein kunstvolles Denkmal. Darauf war Britannia weinend über einer Urne dargestellt, und ein zerbrochenes Schwert und ein liegender Löwe deuteten an, daß das Bildwerk zu Ehren eines gefallenen Soldaten errichtet worden war. Die Bildhauer jener Zeit hatten immer einen ganzen Vorrat solcher Trauersymbole auf Lager, und man kann noch jetzt auf den Wänden der Sankt-Pauls-Kathedrale Hunderte solcher prahlerischen heidnischen Allegorien sehen. Während der ersten fünfzehn Jahre unseres Jahrhunderts bestand eine große Nachfrage danach.
Unter dem erwähnten Denkmal war das bereits bekannte prunkvolle Osbornesche Wappen angebracht, und wie die Inschrift besagte, war das Denkmal geweiht »dem Andenken von George Osborne, zuletzt Hauptmann in Seiner Majestät ...tem Infanterieregiment, gefallen im Alter von achtundzwanzig Jahren, am 18. Juni 1815 in der siegreichen Schlacht bei Waterloo für König und Vaterland. Dulce et decorum est pro patria mori.«
Der Anblick dieses Gedenksteins erregte die Nerven der Schwestern so sehr, daß Miss Maria die Kirche verlassen mußte. Die Gemeinde machte achtungsvoll den tiefschwarzgekleideten, schluchzenden Mädchen Platz und bemitleidete den finsteren alten Vater, der gegenüber dem Monument des toten Soldaten saß. »Ob er Mrs. George vergibt?« fragten sich die Mädchen, sobald der Schmerzensausbruch vorüber war. Auch in Osbornes Bekanntenkreis, wo man den durch die Heirat verursachten Bruch zwischen Vater und Sohn kannte, sprach man viel über die Aussicht einer Versöhnung mit der jungen Witwe. Die Herren am Russell Square und in der City schlossen sogar Wetten darauf ab.
Wenn die Mädchen Befürchtungen hegten, Amelia werde möglicherweise als Tochter der Familie anerkannt werden, so wuchsen diese noch gegen Ende des Herbstes, als ihnen ihr Vater mitteilte, er wolle eine Auslandsreise machen. Er sagte nicht, wohin; sie wußten aber sogleich, daß er seine Schritte nach Belgien lenken würde, und sie hatten erfahren, daß sich Georges Witwe noch in Brüssel befand. Durch Lady Dobbin und deren Töchter waren sie stets ganz gut über das Tun und Treiben der armen Amelia unterrichtet. Durch den Tod des zweiten Majors im Regiment auf dem Schlachtfeld war unser ehrlicher Hauptmann befördert worden; und der tapfere O'Dowd, welcher sich hier sehr ausgezeichnet hatte, wie bei allen Gelegenheiten, wo er seine Kaltblütigkeit und Tapferkeit beweisen konnte, war jetzt Oberst und Träger des Bath-Ordens.
Viele der Tapferen des ...ten Regiments, das an beiden Schlachttagen schwere Verluste erlitten hatte, befanden sich im Herbst noch in Brüssel, um von ihren Wunden zu genesen. Die Stadt war noch Monate nach der großen Schlacht ein riesiges Lazarett, und als die Soldaten und Offiziere sich von ihren Verletzungen zu erholen begannen, füllten sich die Parks und öffentlichen Vergnügungsstätten mit alten und jungen verkrüppelten Soldaten, die, kaum dem Tode entrissen, mit Spiel, Scherz und Liebelei begannen, wie es auf dem Jahrmarkt der Eitelkeit üblich ist. Mr. Osborne machte bald einige vom ...ten Regiment ausfindig. Er kannte ihre Uniform genau und hatte jede Beförderung, jede Versetzung aufmerksam verfolgt und sprach gern vom Regiment und seinen Offizieren, als ob er selbst dazugehörte. Am Tage nach seiner Ankunft in Brüssel sah er beim Verlassen seines Hotels, das direkt am Park lag, einen Soldaten mit den wohlbekannten Aufschlägen, der sich auf einer Steinbank ausruhte. Er ging auf den Verwundeten zu und setzte sich zitternd neben ihn.
»Waren Sie in Hauptmann Osbornes Kompanie?« fragte er, und nach einer Pause fügte er hinzu: »Er war mein Sohn.«
Der Mann gehörte nicht zur Kompanie des Hauptmanns, aber er erhob den gesunden Arm und legte die Hand an die Mütze, traurig und ehrfürchtig vor dem abgezehrten, niedergebeugten Herrn, welcher ihn gefragt hatte. »Es gab keinen besseren und tüchtigeren Offizier im ganzen Heer«, sagte der Soldat. Der Hauptfeldwebel von der Kompanie des Hauptmanns (sie wurde jetzt von Hauptmann Raymond angeführt) sei jedoch in der Stadt und soeben von einem Schulterschuß genesen. Der Herr könne ihn sprechen, wenn er möge, und alles, was er über die Taten des ...ten Regiments wissen wolle, von ihm erfahren. Aber der Herr habe wohl zweifellos schon Major Dobbin gesprochen, den guten Freund des tapferen Hauptmanns, und Mrs. Osborne, die sich auch in Brüssel aufhalte und der es, wie man erzählte, sehr schlecht gehe. Es heißt, sie sei sechs Wochen oder noch länger geradezu nicht bei Sinnen gewesen. Der Herr werde das alles aber wohl schon wissen, und er bitte also um Entschuldigung, fügte der Soldat hinzu.
Osborne drückte dem Soldaten eine Guinee in die Hand und versprach ihm noch eine, wenn er den Hauptfeldwebel ins Hotel du Parc bringen wollte. Dieses Versprechen brachte den Gewünschten sehr bald zu Mr. Osborne. Der erste Soldat entfernte sich wieder, und nachdem er ein paar Soldaten erzählt hatte, daß Hauptmann Osbornes Vater gekommen sei und was für ein freigebiger, großmütiger Herr er sei, tranken und schmausten sie, solange die Guineen reichten, die aus dem üppigen Geldbeutel des trauernden alten Vaters gekommen waren.
In Begleitung des Hauptfeldwebels, der vor kurzem genesen war, begab sich Osborne nach Waterloo und Quatre-Bras, eine Reise, die damals Tausende seiner Landsleute machten. Unter der Führung des Hauptfeldwebels, den er in seinem Wagen mitgenommen hatte, besuchte er beide Schlachtfelder. Er sah die Stelle der Straße, von wo aus das Regiment am 16. zum Kampf marschiert war, und den Hügel, von dem sie die französische Kavallerie herabgetrieben hatten, nachdem diese den fliehenden Belgiern gefolgt war. Dort war die Stelle, wo der edle Hauptmann den französischen Offizier niedermachte, der mit dem jungen Fähnrich um die Fahne gekämpft hatte, nachdem die Fahnenträger gefallen waren. Auf dieser Straße hatten sie sich am nächsten Tage zurückgezogen, und hier war der Erdwall, an dem das Regiment in der Nacht zum 17. im Regen biwakierte. Dort drüben war die Stellung, die sie eingenommen und den ganzen Tag gehalten hatten, wobei sie sich immer wieder formierten, um den Angriffen der französischen Kavallerie zu begegnen, und sich zum Schutz gegen das wütende französische Geschützfeuer immer wieder hinter dem Erdwall niederwarfen. Und an diesem Hügel geschah es, als am Abend die gesamte englische Linie den Befehl zum Vordringen erhielt und der Feind nach seinem letzten Angriff zurückwich, daß der Hauptmann, degenschwingend und mit einem Hurra auf den Lippen, den Hügel hinabeilte, einen Schuß erhielt und tot niederfiel. »Major Dobbin hat dann den Leichnam des Hauptmanns nach Brüssel zurückgebracht und ihn begraben lassen, wie der Herr ja weiß«, berichtete der Hauptfeldwebel mit leiser Stimme. Während er seine Geschichte erzählte, schrien die Bauern und Reliquienjäger aus der Gegend um die beiden herum und boten allerlei Andenken an die Schlacht, Kreuze und Epauletten, zerschossene Kürasse und Adler, zum Verkauf an.
Osborne gab dem Hauptfeldwebel eine stattliche Belohnung, als er nach dem Besuch der Stätten, die der Schauplatz der letzten Taten seines Sohnes gewesen waren, von ihm schied. Das Grab hatte er bereits gesehen; das hatte er sofort nach seiner Ankunft in Brüssel aufgesucht. George lag auf dem schönen Friedhof von Laeken, nahe bei der Stadt. Bei einem Ausflug dorthin hatte er einmal leichthin den Wunsch geäußert, da begraben zu werden. Hier war nun der junge Offizier von seinem Freund in einem ungeweihten Winkel des Friedhofs bestattet worden, durch eine Hecke von den Tempeln und Türmen, den Blumen und Sträuchern getrennt, unter denen die katholischen Toten ruhen. Der alte Osborne empfand es als eine Demütigung, daß sein Sohn, ein englischer Gentleman, Hauptmann in der berühmten britischen Armee, nicht für würdig befunden worden war, in der Erde zu liegen, in der nichts weiter als Ausländer begraben waren. Wer von uns kann sagen, wieviel Eitelkeit sich in unserer wärmsten Empfindung anderen gegenüber verbirgt und wie selbstsüchtig unsere Liebe ist? Der alte Osborne dachte noch viel über den Zwiespalt seiner Gefühle und den Kampf zwischen seinem Instinkt und seiner Selbstsucht nach. Er glaubte fest daran, daß alles, was er tat, richtig sei und daß es immer nach seinem Willen gehen müsse, und gegen jeden Widerstand erhob sich sein Haß, gewappnet und giftig, wie der Stachel einer Wespe. Er war stolz auf seinen Haß, wie auf alles andere. Stets recht haben, stets vorwärtskommen und nie zweifeln, sind dies nicht die Eigenschaften, mit denen die Dummheit die Welt regiert?
Als sich Mr. Osbornes Wagen nach dem Besuch in Waterloo bei Sonnenuntergang dem Stadttor näherte, begegnete ihm eine andere Kutsche, in der zwei Damen und ein Herr saßen, während ein Offizier nebenherritt. Osborne fuhr zusammen, und der Hauptfeldwebel neben ihm warf seinem Nachbarn einen erstaunten Blick zu, während er den Offizier mit der Hand an der Mütze grüßte, der seinerseits den Gruß mechanisch erwiderte. Es war Amelia mit dem lahmen jungen Fähnrich an der Seite und der treuen Freundin Mrs. O'Dowd ihr gegenüber. Es war Amelia, aber wie verschieden von dem frischen munteren Mädchen, das Osborne kannte! Ihr Gesicht war bleich und abgezehrt, ihr hübsches braunes Haar lag gescheitelt unter einer Witwenhaube! Das arme Kind! Ihre Augen waren starr und blickten ins Leere. Sie sah Osborne ausdruckslos ins Gesicht, als die Wagen aneinander vorbeifuhren, erkannte ihn aber nicht, ebensowenig wie er sie erkannte, bis er aufblickte und Dobbin neben ihr reiten sah. Da wußte er, wen er vor sich hatte. Er haßte sie. Er wußte nicht, wie sehr, bis er sie hier gesehen hatte. Als ihr Wagen vorbei war, wandte er sich dem Hauptfeldwebel zu mit einem trotzigen, aufsässigen Blick, dem sein Begleiter nicht ausweichen konnte, – als wollte er sagen: wie wagst ausgerechnet du es, mich anzusehen? Verdammt sollst du sein! Ich hasse sie. Sie ist es, die alle meine Hoffnungen und meinen Stolz zunichte gemacht hat. »Sag dem Halunken, er soll schneller fahren«, schrie er fluchend dem Lakai auf dem Bock zu. Eine Minute später kam ein Pferd über das Pflaster hinter Osbornes Wagen galoppiert, und Dobbin ritt heran. Seine Gedanken waren woanders gewesen, als die Wagen sich begegneten, und erst als er ein paar Schritt weitergeritten war, entsann er sich, daß der gerade Vorbeigefahrene Osborne gewesen war. Dann hatte er sich umgedreht, um zu sehen, ob der Anblick ihres Schwiegervaters auf Amelia irgendeinen Eindruck gemacht habe, aber das arme Mädchen hatte gar nicht gemerkt, wer vorbeigekommen war. Hierauf hatte William, der sie täglich bei ihren Fahrten begleitete, seine Uhr herausgezogen, sich mit einer Verabredung, die ihm plötzlich eingefallen war, entschuldigt und war fortgeritten. Sie bemerkte auch das nicht, sondern blickte geradeaus über die Ebene hinweg zu den fernen Wäldern, wohin George marschiert war.
»Mr. Osborne, Mr. Osborne!« rief Dobbin, als er herangekommen war, und hielt ihm die Hand hin. Osborne machte keine Anstalten., sie zu ergreifen, sondern schrie noch einmal fluchend seinem Bedienten zu, schneller zu fahren. Dobbin legte seine Hand auf den Kutschenschlag.
»Ich muß Sie sprechen, Sir«, sagte er, »ich habe eine Botschaft für Sie.«
»Von der Frau da?« fragte Osborne grimmig.
»Nein«, entgegnete der andere, »von Ihrem Sohn«, worauf Osborne in die Wagenecke zurücksank. Dobbin ließ ihn weiterfahren und ritt dicht dahinter durch die ganze Stadt, ohne ein Wort zu sprechen, bis sie Osbornes Hotel erreichten. Dort folgte er Osborne zu seinen Zimmern. George war oft in diesen Räumen gewesen. Es waren die, die die Crawleys während ihres Aufenthalts in Brüssel bewohnt hatten.
»Bitte, haben Sie vielleicht irgendwelche Befehle für mich, Hauptmann Dobbin oder, Verzeihung, ich hätte sagen sollen, Major Dobbin, da bessere Männer als Sie tot sind und Sie an deren Platz getreten sind«, sagte Mr. Osborne mit dem sarkastischen Ton, den er zuweilen gern annahm.
»Ja, bessere Männer sind tot«, erwiderte Dobbin, »von einem will ich mit Ihnen sprechen.«
»Machen Sie es kurz, Sir«, sagte der andere mit einem Fluch und blickte den Besucher finster an.
»Ich bin hier als sein engster Freund«, fuhr der Major fort, »und als der Vollstrecker seines Letzten Willens. Er hat sein Testament aufgesetzt, ehe wir in die Schlacht zogen. Wissen Sie, wie gering seine Mittel sind und in welcher traurigen Lage sich seine Witwe befindet?«
»Ich kenne seine Witwe nicht«, sagte Osborne. »Soll sie doch zu ihrem Vater zurückkehren.« Aber der Herr, mit dem er sprach, war entschlossen, seinen Gleichmut zu wahren, und fuhr fort, ohne die Unterbrechung zu beachten:
»Kennen Sie Mrs. Osbornes Lage? Ihr Leben und ihr Verstand sind dem Schlag, der sie getroffen hat, beinahe zum Opfer gefallen. Es ist sehr zweifelhaft, ob sie sich je erholen wird. Es besteht noch eine Möglichkeit für sie, und deshalb komme ich zu Ihnen. Sie wird bald Mutter werden. Wollen Sie die Sünde des Vaters an dem Kind heimsuchen? Oder wollen Sie dem Kind um des armen Georges willen verzeihen?«
Osborne brach in einen Schwall von Eigenlob und Verwünschungen aus. Ersteres, um seine Haltung vor dem eigenen Gewissen zu entschuldigen, letzteres, um Georges Pflichtvergessenheit zu übertreiben. Kein Vater in ganz England hätte sich großzügiger gegenüber einem Sohn verhalten können, der sich bösartig gegen ihn aufgelehnt hatte. Er war gestorben, ohne auch nur andeutungsweise zu bekennen, daß er unrecht gehabt habe. Mochte er nun die Folgen seines Ungehorsams und seiner Torheit tragen. Er selbst, Mr. Osborne, jedoch war ein Mann von Wort. Er hatte geschworen, niemals mit jener Frau zu sprechen oder sie gar als Gattin seines Sohnes anzuerkennen. »Das können Sie ihr sagen«, schloß er mit einem Fluch, »und dazu werde ich bis zum Ende meiner Tage stehen.«
Es gab also von dieser Seite her keine Hoffnung mehr. Die Witwe mußte von dem wenigen leben, was sie hatte, oder von dem, womit Joseph sie unterstützen konnte. Wenn ich es ihr auch erzählte, sie würde es doch nicht beachten, dachte Dobbin traurig; denn die Gedanken des armen Mädchens waren seit der Katastrophe überhaupt nicht mehr hier; betäubt von der Last ihres Kummers, war ihr Gutes ebenso gleichgültig wie Böses, und sie hatte auch keine Empfindung für Freundschaft und Güte. Sie nahm alles klaglos hin und versank wieder in ihrem Kummer.
Nach der obigen Unterredung wollen wir jetzt ein Jahr im Leben der armen Amelia überspringen. Sie hat die ersten Monate davon in so tiefem und mitleiderregendem Schmerz zugebracht, daß wir, die wir einige Regungen dieses schwachen, zarten Herzens beobachtet und beschrieben haben, uns vor dem entsetzlichen Kummer, unter dem es blutet, zurückziehen müssen. Tretet still an das Schmerzenslager der armen geknickten Seele. Schließt leise die Tür des dunklen Zimmers, in dem sie leidet, wie jene guten Menschen, die sie in den ersten Monaten ihres Schmerzes pflegten und sie nicht verließen, bis ihr der Himmel Trost gesendet hatte. Ein Tag kam – ein Tag fast entsetzlicher Freude und Verwunderung, wo das arme verwitwete Wesen ein Kind an die Brust drückte, ein Kind mit den Augen ihres dahingegangenen Georges, einen kleinen engelschönen Knaben. Welch eine Wonne, seinen ersten Schrei zu hören! Wie sie über ihm lachte und weinte! Wie Liebe und Hoffnung und Gebet wieder in ihrer Brust erwachten, als der Säugling sich an sie schmiegte! Sie war gerettet. Die Ärzte, die sie behandelten und für ihr Leben oder ihren Verstand gefürchtet hatten, hatten ängstlich auf diese Krisis gewartet, ehe sie erklären konnten, beides sei gerettet. Es war die langen Monate der Furcht und des Zweifels wert für die, die sich in ihre Pflege geteilt hatten, ihre Augen noch einmal zärtlich strahlend auf sie gerichtet zu sehen.
Unser Freund Dobbin war einer von ihnen. Er war es, der sie nach England in das Haus ihrer Mutter zurückgebracht hatte, als Mrs. O'Dowd auf den entschiedenen Befehl ihres Mannes hin die Patientin verlassen hatte. Es wäre eine Herzensweide für jeden gefühlvollen Menschen gewesen, zu sehen, wie Dobbin das Kind hielt, und zu hören, wie Amelia bei diesem Anblick frohlockend lachte. William hatte das Kind aus der Taufe gehoben und bot seinen ganzen Scharfsinn auf, um Tassen, Löffel, Becher, Schüsselchen und Beißkorallen für seinen kleinen Paten einzukaufen.
Wir brauchen hier nicht zu erzählen, wie ihn seine Mutter pflegte und kleidete und nur für ihn lebte, wie sie alle Kinderwärterinnen fortjagte und kaum jemandem anders gestattete, ihn zu berühren, wie sie glaubte, die größte Gunst, die sie seinem Paten, Major Dobbin, erweisen könne, sei, ihn zuweilen mit dem Kleinen spielen zu lassen. Das Kind war ihr ganzes Leben. Ihr ganzes Dasein war eine einzige mütterliche Liebkosung. Sie umhüllte das schwache und unwissende Geschöpf mit Liebe und Anbetung. Es war ihr Leben, was der Säugling von ihrer Brust trank. Nachts und wenn sie allein war, brach ihre Mutterliebe heimlich und gewaltig in Entzücken aus, wie Gottes wunderbare Güte sie dem weiblichen Instinkt gewährt – Freuden, die höher und tiefer sind als die Vernunft, eine blinde, schöne Hingabe, die nur Frauenherzen kennen. William Dobbins Aufgabe war es, über diese Regungen Amelias nachzudenken und ihr Herz zu beobachten, und wenn er in seiner Liebe fast alle Gefühle ahnen konnte, die Amelias Herz bewegten, so sah er leider auch mit unheilvoller Deutlichkeit, daß darin kein Platz für ihn geblieben war. Und so ertrug er sanft sein Schicksal. Er kannte es und war zufrieden damit.
Wahrscheinlich durchschauten Amelias Eltern die Absichten des Majors und waren nicht abgeneigt, ihn zu ermutigen, denn Dobbin kam täglich in ihr Haus und blieb stundenlang bei ihnen, bei Amelia oder dem ehrlichen Mr. Clapp, ihrem Wirt, und seiner Familie. Er brachte unter irgendeinem Vorwand fast täglich Geschenke für jeden mit, und bei dem kleinen Mädchen des Hauswirtes, das Amelias Liebling war, hieß er nur »Major Zuckererbse«. Dies kleine Mädchen spielte gewöhnlich die Zeremonienmeisterin und führte ihn bei Mrs. Osborne ein. Eines Tages mußte sie doch lachen, als Major Zuckererbse im Wagen nach Fulham gefahren kam und mit einem Holzpferd, einer Trommel und Trompete und anderem Kriegsspielzeug für den kleinen George ausstieg, der kaum ein halbes Jahr alt war und für den die besagten Gegenstände wohl doch etwas verfrüht kamen.
Das Kind schlief. »Pst!« machte Amelia, vielleicht etwas ungehalten über die knarrenden Stiefel des Majors. Sie hielt ihm die Hand hin und lächelte, weil er sie erst ergreifen konnte, als er sich seiner Spielwarenlast entledigt hatte. »Geh hinunter, Klein Mary«, sagte er dann zu dem Kind, »ich muß mit Mrs. Osborne etwas besprechen.« Sie blickte erstaunt auf und legte den Kleinen ins Bett.
»Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden, Amelia«, sagte er, während er sanft ihr zartes, weißes Händchen ergriff.
»Verabschieden? Und wohin soll die Reise gehen?« fragte sie lächelnd.
»Schicken Sie Ihre Briefe an meine Beauftragten, man wird sie mir nachsenden, denn Sie werden mir doch schreiben, nicht wahr? Ich werde lange Zeit wegbleiben.«
»Ich werde Ihnen über Georgy schreiben«, sagte sie. »Lieber William, wie gut Sie zu ihm und mir sind. Sehen Sie ihn nur an! Ist er nicht wie ein Engel?«
Die rosigen Händchen des Kindes schlossen sich mechanisch um den Finger des ehrlichen Soldaten, und Amelia blickte ihm strahlend vor Mutterglück ins Gesicht. Die grausamsten Blicke hätten ihn nicht mehr verwunden können als dieser Ausdruck hoffnungsloser Freundlichkeit. Er beugte sich über Mutter und Kind. Einen Augenblick lang konnte er nicht sprechen, und nur mit äußerster Kraftanstrengung konnte er ein »Gott segne Sie!« hervorbringen. – »Gott segne Sie!« erwiderte Amelia, wandte ihm das Gesicht zu und küßte ihn.
»Pst! Wecken Sie Georgy nicht auf«, fügte sie hinzu, als William Dobbin mit schweren Schritten zur Tür stapfte. Sie hörte nicht das Geräusch des davonrollenden Wagens – sie blickte auf das Kind, das im Schlaf lächelte.
36. Kapitel
Wie man von nichts gut leben kann
Ich nehme an, auf unserem Jahrmarkt der Eitelkeit gibt es keinen, der nicht aufmerksam genug ist, sich zuweilen über die weltlichen Angelegenheiten seiner Bekannten den Kopf zu zerbrechen; auch wird wohl keiner so nachsichtig sein und sich nicht zuweilen wundern, wie sein Nachbar Jones oder sein Nachbar Smith bis zum Jahresende mit seinem Geld auskommt. Ich muß zum Beispiel bei aller Achtung für die Jenkins (denn ich speise ein paarmal in jeder Saison bei ihnen) zugeben, daß mich das Auftreten der Familie im Park in der großen Kutsche mit den stattlichen Lakaien bis an mein Lebensende verwundern und täuschen wird; denn obwohl ich weiß, daß die Equipage nur gemietet ist und sämtliche Dienstboten auf Kostgeld stehen, so müssen doch diese drei Menschen und der Wagen wenigstens sechshundert Pfund pro Jahr kosten – und dazu kommen dann noch die glänzenden Diners, die beiden Jungen in Eton, die hervorragende Gouvernante und die Lehrer für die Mädchen, die Reise ins Ausland oder nach Eastbourne oder Worthing im Herbst, der jährliche Ball mit dem Souper aus Günthers Restaurant (aus dem, beiläufig erwähnt, die Speisen meistens dann geliefert werden, wenn Jenkins vornehme Gäste bewirtet. Das weiß ich sehr gut, da ich einmal dazu eingeladen war, um einen leeren Platz zu füllen. Ich sah sogleich, daß diese Mahlzeiten bedeutend besser sind als die gewöhnlichen, zu denen Jenkins seinen weniger vornehmen Bekannten Einladungskarten schickt). Wer wundert sich also nicht, wie Jenkins wohl auskommen mag. Was ist Jenkins eigentlich? Wir wissen es alle, er ist Geheimrat im Schnur- und Siegellackamt mit einem Einkommen von zwölfhundert Pfund pro Jahr. Hatte seine Frau Privatvermögen? Pah! Miss Flint, eins von elf Kindern eines kleinen Gutsbesitzers in Buckinghamshire. Alles, was sie von ihrer Familie erhält, ist ein Truthahn zu Weihnachten, und dafür muß sie ein paar von ihren Schwestern in der toten Saison ernähren und ihre Brüder aufnehmen und verpflegen, wenn sie in die Stadt kommen. Wie reicht also Jenkins mit seinen Einkünften? Ich frage mit jedem seiner Freunde: Warum ist er nicht längst gerichtlich belangt und warum ist er im vergangenen Jahr zu jedermanns Erstaunen von Boulogne wieder zurückgekommen?
»Ich«, das ist hier die Welt im allgemeinen, die Mrs. Grundy aus jedes Lesers Privatkreis, denn jeder von uns kann auf einige Familien seiner Bekanntschaft deuten, bei denen niemand weiß, wovon sie eigentlich leben. Jeder von uns hat schon mit seinem freundlichen Gastgeber angestoßen und sich gewundert, wovon, zum Teufel, dieser das Glas Wein bezahlt hat.
Als sich Rawdon Crawley drei bis vier Jahre nach seinem Pariser Aufenthalt mit seiner Frau in einem kleinen, aber hübschen Haus in der Curzon Street in Mayfair eingerichtet hatte, gab es kaum einen unter den zahlreichen Freunden, die sie darin bewirteten, der sich nicht die obige Frage vorgelegt hätte. Der Romanschreiber weiß, wie schon gesagt, alles. Und da ich in der Lage bin, dem Publikum erzählen zu können, wie Crawley und seine Frau ohne Einkommen lebten, so bitte ich nur die Zeitschriften, die die Angewohnheit haben, Auszüge aus den verschiedenen, gerade erschienenen Werken zu veröffentlichen, die folgende genaue Darstellung und Berechnung nicht abzudrucken, da mir als dem Entdecker der Sache (noch dazu mit einigen Kosten) auch die alleinige Nutznießung davon gebührt. Mein Sohn – würde ich sagen, wenn ich mit einem Kind gesegnet wäre –, du kannst durch eifrige Forschung und beständigen Verkehr mit ihm lernen, wie ein Mensch bequem von nichts leben kann. Am besten ist es aber, dich nicht zu sehr mit Leuten dieses Gewerbes einzulassen, sondern die Berechnungen aus zweiter Hand zu entnehmen, wie etwa Logarithmen, da die eigne Berechnung, das kannst du glauben, dir bedeutende Geldkosten verursachen wird.
Crawley und Frau lebten also ein paar Jahre, die wir nur ganz kurz streifen können, von nichts sehr glücklich und bequem in Paris. In dieser Zeit verließ er die Leibgarde und verkaufte sein Offizierspatent. Wenn wir ihn wiedertreffen, sind der Schnurrbart und der Titel Oberst auf seiner Karte die einzigen Überbleibsel seines Militärberufs.
Es ist bereits erwähnt worden, daß Rebekka bald nach ihrer Ankunft in Paris eine führende Stellung in der Pariser Gesellschaft einnahm und in den ersten Häusern des restaurierten französischen Adels empfangen wurde. Die Engländer von Welt, die sich in Paris aufhielten, machten ihr ebenfalls den Hof, sehr zum Ärger ihrer Gemahlinnen, die den Emporkömmling nicht ausstehen konnten. Einige Monate lang war Mrs. Crawley von den Salons des Faubourg Saint-Germain, wo sie eine gesicherte Stellung hatte, und dem Glanz des neuen Hofes, wo sie mit großer Auszeichnung empfangen wurde, entzückt und vielleicht auch ein bißchen berauscht. Während dieser Zeit der Triumphe vernachlässigte sie wahrscheinlich die Leute, mit denen ihr Mann hauptsächlich verkehrte – meist ehrliche junge Militärs.
Der Oberst gähnte gelangweilt unter den Herzoginnen und vornehmen Damen bei Hofe. Die alten Frauen, die Ecarté spielten, veranstalteten so einen Lärm um ein Fünffrancsstück, daß es sich für Oberst Crawley nicht lohnte, sich an einen Spieltisch zu setzen. Den Witz ihrer Unterhaltung konnte er nicht erfassen, da er die Sprache nicht verstand. Was nützte es seiner Frau, fragte er sich, wenn sie jeden Abend vor einem ganzen Kreis von Prinzessinnen knickste? Er ließ seine Frau bald allein zu diesen Gesellschaften gehen und nahm seine früheren, einfachen Beschäftigungen und Vergnügungen unter den liebenswürdigen Freunden seiner eigenen Wahl wieder auf.
Wenn wir sagen, ein Mann lebt elegant von nichts, so gebrauchen wir das Wort »nichts«, um eine unbekannte Größe zu bezeichnen, und meinen damit einfach, daß wir nicht wissen, wie der fragliche Mensch die Kosten seines Haushalts bestreitet. Unser Freund, der Oberst, besaß ein großes Talent für alle Arten von Glücksspiel; und da er sich beständig mit den Karten, dem Würfelbecher und dem Billardqueue übte, so kann man sich natürlich vorstellen, daß er in der Anwendung dieser Gegenstände eine größere Geschicklichkeit erlangte als Menschen, die sie nur gelegentlich gebrauchen. Der Umgang mit einem Billardqueue gleicht dem mit einem Bleistift, einer Flöte und einem Degen – man meistert diese Instrumente nicht auf Anhieb und bringt es nur durch Ausdauer und fortwährendes Studium, verbunden mit einem natürlichen Talent, dahin, sich darin auszuzeichnen. Crawley nun hatte sich von einem glänzenden Dilettanten zu einem unübertrefflichen Meister des Billardspiels entwickelt. Wie bei einem großen General pflegte sein Genie erst in der Gefahr hervorzutreten, und wenn ihm das Glück während des ganzen Spiels nicht hold war und die Wetten gegen ihn standen, so machte er mit nicht zu überbietender Geschicklichkeit und Kühnheit einige wundervolle Vorstöße, die das Gleichgewicht der Schlacht wiederherstellten, und am Ende wurde er Sieger zum Erstaunen aller – das heißt aller, die sein Spiel nicht kannten. Diejenigen, die daran gewöhnt waren, hüteten sich, ihr Geld gegen einen Mann zu setzen, der plötzlich so reich an Fähigkeiten und an so glänzender und überwältigender Geschicklichkeit war.
Im Kartenspiel war er ebenso geschickt, denn obgleich er am Anfang des Abends ständig Geld verlor, so gleichgültig und fehlerhaft spielte, daß Neulinge oft geneigt waren, sein Talent gering einzuschätzen, so bemerkte man doch, daß Crawleys Spiel ganz anders wurde, sobald wiederholte kleine Verluste ihn zur Vorsicht gemahnten, und daß er noch vor Ende der Nacht seinen Gegner völlig schlagen würde. Es konnten in der Tat nur sehr wenige Menschen behaupten, ihn besiegt zu haben. Seine Triumphe wiederholten sich so häufig, daß man sich nicht zu wundern braucht, wenn seine Neider und Verlierer zuweilen mit Bitterkeit davon sprachen. Wie die Franzosen meinten, der Herzog von Wellington habe nur deshalb nie eine Schlacht verloren, weil er durch eine erstaunliche Reihe glücklicher Zufälle stets Sieger geblieben sei, und bei Waterloo habe er nur durch Betrug den letzten großen Stich gemacht, so deutete man auch im englischen Hauptquartier an, daß nur Falschspiel die ständigen Erfolge von Oberst Crawley erklären könnte.
Obwohl zu jener Zeit Frascati und der »Salon« in Paris geöffnet waren, hatte doch die Spielleidenschaft so um sich gegriffen, daß die öffentlichen Spiellokale für das allgemeine Bedürfnis nicht ausreichten. Deshalb wurde in den Privathäusern so eifrig gespielt, als ob es keine öffentlichen Einrichtungen zur Befriedigung dieser Leidenschaft gäbe. Bei Crawleys bezaubernden kleinen abendlichen réunions ging man diesen verhängnisvollen Vergnügungen nach – zum großen Verdruß der gutmütigen kleinen Mrs. Crawley. Tief bekümmert sprach Rebekka über die Leidenschaft ihres Gatten für die Würfel und klagte gegenüber allen, die ihr Haus betraten. Sie beschwor die jungen Leute, nie, niemals einen Würfelbecher anzufassen, und als der junge Green von den Schützen einst eine beträchtliche Summe verloren hatte, hatte Rebekka eine tränenreiche Nacht, wie der Diener dem unglücklichen jungen Herrn erzählte, und sie fiel sogar vor ihrem Gatten auf die Knie und bat ihn, die Schuld zu erlassen und den Schuldschein zu verbrennen. Aber wie konnte er das! Er selbst hatte ebensoviel an Blackstone von den Husaren und Graf Punter von der Hannoverschen Kavallerie verloren. Green konnte sich einigermaßen Zeit lassen; aber bezahlen? – natürlich, bezahlen mußte er. Es war kindisch, zu verlangen, daß er einen Schuldschein verbrennen sollte.
Andere Offiziere, hauptsächlich junge – denn die jungen Leute drängten sich um Mrs. Crawley –, kamen mit langen Gesichtern von ihren Gesellschaften, wo sie stets mehr oder weniger Geld an ihren verhängnisvollen Spieltischen zurückgelassen hatten. Ihr Haus kam langsam in einen schlechten Ruf. Die alten Hasen warnten die weniger Erfahrenen vor der Gefahr. Oberst O'Dowd vom ...ten Regiment, einem von denen, die damals in Paris standen, warnte Leutnant Spooney von seinem Korps. Ein lauter, heftiger Streit entbrannte zwischen dem Infanterieoberst und seiner Gemahlin, die im Café de Paris speisten, und Oberst und Mrs. Crawley, die ebenfalls dort aßen. Die Damen auf beiden Seiten griffen ein. Mrs. O'Dowd schnippte mit den Fingern Mrs. Crawley ins Gesicht und nannte deren Mann »nichts Besseres als einen Schwindler«. Oberst Crawley forderte Oberst O'Dowd; aber als der Oberbefehlshaber von dem Streit hörte, ließ er Oberst Crawley kommen, der gerade die Pistolen, »mit denen er Hauptmann Marker erschossen hatte«, bereitmachte, und seine Unterredung mit ihm bewirkte, daß kein Duell stattfand. Wäre Rebekka nicht vor General Tufto auf die Knie gefallen, hätte man Crawley nach England zurückgeschickt. Von da an spielte Rawdon ein paar Wochen nur mit Zivilisten.
Trotz Rawdons zweifelloser Geschicklichkeit und seines steten Erfolges wurde es seiner Frau bei Betrachtung dieser Dinge doch bald klar, daß ihre Lage recht unsicher war, und wenn sie auch selten etwas bezahlten, so würde ihr kleines Kapital doch eines Tages gleich Null werden. »Das Spiel, Liebster«, pflegte sie zu sagen, »ist gut, das Einkommen etwas aufzubessern, aber es taugt nicht als alleinige Einkommensquelle. Eines Tages haben die Menschen es satt zu spielen, und wo bleiben wir dann?« Rawdon meinte, daß ihre Bemerkung berechtigt sei, hatte er doch selbst bemerkt, daß die Leute nach einigen Abendveranstaltungen bei ihm wirklich des Spiels müde waren und sich trotz der Reize Rebekkas selten sehen ließen.
So angenehm und leicht ihr Leben in Paris auch war, so war es doch letzten Endes nur Zeitvergeudung und liebenswürdige Spielerei, und Rebekka sah ein, daß sie Rawdons Glück im eigenen Lande erreichen müsse. Sie mußte ihm eine Stellung oder ein Amt in England oder in den Kolonien verschaffen, und sie beschloß, nach England zu gehen, sobald der Weg dahin für sie geebnet war. Als ersten Schritt hatte sie Crawley veranlaßt, sein Patent in der Garde zu verkaufen und sich auf halben Sold setzen zu lassen. Sein Dienst als Adjutant bei General Tufto hatte schon früher aufgehört. Rebekka machte sich in allen Gesellschaften über diesen Offizier lustig, lachte über sein Toupet (das er sich hatte machen lassen, als er nach Paris kam), seinen Hosenbund, seine falschen Zähne und vor allem über seine anmaßende Einbildung, als Herzensbrecher zu gelten und eitel zu glauben, jede Dame, mit der er zusammentraf, sei in ihn verliebt. Der General hatte nun seine Aufmerksamkeit Mrs. Brent, der Frau von Kommissar Brent, die so buschige Augenbrauen hatte, zugewendet. Sie kam nun in den Genuß seiner Bukette, seiner Diners im Restaurant, seiner Opernlogen und seiner Nippsachen. Die arme Mrs. Tufto war nicht glücklicher als zuvor und mußte noch immer lange Abende allein mit ihren Töchtern verbringen, während sie wußte, daß ihr General parfümiert und frisiert fortgegangen war, um im Theater hinter Mrs. Brents Stuhl zu stehen. Becky hatte statt seiner zwar ein Dutzend anderer Bewunderer, und sie konnte ihre Rivalin mit ihrem Witz in Stücke reißen, aber wie gesagt, begann sie dieses untätigen geselligen Lebens müde zu werden; Opernlogen und Diners im Restaurant hatten ihren Reiz für sie verloren; die Blumensträuße ließen sich nicht als Reserve für später aufbewahren, und von allerlei Tand, Spitzentüchlein und Glacehandschuhen konnte sie nicht leben. Sie fühlte die Leichtfertigkeit all dieser Vergnügungen und sehnte sich nach inhaltsreicheren Genüssen.
Zu dieser Zeit traf eine Nachricht ein, die sich unter den zahlreichen Gläubigern vom Oberst in Paris schnell herumsprach und sie mit Befriedigung erfüllte. Miss Crawley, die reiche Tante, von der er eine riesige Erbschaft erwartete, lag im Sterben, und der Oberst mußte an ihr Bett eilen. Mrs. Crawley sollte mit dem Kind zurückbleiben, bis er kam, sie zu holen. Er reiste nach Calais ab, und dort sicher angekommen, hätte er eigentlich nach Dover gehen müssen; statt dessen bestieg er jedoch die Postkutsche nach Dünkirchen und reiste von da nach Brüssel, für das er von früher her eine Vorliebe hatte. Er hatte nämlich in London mehr Schulden als in Paris und zog daher die kleine ruhige belgische Stadt den beiden geräuschvolleren Hauptstädten vor.
Die Tante war tot. Mrs. Crawley bestellte für sich und den kleinen Rawdon Trauerkleidung. Der Oberst war mit dem Ordnen der Erbschaftsangelegenheiten beschäftigt. Sie konnten nun im Hotel den ersten Stock nehmen statt des kleinen Zwischenstockwerks, das sie bewohnten. Mrs. Crawley hatte mit dem Hauswirt eine Besprechung über neue Vorhänge, einen freundschaftlichen Wortwechsel über die Teppiche, kam aber schließlich zu einer Einigung über alles, mit Ausnahme der Rechnung. Sie fuhr in einem seiner Wagen ab, an ihrer Seite die französische Bonne mit dem Kind, während ihr der freundliche Wirt und seine Frau vom Tore aus zum Abschied nachlächelten. General Tufto war wütend, als er hörte, sie sei fort, und Mrs. Brent war wütend auf ihn, weil er wütend war. Leutnant Spooney war tief ins Herz getroffen, und der Wirt bereitete seine besten Zimmer für die Rückkehr der bezaubernden kleinen Frau und ihres Mannes vor. Er hütete die Koffer, die sie zurückgelassen hatten, wie seinen Augapfel. Madame Crawley hatte sie ihm besonders ans Herz gelegt. Als man sie jedoch nach geraumer Zeit öffnete, erwies sich ihr Inhalt als nicht besonders wertvoll.
Bevor Mrs. Crawley sich jedoch zu ihrem Mann in die belgische Hauptstadt begab, machte sie einen Abstecher nach England. Ihren kleinen Sohn ließ sie unter der Obhut ihres französischen Mädchens auf dem Kontinent zurück. Der Abschied zwischen Rebekka und dem kleinen Rawdon bereitete keinem von beiden großen Schmerz. Um die Wahrheit zu gestehen, hatte sie von dem jungen Herrn seit seiner Geburt nicht viel zu Gesicht bekommen.
Nach der liebreichen Sitte französischer Mütter hatte sie ihn zu einer Amme in einem Dorf nahe Paris gegeben, wo der kleine Rawdon die ersten Monate seines Lebens nicht unglücklich mit einer zahlreichen Familie von Pflegebrüdern in Holzschuhen zugebracht hatte. Der Vater ritt oft hinaus, um ihn zu besuchen, und sein Herz erglühte, wenn er den rosigen, schmutzigen kleinen Kerl lustig kreischen hörte und zusah, wie er unter der Aufsicht der Gärtnersfrau, seiner Pflegemutter, glückstrahlend im Schlamm saß und Kuchen fabrizierte.
Rebekka zeigte nie große Lust, ihren Sohn und Erben zu besuchen. Er hatte ihr einmal einen neuen taubenblauen Umhang verdorben. Die Liebkosungen seiner Amme zog er denen seiner Mutter vor, und als er die lustige Wärterin, die beinahe seine Mutter war, schließlich verließ, brüllte er stundenlang. Er ließ sich erst durch das Versprechen seiner Mutter beruhigen, daß er am nächsten Tag zu seiner Amme zurück dürfe. Auch der Amme, die sich sonst wahrscheinlich über sein Scheiden gegrämt hätte, erzählte man, daß ihr das Kind bald zurückgebracht werde, und eine Zeitlang wartete sie ängstlich auf seine Rückkehr.
Unsere Freunde gehörten wirklich zu den ersten jenes Geschlechtes kühner englischer Abenteurer, die später den Kontinent überschwemmten und in allen europäischen Hauptstädten ihre Schwindeleien vollbrachten. Die Achtung vor dem Reichtum und der Ehre der Engländer war in jenen glücklichen Tagen von 1817/18 noch sehr groß. Sie hatten, wie man erzählt, damals noch nicht gelernt, mit der Hartnäckigkeit, die sie jetzt auszeichnet, zu feilschen. Europas große Städte waren damals noch nicht dem Unternehmungsgeist englischer Schurken geöffnet; während es jetzt kaum eine Stadt in Frankreich oder Italien gibt, wo nicht einige unserer edlen Landsleute mit ihrem protzigen, anmaßenden Benehmen, das wir überall zur Schau stellen, Gastwirte beschwindeln, leichtgläubige Bankiers mit gefälschten Wechseln betrügen und Wagenbauer um ihre Wagen, Goldschmiede um ihre Juwelen, unvorsichtige Reisende um ihr Geld und sogar öffentliche Bibliotheken um ihre Bücher bringen. Vor dreißig Jahren dagegen brauchte man nur der gnädige Herr aus England zu sein und in einem eigenen Wagen zu reisen, um überall Kredit zu bekommen, wo man ihn suchte. Damals betrogen die Gentlemen nicht, sondern wurden betrogen. Erst ein paar Wochen nach der Abreise der Crawleys bemerkte der Wirt des Hotels, worin sie während ihres Pariser Aufenthalts gewohnt hatten, seinen Verlust, nämlich erst nachdem Madame Marabou, die Putzmacherin, wiederholt mit einer kleinen Rechnung für Sachen, die sie Madame Crawley geliefert hatte, aufgetaucht war und erst als Monsieur Didelot von der Boule d'Or im Palais-Royal ein halbes dutzendmal gefragt hatte, ob cette charmante Milady, die Uhren und Armbänder bei ihm gekauft hatte, de retour sei. Tatsächlich war nicht einmal die arme Gärtnersfrau, die Madames Kind gestillt hatte, nach den ersten sechs Monaten für die Milch der Menschenfreundlichkeit, die sie dem lebhaften und gesunden kleinen Rawdon gespendet hatte, bezahlt worden. Nein, nicht einmal die Amme war bezahlt worden – die Crawleys hatten zu große Eile gehabt, um an diese unbedeutende Schuld zu denken. Der Hotelwirt fluchte bis an sein Ende auf die englische Nation. Er fragte jeden Reisenden, ob er einen gewissen Oberst Lord Crawley kenne – avec sa femme – une petite dame, très spirituelle. »Ah, Monsieur«, setzte er dann stets hinzu, »ils m'ont affreusement vole.« Es war traurig, seine Stimme zu hören, wenn er von dieser Katastrophe sprach.
Rebekkas Ziel bei ihrer Reise nach London war, eine Art Vergleich mit den zahlreichen Gläubigern ihres Mannes zu treffen, um ihnen einen Anteil von neun Pence bis zu einem Shilling pro Pfund zu bieten und damit ihrem Mann die Rückkehr in sein Vaterland zu sichern. Es ziemt uns nicht, alle ihre Schritte bei diesen schwierigen Verhandlungen zu verfolgen; als sie die Leute jedoch zu ihrer Zufriedenheit darauf aufmerksam machte, daß die Summe, die sie ihnen hier bieten könne, das gesamte verfügbare Kapital ihres Mannes sei, und sie überzeugt hatte, daß Oberst Crawley lieber auf dem Kontinent bleiben als nach England zu seinen unbezahlten Schulden zurückkehren würde, als sie ihnen bewiesen hatte, daß ihm unmöglich von anderer Seite Geld zufallen würde und daß sie auf Erden keine Aussicht mehr hätten, einen größeren Teil zu erhalten, als sie jetzt bieten konnte, brachte sie die Gläubiger des Obersten dahin, ihre Vorschläge einmütig anzunehmen, und sie kaufte mit fünfzehnhundert Pfund bar mehr als den zehnfachen Schuldbetrag.
Mrs. Crawley nahm bei diesem Geschäft keinen Rechtsanwalt. Die Sache war so einfach, »tun oder es bleibenlassen«, wie sie ganz treffend bemerkte, daß sie die Gläubiger veranlaßte, durch ihre Anwälte den Handel abzuschließen. Mr. Lewis, der Mr. Davids vom Lion Square vertrat, und Mr. Moss, der für Mr. Manasseh von der Cursitor Street arbeitete (beides waren Hauptgläubiger des Obersten), machten der Dame Komplimente darüber, wie glänzend sie ihr Geschäft betrieb, und beteuerten, daß keiner ihrer Berufskollegen sie übertreffen könnte.
Rebekka nahm die Gratulationen mit der größten Bescheidenheit entgegen. Sie ließ eine Flasche Sherry und ein Kuchenbrot in die schmutzige kleine Wohnung kommen, in der sie während ihrer Geschäfte wohnte, und bewirtete damit die Rechtsanwälte ihrer Gegner. Sie drückte ihnen beim Scheiden gutgelaunt die Hand und kehrte direkt nach dem Kontinent zu Mann und Sohn zurück, um dem älteren Rawdon die frohe Botschaft von seiner völligen Freiheit zu bringen. Der jüngere Rawdon war während der Abwesenheit seiner Mutter von Mademoiselle Geneviève, ihrem französischen Mädchen, stark vernachlässigt worden. Das junge Ding hatte eine Liebschaft mit einem Soldaten der Garnison von Calais angefangen und ihren Schützling in der Gesellschaft dieses Militärs vergessen. Der kleine Rawdon war um ein Haar dem Ertrinken entgangen, als ihn die zerstreute Genevieve am Strand von Calais verlassen und verloren hatte.
So kamen also Oberst Crawley und Frau nach London, und in ihrem Haus in der Curzon Street in Mayfair zeigten sie, welche Geschicklichkeit diejenigen besitzen müssen, die von den obenerwähnten Mitteln leben wollen.
37. Kapitel
Fortsetzung
Zuallererst müssen wir unbedingt berichten, wie man ein Haus umsonst mieten kann. Diese Häuser sind entweder unmöbliert zu haben, und dann kann man sie nach eigenem Geschmack prächtig einrichten und ausstatten lassen, wenn man bei Gillow oder Banting Kredit hat. Oder man mietet sie möbliert, was für die meisten nicht so mühsam und kompliziert ist. Crawley und seine Frau zogen es vor, ihr Haus so zu mieten.
Ehe Mr. Bowls die Herrschaft über Miss Crawleys Haus und Keller in der Park Lane übernahm, hatte die Dame einen Mr. Raggles als Butler gehabt. Er war auf dem Familiengut in Queen's Crawley geboren und der jüngere Sohn eines dortigen Gärtners. Durch gute Führung, nettes Äußeres und hübsche Waden und eine ernste Haltung hatte sich Raggles vom Messerputzbrett zum Bedientensitz auf der Kutsche und vom Bedientensitz zum Butleramt emporgeschwungen. Nachdem er eine gewisse Anzahl von Jahren Miss Crawleys Haushalt geführt hatte, wo er guten Lohn, fette Nebeneinkünfte und reichlich Gelegenheit zum Sparen gehabt hatte, teilte er mit, daß er mit einer früheren Köchin von Miss Crawley, die sich mit einer Wäschemangel und einem kleinen Gemüseladen in der Nachbarschaft ehrlich ernährte, die Ehe eingehen wolle. In Wirklichkeit hatte die Trauung schon vor mehreren Jahren heimlich stattgefunden, obwohl Miss Crawley die Neuigkeit von Mr. Raggles' Ehe erst durch einen kleinen Jungen und ein Mädchen von sieben und acht Jahren erfahren hatte, deren beständige Anwesenheit in der Küche Miss Briggs' Aufmerksamkeit erregt hatte.
Mr. Raggles zog sich also zurück und übernahm persönlich die Herrschaft über den kleinen Laden und das Gemüse. Er fügte seinen Vorräten noch Milch und Sahne, Eier und Speck vom Lande zu, und während andere ehemalige Butler in Wirtshäusern Alkoholitäten ausschenkten, war er zufrieden beim Handel mit den einfachen Landerzeugnissen. Da er viele Bekannte unter den Butlern der Nachbarschaft hatte und er und Mrs. Raggles sie in ihrem hübschen Hinterzimmer bewirteten, so fanden Milch, Sahne und Eier bei vielen Kollegen Absatz, und seine Einkünfte wuchsen mit jedem Jahr. Ein Jahr nach dem anderen häufte er ruhig und bescheiden Geld an, und als schließlich die hübsche und vollständig eingerichtete Junggesellenbehausung in der Curzon Street Nr. 201 in Mayfair, zuletzt bewohnt von dem ehrenwerten Mr. Frederick Deuceace, der ins Ausland gegangen war, mit ihren reichen, prächtigen Möbeln bester Fabrikation unter den Hammer kam – wer anders ging hin und kaufte Mietvertrag und Einrichtung des Hauses als Charles Raggles? Zwar mußte er einen Teil des Geldes zu recht hohen Zinsen von einem anderen Butler borgen, den Hauptteil jedoch bezahlte er bar, und Mrs. Raggles schlief nicht wenig stolz zum ersten Male in einem geschnitzten Mahagonibett mit seidenen Vorhängen, einem riesigen Drehspiegel gegenüber und einer Garderobe, die sie und ihren Mann und die ganze Familie aufnehmen konnte.
Sie hatten natürlich nicht die Absicht, ein so prächtiges Haus auf die Dauer selbst zu bewohnen. Raggles hatte das Haus gekauft, um es wieder zu vermieten. Sobald sich ein Mieter fand, versank er wieder in seinem Gemüseladen; es war aber ein glückliches Gefühl für ihn, aus seiner Behausung herauszukommen und nach der Curzon Street zu wandern; dort konnte er sein Haus – sein eignes Haus – mit Geranien im Fenster und einem verzierten Bronzetürklopfer betrachten. Der Bediente, der mitunter am Vorplatzgitter herumlungerte, behandelte ihn mit Respekt; die Köchin kaufte das Gemüse bei ihm und nannte ihn Herr Wirt. Es gab nichts, was die Mieter taten, und kein Gericht, das auf ihren Tisch kam, worüber Raggles nicht unterrichtet war, wenn er es wollte.
Er war ein guter Mann, gut und glücklich. Das Haus brachte ihm ein so hübsches jährliches Einkommen, daß er sich entschloß, seine Kinder in gute Schulen zu schicken, und ungeachtet der Kosten kam Charles zu Doktor Swishtail ins Zuckerrohrstockhaus und die kleine Matilda zu Miss Peckover ins Laurentinumhaus in Clapham. Raggles liebte und betete die Familie Crawley als die Urheber all seines Lebensglücks an. Er hatte in seinem Hinterzimmer eine Silhouette seiner Herrin und eine Sepiazeichnung vom Portierhaus in Queen's Crawley, von der alten Jungfer selbst ausgeführt. Das einzige, was er der Einrichtung des Hauses in der Curzon Street hinzufügte, war ein Druck mit der Ansicht von Queen's Crawley in Hampshire, dem Landsitz von Sir Walpole, Baronet. Dieser fuhr in einer vergoldeten Kutsche mit sechs Schimmeln an einem See vorbei, auf dem Schwäne schwammen und eine Barke voller Damen in Reifröcken und Musikanten mit Perücken und Fähnchen. Raggles glaubte wirklich, es gäbe auf der ganzen Welt nur einen solchen Palast wie diesen und nur eine so erlauchte Familie.
Das Glück wollte es, daß Raggles' Haus in der Curzon Street zu vermieten war, als Rawdon und seine Frau nach London zurückkehrten. Der Oberst kannte das Gebäude und seinen Besitzer recht gut, da Raggles stets mit der Familie Crawley in Verbindung geblieben war. Wenn Miss Crawley Gäste hatte, half er Mr. Bowls. Der alte Mann vermietete dem Oberst nicht nur sein Haus, sondern trat auch als Butler auf, wenn er Gesellschaft hatte, während Mrs. Raggles in der Küche wirtschaftete und Speisen hinaufschickte, mit denen selbst Miss Crawley zufrieden gewesen wäre. Auf diese Weise bekam Crawley also das Haus umsonst. Raggles mußte zwar Steuern und die Hypothekenzinsen an den anderen Butler und die Lebensversicherung und das Schulgeld für seine Kinder und Essen und Trinken für seine eigene Familie und eine Zeitlang auch für Oberst Crawley bezahlen. Zwar wurde der arme Teufel durch das Geschäft völlig ruiniert, seine Kinder warf man auf die Straße und ihn selbst ins Schuldgefängnis, aber schließlich muß doch immer einer für die Herren bezahlen, die von nichts leben, und so kam es, daß der unglückliche Raggles zum Repräsentanten von Oberst Crawleys fehlendem Kapital wurde.
Ich möchte wissen, wie viele Familien durch große Meister von Crawleys Art zum Bankrott und Vagabundenleben getrieben werden – wie viele hohe Adlige ihre kleinen Kaufleute bestehlen, sich herablassen, ihre armen Diener um erbärmlich kleine Summen zu beschwindeln und um ein paar Shilling zu betrügen. Wenn wir lesen, daß ein edler Adliger nach dem Kontinent gegangen ist oder ein anderer edler Adliger in seinem Haus eine Versteigerung hat –und daß der eine oder andere sechs oder sieben Millionen Schulden hat, so erscheint uns selbst die Niederlage noch glorreich, und wir achten das Opfer in der Großartigkeit seines Ruins. Wer aber bemitleidet einen armen Friseur, der das Geld für das Pudern der Köpfe der Diener nicht erhält, oder einen armen Zimmermann, der sich ruiniert hat, als er in dem déjeuner der Lady Verzierungen anbrachte und Pavillons errichtete; oder den armen Teufel von Schneider, den der Verwalter begönnerte und der alles, was er besaß, und vielleicht noch mehr, verpfändet hat, um die Livreen anfertigen zu können, die bei ihm zu bestellen der Lord ihm die Ehre erwies? Wenn das große Haus einstürzt, so fallen alle diese armen Teufel unbemerkt mit. Es heißt ja in den alten Legenden, bevor ein Mensch zum Teufel geht, schickte er diesem erst einmal einen Haufen anderer Seelen.
Rawdon und seine Frau begünstigten großmütig all die von Miss Crawleys Geschäftsleuten, die ihnen dienen wollten. Einige, besonders die Armen, waren dazu bereit genug. Es war wunderbar, die Ausdauer zu beobachten, mit der die Waschfrau von Tooting Woche für Woche jeden Sonnabend mit dem Wäschekarren und der Rechnung kam. Mr. Raggles selbst hatte das Gemüse zu liefern. Die Rechnung für den Porter der Dienstboten im »Wirtshaus zum Kriegsglück« ist eine Kuriosität in den Annalen der Biergeschichte. Allen Dienstboten war man den größten Teil des Lohnes schuldig und erhielt somit zwangsläufig ein Interesse am Haus wach. Tatsächlich wurde niemand und nichts bezahlt, weder der Schlosser, der das Schloß öffnete, noch der Glaser, der eine neue Scheibe einsetzte, noch der Wagenverleiher, von dem man die Kutsche gemietet hatte, noch der Kutscher, der sie lenkte, noch der Fleischer, der die Hammelkeule lieferte, noch die Kohlen, mit denen sie gebraten wurde, noch die Köchin, die sie mit Fett begoß, noch die Dienstboten, die sie aßen. Das ist, wie man mir erzählte, nicht selten die Art, in der Leute elegant von nichts leben.
In einer kleinen Stadt können derartige Dinge nicht unbemerkt geschehen. Wir wissen dort, wieviel Milch unser Nachbar holt, und erspähen die Keule oder das Geflügel, das für sein Mittagessen ins Haus gebracht wird. So wußten wahrscheinlich die Curzon Street Nr. 200 und 202, was in dem Haus zwischen ihnen vorging, da die Dienstboten durch den Zaun miteinander verkehrten. Aber Crawley und seine Frau und auch seine Freunde wußten nichts von 200 und 202. Wenn man nach 201 kam, so gab es ein herzliches Willkommen, ein freundliches Lächeln, ein gutes Mittagessen und einen munteren Händedruck vom Gastgeber und seiner Frau, und es schien der Welt, als ob sie jährlich drei- bis viertausend hätten. Das hatten sie allerdings auch, zwar nicht an Geld, aber an Waren und Arbeit. Wenn sie den Hammelbraten auch nicht bezahlten, so hatten sie ihn doch – wenn sie kein Gold und Silber für ihren Wein ausgaben, wie sollten wir das wissen? Kein Mensch hatte besseren Rotwein auf der Tafel als der ehrliche Rawdon, keiner gab fröhlichere Diners, und nirgends wurde hübscher serviert. Seine Salons waren die nettesten, kleinsten, bescheidensten, die man sich denken kann. Rebekka hatte sie mit dem feinsten Geschmack und tausend Pariser Kleinigkeiten ausgestattet, und wenn sie am Klavier saß und fröhlichen Herzens ihre Lieder trällerte, so glaubte sich der Fremde in ein kleines Paradies häuslicher Behaglichkeit versetzt und gestand, daß zwar der Mann recht dumm sei, die Frau aber bezaubernd und die Diners die reizendsten von der Welt.
Rebekka kam durch ihren Witz, ihre Klugheit und ihre Schlagfertigkeit bei einer gewissen Klasse Londoner bald in Mode. Man sah an ihrer Tür ehrbare Kutschen, denen Menschen vornehmsten Ranges entstiegen. Man sah ihren Wagen im Park von berühmten Stutzern umringt. Ihre kleine Loge im dritten Rang der Oper war von ständig wechselnden Gesichtern bevölkert. Wir müssen allerdings gestehen, daß sich die Damen von ihr fernhielten und ihre Türen unserer kleinen Abenteuerin verschlossen blieben.
Über die vornehme Welt der Damen und ihre Sitten kann der Verfasser unserer Geschichte natürlich nur vom Hörensagen berichten. Ein Mann kann diese Geheimnisse ebensowenig durchschauen oder verstehen, wie er weiß, worüber sich die Damen unterhaken, wenn sie sich nach dem Essen in die oberen Gemächer zurückziehen. Nur durch mühsame, ausdauernde Nachforschungen kann man zuweilen eine Andeutung über diese Geheimnisse erhalten. Durch ebensolche Emsigkeit weiß jeder, der auf dem Pflaster der Pall Mall wandelt und die Londoner Klubs besucht, entweder aus eigener Erfahrung oder von einem Bekannten, mit dem er Billard spielt oder speist, etwas über die vornehme Londoner Welt. Er merkt, daß es Männer gibt (wie zum Beispiel Rawdon Crawley, dessen Lage wir schon beschrieben haben), die, weil sie mit den berühmtesten Stutzern im Park verkehren, in den Augen der unwissenden Welt und der Lehrlinge dort eine gute Figur machen. Ebenso gibt es aber auch Damen, die man als Typ der Männer bezeichnen könnte, da sie von allen Herren begrüßt und von ihren Ehefrauen geschnitten oder mit Geringschätzung betrachtet werden. Zu dieser Art gehört Mrs. Firebrace, die Dame mit den schönen blonden Locken, die man täglich, umringt von den größten und bekanntesten Stutzern des Königreiches, im Hyde Park sehen kann. Eine andere von ihnen ist Mrs. Rockwood, deren Gesellschaften ausführlich in allen Zeitungen der vornehmen Welt beschrieben werden und bei der eine Menge von Gesandten und hohen Adligen zu speisen pflegen. Die Reihe ließe sich noch beliebig erweitern, wenn es etwas mit unserer Geschichte zu tun hätte. Während nun aber einfache Menschen, die die Welt nicht kennen, oder Leute vom Lande mit einem Hang zum Vornehmen diese Damen an öffentlichen Orten in ihrer scheinbaren Glorie beobachten oder sie aus der Ferne beneiden, so könnten besser Unterrichtete ihnen klarmachen, daß die beneideten Damen ebenso geringe Aussichten auf eine Stellung in der »Gesellschaft« besitzen wie die unwissende kleine Gutsbesitzersfrau in Somersetshire, die in der »Morning Post« von ihrem Leben und Treiben liest. Die in London Lebenden kennen diese schrecklichen Wahrheiten. Man hört, wie unbarmherzig viele Damen von scheinbarem Rang und Reichtum von dieser »Gesellschaft« ausgeschlossen sind. Die verzweifelten Anstrengungen, mit denen sie in diesen Kreis zu gelangen suchen, die Demütigungen, denen sie sich aussetzen, die Beleidigungen, die sie einstecken, sind sehr verwunderlich für diejenigen, die sich das Studium der Menschen oder Frauen zur Aufgabe gemacht haben.