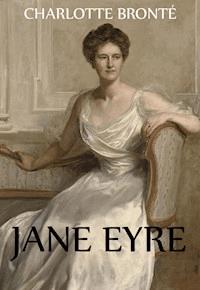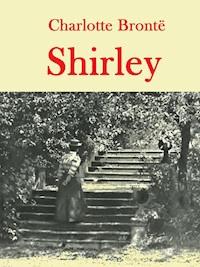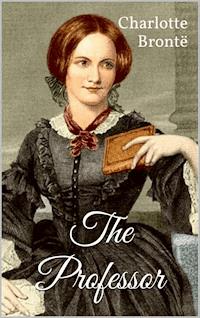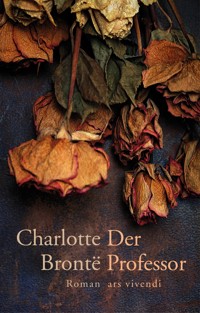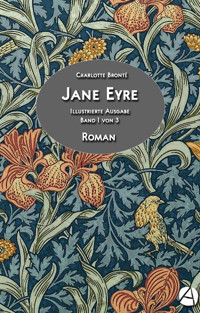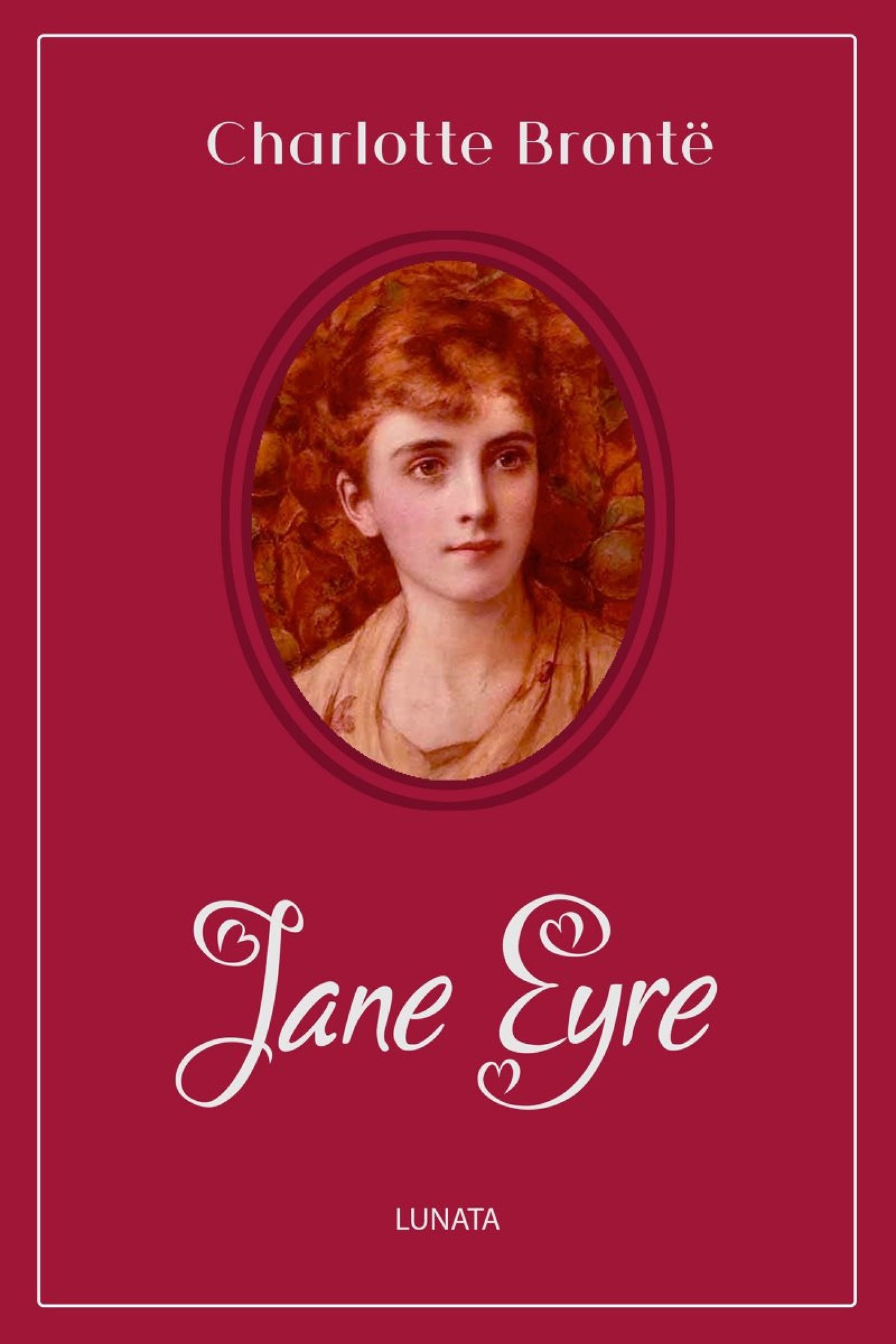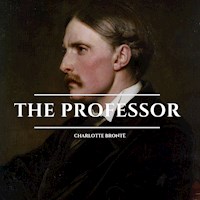0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: 99 Welt-Klassiker
- Sprache: Deutsch
Im Jahre 1847 veröffentlicht die damals 31-jährige Charlotte Brontë "Jane Eyre. Eine Autobiographie" (Im Original "Jane Eyre. An Autobiography"), den Klassiker der viktorianischen Romanliteratur des 19 Jahrhunderts. Erzählt wird die Lebensgeschichte von Jane Eyre, die nach einer schweren Kindheit eine Stelle als Gouvernante annimmt und sich in ihren Arbeitgeber verliebt, jedoch immer wieder um ihre Freiheit und Selbstbestimmung kämpfen muss. Noch in der Nacht vor der Hochzeit entdeckt Jane ein schreckliches Geheimnis: Im obersten Stockwerk des Hauses hält ihr zukünftiger Ehemann seine wahnsinnig gewordene Frau versteckt. "Jane Eyre" ist ein Roman der Leidenschaften und Gefühle, der lauernden Stimmungen und eines frisch erwachten Lebenshungers. Es war der erste Roman, der der weiblichen Erfahrung von Machtlosigkeit in dieser Form eine neue Stimme gab. Es war überhaupt das erste Buch aus der Perspektive einer jungen Frau. "Ich bin kein Vogel, und kein Netz und kein Vogelsteller vermag mich zu fangen. Ich bin ein freies, menschliches Wesen mit einem unabhängigen Willen, und jetzt mache ich denselben geltend, indem ich Sie verlasse.", sagt Jane Eyre zu dem Mann, den sie liebt. Der Romane wurde mehrmals für Theater, Film und Fernsehen bearbeitet. Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1035
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Charlotte Brontë
Jane Eyre
Eine Autobiografie
Charlotte Brontë
Jane Eyre
Eine Autobiografie
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2025Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Maria von Borch EV: Reclam, Leipzig, 1918 4. Auflage, ISBN 978-3-954180-19-6
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Autorin und Werk
Erster Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Zweiter Teil
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
99 Welt-Klassiker
Der Tee der drei alten Damen
Arme Leute und Der Doppelgänger
Der Vampir
Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde
Der Idiot
Jane Eyre
Effi Briest
Ilias & Odyssee
Geschichte des Gil Blas von Santillana
Die Erziehung des Herzens
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Autorin und Werk
Charlotte Brontë (✳ 21.04.1816 in Thornton, Yorkshire; † 31.03.1855 in Haworth, Yorkshire), ist die älteste der drei außergewöhnlichen Schriftsteller-Schwestern Emily Jane, Anne und Charlotte. Sie veröffentlichte ihre Romane unter dem Pseudonym Currer Bell.
Charlotte Brontë wird als drittes Kind des irischen Pfarrers Patrick Brontë und seiner Frau Maria, geb. Branwell, geboren. Gemeinsam mit ihren drei jüngeren Geschwistern Patrick Branwell, Emily Jane und Anne beginnt sie schon als Kind zu schreiben und verfasst zahlreiche winzige Heftchen und Fantasiegeschichten.
Die Kinder werden meist daheim unterrichtet und besuchen die Schule nur kurz.
1835 tritt Charlotte eine Stelle als Lehrerin an. 1842 besucht sie zusammen mit ihrer Schwester Emily das Brüsseler »Pensionnat de Demoiselles« in der Absicht dort ihr Französisch zu verbessern. Sie plant eine eigene Mädchenschule zu eröffnen, muss aber das Projekt wegen mangelnder Nachfrage aufgeben.
Zusammen mit ihren Schwestern gibt sie unter den (männlichen) Pseudonymen Ellis (Emily), Acton (Anne) und Currer (Charlotte) Bell einen Gedichtband heraus, der nicht sehr erfolgreich verkauft wird.
Auch Charlottes erster Roman »The Professor« über ihre eigene unerwiderte Liebe zu einem verheirateten Mann findet zu ihren Lebzeiten keinen Verleger.
1847 endlich ist das Jahr der 3 Schwestern. Jede bringt einen Roman heraus – und »die Bells« sind mit einem Mal bekannt. Während Kritik und Publikum Charlottes »Jane Eyre« feiern, reagiert man auf Emilys »Die Sturmhöhe« (»Wuthering Heights«) mit gemischten Gefühlen, zu gewagt und mysteriös wirkt diese Geschichte. Annes Roman »Agnes Grey« gilt zunächst nur als leichte und unterhaltsame Lektüre.
Man vermutet einen männlichen Urheber hinter »Jane Eyre« und ist sehr überrascht, als sich der Autor als Frau entpuppt. Charlotte wird in die literarischen Kreise Londons eingeführt und geniest eine kurze Zeit des Ruhms. Ihre Bücher erscheinen weiterhin unter Pseudonym.
1854 heiratet sie Arthur Bell Nicholls, den Hilfspfarrer ihres Vaters. Am Karsamstag 1855 stirbt sie – laut Totenschein an Tuberkulose – vermutlich jedoch an »Hyperemesis gravidarum« (schwangerschaftsbedingte Stoffwechselstörung).
Allen Geschwistern ist nur ein kurzes Leben beschert. Der Bruder Patrick Branwell, ein talentierter Maler und Dichter, stirbt vermutlich an den Folgen des Alkoholismus 1848 im Alter von 37 Jahren, Emily Jane stirbt ebenfalls 1848 mit 30 ebenso wie die Jüngste, Anne ein Jahr darauf, 1849, im Alter von 29 Jahren an den Folgen der Tuberkulose.
Charlotte Brontës letzter Roman »Emma« bleibt unvollendet und erscheint 1860 postum zusammen in einer Ausgabe ihres Erstlingswerk »The Professor«.
Erster Teil
Erstes Kapitel
Es war ganz unmöglich, an diesem Tage einen Spaziergang zu machen. Am Morgen waren wir allerdings während einer ganzen Stunde in den blätterlosen, jungen Anpflanzungen umhergewandert; aber seit dem Mittagessen – Mrs. Reed speiste stets zu früher Stunde, wenn keine Gäste zugegen waren – hatte der kalte Winterwind so düstere, schwere Wolken und einen so durchdringenden Regen heraufgeweht, dass von weiterer Bewegung in frischer Luft nicht mehr die Rede sein konnte.
Ich war von Herzen froh darüber: lange Spaziergänge, besonders an frostigen Nachmittagen, waren mir stets zuwider: – ein Greuel war es mir, in der rauen Dämmerstunde nach Hause zu kommen, mit fast erfrorenen Händen und Füßen, – mit einem Herzen, das durch das Schelten Bessie’s, der Kinderwärterin, bis zum Brechen schwer war, – gedemütigt durch das Bewusstsein, physisch so tief unter Eliza, John und Georgina Reed zu stehen.
Die soeben erwähnten Eliza, John und Georgina hatten sich in diesem Augenblick im Salon um ihre Mama versammelt: diese ruhte auf einem Sofa in der Nähe des Kamins und umgeben von ihren Lieblingen, die zufälligerweise in diesem Moment weder zankten noch schrien, sah sie vollkommen glücklich aus. Mich hatte sie davon dispensiert, mich der Gruppe anzuschließen, indem sie sagte, dass es sie tief unglücklich mache, gezwungen zu sein, mich fern zu halten; dass sie mich aber von Vorrechten ausschließen müsse, zu deren Genuss nur zufriedene, glückliche, kleine Kinder berechtigt seien, und dass sie mir erst verzeihen würde, wenn sie sowohl durch eigene Wahrnehmung wie durch Bessie’s Worte zu der Überzeugung gelangt sein würde, dass ich in allem Ernst versuche, mir anziehendere und freundlichere Manieren, einen kindlicheren, geselligeren Charakter – ein leichteres, offenherzigeres, natürlicheres Benehmen anzueignen.
»Was sagt denn Bessie, dass ich getan habe?« fragte ich.
»Jane, ich liebe weder Spitzfindigkeiten noch Fragen; außerdem ist es gradezu widerlich, wenn ein Kind ältere Leute in dieser Weise zur Rede stellt. Augenblicklich setzest du dich irgendwo hin und schweigst, bis du freundlicher und liebenswürdiger reden kannst.«
An das Wohnzimmer stieß ein kleines Frühstückszimmer: ich schlüpfte hinein. Hier stand ein großer Bücherschrank. Bald hatte ich mich eines großen Bandes bemächtigt, nachdem ich mich zuerst vorsichtig vergewissert hatte, dass er Bilder enthalte. Ich stieg auf den Sitz in der Fenstervertiefung, zog die Füße nach und kreuzte die Beine wie ein Türke; dann zog ich die dunkelroten Moiree-Vorhänge fest zusammen und saß so in einem doppelten Versteck.
Scharlachrote Draperien schlossen mir die Aussicht zur rechten Hand; links befanden sich die großen, klaren Fensterscheiben, die mich vor dem düstern Novembertag wohl schützten, mich aber nicht von ihm trennten. In kurzen Zwischenräumen, wenn ich die Blätter meines Buches wendete, fiel mein Blick auf das Bild dieses winterlichen Nachmittags. In der Ferne war nichts als ein blasser, leerer Nebel, Wolken; im Vordergrunde der feuchte, freie Platz vor dem Hause, vom Winde entlaubte Gesträuche, und ein unaufhörlicher vom Sturm wildgepeitschter Regen.
Ich kehrte zu meinem Buche zurück – Bewicks Geschichte von Englands gefiederten Bewohnern; im Allgemeinen kümmerte ich mich wenig um den gedruckten Text des Werkes, und doch waren da einige einleitende Seiten, welche ich, obgleich nur ein Kind, nicht gänzlich übergehen konnte. Es waren jene, die von den Verstecken der Seevögel handelten, von jenen einsamen Felsen und Klippen, welche nur sie allein bewohnen, von der Küste Norwegens, die von ihrer äußersten südlichen Spitze, dem Lindesnäs bis zum Nordkap mit Inseln besäet ist.
Wo der nördliche Ozean, in wildem Wirbel Um die nackten, öden Inseln tobt Des ultima Thule; und das atlantische Meer Sich stürmisch zwischen die Hebriden wälzt.
Auch konnte ich nicht unbeachtet lassen, was dort stand von den düsteren Küsten Lapplands, Sibiriens, Spitzbergens, Novazemblas, Islands, Grönlands, mit dem weiten Bereich der arktischen Zone und jenen einsamen Regionen des öden Raums – jenem Reservoir von Eis und Schnee, wo fest gefrorene Felder – die Anhäufung von Jahrhunderten von Wintern – alpine Höhen auf Höhen erfroren, den Nordpol umgeben und die vervielfachte Strenge der äußersten Kälte konzentrieren. Von diesen todesweißen Regionen machte ich mir meinen eigenen Begriff: schattenhaft, wie all jene nur halb verstandenen Gedanken, die eines Kindes Hirn kreuzen, aber einen seltsam tiefen Eindruck hinterlassend. Die Worte dieser einleitenden Seiten verbanden sich mit den darauf folgenden Vignetten und gaben allen eine Bedeutung: jenem Felsen, der aus einem Meer von Wellen und Wogenschaum emporragte; dem zertrümmerten Boote, das an traurig wüster Küste gestrandet; dem kalten, geisterhaften Monde, der durch düstere Wolkenmassen auf ein sinkendes Wrack herabblickt.
Ich weiß nicht mehr, mit welchem Empfinden ich auf den stillen, einsamen Friedhof mit seinem beschriebenen Leichenstein sah, auf jenes Tor, die beiden Bäume, den niedrigen Horizont, der durch eine zerfallene Mauer begrenzt war, auf die schmale Mondessichel, deren Aufgang die Stunde der Abendflut bezeichnete.
Die beiden Schiffe, welche auf regungsloser See von einer Windstille befallen werden, hielt ich für Meergespenster.
Über den Unhold, welcher das Bündel des Diebes auf dessen Rücken fest band, eilte ich flüchtig hinweg; er war ein Gegenstand des Schreckens für mich.
Und ein gleiches Entsetzen flößte mir das schwarze, gehörnte Etwas ein, das hoch auf einem Felsen saß und in weiter Ferne eine Menschenmasse beobachtete, die einen Galgen umgab.
Jedes Bild erzählte eine Geschichte: oft war diese für meinen unentwickelten Verstand geheimnisvoll, meinem unbestimmten Empfinden unverständlich, – stets aber flößte sie mir das tiefste Interesse ein: dasselbe Interesse, mit welchem ich den Erzählungen Bessie’s horchte, wenn sie zuweilen an Winterabenden in guter Laune war; dann pflegte sie ihren Plätttisch an das Kaminfeuer der Kinderstube zu bringen, erlaubte uns, unsere Stühle an denselben zu rücken, und während sie dann Mrs. Reeds Spitzenvolants bügelte und die Spitzen ihrer Nachthauben kräuselte, ergötzte sie unsere Ohren mit Erzählungen von Liebesgram und Abenteuern aus alten Märchen und noch älteren Balladen, oder – wie ich erst viel später entdeckte – aus den Blättern von Pamela, und Henry, Graf von Moreland.
Mit Bewick auf meinen Knien war ich damals glücklich: glücklich wenigstens auf meine Art. Ich fürchtete nichts als eine Unterbrechung, eine Störung – und diese kam nur zu bald. Die Tür zum Frühstückszimmer wurde geöffnet.
»Bah, Frau Träumerin!« ertönte John Reeds Stimme; dann hielt er inne; augenscheinlich war er erstaunt, das Zimmer leer zu finden.
»Wo zum Teufel ist sie denn?« fuhr er fort, »Lizzy! Georgy!« rief er seinen Schwestern zu, »Joan ist nicht hier. Sagt doch Mama, dass sie in den Regen hinaus gelaufen ist – das böse Tier!«
»Wie gut, dass ich den Vorhang zusammengezogen habe«, dachte ich; und dann wünschte ich inbrünstig, dass er mein Versteck nicht entdecken möge; John Reed selbst würde es auch niemals entdeckt haben; er war langsam, sowohl von Begriffen wie in seinem Wahrnehmungsvermögen; aber Eliza steckte den Kopf zur Tür hinein und sagte sofort:
»Sie ist gewiss wieder in die Fenstervertiefung gekrochen, sieh nur nach, Jack.«
Ich trat sofort heraus, denn ich zitterte bei dem Gedanken, dass der erwähnte Jack mich hervorzerren würde.
»Da bin ich, was wünscht Ihr?« fragte ich mit schlecht erheuchelter Gleichgültigkeit.
»Sag: was wünschen Sie, Mr. Reed«, lautete seine Antwort. »Ich will, dass du hierher kommst«, und indem er in einem Lehnstuhl Platz nahm, gab er mir durch eine Geste zu verstehen, dass ich näher kommen und vor ihn treten solle.
John Reed war ein Schuljunge von vierzehn Jahren; vier Jahre älter als ich, denn ich war erst zehn Jahr alt; groß und stark für sein Alter, mit einer unreinen, ungesunden Hautfarbe; große Züge in einem breiten Gesicht, schwerfällige Gliedmaßen und große Hände und Füße. Gewöhnlich pflegte er sich bei Tische so vollzupfropfen, dass er gallig wurde; das machte seine Augen trübe und seine Wangen schlaff. Eigentlich hätte er jetzt in der Schule sein müssen, aber seine Mama hatte ihn für ein bis zwei Monate nach Hause geholt »seiner zarten Gesundheit wegen«. Mr. Miles, der Direktor der Schule versicherte, dass es ihm außerordentlich gut gehen würde, wenn man ihm nur weniger Kuchen und Leckerbissen von Hause schicken wollte; aber das Herz der Mutter empörte sich bei einer so roh ausgesprochenen Meinung und neigte mehr zu der feineren und zarteren Ansicht, dass Johns blassgelbe Farbe von Überanstrengung beim Lernen und vielleicht auch von Heimweh herrühre. –
John hegte wenig Liebe für seine Mutter und seine Schwestern, und eine starke Antipathie gegen mich. Er quälte und bestrafte mich; nicht zwei- oder dreimal in der Woche, nicht ein- oder zweimal am Tage, sondern fortwährend und unaufhörlich; jeder Nerv in mir fürchtete ihn, und jeder Zollbreit Fleisch auf meinen Knochen schauderte und zuckte, wenn er in meine Nähe kam. Es gab Augenblicke, wo der Schrecken, den er mir einflößte, mich ganz besinnungslos machte; denn ich hatte niemanden, der mich gegen seine Drohungen und seine Tätlichkeiten verteidigte; die Dienerschaft wagte es nicht, ihren jungen Herren zu beleidigen, indem sie für mich gegen ihn Partei ergriff, und Mrs. Reed war in diesem Punkte blind und taub: sie sah niemals, wenn er mich schlug, sie hörte niemals, wenn er mich beschimpfte, obgleich er beides gar oft in ihrer Gegenwart tat: häufiger zwar noch hinter ihrem Rücken.
Aus Gewohnheit gehorchte ich John auch dieses Mal und näherte mich seinem Stuhl: ungefähr zwei bis drei Minuten brachte er damit zu, mir seine Zunge so weit entgegenzustrecken, wie er es ohne Gefahr für seine Zungenbänder bewerkstelligen konnte; ich fühlte, dass er mich jetzt gleich schlagen würde, und obgleich ich eine tödliche Angst vor dem Schlage empfand, vermochte ich doch über die ekelerregende und hässliche Erscheinung des Burschen, der denselben austeilen würde, meine Betrachtungen anzustellen. Ich weiß nicht, ob er diese Gedanken auf meinem Gesichte las, denn plötzlich, ohne ein Wort zu sagen, schlug er heftig und brutal auf mich los. Ich taumelte; dann gewann ich das Gleichgewicht wieder und trat einige Schritte von seinem Stuhl zurück.
»Das ist für die Frechheit, dass du vor einer Weile gewagt hast, Mama eine Antwort zu geben«, sagte er, »und dass du gewagt hast, dich hinter den Vorhang zu verkriechen, und für den Blick, den ich vor zwei Minuten in deinen Augen gewahrte, du Ratze, du!«
An Johns Beschimpfungen gewöhnt, fiel es mir niemals ein, irgend etwas auf dieselben zu erwidern; ich dachte nur daran, wie ich den Schlag ertragen sollte, der unfehlbar auf die Schimpfworte folgen würde.
»Was hast du da hinter dem Vorhange gemacht?« fragte er weiter.
»Ich habe gelesen.«
»Zeige mir das Buch.«
Ich ging an das Fenster zurück und holte es von dort.
»Du hast kein Recht, unsere Bücher zu nehmen; du bist eine Untergebene, hat Mama gesagt; du hast kein Geld; dein Vater hat dir keins hinterlassen; eigentlich solltest du betteln und hier nicht mit den Kindern eines Gentleman, wie wir es sind, zusammen leben, und dieselben Mahlzeiten essen wie wir, und Kleider tragen, die unsere Mama dir kaufen muss. Nun, ich werde dich lehren, zwischen meinen Büchern umherzustöbern, denn sie gehören mir, und das ganze Haus gehört mir, oder wird mir wenigstens in einigen Jahren gehören. Geh und stell dich an die Tür; nicht vor den Spiegel oder die Fenster.«
Ich tat, wie mir geheißen, ohne eine Ahnung von seiner Absicht zu haben; als ich aber gewahrte, dass er das Buch emporhob und mit demselben zielte, sprang ich instinktiv zur Seite und stieß einen Schreckensschrei aus; jedoch nicht schnell genug; das Buch wurde geschleudert, es traf mich, und ich fiel, indem ich mit dem Kopf gegen die Tür schlug und mich verletzte. Die Wunde blutete, der Schmerz war heftig; mein Entsetzen war über den Höhepunkt hinausgegangen; andere Empfindungen bemächtigten sich meiner.
»Du böser, grausamer Bube!« schrie ich. »Du bist wie ein Mörder – du bist wie ein Sklaventreiber – du bist wie die römischen Kaiser!«
Ich hatte Goldsmiths Geschichte Roms gelesen und mir meine eigene Ansicht über Nero, Caligula und andere gebildet. Im Stillen hatte ich Vergleiche gezogen, welche laut zu äußern allerdings niemals meine Absicht gewesen.
»Was! Was!« schrie er. »Hat sie das zu mir gesagt? Habt ihr es gehört, Eliza und Georgina? Das will ich der Mama erzählen! – Aber erst noch …«
Er stürzte auf mich zu: ich fühlte, wie er mein Haar und meine Schulter fasste; er kämpfte mit einem verzweifelten Geschöpfe. Ich sah wirklich in ihm einen Tyrannen, – einen Mörder. Dann fühlte ich, wie einzelne Blutstropfen von meinem Kopfe auf den Hals herabfielen, und empfand einen stechenden Schmerz: diese Empfindungen siegten für den Augenblick über die Furcht und ich trat ihm in wahnsinniger Wut entgegen. Was ich mit meinen Händen tat, kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber er schrie fortwährend »Ratze! Ratze!« und brüllte aus Leibeskräften. Hilfe war ihm nahe: Eliza und Georgina waren gelaufen, um Mrs. Reed zu holen, die nach oben gegangen war. Jetzt erschien sie auf der Szene, und ihr folgten Bessie und ihre Kammerjungfer Abbot. Man trennte uns: dann vernahm ich die Worte:
»Du liebe Zeit! Du liebe Zeit! Welch eine Furie, so auf Mr. John loszustürzen!«
»Hat man jemals ein so leidenschaftliches Geschöpf gesehen!« –
Dann fügte Mrs. Reed hinzu:
»Führt sie in das rote Zimmer und schließt sie dort ein.« Vier Hände bemächtigten sich meiner sofort und man trug mich nach oben.
Zweites Kapitel
Auf dem ganzen Wege leistete ich Widerstand; dies war etwas Neues und ein Umstand, der viel dazu beitrug, Bessie und Miss Abbot in der schlechten Meinung zu bestärken, welche diese ohnehin schon von mir hegten. Tatsache ist, dass ich vollständig außer mir war, wie die Franzosen zu sagen pflegen; ich wusste sehr wohl, dass die Empörung dieses einen Augenblicks mir schon außergewöhnliche Strafen zugezogen haben musste, und wie viele andere rebellische Sklaven war ich in meiner Verzweiflung fest entschlossen, bis ans Äußerste zu gehen.
»Halten Sie ihre Arme, Miss Abbot; sie ist wie eine wilde Katze.«
»Schämen Sie sich! Schämen Sie sich!« rief die Kammerjungfer. »Welch ein abscheuliches Betragen, Miss Eyre, einen jungen Gentleman zu schlagen! Den Sohn Ihrer Wohltäterin! Ihren jungen Herrn!«
»Herr! Wie ist er mein Herr? Bin ich denn eine Dienerin?«
»Nein. Sie sind weniger als eine Dienerin, denn Sie tun nichts, Sie arbeiten nicht für Ihren Unterhalt. Da! Setzen Sie sich und denken Sie über Ihre Schlechtigkeit und Bosheit nach!«
Inzwischen hatten sie mich in das von Mrs. Reed bezeichnete Gemach gebracht und mich auf einen Stuhl geworfen; mein erster Impuls war, wie eine Sprungfeder wieder von demselben empor zu schnellen; vier Hände hielten mich jedoch augenblicklich wieder wie mit eisernen Klammern.
»Wenn Sie nicht still sitzen, werden wir Sie festbinden«, sagte Bessie. »Miss Abbot, borgen Sie mir Ihre Strumpfbänder; die meinen würde sie augenblicklich zerreißen.«
Miss Abbot wandte sich ab, um ein starkes Bein von den notwendigen Banden zu befreien. Diese Vorbereitungen, um mir Fesseln anzulegen, und die neue Schande, die dies für mich bedeutete, diente dazu, meine Aufregung ein wenig zu mindern.
»Nehmen Sie sie nicht ab«, schrie ich, »ich werde ganz still sitzen.«
Um ihnen für dies Versprechen eine Garantie zu bieten, hielt ich mich mit beiden Händen an meinem Sitz fest.
»Das möchte ich Ihnen auch raten«, sagte Bessie; und als sie sich überzeugt hatte, dass ich wirklich anfing, mich zu beruhigen, ließ sie mich los; dann stellten sie und Miss Abbot sich mit gekreuzten Armen vor mich und blickten finster und zweifelnd in mein Gesicht, als glaubten sie nicht an meinen gesunden Verstand.
»Das hat sie bis jetzt noch niemals getan«, sagte endlich Bessie zu Abigail gewendet.
»Aber es hat schon lange in ihr gesteckt«, lautete die Antwort. »Ich habe der gnädigen Frau schon oft meine Meinung über das Kind gesagt, und sie hat mir auch beigestimmt. Sie ist ein verstecktes, kleines Ding: ich habe noch nie ein Mädchen in ihrem Alter gesehen, das so schlau wäre.«
Bessie antwortete nicht; nach einer Weile wandte sie sich zu mir und sagte:
»Fräulein, Sie sollten doch wissen, dass Sie Mrs. Reed verpflichtet sind, sie erhält Sie. Wenn sie Sie fortschickte, so müssten Sie ins Armenhaus gehen.«
Auf diese Worte fand ich nichts zu erwidern; sie waren mir nicht mehr neu; so weit ich in meinem Leben zurückdenken konnte, hatte ich Winke desselben Inhalts gehört. Dieser Vorwurf meiner Abhängigkeit war in meinen Ohren fast zum leeren, bedeutungslosen Singsang geworden, sehr schmerzlich und bedrückend, aber nur halb verständlich. Nun fiel auch Miss Abbot ein:
»Und Sie sollten auch nicht denken, dass Sie mit den Fräulein Reed und Mr. Reed auf gleicher Stufe stehen, weil Mrs. Reed Ihnen gütig erlaubt, mit ihren Kindern erzogen zu werden. Diese werden einmal ein großes Vermögen haben, und Sie sind arm. Sie müssen demütig und bescheiden sein und versuchen, sich den anderen angenehm zu machen.«
»Was wir Ihnen sagen, ist zu Ihrem Besten«, fügte Bessie hinzu, ohne in hartem Ton zu reden, »Sie sollten versuchen, sich nützlich und angenehm zu machen, dann würden Sie hier vielleicht eine Heimat finden; wenn Sie aber heftig und roh und ungezogen werden, so wird Mrs. Reed Sie fortschicken, davon bin ich fest überzeugt.«
»Außerdem«, sagte Miss Abbot, »wird Gott Sie strafen. Er könnte Sie mitten in Ihrem Trotz tot zu Boden fallen lassen, und wohin kämen Sie dann? Kommen Sie, Bessie, wir wollen sie allein lassen: um keinen Preis der Welt möchte ich ihr Herz haben. Sagen Sie Ihr Gebet, Miss Eyre, wenn Sie allein sind; denn wenn Sie nicht bereuen, könnte etwas Schreckliches durch den Kamin herunterkommen und Sie holen.«
Sie gingen und schlossen die Tür hinter sich ab.
Das rote Zimmer war ein Fremdenzimmer, in dem nur selten jemand schlief; ich könnte beinahe sagen niemals oder nur dann, wenn ein zufälliger Zusammenfluss von Besuchern auf Gateshead-Hall es notwendig machte, alle Räumlichkeiten des Hauses nutzbar zu machen. Und doch war es eins der schönsten und prächtigsten Gemächer im Herrenhause. Wie ein Tabernakel stand im Mittelpunkt desselben ein Bett von massiven Mahagonipfeilern getragen und mit Vorhängen von dunkelrotem Damast behängt; die beiden großen Fenster, deren Rouleaux immer herabgelassen waren, wurden durch Gehänge und Faltendraperien vom selben Stoffe halb verhüllt; der Teppich war rot; der Tisch am Fußende des Bettes war mit einer hochroten Decke belegt; die Wände waren mit einem Stoffe behängt, der auf lichtbraunem Grunde ein zartes rosa Muster trug; die Garderobe, der Toilettetisch, die Stühle waren aus dunklem, poliertem Mahagoni angefertigt. Aus diesen düsteren Schatten erhoben sich weiß und hoch und glänzend die aufgehäuften Matratzen und Kopfkissen des Bettes, über die eine schneeweiße Decke gebreitet war. Eben so unheimlich stach ein großer, gepolsterter, ebenfalls weißer Lehnstuhl hervor, der am Kopfende des Bettes stand und vor dem sich ein Fußschemel befand; damals erschien er mir wie ein geisterhafter Thron.
Das Zimmer war dumpf, weil nur selten ein Feuer in demselben angezündet wurde; es war still, weil es weit von der Kinderstube und den Küchen entfernt lag; unheimlich, weil ich wusste, dass fast niemals jemand dasselbe betrat. Nur am Sonnabend kam das Hausmädchen hierher, um den stillen Staub einer Woche von den Möbeln und den Spiegeln zu wischen; und in langen Zwischenräumen kam auch Mrs. Reed hierher, um den Inhalt einer gewissen Schieblade zu revidieren, in welcher sich verschiedene Urkunden, ihre Juwelenschatulle und ein Miniaturbild ihres verstorbenen Gatten befand. In diesen letzten Worten liegt das Geheimnis des roten Zimmers, der Zauberbann, weshalb es trotz seiner Pracht so einsam und verlassen war.
Mr. Reed war seit neun Jahren tot; in diesem Gemache hatte er seinen letzten Atemzug getan; hier lag er aufgebahrt; von hier hatten die Leichenträger ihn hinausgetragen – und seit jenem Tage hatte ein Gefühl trauriger Weihe jeden unberufenen Besucher von seiner Schwelle fern gehalten.
Der Sitz, auf welchen Bessie und die bitterböse Miss Abbot mich gebannt hatten, war eine niedrige Ottomane, welche nahe dem weißen Marmorkamin stand; das Bett türmte sich vor mir auf; zu meiner Rechten befand sich ein hoher dunkler Garderobenschrank, auf dessen Tafelwerk sich die leisen, düsteren Lichter brachen; zu meiner Linken waren die verhängten Fenster; ein großer Spiegel zwischen denselben wiederholte die totesstille Majestät des Bettes und des Zimmers. Ich war nicht ganz sicher, ob sie die Tür zugeschlossen hatten; und als ich wieder Mut genug hatte, um mich zu bewegen, stand ich auf und ging um nachzusehen. Ach ja! Keine Kerkertür war jemals sicherer verschlossen! Als ich wieder an die Ottomane zurückging, musste ich an dem Spiegel vorüber, mein gebannter Blick bohrte sich unwillkürlich in die Tiefe desselben ein. In ihm sah alles noch kühler und hohler und düsterer aus als in Wirklichkeit, und die seltsame, kleine Gestalt, die mir aus ihm entgegenblickte, mit weißem Gesicht und Armen, die grell aus der Dunkelheit hervorleuchteten, mit Augen, die vor Furcht hin- und herrollten, wo sonst alles bewegungslos war – diese kleine Gestalt sah aus, wie ein wirkliches Gespenst; ich dachte an eins jener zarten Phantome, halb Elfe, halb Kobold, wie sie in Bessies Dämmerstunden-Geschichten aus einsamen, wilden Schluchten und düsteren Mooren hervorkamen und sich dem Auge des nächtlichen Wanderers zeigten. Ich kehrte auf meinen Sitz zurück.
In diesem Augenblick bemächtigte der Aberglaube sich meiner, aber die Stunde seines vollständigen Sieges über mich war noch nicht gekommen: mein Blut war noch warm; die Wut des empörten Sklaven erhitzte mich noch mit ihrer ganzen Bitterkeit; ich hatte noch einen wilden Strom von Gedanken an die Vergangenheit zu bändigen, bevor ich mich ganz dem Jammer über die trostlose Gegenwart hingeben konnte.
Wie der schmutzige Bodensatz aus einem trüben Brunnen, so stieg aus meinem bewegten, aufgeregtem Gemüt alles an die Oberfläche meines Empfindens: John Reeds wilde Tyrannei, die hochmütige Gleichgültigkeit seiner Schwestern, die Abneigung seiner Mutter, die Parteilichkeit der Dienstboten! Weshalb musste ich stets leiden, stets mit verächtlichen Blicken angesehen werden, immer beschuldigt, immer verurteilt werden? Weshalb konnte ich niemals etwas recht machen? Weshalb war es immer nutzlos, wenn ich versuchte, irgend eines Menschen Gunst zu erringen? Man hatte Achtung vor Eliza, die doch so eigensinnig und selbstsüchtig war. Jedermann hatte Nachsicht mit Georgina, die stets übelgelaunt und trotzig und frech war. Ihre Schönheit, ihre rosigen Wangen und goldigen Locken schienen jeden zu entzücken, der sie anblickte und ihr Vergebung für all ihre Mängel und Fehler zu erkaufen. John wurde niemals bestraft, niemand widersprach ihm jemals, obgleich er den Tauben die Hälse umdrehte, die jungen Hühner umbrachte, die Hunde auf die Schafe hetzte, den Weinstock im Treibhause seiner Trauben beraubte und von den seltensten Pflanzen die Knospen abriss; er nannte seine Mutter sogar »liebe Alte«; nahm durchaus keine Rücksicht auf ihre Wünsche; zerriss und beschmutzte ihre seidenen Kleider nicht selten, – und doch war er »ihr einziger Liebling«. Ich wagte niemals, einen Fehler zu begehen; ich bemühte mich stets, meine Pflicht zu tun, und mich nannte man unartig und unerträglich, mürrisch und hinterlistig, vom Morgen bis zum Mittag, vom Mittag bis zum Abend.
Mein Kopf schmerzte noch und blutete nach dem erhaltenen Schlage und dem Falle, welchen ich getan; niemand hatte John einen Verweis erteilt, weil er mich grundlos geschlagen; aber weil ich mich gegen ihn aufgelehnt hatte, um seiner weiteren unvernünftigen, besinnungslosen Heftigkeit zu entgehen, hatten alle mich mit den lautesten Schmähungen überhäuft.
»Ungerecht! – ungerecht!« sagte meine Vernunft, welcher die fortwährende, qualvolle Aufreizung eine frühzeitige, wenn auch vorübergehende Kraft verliehen hatte; und die Entschlossenheit, welche auch geweckt war, ließ mich allerhand Mittel ersinnen, um eine Flucht aus diesem schier unerträglich gewordenen Drucke zu bewerkstelligen – ich dachte daran, auf und davon zu laufen, oder wenn dies nicht möglich, wenigstens niemals wieder Speise und Trank zu mir zu nehmen und auf diese Weise zu Tode zu hungern.
Wie bestürzt war meine Seele an diesem traurigen Nachmittag! Wie erregt war mein Gemüt, wie furchtbar empört mein Herz! Aber in welcher Düsterheit, welcher Verblendung, welcher unglaublichen Unwissenheit wurde dieser Seelenkampf ausgekämpft! Ich hatte keine Antwort auf die sich mir unaufhörlich aufdrängende Frage, weshalb ich so viel leiden musste. Jetzt nach Verlauf von – nein, ich will nicht sagen, von wie vielen Jahren – habe ich die Antwort gefunden!
Ich war ein Misston in Gateshead-Hall. Ich war ein Nichts an diesem Orte; ich hatte keine Gemeinschaft mit Mrs. Reed oder ihren Kindern oder ihren bezahlten Vasallen. Sie liebten mich nicht, und in der Tat, ich liebte sie ebensowenig. Es war auch nicht ihre Pflicht, mit Liebe auf ein Geschöpf zu blicken, welches mit keiner einzigen Seele sympathisieren konnte; ein heterogenes Geschöpf, welches ihr direktes Gegenteil in Temperament, in Fähigkeiten und Neigungen war; ein nutzloses Geschöpf, welches ihrem Interesse nicht dienen, zu ihrem Vergnügen nichts beitragen konnte; ein strafbares Geschöpf, welches die Keime der Empörung über die ihm widerfahrende Behandlung in sich nährte, ein Geschöpf, das die tiefste Verachtung für ihren Verstand, ihr Urteilsvermögen nährte. Ich weiß wohl, dass, wenn ich ein sanguinisches, geistreiches, herrisches, schönes, wildes Kind gewesen wäre – wenn auch ebenso abhängig und freundlos – so würde Mrs. Reed meine Gegenwart in liebenswürdigerer Weise ertragen haben; ihre Kinder hätten für mich ein freundlicheres Gefühl der Gemeinsamkeit gehegt; die Dienstboten wären weniger geneigt gewesen, mich zum Sündenbock der Kinderstube zu machen.
Das Tageslicht begann aus dem roten Zimmer zu schwinden; es war nach vier Uhr, und auf den bewölkten Nachmittag folgte die trübe Dämmerung. Ich hörte, wie der Regen noch unaufhörlich gegen das Fenster der Treppe schlug, wie der Wind in den Laubgängen hinter dem Herrenhause heulte; nach und nach wurde ich so kalt wie Marmor, und dann begann mein Mut zu sinken. Die gewöhnliche Stimmung des Gedemütigtseins, Zweifel an mir selbst, hilflose Traurigkeit bemächtigten sich meiner und fielen dämpfend auf die Asche meiner dahinschwindenden Wut. Alle sagten ja, dass ich boshaft sei – vielleicht war es der Fall, denn hatte ich nicht soeben den Gedanken gehegt, mich zu Tode zu hungern? Das war doch gewiss ein Verbrechen: denn war ich bereit zu sterben? oder war das Gewölbe unter der Kanzel in der Kirche von Gateshead ein so einladendes Ende? In diesem Gewölbe lag Mr. Reed begraben, wie man mir gesagt hatte; dieser Gedanke führte mich dazu, sein Andenken herauf zu beschwören; und mit wachsendem Grauen verweilte ich bei demselben. Ich konnte mich seiner nicht erinnern; aber ich wusste, dass er mein Onkel gewesen, – der einzige Bruder meiner Mutter – dass er mich in sein Haus aufgenommen, als ich ein armes, elternloses Kind gewesen; und dass er noch in seinen letzten Augenblicken Mrs. Reed das Versprechen abgenommen hatte, mich wie ihr eigenes Kind zu erziehen und zu versorgen. Mrs. Reed war höchstwahrscheinlich der Überzeugung, dass sie dieses Versprechen gehalten habe, und so weit ihre Natur ihr dies erlaubte, hatte sie es auch getan; aber wie sollte sie denn auch in Wirklichkeit für einen Eindringling Liebe hegen, der nicht zu ihrer Familie gehörte und nach dem Tode ihres Gatten durch keine Bande mehr an sie gekettet war? Es musste allerdings ärgerlich sein, sich durch ein unter solchen Umständen gegebenes Versprechen genötigt zu sehen, einem fremden Kinde, das sie nicht lieben konnte, die Eltern zu ersetzen, und es ertragen zu müssen, dass eine unsympathische Fremde sich unaufhörlich in ihren Familienkreis drängte.
Eine sonderbare Idee bemächtigte sich meiner. Ich zweifelte nicht – hatte es niemals bezweifelt – dass Mr. Reed, wenn er am Leben geblieben, mich mit Güte behandelt haben würde; und jetzt, als ich so dasaß und auf die dunklen Wände und das weiße Bett blickte, zuweilen auch wie gebannt ein Auge auf den trübe blinkenden Spiegel warf – da begann ich mich an das zu erinnern, was ich von Toten gehört hatte, die im Grabe keine Ruhe finden konnten, weil man ihre letzten Wünsche unerfüllt gelassen, und jetzt auf die Erde zurückkehrten, um die Meineidigen zu strafen und die Bedrückten zu rächen; ich dachte, wie Mr. Reeds Geist, gequält durch das Unrecht, welches man dem Kinde seiner Schwester zufügte, seine Ruhestätte verließ – entweder in dem Gewölbe der Kirche oder in dem unbekannten Lande der Abgeschiedenen – und in diesem Zimmer vor mir erscheinen könne. Ich trocknete meine Tränen und unterdrückte mein Schluchzen; denn ich fürchtete, dass diese lauten Äußerungen meines Grams eine übernatürliche Stimme zu meinem Troste erwecken oder aus dem mich umgebenden Dunkel ein Antlitz mit einem Heiligenschein hervorleuchten lassen könne, das sich mit wundersamem Mitleid über mich beugte. Dieser Gedanke, der in der Theorie vielleicht ganz trostreich, würde entsetzlich sein, wenn er zur Wirklichkeit werden könnte, das fühlte ich: mit aller Gewalt versuchte ich, ihn zu unterdrücken – ich bemühte mich, ruhig und gefasst zu sein. Indem ich mir das Haar von Stirn und Augen strich, erhob ich den Kopf und versuchte in dem dunklen Zimmer umher zu blicken: in diesem Augenblick sah ich den Wiederschein eines Lichtes an der Wand! – War es vielleicht der Mondesstrahl, der durch eine Öffnung in dem Vorhang drang, fragte ich mich? Nein, die Mondesstrahlen waren ruhig und dies Licht bewegte sich; während ich noch hinblickte, glitt es zur Decke hinauf und erzitterte über meinem Kopfe. Jetzt kann ich freilich begreifen, dass dieser Lichtstreifen aller Wahrscheinlichkeit nach der Schimmer einer Laterne war, welche jemand über den freien Platz vor dem Hause trug; aber damals, mit dem auf Schrecken und Entsetzen vorbereiteten Gemüt, mit meinen vor Aufregung bebenden Nerven, hielt ich den sich schnell bewegenden Strahl für den Herold einer Erscheinung, die aus einer anderen Welt zu mir kam. Mein Herz pochte laut, mein Kopf wurde heiß; in meinen Ohren spürte ich ein Brausen, das ich für das Rauschen der Flügel hielt; ein Etwas schien sich mir zu nähern; ich fühlte mich bedrückt, erstickt; mein Widerstandsvermögen gab nach; ich stürzte auf die Tür zu und rüttelte mit verzweifelter Anstrengung am Schlosse. Eilende Schritte kamen durch den äußeren Korridor daher; der Schlüssel wurde im Schlosse umgedreht, Bessie und Miss Abbot traten ein.
»Miss Eyre, sind Sie krank?« fragte Bessie.
»Welch ein fürchterlicher Lärm! Ich bin ganz außer mir!« rief Abbot aus.
»Nehmt mich mit hinaus! Lasst mich in die Kinderstube gehen!« schrie ich ununterbrochen.
»Weshalb denn? Ist Ihnen irgend etwas geschehen? Haben Sie etwas gesehen?« fragte Bessie wiederum.
»O, ich sah ein Licht und ich meinte, dass ein Geist kommen würde.« Ich hatte mich jetzt Bessies Hand bemächtigt, und sie entwand sie mir nicht.
»Sie hat mit Absicht so geschrien«, erklärte Abbot mit einigem Abscheu. »Und welch ein Geschrei! Wenn sie große Schmerzen gehabt hätte, so könnte man es noch entschuldigen, aber sie wollte weiter nichts, als uns alle herbeilocken. Ich kenne ihre bösen Streiche schon.«
»Was gibt es denn hier?« fragte eine andere Stimme gebieterisch; und Mrs. Reed kam mit flatternden Haubenbändern und wehendem Kleide durch den Korridor daher. »Abbot und Bessie, ich glaube, dass ich Befehl gegeben habe, Jane Eyre in dem roten Zimmer zu lassen, bis ich selbst sie holen würde?«
»Miss Jane schrie so laut, Madame«, wandte Bessie zögernd ein.
»Lasst sie los«, war die einzige Antwort. »Lass Bessies Hand los, Kind: verlass dich darauf, auf diese Weise wirst du nicht hinaus gelangen. Ich verabscheue solche List, besonders bei Kindern; es ist meine Pflicht, dir zu beweisen, dass du mit derartigen Ränken und Schlichen nicht weit kommst. Jetzt wirst du noch eine ganze Stunde hierbleiben, und auch dann gebe ich dich nur frei, wenn du mir das Versprechen gibst, vollkommen ruhig und unterwürfig zu sein.«
»O, Tante, hab Erbarmen! Vergib mir doch! Ich kann, ich kann es nicht ertragen. – Bestrafe mich doch auf andere Weise! Ich komme um, wenn …«
»Sei still! Diese Heftigkeit ist ganz widerlich und empörend!« und ohne Zweifel hegte sie auch Abscheu gegen mein Betragen. In ihren Augen war ich eine frühreife Schauspielerin; sie sah in der Tat auf mich wie auf eine Zusammensetzung der heftigsten Leidenschaften, eines niedrigen, gemeinen Geistes und gefährlicher Falschheit.
Als Bessie und Abbot sich zurückgezogen hatten, warf Mrs. Reed, die meiner wilden Angst und meines lauten Schluchzens wohl müde geworden sein mochte, mich rasch in das Zimmer zurück und schloss mich ohne weitere Erklärungen und Worte wieder ein. Ich hörte noch, wie sie davon rauschte; und bald nachdem sie gegangen war, muss ich in Krämpfe verfallen sein: Bewusstlosigkeit machte der Szene ein Ende!
Drittes Kapitel
Dann erinnerte ich mich an nichts mehr. Als ich erwachte, war es mit dem Gefühl eines schrecklichen Alpdrückens, vor mir sah ich eine unheimliche rote Glut, von der sich dicke, schwarze Stangen abhoben. Ich hörte Stimmen, die hohl an mein Ohr klangen, als würden sie durch das Rauschen des Wassers oder Toben des Windes übertönt. Aufregung, Ungewissheit und ein alles beherrschendes Gefühl des Entsetzens hielt alle meine Sinne gefangen. Es vergingen nur wenige Augenblicke, und dann gewahrte ich, dass jemand mich berührte, mich aufhob und mich in eine sitzende Stellung brachte, und zwar viel zärtlicher und sorgsamer, als mich bis jetzt irgendjemand gestützt oder emporgehoben hatte. Ich lehnte meinen Kopf gegen einen Arm oder ein Polster und fühlte mich unendlich wohl.
Noch fünf Minuten und die Wolken der Bewusstlosigkeit begannen zu schwinden. Jetzt wusste ich sehr wohl, dass ich in meinem eigenen Bette lag, und dass die rote Glut nichts anderes war, als das Feuer im Kamin der Kinderstube. Es war Nacht, eine Kerze brannte auf dem Tische; Bessie stand am Fußende meines Bettes und hielt eine Waschschüssel in der Hand, ein Herr saß auf einem Lehnstuhle neben mir und beugte sich über mich.
Ich empfand eine unbeschreibliche Erleichterung, eine wohltuende Überzeugung der Sicherheit und des Beschütztseins, als ich sah, dass sich ein Fremder im Zimmer befand, ein Mensch, der nicht zum Haushalt von Gateshead, nicht zu den Verwandten von Mrs. Reed gehörte. – Mich von Bessie abwendend – obgleich ihre Gegenwart mir weit weniger unangenehm war, als mir zum Beispiel Abbots Gesellschaft gewesen wäre – prüfte ich die Gesichtszüge des Herrn; ich kannte ihn, es war Mr. Lloyd, ein Apotheker, den Mrs. Reed zuweilen rufen ließ, wenn ihre Dienstboten krank waren. Für sich selbst und ihre Kinder nahm sie immer nur die Hilfe des Arztes in Anspruch.
»Nun, wer bin ich?« fragte er.
Ich sprach seinen Namen aus und streckte ihm zu gleicher Zeit meine Hand entgegen; er nahm sie, lächelte und sagte: »Ah, wir werden uns jetzt langsam erholen.« Dann legte er mich nieder, wandte sich zu Bessie, empfahl ihr, sehr vorsichtig zu sein und mich während der Nacht nicht zu stören. Nachdem er noch weitere Weisungen erteilt und gesagt hatte, dass er am folgenden Tage wiederkommen würde, ging er fort; zu meiner größten Betrübnis; während er auf dem Stuhl neben meinem Kopfkissen saß, fühlte ich mich so beschützt, so sicher, und als die Tür sich hinter ihm schloss, wurde das ganze Zimmer dunkel und mein Herz verzagte von neuem, es unterlag der Last eines unbeschreiblichen Grams.
»Glauben Sie, dass Sie schlafen können, Miss?« fragte Bessie mich ungewöhnlich sanft.
Kaum wagte ich, ihr zu antworten, denn ich fürchtete, dass ihre nächsten Worte wieder rau klingen würden. »Ich will es versuchen«, sagte ich leise.
»Möchten Sie nicht irgend etwas essen oder trinken?«
»Nein, ich danke, Bessie.«
»Nun, dann werde ich auch schlafen gehen, denn es ist schon nach Mitternacht; aber Sie können mich rufen, wenn Sie während der Nacht irgend etwas brauchen.«
Welche seltene Höflichkeit! Sie ermutigte mich, eine Frage zu stellen.
»Bessie, was ist denn mit mir geschehen? Bin ich sehr krank?«
»Ich vermute, dass Sie vor Schreien im roten Zimmer krank geworden sind; aber Sie werden ohne Zweifel bald wieder ganz gesund sein.«
Bessie ging in das anstoßende Zimmer der Hausmädchen. Ich hörte, wie sie dort sagte:
»Sarah, komm und schlaf bei mir in der Kinderstube, und wenn es mein Leben gälte, so könnte ich diese Nacht nicht mit dem armen Kinde allein bleiben; es könnte sterben! Wie sonderbar, dass Miss Jane einen solchen Anfall haben musste! Ich möchte doch wissen, ob sie irgend etwas gesehen hat. Mrs. Reed war dieses Mal aber auch zu hart gegen sie.«
Sarah kam mit ihr zurück; beide gingen zu Bett; sie flüsterten wenigstens noch eine halbe Stunde miteinander, bevor sie einschliefen. Ich hörte einige Bruchstücke ihrer Unterhaltung, und aus diesen schloss ich auf den Hauptgegenstand ihrer Diskussion.
»Etwas ist an ihr vorübergeschwebt, ganz in Weiß gekleidet, dann ist es verschwunden.« – – »Ein großer, schwarzer Hund hinter ihm.« – »Dreimal hat es laut an der Zimmertür geklopft.« – »Ein Licht auf dem Friedhofe gerade über seinem Grabe« – u.s.w., u.s.w.
Endlich schliefen beide ein. Feuer und Licht erloschen. In schaurigem Wachen ging die Nacht für mich langsam hin; Entsetzen und Angst hielten Ohren, Augen und Sinne wach. – Entsetzen und Angst, wie nur Kinder es zu empfinden imstande sind.
Diesem Zwischenfall im roten Zimmer folgte keine lange, ernste, körperliche Krankheit; nur eine heftige Erschütterung meiner Nerven, deren Widerhall ich noch bis auf den heutigen Tag empfinde. Ja, Mrs. Reed, Ihnen verdanke ich gar manchen qualvollen Schmerz der Seele. Aber ich sollte Ihnen verzeihen, denn Sie wussten nicht, was Sie taten, während Sie jede Faser meines Herzens zerrissen, glaubten Sie nur meine bösen Neigungen und Anlagen zu ersticken.
Am nächsten Tage gegen Mittag war ich bereits aufgestanden und angekleidet und saß in einen warmen Shawl gehüllt vor dem Kaminfeuer. Ich fühlte mich körperlich schwach und gebrochen, aber mein schlimmstes Übel war ein unaussprechlicher Jammer der Seele, ein Jammer, der mir fortwährend stille Tränen entlockte, kaum hatte ich einen salzigen Tropfen von meiner Wange getrocknet, als auch schon ein anderer folgte. Und doch meinte ich, dass ich augenblicklich glücklich sein müsste, denn keiner von den Reeds war da, alle waren mit ihrer Mama im großen Wagen spazieren gefahren; auch Abbot nähte in einem anderen Zimmer, und während Bessie hin und her ging, Spielsachen forträumte und Schiebladen ordnete, richtete sie dann und wann ein ungewöhnlich freundliches Wort an mich. Diese Lage der Dinge wäre für mich ein Paradies des Friedens gewesen, für mich, die ich nur an ein Dasein voll unaufhörlichen Tadels und grausame Sklaverei gewöhnt war, – aber in der Tat waren meine Nerven jetzt in einem solchen Zustande, dass keine Ruhe sie mehr sänftigen, kein Vergnügen sie mehr freudig erregen konnte.
Bessie war unten in der Küche gewesen und brachte mir jetzt einen Kuchen herauf, der auf einem gewissen, bunt gemalten Porzellanteller lag, dessen Paradiesvogel, welcher sich auf einem Kranz von Maiglöckchen und Rosenknospen schaukelte, stets eine enthusiastische Bewunderung in mir wach gerufen hatte. Gar oft hatte ich innig gebeten, diesen Teller in die Hand nehmen zu dürfen, um ihn genauer betrachten zu können, bis jetzt hatte man mich aber stets einer solchen Gunst für unwürdig gehalten. Jetzt stellte man mir nun diesen kostbaren Teller auf den Schoß und bat mich freundlich, das Stückchen auserlesenen Gebäcks, welches auf demselben lag, zu essen. Eitle Gunst! Sie kam zu spät, wie so manche andere, die so innig erwünscht, und so lange versagt worden war! Ich konnte den Kuchen nicht essen, und das Gefieder des Vogels, die Farben der Blumen schienen mir seltsam verblasst – ich schob sowohl Teller wie Gebäck von mir. Bessie fragte mich, ob ich ein Buch haben wolle. Das Wort Buch wirkte wie ein vorübergehendes Reizmittel, und ich bat sie, mir »Gullivers Reisen« aus der Bibliothek zu holen. Dieses Buch hatte ich schon unzählige Male mit Entzücken gelesen; ich hielt es für eine Erzählung von Tatsachen und entdeckte in ihm eine Ader, die ein weit tieferes Interesse für mich hatte, als dasjenige, welches ich in Märchen gefunden hatte; denn nachdem ich die Elfen vergebens unter den Blättern des Fingerhuts und der Glockenblume, unter Pilzen und altem, von Epheu umrankten Gemäuer gesucht, hatte ich mein Gemüt mit der traurigen Wahrheit ausgesöhnt, dass sie alle England verlassen hätten, um in ein unbekanntes Land zu gehen, wo die Wälder noch stiller und wilder und dicker, die Menschen noch spärlicher gesäet seien. Liliput hingegen und Brobdignag waren nach meinem Glauben solide Bestandteile der Erdoberfläche; ich zweifelte gar nicht, dass, wenn ich eines Tages eine weite Reise machen könnte, ich mit meinen eigenen Augen die kleinen Felder und Häuser, die winzigen Menschen, die zierlichen Kühe, Schafe und Vögel des einen Königreichs sehen würde, und ebenso die baumhohen Kornfelder, die mächtigen Bullenbeißer, die Katzen-Ungeheuer, die turmhohen Männer und Frauen des anderen. Und doch, als ich den geliebten Band jetzt in Händen hielt – als ich die Seiten umblätterte und in den wundersamen Bildern den Reiz suchte, welchen sie mir bis jetzt stets gewährt hatten – da war alles alt und trübselig; die Riesen waren hagere Kobolde; die Pigmäen boshafte und scheußliche Gnomen, Gulliver ein trübseliger Wanderer in öden und gefährlichen Regionen. Ich schloss das Buch, in dem ich nicht länger zu lesen wagte und legte es auf den Tisch neben das unberührte Stück Kuchen.
Bessie war jetzt mit dem Abstauben und Aufräumen des Zimmers zu Ende, und nachdem sie ihre Hände gewaschen hatte, öffnete sie eine gewisse kleine Schieblade, welche mit den schönsten, prächtigsten Lappen von Seide und Atlas angefüllt war, und begann einen Hut für Georginas neue Puppe zu machen. Dann begann sie zu singen; das Lied lautete:
»Als wir durch Wald und Flur streiften. Vor langer, langer Zeit.«
Wie oft hatte ich dies Lied schon gehört, und immer mit dem größten Entzücken; denn Bessie hatte eine süße Stimme – wenigstens nach meinem Geschmack. Aber jetzt, obgleich ihre Stimme noch immer lieblich klang, lag für mich eine unbeschreibliche Traurigkeit in dieser Melodie. Zuweilen, wenn ihre Arbeit sie ganz in Anspruch nahm, sang sie den Refrain sehr leise, sehr langsam: »Vor langer, langer Zeit«; dann klang es wie die Schlusskadenz eines Grabliedes. Endlich begann sie eine andere Ballade zu singen, diesmal eine wirklich traurige.
Mein Körper ist müd und wund ist mein Fuß, Weit ist der Weg, den ich wandern muss. Bald wird es Nacht, und den Weg ich nicht find’. Den ich wandern muss, armes Waisenkind! Weshalb sandten sie mich so weit, so weit, Durch Feld und Wald, auf die Berg’, wo es schneit? Die Menschen sind hart! Doch Engel so lind. Bewachen mich armes Waisenkind. Die Sterne, sie scheinen herab so klar. Die Luft ist mild! Es ist doch wahr: Gott ist barmherzig, er steuert dem Wind, Dass er nicht erfasse das Waisenkind. Und wenn ich nun strauchle am Waldesrand Oder ins Meer versink, wo mich führt keine Hand’, So weiß ich doch, dass den Vater ich find’, Er nimmt an sein Herz das Waisenkind! Das ist meine Hoffnung, die Kraft mir gibt. Dass Gott da droben sein Kind doch liebt. Bei ihm dort oben die Heimat ich find’. Er liebt auch das arme Waisenkind!
»Kommen Sie, Miss Jane, weinen Sie nicht«, sagte Bessie, als sie zu Ende war. Ebensogut hätte sie dem Feuer sagen können »brenne nicht!« aber wie hätte sie denn auch eine Ahnung von dem herzzerreißenden Schmerz haben können, dessen Beute ich war? – Im Laufe des Morgens kam Mr. Lloyd wieder.
»Wie? Schon aufgestanden?« rief er, als er in die Kinderstube trat. »Nun, Wärterin, wie geht es ihr denn eigentlich?«
Bessie entgegnete, dass es mir außerordentlich gut gehe.
»Dann sollte sie aber fröhlicher aussehen. Kommen Sie her, Miss Jane. Sie heißen Jane, nicht wahr?«
»Ja, mein Herr, Jane Eyre!«
»Nun, Sie haben geweint, Miss Jane Eyre, wollen Sie mir nicht sagen, weshalb? Haben Sie Schmerzen?«
»Nein, Herr.«
»Ah, ich vermute, dass sie weint, weil sie nicht mit Mrs. Reed spazieren fahren durfte«, warf Bessie hier ein.
»O nein, gewiss nicht, für solche Albernheit ist sie denn doch zu alt.«
Das dachte ich auch; und da meine Selbstachtung durch die falsche Beschuldigung verletzt war, antwortete ich schnell: »In meinem ganzen Leben habe ich noch keine Tränen um solche Dinge vergossen. Ich hasse die Spazierfahrten. Ich weine, weil ich so unglücklich bin.«
»Schämen Sie sich, Miss!« rief Bessie.
Der gute Apotheker schien ein wenig verwirrt. Ich stand vor ihm; er heftete seine Augen fest auf mich. Diese Augen waren klein und grau, nicht sehr leuchtend, aber ich glaube, dass ich sie jetzt sehr klug finden würde. Trotz der harten Züge hatte er ein gutmütiges Gesicht. Nachdem er mich lange mit Muße betrachtet hatte, sagte er: »Was hat Sie gestern krank gemacht?«
»Sie ist gefallen«, sagte Bessie wieder einfallend.
»Gefallen! Nun, das ist gerade wieder wie ein Kind! Kann sie bei ihrem Alter denn noch nicht allein gehen? Sie muss doch acht oder neun Jahre alt sein?«
»Jemand hat mich zu Boden geschlagen«, lautete die derbe Erklärung, welche der Schmerz gekränkten Stolzes mir wiederum entriss, »aber das hat mich nicht krank gemacht«, fügte ich hinzu, während Mr. Lloyd bedächtig eine Prise Tabak nahm.
Als er die Tabaksdose wieder in seine Westentasche schob, rief der laute Klang einer Glocke die Dienstboten zum Mittagessen; er wusste, was es bedeutete: »Das gilt Ihnen, Wärterin«, sagte er, »Sie können hinunter gehen; ich werde Miss Jane einige Lehren geben, bis Sie zurückkehren.«
Bessie wäre lieber geblieben, aber sie war gezwungen zu gehen, weil die Pünktlichkeit bei den Mahlzeiten eine Sache war, auf welche in Gateshead-Hall strenge gehalten wurde.
»Der Fall hat Sie nicht krank gemacht? Nun, was war es denn?« fragte Mr. Lloyd weiter, nachdem Bessie gegangen war.
»Ich war in einem Zimmer eingesperrt, wo ein Geist umgeht – und es war schon lange dunkel.«
Ich sah, wie Mr. Lloyd lächelte und zugleich die Stirn runzelte. »Ein Geist! Was! Sie sind am Ende doch nichts anderes, als ein kleines Kind! Sie fürchten sich vor Geistern?«
»Ja, vor Mr. Reeds Geist fürchte ich mich. Er starb in jenem Zimmer und lag dort auf der Bahre. Weder Bessie noch sonst jemand geht am Abend hinein, wenn es nicht dringend notwendig ist; und es war so furchtbar grausam, mich dort allein, ohne Licht, einzuschließen – so grausam, dass ich glaube, ich werde es niemals vergessen können.«
»Unsinn! Und macht das Sie so elend? Fürchten Sie sich jetzt bei Tage auch noch?«
»Nein. Aber es dauert nicht lange und dann wird es wieder Nacht. Und außerdem, ich bin unglücklich, sehr unglücklich um anderer Dinge willen.«
»Was für Dinge denn? Können Sie mir die nicht nennen?«
Wie sehr wünschte ich, offen und ehrlich auf diese Frage zu antworten! Wie schwer war es aber, Worte für eine solche Antwort zu finden! Kinder können wohl empfinden, aber sie können ihr Empfinden nicht zergliedern; und wenn ihnen die Zergliederung zum Teil auch in Gedanken gelingt, so wissen sie nicht, wie sie das Resultat dieses Vorganges in Worte kleiden sollen. Da ich aber fürchtete, dass ich diese erste und einzige Gelegenheit, meinen Kummer durch Mitteilung zu erleichtern, ungenützt vorübergehen lassen könnte, gelang es mir nach einer unruhigen Pause, eine unzulängliche, aber wahre Antwort hervorzubringen.
»Erstens habe ich keinen Vater, keine Mutter, keinen Bruder, keine Schwester.«
»Aber Sie haben eine gütige Tante und liebe Vettern und Cousinen.«
Wiederum hielt ich inne, dann rief ich kindisch aus:
»Aber John Reed hat mich zu Boden geschlagen und meine Tante hat mich im roten Zimmer eingesperrt.«
Zum zweiten Mal holte Mr. Lloyd seine Schnupftabaksdose hervor.
»Finden Sie denn nicht, dass Gateshead-Hall ein wunderschönes Haus ist?« fragte er. »Sind Sie nicht dankbar, an einem so schönen Orte leben zu können?«
»Es ist nicht mein eigenes Haus, Sir; und Abbot sagt, dass ich weniger recht habe, hier zu sein, als ein Dienstbote.«
»Dummes Zeug! Sie können doch nicht so dumm sein, zu wünschen, dass Sie einen so herrlichen Ort wie diesen verlassen dürften?«
»Wenn ich nur wüsste, wohin ich gehen sollte, ich wäre wahrhaftig froh zu gehen; aber ich darf Gateshead erst verlassen, wenn ich erwachsen bin.«
»Vielleicht doch früher – wer weiß? Haben Sie außer Mrs. Reed keine Verwandte?«
»Ich glaube nicht, Sir.«
»Niemanden, der mit Ihrem Vater verwandt war?«
»Ich weiß es nicht. Einmal fragte ich Tante Reed, und da sagte sie, dass ich möglicherweise irgendwelche arme, heruntergekommene Verwandte, namens Eyre, haben könne, dass sie aber nichts über sie wisse.«
»Möchten Sie denn zu ihnen gehen, wenn Sie solche Angehörige hätten?«
Ich besann mich. Armut hat etwas abschreckendes für erwachsene Menschen; für Kinder aber noch mehr; sie haben nicht viel Sinn für fleißige, arbeitsame, ehrenhafte Armut; dies Wort erweckt in ihnen nur den Gedanken an zerlumpte Kleider, kärgliche Nahrung, einen kalten Ofen, rohe Manieren und entwürdigende Laster: auch für mich war Armut gleichbedeutend mit Entehrung.
»Nein. Ich möchte nicht bei armen Leuten leben«, war meine Antwort.
»Auch nicht, wenn sie gütig gegen Sie wären?«
Ich schüttelte den Kopf. Ich konnte nicht begreifen, wie arme Leute überhaupt die Mittel haben, gütig zu sein. Und dann – sprechen lernen wie sie – ihre Manieren annehmen – schlecht erzogen werden – aufwachsen wie eins jener armen Weiber, die ich zuweilen vor den Türen der Hütten ihre Kinder warten und ihre Kleider waschen sah? – nein, ich war nicht heroisch genug, meine Freiheit um den Preis meiner Kaste zu erkaufen.
»Aber sind Ihre Verwandten denn so arm? Gehören sie zur arbeitenden Klasse?«
»Das weiß ich nicht; Tante Reed sagt, wenn ich überhaupt Angehörige habe, so müssen sie Bettlergesindel sein. Nein, nein, ich möchte nicht betteln gehen.«
»Möchten Sie nicht in die Schule gehen?«
Wiederum dachte ich nach; kaum wusste ich, was eine Schule denn eigentlich sei; Bessie sprach zuweilen davon wie von einem Orte, an dem man von jungen Damen erwartet, dass sie außerordentlich manierlich und geziert sind; John Reed hasste seine Schule und schmähte seinen Lehrer, aber John Reeds Ansichten und Geschmack waren keine Regel für die meinen, und wenn Bessies Berichte über Schuldisziplin (diese stammten von den Töchtern einer Familie, in welcher sie gedient hatte, bevor sie nach Gateshead kam) etwas abschreckend lauteten, so waren ihre Erzählungen von verschiedenen Talenten und Kenntnissen, welche diese selben jungen Damen sich angeeignet hatten, andererseits höchst verlockend. Sie prahlte von wunderschönen Gemälden, von Landschaften und Blumen, welche sie vollendet, von Liedern, die sie singen und Klavierpiecen, die sie spielen, von Geldbörsen, die sie häkeln, von französischen Büchern, die sie übersetzen konnten, bis mein Gemüt, während ich ihr lauschte, zur Nachahmung aufgestachelt wurde. Außerdem wäre die Schule doch eine gründliche Abwechselung: damit war eine lange Reise verknüpft, eine gänzliche Trennung von Gateshead, ein Eintritt in ein neues Leben.
»Ich möchte in der Tat in eine Schule gehen«, war die hörbare Schlussfolgerung meines Nachsinnens.
»Nun, nun, wer weiß denn, was geschieht!« sagte Mr. Lloyd, indem er sich erhob. »Das Kind braucht Luft- und Ortsveränderung«, fügte er hinzu, mit sich selbst redend, »die Nerven sind in einer bösen Verfassung.«
Jetzt kam Bessie zurück; in demselben Augenblick hörte man Mrs. Reeds Wagen über den Kies der Gartenwege rollen.
»Ist das Ihre Herrin, Wärterin?« fragte Mr. Lloyd, »ich möchte noch mit ihr reden bevor ich gehe.«
Bessie forderte ihn auf, ins Frühstückszimmer zu gehen und geleitete ihn hinaus. Wie ich aus den nachfolgenden Begebenheiten schloss, wagte der Apotheker während der Unterredung mit Mrs. Reed ihr anzuempfehlen, dass sie mich in eine Schule schicke; und ohne Zweifel wurde dieser Rat sehr bereitwillig angenommen, denn als ich an einem der folgenden Abende im Bette lag, und Bessie und Abbot mich schlafend glaubten, sagte letztere: »Ich glaube, die gnädige Frau ist nur zu froh, solch ein langweiliges, boshaftes Kind los zu werden; sie sieht immer aus, als beobachte sie jeden Menschen und schmiede heimliche Pläne.« – Ich glaube wahrhaftig, dass Abbot mich für eine Art kindlichen Guy Fawkes1 hielt.
Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich auch aus Miss Abbots Mitteilungen an Bessie, dass mein Vater ein armer Prediger gewesen; dass meine Mutter ihn gegen den Willen ihrer Angehörigen geheiratet habe, welche diese Heirat für erniedrigend gehalten; dass mein Großvater Reed so erzürnt über ihren Ungehorsam gewesen, dass er sie gänzlich enterbte; dass mein Vater, nachdem er kaum ein Jahr mit meiner Mutter verheiratet gewesen, ein typhöses Fieber bekommen, während er die arme Bevölkerung einer großen Fabrikstadt, in welcher seine Pfarre lag, besuchte; und dass meine arme Mutter kaum einen Monat später ihrem Gatten ins Grab folgte.
Als Bessie diese Erzählung mit anhörte, seufzte sie und sagte: »Abbot, die arme Miss Jane ist auch zu bedauern.«
»Ja, ja«, entgegnete Abbot, »wenn sie ein liebes, gutes, hübsches Kind wäre, so könnte man Mitleid mit ihr haben, weil sie so gänzlich verlassen ist; aber solch eine scheußliche kleine Kröte kann einem doch unmöglich Erbarmen einflößen.«
»Nein, nicht viel«, stimmte Bessie ihr bei, »auf jeden Fall würde eine so prächtige Schönheit wie Miss Georgiana in einer solchen Lage viel rührender sein.«
»Ja, ja, ich bete Miss Georgiana an!« rief die begeisterte Abbot. »Der kleine süße Liebling! – Mit ihren langen Locken und blauen Augen, und den süßen, lieblichen Farben, gerade als ob sie angemalt wäre! – Bessie, ich hätte wahrhaftig Appetit auf einen gerösteten Käse zum Abendbrot.«
»Ich auch, ich auch – mit geschmorten Zwiebeln. Kommen Sie, wir wollen hinunter gehen.«
Und sie gingen.
Guy Fawkes, geboren 1570, Haupt der Pulververschwörung in London, 1605 hingerichtet. <<<
Viertes Kapitel
Aus meiner Unterredung mit Mr. Lloyd und der soeben wiederholten Konferenz zwischen Abbot und Bessie schöpfte ich Hoffnung genug, um den Wunsch nach Genesung zu hegen; eine Veränderung schien bevorstehend – ich wünschte und wartete im Stillen. Die Sache verzögerte sich indessen. Tage und Wochen vergingen; mein Gesundheitszustand war wieder ein normaler, aber ich vernahm keine Anspielung mehr auf den Gegenstand, über welchen ich brütete. Oft betrachtete Mrs. Reed mich mit strengen, finsteren Blicken, aber nur selten sprach sie zu mir. Seit meiner Krankheit hatte sie eine schärfere Grenzlinie denn je zwischen mir und ihren eigenen Kindern gezogen; mir war eine kleine Kammer als Schlafgemach angewiesen worden; man hatte mich verdammt, meine Mahlzeiten allein einzunehmen, und ich musste allein in der Kinderstube verweilen, während meine Vettern und Cousinen sich stets im Wohnzimmer aufhielten. Indessen fiel noch immer kein Wink über den Plan, mich in ein Erziehungsinstitut zu schicken; und doch hegte ich die instinktive Gewissheit, dass sie mich nicht mehr lange unter ihrem Dache dulden würde; denn mehr als je drückte ihr Blick, wenn er auf mich fiel, einen unüberwindlichen und eingewurzelten Abscheu aus.
Eliza und Georgiana handelten augenscheinlich nach Instruktionen, indem sie so wenig wie möglich mit mir sprachen; John streckte die Zunge aus sobald er mich erblickte und versuchte sogar einmal mich zu züchtigen; da ich mich aber augenblicklich gegen ihn wandte und er in meinen Blicken dieselbe Wut wahrnahm, in welcher ich mich schon einmal gegen ihn aufgelehnt hatte, hielt er es für besser, abzulassen und unter lauten Verwünschungen davon zu laufen, während er schrie, ich habe ihm das Nasenbein zertrümmert. Allerdings hatte ich nach diesem hervorragendsten Gesichtszuge einen Schlag geführt, so heftig wie meine Knöchel ihn auszuteilen vermochten; und als ich sah, dass entweder dieser Schlag oder meine Blicke ihn eingeschüchtert hatten, spürte ich die größte Neigung, meinen Vorteil noch weiter auszubeuten; er war indessen schon zu seiner Mutter gelaufen. Ich hörte, wie er mit stammelnden Lauten eine Geschichte begann »wie diese abscheuliche Jane Eyre« einer wilden Katze gleich auf ihn gesprungen sei; mit strenger Stimme unterbrach ihn seine Mutter.
»Sprich mir nicht von ihr, John; ich habe dir gesagt, dass du ihr nicht zu nahe kommen sollst; sie ist nicht einmal deiner Beachtung wert; ich will nicht, dass du oder eine deiner Schwestern mit ihr etwas zu tun haben.«
In diesem Augenblick lehnte ich mich über das Treppengeländer und schrie plötzlich ohne im geringsten über meine Worte nachzudenken:
»Sie sind nicht wert, mit mir zu verkehren.«
Mrs. Reed war eine ziemlich starke Frau; als sie indessen diese seltsamen und frechen Worte vernahm, kam sie ganz leichtfüßig die Treppe herauf gelaufen, zog mich mit Windeseile in die Kinderstube und indem sie mich an die Seite meines kleinen Bettes drückte, verbot sie mir mit pathetischer Stimme, mich von dieser Stelle fortzurühren und während des ganzen Tages auch nur noch ein einziges Wort zu sprechen.
»Was würde Onkel Reed jetzt sagen, wenn er noch lebte?« war meine fast willenlos getane Frage. Ich sage, »fast willenlos«, denn es war, als spräche meine Zunge diese Worte aus, ohne dass mein Wille darum wusste. – Es sprach etwas aus mir, worüber ich keine Gewalt hatte.
»Was?« zischte Mrs. Reed fast unhörbar; in ihrem sonst so kalten, ruhigen, grauen Auge blitzte etwas auf, das der Furcht glich; sie ließ meinen Arm los und blickte mich an, als wisse sie nicht recht, ob ich ein Kind oder ein Teufel sei. Jetzt fasste ich Mut.
»Mein Onkel Reed ist im Himmel und kann alles sehen, was Sie tun und sagen; und mein Vater und meine Mutter auch; sie wissen, dass Sie mich den ganzen Tag einsperren und dass Sie nur wünschen, ich wäre tot.«
Mrs. Reed war schnell wieder gefasst; sie schüttelte mich heftig, sie ohrfeigte mich aus allen Kräften und verließ mich dann ohne eine Silbe zu sprechen. Bessie füllte diese Lücke aus, indem sie mir eine stundenlange Strafpredigt hielt, in welcher sie mir ohne jeden Zweifel bewies, dass ich das elendeste und pflichtvergessenste Kind sei, das jemals unter einem Dache erzogen worden. Halb und halb glaubte ich ihr; denn ich empfand selbst, wie in diesem Augenblick nur böse Gefühle in meiner Brust tobten.