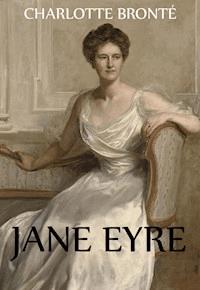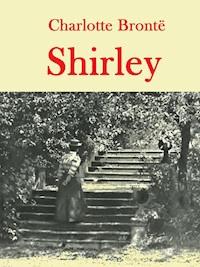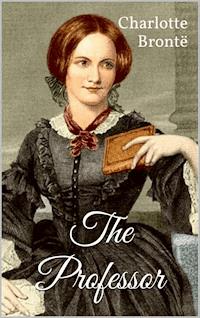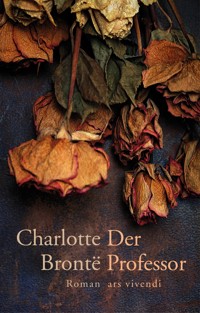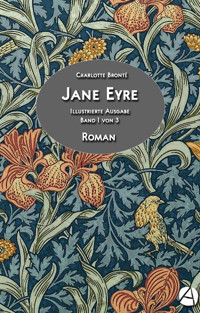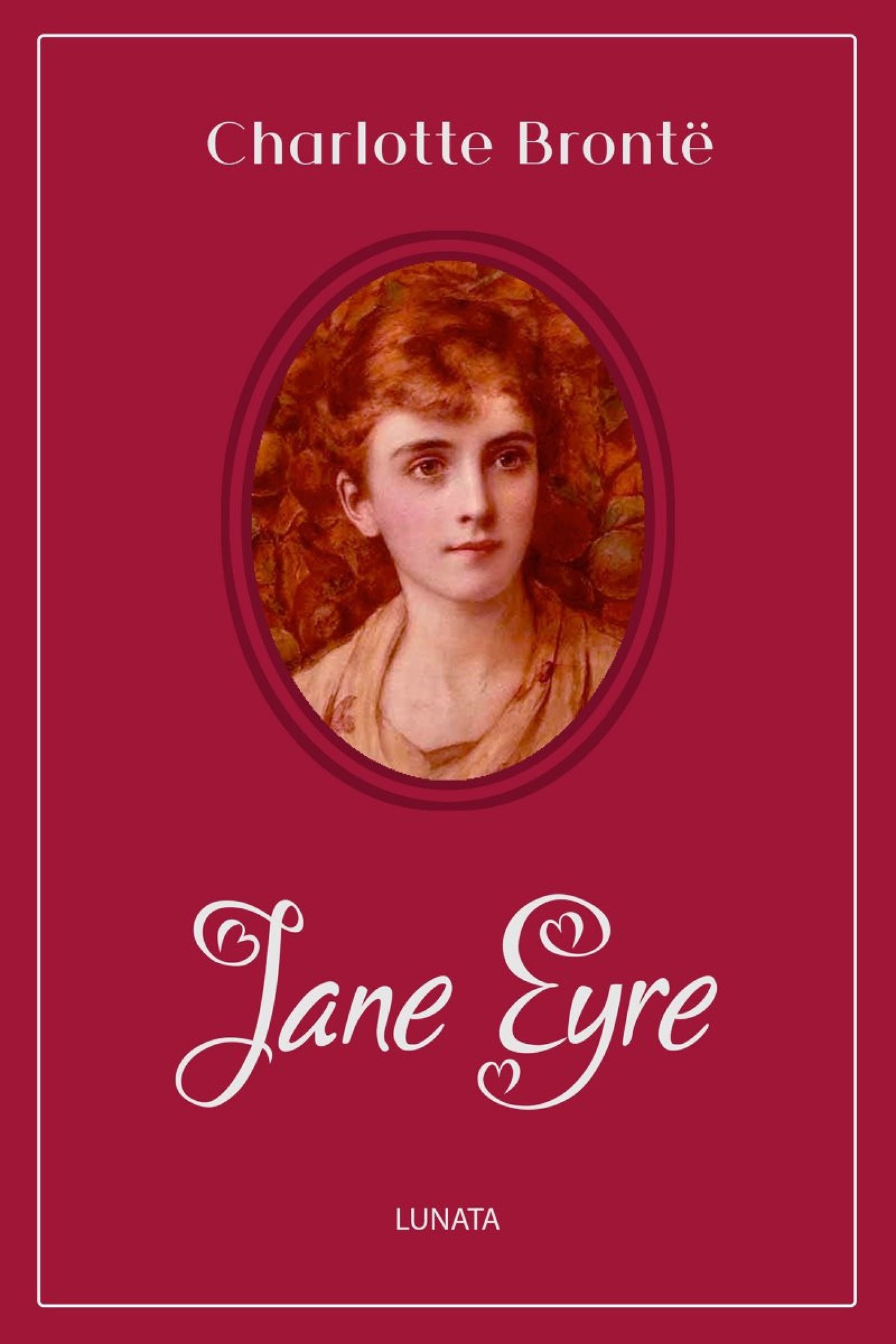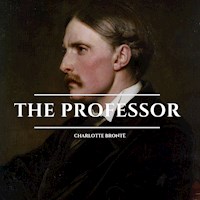9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Reclam Taschenbuch
- Sprache: Deutsch
Charlotte Brontës Meisterwerk, das sie im Alter von knapp dreißig Jahren verfasste, zählt zu den großen Frauenromanen der Weltliteratur. Im Mittelpunkt des Geschehens stehen die Gouvernante Jane Eyre und Edward Rochester, der Herr von Thornfield Hall. Edward, dessen uneheliche Tochter Adèle von Jane unterrichtet wird, verliebt sich in Jane, aber zur Hochzeit kommt es – vorerst – nicht. Schreckliche Dinge passieren in dem düsteren Herrenhaus, die Jane sich nicht erklären kann. Sie ahnt nicht, dass eine Irre darin haust ... – Mit einer kompakten Biographie der Autorin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1072
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Charlotte Brontë
Jane Eyre
Eine Autobiografie
Reclam
Englischer Originaltitel: Jane Eyre. An Autobiography (1847)
2020 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Durchgesehene Ausgabe 2020
Covergestaltung: Anja Grimm Gestaltung
Coverabbildung: © shutterstock.com / Theraphosath
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2020
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961701-5
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-020592-1
www.reclam.de
Inhalt
Jane Eyre
Anmerkungen
Nachwort
Zeittafel
Kapitel 1
An jenem Tag konnte man unmöglich spazieren gehen. Zwar waren wir am Vormittag eine Stunde lang zwischen den kahlen Büschen und Sträuchern umhergestreift, doch seit dem Mittagessen (wenn kein Besuch da war, speiste Mrs. Reed stets zeitig) hatte der kalte Winterwind so dunkle Wolken und einen so durchdringenden Regen mitgebracht, dass ein weiterer Aufenthalt im Freien nun nicht mehr in Frage kam.
Ich war froh darüber. Lange Spaziergänge, vor allem an frostigen Nachmittagen, hatte ich noch nie gemocht: die Heimkehr im unwirtlichen Halbdunkel mit erstarrten Fingern und Zehen, das fortwährende Geschimpfe von Bessie, dem Kindermädchen, das mir das Herz schwer machte, und das demütigende Bewusstsein meiner körperlichen Unterlegenheit gegenüber Eliza, John und Georgiana Reed waren mir ein Gräuel.
Besagte Eliza, John und Georgiana waren jetzt im Wohnzimmer um ihre Mama versammelt. Sie lag auf einem Sofa in der Nähe des Kamins und sah im Kreise ihrer Lieblinge (die im Augenblick gerade einmal weder stritten noch weinten) vollkommen glücklich aus. Mich hatte sie mit der Bemerkung von der Gruppe ausgeschlossen, es täte ihr leid, mich von ihnen fernhalten zu müssen; doch ehe sie nicht von Bessie höre oder mit eigenen Augen feststellen könne, dass ich mich ernsthaft um ein umgänglicheres und kindlicheres Betragen, eine einnehmendere und heiterere Art bemühte kurz, also versuchte, etwas fröhlicher, unbekümmerter, offener und natürlicher zu sein –, müsse sie mir nun einmal die Vergünstigungen versagen, die nur zufriedenen, braven kleinen Kindern zustünden.
»Was hat Bessie gesagt? Was soll ich denn getan haben?«, fragte ich.
»Jane, ich mag diese naseweise Krittelei und Fragerei nicht. Außerdem ist es wirklich erschreckend und abstoßend, wenn ein Kind einem Erwachsenen gegenüber einen solchen Ton anschlägt. Setz dich irgendwo hin und schweig, bis du imstande bist, dich freundlich und liebenswürdig zu unterhalten.«
Neben dem Salon lag ein kleines Frühstückszimmer. Dort schlüpfte ich hinein. In dem Raum befand sich ein Bücherschrank. Bald nahm ich mir einen Band heraus, wobei ich darauf achtete, dass es einer mit Bildern war. Ich kletterte auf die Bank in der Fensternische, zog meine Füße hoch und ließ mich im Schneidersitz darauf nieder, und nachdem ich den roten Moirévorhang fast ganz zugezogen hatte, fühlte ich mich in meinem Zufluchtsort doppelt geschützt.
Falten des scharlachroten Stoffes versperrten mir die Sicht nach rechts; zu meiner Linken schützten mich die blanken Fensterscheiben vor dem trostlosen Novembertag, ohne mich indes völlig von ihm zu trennen, und wenn ich die Seiten meines Buches umblätterte, vertiefte ich mich von Zeit zu Zeit in den Anblick, den jener Winternachmittag bot. Die Ferne verlor sich in einem fahlen Nichts aus Nebel und Wolken; unmittelbar vor mir lagen der nasse Rasen und das sturmgepeitschte Gebüsch, über das der Regen, von langen, aufheulenden Windstößen angetrieben, unaufhörlich und heftig hinwegfegte.
Ich wandte mich wieder meinem Buch zu – Bewicks Britischer Vogelkunde. Um den Text kümmerte ich mich im Allgemeinen recht wenig, doch gab es ein paar Seiten, die ich selbst als Kind nicht einfach überspringen konnte. Es handelte sich um die Einleitung, in der von den Schlupfwinkeln der Seevögel die Rede war; von den »einsamen Felsen und Klippen«, die einzig und allein von diesen bevölkert werden; von der Küste Norwegens, die von ihrem südlichsten Punkt, dem Kap Lindesnes oder Naze, bis zum Nordkap mit Inseln übersät ist und
Wo das Nordmeer in unermesslichen Strudeln
die nackten Felsen des fernen Thule brodelnd umtost;
wo die mächt’gen atlantischen Wogen sich Bahn brechen
zwischen den sturmgepeitschten Hebriden.
Auch fesselte mich die Schilderung der rauen Küsten Lapplands, Sibiriens, Spitzbergens, Novaja Semljas, Islands und Grönlands mit »dem unendlichen Gebiet der arktischen Zone und jenen einsamen Regionen trostloser Weite – jenem riesigen Speicher von Frost und Schnee, wo ewiges Eis, von Wintern in Jahrhunderten zu hohen Bergen aufgetürmt, den Pol umgibt und die vielfältigen Unbilden strengster Kälte sich vereinigen«. Von diesem toten weißen Reich habe ich mir meine eigene Vorstellung gebildet: Unwirklich und schattenhaft war sie, wie alle die nur halb verstandenen Begriffe, die vage durch Kinderköpfe geistern, aber ungewöhnlich packend und eindrucksvoll. Die Worte dieser einleitenden Seiten verbanden sich mit den nachfolgenden Abbildungen und gaben dem einsam aus einem Meer von Wogen und Gischt aufragenden Felsen ebenso seine Bedeutung wie dem auseinandergebrochenen Schiff, das an einer verlassenen Küste gestrandet war, und dem kalten, gespenstischen Mond, der zwischen Wolkenbändern hindurch auf ein sinkendes Wrack herabblickt.
Ich kann die Stimmung nicht beschreiben, die über dem verlassenen Kirchhof lag mit seinem beschrifteten Grabstein, seinem Tor, den beiden Bäumen, dem niedrigen, von einer verfallenen Mauer umgürteten Horizont und der eben erst aufgegangenen Mondsichel, die den Anbruch der Nacht ankündigte.
Die beiden draußen auf dem Meer in eine Flaute geratenen Schiffe kamen mir wie Seeungeheuer vor.
Den Unhold, der die Diebesbeute auf dem Rücken festhält, überblätterte ich rasch: Er flößte mir Schrecken ein – wie auch das schwarze gehörnte Wesen, das etwas abseits auf einem Felsen saß und eine Menschenansammlung beobachtete, die sich in einiger Entfernung um einen Galgen drängte.
Jedes Bild erzählte eine Geschichte, geheimnisvoll oft für mein noch unentwickeltes Begriffsvermögen und mein kindliches Empfinden, doch stets äußerst fesselnd – so fesselnd wie die Geschichten, die Bessie zuweilen an Winterabenden erzählte, wenn sie gerade einmal gut gelaunt war. Dann stellte sie ihren Bügeltisch vor den Kamin im Kinderzimmer, ließ uns darum herum sitzen, und während sie Mrs. Reeds Spitzenrüschen bügelte und steifte und die Borten ihrer Nachthaube kräuselte, fütterte sie unsere lebhafte Phantasie mit Geschichten von Liebe und Abenteuer, die aus alten Märchen oder noch älteren Balladen stammten oder (wie ich später entdeckte) aus Pamela und Heinrich, Graf von Moreland.
Mit Bewick auf den Knien war ich damals glücklich, zumindest glücklich auf meine Art. Ich fürchtete nichts weiter, als gestört zu werden, und das geschah nur zu bald. Die Tür zum Frühstückszimmer wurde geöffnet.
»Puh! Madame Griesgram!«, ertönte John Reeds Stimme. Dann hielt er inne, denn er merkte wohl, dass das Zimmer offenbar leer war.
»Wo zum Teufel steckt sie?«, fuhr er fort. »Lizzy! Georgy!«, rief er seinen Schwestern zu, »Jane ist nicht hier. Sagt Mama, sie sei in den Regen hinausgelaufen – dieses ungezogene Gör!«
›Gut, dass ich den Vorhang zugezogen habe‹, dachte ich und wünschte inständig, er möge mein Versteck nicht entdecken. Und John Reed selbst hätte es auch nicht aufgespürt, er hatte nämlich weder scharfe Augen noch einen scharfen Verstand. Eliza dagegen steckte nur den Kopf zur Tür herein und sagte sogleich: »Sie sitzt sicher in der Fensternische, Jack.«
Ich kam sofort hervor, denn ich zitterte bei der Vorstellung, von besagtem Jack herausgezerrt zu werden.
»Was willst du?«, fragte ich zaghaft und verlegen.
»Das heißt: ›Was wünschen Sie, Master Reed‹«, lautete die Antwort. »Ich wünsche, dass du hierher kommst.« Er setzte sich in einen Lehnstuhl und forderte mich mit einer Handbewegung auf, näher zu treten und mich vor ihn hinzustellen.
John Reed war ein Schuljunge von vierzehn Jahren, also vier Jahre älter als ich, denn ich war erst zehn. Er war groß und kräftig für sein Alter und hatte eine gelbliche, ungesunde Haut, ein breites Gesicht mit groben Zügen, plumpe Gliedmaßen und große Hände und Füße. Bei Tisch schlang er für gewöhnlich so in sich hinein, dass es ihm auf die Galle geschlagen war und er trübe Triefaugen und schlaffe Wangen bekommen hatte. Eigentlich hätte er in der Schule sein sollen, aber seine Mama hatte ihn »seiner zarten Gesundheit wegen« für ein, zwei Monate nach Hause geholt. Mr. Miles, der Lehrer, behauptete zwar, es würde ihm sehr gut gehen, bekäme er weniger Kuchen und Süßigkeiten von zu Hause geschickt; doch das mütterliche Herz sträubte sich gegen ein so hartes Urteil und neigte eher zu der beschönigenden Ansicht, Johns Blässe rühre von Übereifer und vielleicht sogar Heimweh her.
John hegte keine große Zuneigung für seine Mutter und seine Schwestern und Abneigung gegen mich. Er tyrannisierte und schlug mich, und zwar nicht nur zwei-, dreimal in der Woche oder ein-, zweimal am Tag, sondern in einem fort. Jeder Nerv in mir fürchtete ihn, jede Faser Fleisches auf meinen Knochen zog sich zusammen, wenn er mir nahe kam. Es gab Augenblicke, da wurde ich vor Angst fast verrückt, denn ich hatte niemanden, an den ich mich gegen seine Drohungen oder Übergriffe um Hilfe wenden konnte: Die Dienstboten wollten ihren jungen Herrn nicht gegen sich aufbringen, indem sie für mich Partei ergriffen, und Mrs. Reed war in dieser Hinsicht blind und taub. Nie sah oder hörte sie, dass er mich schlug oder beschimpfte, obgleich er beides dann und wann sogar in ihrer Gegenwart tat, häufiger freilich hinter ihrem Rücken.
Gewohnt, John zu gehorchen, trat ich vor seinen Stuhl, und er verbrachte die nächsten drei Minuten damit, mir die Zunge so weit herauszustrecken, wie er es konnte, ohne sich dabei weh zu tun. Ich wusste, dass er gleich zuschlagen würde. Trotz der Angst, mit der ich den Schlag erwartete, studierte ich angewidert das abstoßende, hässliche Äußere desjenigen, der ihn mir sogleich versetzen würde. Ich frage mich, ob er diesen Gedanken in meinem Gesicht las, denn plötzlich schlug er, ohne ein Wort zu sagen, heftig zu. Ich wankte, und als ich mein Gleichgewicht wiedergefunden hatte, wich ich ein, zwei Schritte von seinem Stuhl zurück.
»Das ist für die Unverschämtheit, mit der du Mama vorhin geantwortet hast«, sagte er, »und für deine heimtückische Art, dich hinter Vorhängen zu verstecken, und für den Blick, mit dem du mich gerade angeglotzt hast, du Ratte!«
Ich war an John Reeds Beschimpfungen gewöhnt, und es kam mir gar nicht in den Sinn, etwas darauf zu erwidern. Meine Sorge war vielmehr, wie ich den Schlag ertragen sollte, der der Beleidigung mit Sicherheit folgen würde.
»Was hast du da hinter dem Vorhang gemacht?«, fragte er.
»Ich habe gelesen.«
»Zeig das Buch.«
Ich ging zum Fenster zurück und holte es.
»Es steht dir nicht zu, unsere Bücher zu nehmen. Du bist von uns abhängig, sagt Mama. Du hast kein Geld, dein Vater hat dir keines hinterlassen. Eigentlich solltest du betteln gehen und nicht mit Kindern feiner Leute wie uns hier leben, die gleichen Mahlzeiten einnehmen wie wir und dich auf Kosten unserer Mama kleiden. Aber ich werde dich schon lehren, meine Bücherregale zu durchstöbern – sie gehören nämlich mir. Das ganze Haus gehört mir oder wird in ein paar Jahren mir gehören. Geh, stell dich an die Tür, weg vom Spiegel und den Fenstern!«
Ich gehorchte, ohne zunächst zu erkennen, was er vorhatte. Als ich dann aber bemerkte, wie er das Buch hob, es hin und her schwang und Anstalten machte, es nach mir zu werfen, sprang ich unwillkürlich mit einem Ausruf des Schreckens zur Seite, allerdings nicht schnell genug: der Band kam geflogen und traf mich. Ich fiel hin, schlug dabei mit dem Kopf gegen die Tür und verletzte mich. Die Platzwunde blutete, ein heftiger Schmerz durchzuckte mich. Meine Angst indes hatte ihren Höhepunkt überschritten, andere Gefühle traten nun an ihre Stelle.
»Du gemeiner, grausamer Kerl!«, stieß ich hervor. »Du bist wie ein Mörder – wie ein Sklaventreiber – du bist wie die römischen Kaiser!«
Ich hatte Goldsmiths Geschichte Roms gelesen und mir meine eigene Meinung über Nero, Caligula etc. gebildet. Und still für mich hatte ich auch Parallelen gezogen, die ich jedoch nie auf diese Weise laut zu äußern vorgehabt hatte.
»Was! Was!«, rief er. »Hat sie das zu mir gesagt? Habt ihr das gehört, Eliza und Georgiana? Das werde ich Mama erzählen! Aber vorher –«
Er stürzte sich Hals über Kopf auf mich. Ich fühlte, wie er mich an Haaren und Schulter packte. Doch er war an ein zu allem entschlossenes Wesen geraten, denn ich sah in ihm wirklich einen Tyrannen, ja einen Mörder. Ich spürte ein, zwei Tropfen Blut von meinem Kopf in den Nacken rinnen und einen ziemlich stechenden Schmerz. Diese Empfindungen waren nun stärker als meine Angst, und ich setzte mich wie toll zur Wehr. Ich weiß nicht genau, was ich mit meinen Händen tat, aber er schrie »Ratte! Ratte!« und brüllte laut auf. Hilfe nahte indes schon, denn Eliza und Georgiana waren sogleich losgestürmt, um Mrs. Reed zu holen, die nach oben gegangen war. Nun tauchte sie, gefolgt von Bessie und ihrer Zofe Abbot, am Ort des Geschehens auf. Wir wurden getrennt, und ich hörte die Worte:
»Du lieber Himmel! Was für eine Furie! So auf Master John loszugehen!«
»Hat man je einen derartigen Wutanfall erlebt!«
Dann befahl Mrs. Reed: »Bringt sie ins Rote Zimmer und sperrt sie dort ein.« Sofort ergriffen mich vier Hände, und ich wurde die Treppe hinaufgezerrt.
Kapitel 2
Ich sträubte und wehrte mich die ganze Zeit: Das war etwas Neues für mich und ein Umstand, der Bessie und Miss Abbot in der schlechten Meinung, die sie sich nun einmal von mir gebildet hatten, noch bestärkte. Tatsächlich war ich ziemlich von Sinnen oder vielmehr völlig außer mir. Ich war mir bewusst, dass ich mit meinem kurzen Aufbegehren bereits außergewöhnliche Strafen auf mich gezogen hatte, und, wie jeder aufrührerische Sklave, war ich in meiner Verzweiflung entschlossen, bis zum Äußersten zu gehen.
»Halten Sie sie an den Armen fest, Miss Abbot. Sie führt sich ja auf wie eine tollwütige Katze.«
»Pfui! Schämen Sie sich!«, rief die Kammerzofe. »Was für ein unerhörtes Betragen, Miss Eyre, einen jungen Mann aus gutem Hause zu schlagen, den Sohn Ihrer Wohltäterin! Ihren jungen Herrn!«
»Meinen Herrn! Wieso mein Herr? Bin ich etwa eine Dienstmagd?«
»Nein, Sie sind noch weniger als eine Magd, denn Sie tun ja nichts, um Ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Da, setzen Sie sich hin und denken Sie über Ihr schändliches Benehmen nach.«
Sie hatten mich inzwischen in den von Mrs. Reed bezeichneten Raum gebracht und unsanft auf einen Stuhl gestoßen. Einem inneren Antrieb folgend, wollte ich wie eine Sprungfeder gleich wieder hochschnellen, doch zwei Paar Hände hielten mich augenblicklich zurück.
»Wenn Sie nicht ruhig sitzen bleiben, müssen wir Sie anbinden«, erklärte Bessie. »Leihen Sie mir Ihre Strumpfbänder, Miss Abbot, meine würde sie sofort zerreißen.«
Miss Abbot wandte sich ab, um das geforderte Band von ihrem strammen Bein zu streifen. Diese Anstalten, mir Fesseln anzulegen, und die damit verbundene zusätzliche Schmach dämpften meine Erregung etwas.
»Nehmen Sie sie nicht ab«, rief ich. »Ich werde mich nicht rühren.«
Zur Bekräftigung meiner Worte klammerte ich mich mit den Händen fest an meinen Sitz.
»Das will ich Ihnen auch geraten haben!«, sagte Bessie, und erst nachdem sie sich vergewissert hatte, dass ich tatsächlich sitzen blieb, ließ sie mich los. Dann stellten sie und Miss Abbot sich mit verschränkten Armen vor mich hin und musterten finster und argwöhnisch mein Gesicht, als zweifelten sie an meinem Verstand.
»So etwas hat sie bisher noch nie getan«, sagte Bessie schließlich zur Kammerzofe.
»Aber es steckte immer schon in ihr«, war die Antwort. »Ich hab der Gnädigen schon oft meine Meinung über das Kind gesagt, und die Gnädige hat mir zugestimmt. Es ist ein hinterhältiges kleines Ding. Noch nie hab ich ein Mädchen gesehn, das in ihrem Alter schon so falsch und verschlagen war.«
Bessie antwortete nicht, doch gleich darauf wandte sie sich an mich:
»Sie sollten sich darüber im Klaren sein, junges Fräulein, dass Sie Mrs. Reed zu Dank verpflichtet sind. Sie sorgt für Sie, und wenn sie Sie vor die Tür setzte, müssten Sie ins Armenhaus.«
Auf diese Worte hatte ich nichts zu erwidern; sie waren mir nicht neu. Derartige Anspielungen gehörten schon zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen. Der Vorwurf meiner Abhängigkeit war in meinen Ohren zu einer abstrusen Litanei geworden, die zwar äußerst schmerzlich und niederschmetternd, mir aber nur halb verständlich war. Miss Abbot stimmte ein:
»Und Sie sollten sich nicht einbilden, mit den gnädigen Fräulein und dem jungen Herrn Reed auf einer Stufe zu stehn, nur weil die Gnädige so liebenswürdig ist und Sie mit ihnen gemeinsam aufwachsen lässt. Die jungen Herrschaften werden einmal eine Menge Geld haben und Sie keins. Ihre Stellung gebietet Ihnen, bescheiden und demütig zu sein und sich zu bemühen, ihnen stets freundlich und zuvorkommend zu begegnen.«
»Was wir Ihnen da sagen, ist nur zu Ihrem Besten«, fügte Bessie mit sanfterer Stimme hinzu. »Sie sollten versuchen, sich nützlich zu machen und liebenswürdiger zu sein, vielleicht würden Sie dann hier ein wirkliches Zuhause finden. Wenn Sie allerdings heftig und ausfallend werden, wird Sie die Gnädige ganz bestimmt fortschicken.«
»Außerdem«, sagte Miss Abbot, »wird Gott sie strafen. Er könnte sie mitten in einem ihrer Zornausbrüche tot umfallen lassen, und wohin käme sie dann wohl? Kommen Sie, Bessie, wir wollen gehen. Nicht um alles in der Welt möchte ich ihr Herz haben. Beten Sie, Miss Eyre, wenn Sie allein sind; denn wenn Sie nicht bereuen, könnte etwas Schlimmes den Kamin herunterkommen und Sie fortholen.«
Sie gingen, schlossen die Tür hinter sich und sperrten sie ab.
Das Rote Zimmer war ein Gästezimmer, in dem nur sehr selten jemand übernachtete – eigentlich nie, könnte ich sagen, wenn sich nicht gerade zufällig so viele Besucher in Gateshead Hall einfanden, dass alle verfügbaren Unterbringungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden mussten. Dabei war es einer der größten und prunkvollsten Räume des Herrenhauses. Ein von vier massiven Mahagonipfosten getragenes, mit dunkelroten Damastvorhängen versehenes Bett erhob sich in der Mitte wie ein Tabernakel, die beiden großen Fenster, deren Läden stets geschlossen blieben, waren hinter breiten Borten und Falten aus gleichem Stoff halb verborgen. Der Teppich war rot, und auch der Tisch am Fußende des Bettes war mit einem karmesinroten Tuch bedeckt. Die Wände hatten einen hellen Braunton mit einer Nuance Rosa darin; Kleiderschrank, Toilettentisch und Stühle waren aus dunkelpoliertem, altem Mahagoni. Von diesem ringsum herrschenden Dunkel hoben sich hoch und leuchtend hell die aufgetürmten Matratzen und Kissen ab, über die eine schneeweiße gesteppte Baumwolldecke gebreitet war. Kaum weniger auffallend war ein großer, ebenfalls weißer Polstersessel mit einem Fußschemel davor, der am Kopfende des Bettes stand und mir wie ein fahler, gespenstischer Thron vorkam.
Der Raum war kalt, weil hier nur selten ein Feuer brannte; still, weil er vom Kinderzimmer und den Küchen weit entfernt lag; feierlich, weil er, wie jeder wusste, kaum betreten wurde. Nur das Zimmermädchen kam samstags hierher, um den Staub, der sich im Verlauf einer Woche geräuschlos angesammelt hatte, von Spiegeln und Möbeln zu wischen; und Mrs. Reed selbst suchte ihn in größeren Zeitabständen auf, um den Inhalt eines bestimmten geheimen Schubfaches im Kleiderschrank durchzusehen, in dem sie verschiedene Urkunden, ihre Schmuckschatulle und ein Miniaturbildnis ihres verstorbenen Gatten aufbewahrte. Und in diesen letzten Worten liegt auch das Geheimnis des Roten Zimmers – der Bann, unter dem es trotz seiner Pracht zu einem so verlassenen Ort geworden war.
Mr. Reed war vor neun Jahren gestorben. In diesem Zimmer hatte er seinen letzten Atemzug getan; hier hatte er aufgebahrt gelegen; von hier hatten die Leichenträger den Sarg fortgetragen, und seit jenem Tag hatte ein Gefühl düsterer Ehrfurcht die Hausbewohner davor zurückschrecken lassen, den Raum häufig zu betreten.
Der Sitz, auf dem Bessie und die gestrenge Miss Abbot mich wie angenagelt zurückgelassen hatten, war ein niedriges Liegesofa in der Nähe des marmornen Kaminsimses. Vor mir erhob sich das Bett; zu meiner Rechten stand der hohe, dunkle Kleiderschrank, auf dessen polierten Flächen gedämpfte Lichtreflexe unzusammenhängende Muster zeichneten; zu meiner Linken befanden sich die verhüllten Fenster und zwischen ihnen ein großer Spiegel, in dem sich die Pracht und Leere von Bett und Raum wiederholten. Ich war mir nicht ganz sicher, ob die Tür wirklich abgeschlossen war, und als ich es endlich wagte, mich zu bewegen, stand ich auf, um nachzusehen. Aber ach, sie ließ sich nicht öffnen! Kein Kerker war jemals sicherer gewesen! Auf dem Weg zurück zu meinem Platz musste ich am Spiegel vorbei, und unwillkürlich erkundete mein Blick wie gebannt die Tiefe des Raumes, die er enthüllte. In seiner unwirklichen Perspektive wirkte alles noch kälter und düsterer, als es tatsächlich war, und die seltsame kleine Gestalt, die mich daraus anstarrte, sah mit ihrem bleichen Gesicht, ihren weißen Armen, die als helle Punkte das Dunkel durchbrachen, und den glänzenden Augen, die ängstlich um sich blickten, wo alles andere in tiefster Regungslosigkeit verharrte, wie ein richtiges Gespenst aus. Sie kam mir vor wie eines jener winzigen Geisterwesen, die – halb Fee, halb Kobold – Bessies abendlichen Geschichten zufolge im Moor einsamen, farnbewachsenen Talschluchten entstiegen und vor den Augen verspäteter Reisender auftauchten. Ich kehrte zum Sofa zurück.
In jenem Augenblick beschlich mich bereits abergläubische Furcht, doch die Stunde ihres vollkommenen Sieges über mich war noch nicht gekommen: Noch war mein Blut in Wallung, noch stärkte mich die Wut des aufbegehrenden Sklaven mit ihrer Kraft der Verbitterung. Ich musste erst gegen eine reißende Flut von Erinnerungen ankämpfen, ehe mich die bedrückende Gegenwart überwältigen konnte.
Die tyrannischen Quälereien John Reeds, die hochmütige Gleichgültigkeit seiner Schwestern, die Abneigung seiner Mutter, die Parteilichkeit der Dienstboten, all das stieg in meiner geistigen Erregung in mir auf wie trübe Ablagerungen in einem verschlammten Brunnen. Warum musste ich immer leiden? Warum wurde ich ständig gescholten, beschuldigt und verurteilt? Warum konnte ich es nie jemandem recht machen? Warum war es sinnlos zu versuchen, jemandes Gunst zu gewinnen? Die eigenwillige, selbstsüchtige Eliza wurde geachtet. Der verwöhnten Georgiana mit ihrer gehässigen Boshaftigkeit und ihrem zänkischen, unverschämten Betragen brachte jedermann Nachsicht entgegen. Ihre Schönheit, ihre rosigen Wangen und goldenen Locken schienen alle, die sie sahen, zu entzücken und ihr Straffreiheit für alle ihre Ungehörigkeiten zu erkaufen. Niemand gebot John Einhalt oder strafte ihn gar, obwohl er den Tauben den Hals umdrehte, die kleinen Pfauenküken tötete, die Hunde auf die Schafe hetzte, im Gewächshaus die Weinstöcke plünderte und die Knospen der erlesensten Pflanzen im Wintergarten knickte. Auch nannte er seine Mutter »altes Mädchen«, machte sich zuweilen über ihre dunkle Haut lustig, die der seinen ganz ähnlich war, setzte sich offen über ihre Wünsche hinweg, und nicht selten zerriss oder beschmutzte er ihre seidenen Kleider: trotz alledem war und blieb er »ihr kleiner Liebling«. Ich hingegen wagte nicht, auch nur die kleinste Unachtsamkeit zu begehen; ich bemühte mich vielmehr eifrig, allen meinen Pflichten nachzukommen, und doch schimpfte man mich von morgens bis mittags und von mittags bis abends ungezogen und mürrisch, widerspenstig und hinterhältig.
Mein Kopf schmerzte und blutete noch immer von dem Schlag, den ich erhalten hatte, und dem nachfolgenden Sturz. Niemand hatte John dafür getadelt, dass er mich mutwillig geschlagen hatte; aber ich, die ich mich gegen ihn zur Wehr gesetzt hatte, um weitere unberechenbare Gewalttätigkeiten seinerseits zu verhindern, wurde von allen Seiten mit Schimpf und Schande überhäuft.
»Es ist ungerecht! Ungerecht!«, sagte meine Vernunft, die aufgrund der quälenden Gedanken rasch, wenn auch nur vorübergehend, wieder Macht über mich gewann; und von wilder Entschlossenheit ergriffen, begann ich mir ungewöhnliche Mittel zu überlegen, um der unerträglich gewordenen Unterdrückung zu entrinnen – wie etwa davonzulaufen oder, falls das nicht möglich war, nichts mehr zu essen und zu trinken, bis ich vor Entkräftung stürbe.
Wie bestürzt und verstört war meine Seele an jenem trostlosen, düsteren Nachmittag! In welchem Aufruhr befanden sich meine Gedanken, wie sehr empörte sich mein Herz! Doch in welchem Dunkel, in welch krasser Unwissenheit musste ich diesen inneren Kampf führen! Ich konnte keine Antwort auf die unablässig bohrende Frage finden, warum ich so litt. Heute, nach – ich will nicht sagen, wie vielen – Jahren, sehe ich sie ganz klar.
Ich war ein Fremdkörper in Gateshead Hall; ich war anders als all die anderen, die dort lebten. Mit Mrs. Reed, ihren Kindern oder ihren auserwählten Vasallen hatte ich nichts gemein. Wenn sie mich nicht liebten, so liebte ich sie freilich ebenso wenig. Und schließlich waren sie nicht verpflichtet, einem Wesen Zuneigung entgegenzubringen, das keine ihrer Empfindungen und Ansichten zu teilen vermochte; einem so andersartigen Wesen, das sich in Temperament, Charakter und Neigungen grundlegend von ihnen unterschied; einem nutzlosen Wesen, unfähig, ihren Interessen zu dienen oder zu ihrem Vergnügen beizutragen; einem böswilligen Wesen, das es wagte, sich über ihre Behandlung zu entrüsten und ihr Urteil zu verachten. Wäre ich – obschon gleichermaßen abhängig und ohne Freunde – ein heiteres, begabtes, anspruchsvolles Kind, ein hübscher, ausgelassener Wildfang gewesen, hätte Mrs. Reed meine Anwesenheit gewiss mit mehr Wohlwollen ertragen; ihre Kinder hätten mir gegenüber mehr Herzlichkeit und Kameradschaft empfunden und die Dienstboten weniger Neigung verspürt, mich zum Sündenbock des Kinderzimmers zu machen.
Das Tageslicht wich allmählich aus dem Roten Zimmer; es war schon nach vier, und der bewölkte Nachmittag ging in trübes Zwielicht über. Ich hörte den Regen noch immer unablässig gegen das Treppenfenster trommeln und den Wind im Wäldchen hinter dem Haus heulen. Nach und nach wurde mir eiskalt, und mein Mut begann zu sinken. Das gewohnte Gefühl von Demütigung, Selbstzweifeln und trostloser Niedergeschlagenheit legte sich wie ein feuchtes Tuch auf die letzten Funken meines erlöschenden Zorns. Alle sagten, ich sei schlecht, und vielleicht war ich es auch wirklich: Hatte ich nicht eben daran gedacht, mich zu Tode zu hungern? Das war ohne Zweifel eine schwere Sünde. War ich denn überhaupt aufs Sterben vorbereitet? Oder war etwa die Gruft unter dem Chor der Kirche von Gateshead ein verlockender Ort? In dieser Gruft, so hatte man mir erzählt, lag Mr. Reed begraben. Beim Gedanken daran kam mir all das in den Sinn, was ich über ihn erfahren hatte, und mit wachsender Beklemmung dachte ich darüber nach. Ich konnte mich nicht an ihn erinnern, doch wusste ich, dass er mein richtiger Onkel – der Bruder meiner Mutter – gewesen war und dass er mich, als ich im Säuglingsalter meine Eltern verloren hatte, zu sich genommen und noch auf dem Totenbett Mrs. Reed das Versprechen abverlangt hatte, mich wie eines ihrer eigenen Kinder aufzuziehen und für mich zu sorgen. Wahrscheinlich war Mrs. Reed sogar davon überzeugt, sie habe dieses Versprechen erfüllt, und das hat sie wohl auch, soweit ihre Natur es ihr gestattete. Aber wie sollte sie einen Eindringling wirklich liebhaben, der nicht ihrer Familie entstammte und mit dem sie nach dem Tod ihres Gatten nichts mehr verband? Es muss ihr höchst lästig gewesen sein, durch eine nur ungern gegebene Zusage gebunden, Elternstelle bei einem fremden Kind zu vertreten, das sie nicht lieben konnte, und mitanzusehen, wie eine so andersartige, unsympathische Fremde ihrem eigenen Familienkreis auf Dauer aufgedrängt war.
Ein seltsamer Gedanke stieg in mir auf. Ich bezweifelte nicht – hatte niemals bezweifelt –, dass Mr. Reed, wäre er noch am Leben gewesen, mich gut und liebevoll behandelt hätte, und als ich nun so dasaß, das weiße Bett und die im Dunkeln liegenden Wände betrachtete und mein Blick immer wieder wie gebannt zu dem mattschimmernden Spiegel wanderte, begann ich mich an das zu erinnern, was ich über Verstorbene gehört hatte, die in ihren Gräbern keine Ruhe fanden, weil man ihre letzten Wünsche missachtet hatte, und die auf die Erde zurückkehrten, um die Eidesbrecher zu strafen und die Unterdrückten zu rächen. Ich glaubte, Mr. Reeds Geist könnte, beunruhigt über das Unrecht, das dem Kind seiner Schwester zugefügt wurde, seine Ruhestätte – in der Kirchengruft oder dem unbekannten Reich der Toten – verlassen und mir hier in diesem Zimmer erscheinen. Rasch trocknete ich mir die Tränen und unterdrückte mein Schluchzen, aus Angst, jedwede Bekundung so großen Kummers könnte eine Stimme aus dem Jenseits wecken, die mir Trost zusprechen wollte, oder aus der Dunkelheit ein von einem Heiligenschein umrahmtes Antlitz heraufbeschwören, das sich aus mir unbekanntem Mitleid über mich beugte. Der Gedanke, diese eigentlich recht tröstliche Vorstellung könnte Wirklichkeit werden, erfüllte mich indes bald mit einem Gefühl des Grauens. Mit aller Macht versuchte ich, es zu verdrängen, und bemühte mich, tapfer zu sein. Ich schüttelte das Haar aus der Stirn und hob den Kopf, um mich mutig in dem dunklen Zimmer umzusehen. In diesem Augenblick fiel ein schwacher Lichtschein auf die Wand. War es, fragte ich mich, das Licht des Mondes, das durch eine Ritze im Fensterladen drang? Nein, denn Mondlicht verharrte ruhig an einer Stelle, und dieses hier bewegte sich. Vor meinem entsetzten Blick glitt es an die Decke hinauf und hielt zitternd über meinem Kopf inne. Heute kann ich mir ohne weiteres denken, dass dieser Lichtstrahl sehr wahrscheinlich von einer Laterne stammte, die jemand draußen über den Rasen trug; doch damals, als ich innerlich auf etwas Schreckliches gefasst war und meine Nerven aufgrund meiner Erregung völlig überreizt waren, glaubte ich in dem über die Wand huschenden Lichtstrahl den Vorboten einer Erscheinung aus einer anderen Welt vor mir zu haben. Mein Herz schlug wild, mein Kopf begann zu glühen. Ein Rauschen, das mir wie Flügelschlagen klang, drang an mein Ohr. Etwas schien ganz in meiner Nähe zu sein. Ich fühlte mich bedrängt, dem Ersticken nahe. Länger hielt ich es einfach nicht mehr aus. Ich stürzte zur Tür und rüttelte in verzweifelter Anstrengung daran. Eilige Schritte näherten sich draußen auf dem Flur, der Schlüssel wurde umgedreht, Bessie und Abbot betraten das Zimmer.
»Miss Eyre, sind Sie krank?«, fragte Bessie.
»Was für ein entsetzlicher Lärm! Er ist mir durch Mark und Bein gegangen«, rief Abbot.
»Lassen Sie mich hinaus! Lassen Sie mich ins Kinderzimmer!«, flehte ich.
»Warum denn? Sind Sie verletzt? Haben Sie etwas gesehen?«, forschte Bessie weiter.
»O ja! Ich habe ein Licht gesehen, und ich habe geglaubt, gleich würde ein Geist erscheinen.« Ich hatte unterdessen Bessies Hand ergriffen, und sie entzog sie mir nicht.
»Sie hat absichtlich geschrien«, erklärte Abbot entrüstet. »Und wie sie geschrien hat! Wenn sie große Schmerzen gehabt hätte, wäre es noch verzeihlich gewesen, aber sie wollte ja nur, dass wir alle herkommen. Ich kenne ihre üblen Streiche.«
»Was hat das alles zu bedeuten?«, fragte eine andere Stimme gebieterisch, und mit wehenden Haubenbändern und laut raschelnden Röcken kam Mrs. Reed den Korridor entlanggeeilt. »Abbot, Bessie, habe ich nicht strikte Anweisung gegeben, dass Jane Eyre im Roten Zimmer zu bleiben hat, bis ich selbst sie herauslasse?«
»Miss Jane hat so laut geschrien, gnädige Frau«, wandte Bessie ein.
»Lassen Sie sie los«, war die einzige Antwort. »Lass Bessies Hände los, Kind. Mit derlei Schlichen wirst du hier nicht herauskommen, das kann ich dir versichern. Ich verabscheue Verschlagenheit – vor allem bei Kindern. Es ist meine Pflicht, dich zu lehren, dass man mit List und Tücke nicht weiterkommt. Dafür wirst du noch eine Stunde länger hier bleiben, und auch dann werde ich dich nur freilassen, wenn du artig und mucksmäuschenstill warst.«
»Ach Tante! Haben Sie Mitleid! Vergeben Sie mir! Ich kann es nicht ertragen. Bestrafen Sie mich doch auf irgendeine andere Art. Ich sterbe, wenn –«
»Schweig! Diese Heftigkeit ist ja schon widerlich.« Und zweifellos empfand sie es so. In ihren Augen war ich eine frühreife Schauspielerin, und sie war aufrichtig davon überzeugt, in mir eine Mischung von bösartigen Leidenschaften, Durchtriebenheit und gefährlicher Falschheit vor sich zu haben.
Als Bessie und Abbot sich zurückgezogen hatten, stieß mich Mrs. Reed – meiner mittlerweile unbändigen Angst und meines zügellosen Schluchzens überdrüssig – plötzlich in das Zimmer zurück und schloss mich, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, erneut ein. Ich hörte sie davonrauschen, und bald nachdem sie sich entfernt hatte, muss ich eine Art Anfall erlitten haben: ich verlor das Bewusstsein.
Kapitel 3
Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich mit dem Gefühl aufwachte, einen entsetzlichen Alptraum gehabt zu haben. Vor mir sah ich einen grässlichen grellroten Schein, der von dicken schwarzen Gitterstäben durchbrochen war. Auch vernahm ich Stimmen, die ganz hohl klangen, als würden sie durch das Rauschen von Wind oder Wasser gedämpft: Aufregung, Ungewissheit und ein übermächtiges Gefühl des Schreckens verwirrten meine Sinne. Bald wurde ich gewahr, dass jemand sich um mich bemühte, mich aufrichtete und mich beim Sitzen stützte, und dies liebevoller und behutsamer, als ich je aufgerichtet oder gestützt worden war. Ich lehnte meinen Kopf gegen ein Kissen oder einen Arm und fühlte mich wohl.
Fünf Minuten später war die Verwirrung, die meinen Geist getrübt hatte, gewichen, und ich erkannte, dass ich in meinem eigenen Bett lag und der rote Schein vom Kaminfeuer im Kinderzimmer kam. Es war Nacht; auf dem Tisch brannte eine Kerze; Bessie stand am Fußende des Bettes mit einer Schüssel in der Hand, und auf einem Stuhl neben meinem Kopfkissen saß ein Herr und beugte sich über mich.
Ich verspürte eine unsägliche Erleichterung, ein beruhigendes Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit, als ich bemerkte, dass ein Fremder im Raum war, jemand, der nicht zu Gateshead gehörte und nichts mit Mrs. Reed zu tun hatte. Ich wandte mich von Bessie ab (obgleich mir ihre Anwesenheit weitaus weniger unangenehm war, als es zum Beispiel die von Abbot gewesen wäre) und betrachtete das Gesicht des fremden Herrn. Ich erkannte ihn: Es war Mr. Lloyd, ein Apotheker, den Mrs. Reed gelegentlich holen ließ, wenn einer der Dienstboten krank war; für sich selbst und die Kinder pflegte sie stets einen Arzt zu rufen.
»Nun, wer bin ich?«, fragte er.
Ich nannte seinen Namen und reichte ihm dabei die Hand. Er ergriff sie lächelnd und sagte: »Mit der Zeit werden wir gewiss wieder ganz gesund werden.« Dann ließ er mich in die Kissen zurückgleiten und schärfte Bessie ein, darauf zu achten, dass ich während der Nacht nicht gestört würde. Nachdem er noch einige weitere Anweisungen gegeben und angekündigt hatte, dass er am nächsten Tag wiederkommen wolle, ging er zu meinem großen Leidwesen fort, denn solange er auf seinem Stuhl neben meinem Kissen saß, hatte ich mich beschützt und nicht so verlassen gefühlt; als er jedoch die Tür hinter sich schloss, wurde das ganze Zimmer wieder düster, und mein Mut verließ mich erneut: unbeschreibliche Traurigkeit machte mir das Herz schwer.
»Glauben Sie, Sie können jetzt schlafen, Miss?«, fragte Bessie mit ungewöhnlich sanfter Stimme.
Ich wagte kaum zu antworten, denn ich fürchtete, der nächste Satz könnte schon wieder barsch sein. »Ich werde es versuchen.«
»Möchten Sie etwas trinken, oder können Sie etwas essen?«
»Nein, danke, Bessie.«
»Dann werde ich jetzt wohl besser auch zu Bett gehen, es ist schon nach zwölf. Rufen Sie mich aber ruhig, wenn Sie während der Nacht etwas brauchen.«
Welch wunderbare Höflichkeit! Sie ermutigte mich, eine Frage zu stellen.
»Bessie, was ist mit mir? Bin ich krank?«
»Wahrscheinlich sind Sie im Roten Zimmer vor lauter Weinen ohnmächtig geworden. Aber sicher geht es Ihnen bald wieder besser.«
Bessie ging in die Kammer des Hausmädchens, die sich gleich nebenan befand. Ich hörte, wie sie sagte:
»Schlafen Sie doch bei mir im Kinderzimmer, Sarah; nicht um alles in der Welt möchte ich heute Nacht mit dem armen Kind allein sein; es könnte sterben. Seltsam, dass sie diesen Anfall hatte. Ich frage mich, ob sie irgendetwas gesehen hat. Die Gnädige war diesmal wirklich zu streng.«
Sarah kam mit ihr zurück; sie legten sich beide hin und flüsterten noch eine halbe Stunde miteinander, bevor sie einschliefen. Ich fing Fetzen ihres Gesprächs auf, denen ich nur allzu deutlich entnehmen konnte, worüber sie sich unterhielten.
»Etwas huschte an ihr vorbei, etwas ganz in Weiß Gekleidetes, und verschwand« – »Ein großer schwarzer Hund folgte ihm« – »Drei laute Schläge an die Zimmertür« – »Ein Licht auf dem Friedhof, genau über seinem Grab« – etc.
Endlich schliefen beide; Feuer und Kerze erloschen. Für mich aber schleppten sich die Stunden jener endlos langen Nacht in schauriger Schlaflosigkeit dahin: Auge, Ohr und Geist waren gleichermaßen angespannt in grauenvoller Furcht, wie nur Kinder sie zu empfinden vermögen.
Der Zwischenfall im Roten Zimmer hatte keine ernstliche oder längere körperliche Erkrankung zur Folge, doch meine Nerven hatten einen Schock erlitten, dessen Nachwirkungen ich noch heute spüre. Ja, Mrs. Reed, Ihnen verdanke ich manch furchtbare Seelenqual. Aber ich sollte Ihnen vergeben, denn Sie wussten nicht, was Sie taten: Sie glaubten, nur meine schlechten Eigenschaften auszurotten, während Sie mir in Wirklichkeit das Herz brachen.
Am nächsten Tag zur Mittagszeit war ich schon wieder auf und angekleidet und saß, in einen Schal gehüllt, im Kinderzimmer am Kamin. Ich fühlte mich körperlich schwach und erschöpft, aber das Schlimmste war die unsägliche Niedergeschlagenheit, unter der ich litt – eine Niedergeschlagenheit, die mich fortwährend still vor mich hinweinen ließ. Kaum hatte ich einen salzigen Tropfen von meiner Wange gewischt, folgte schon der nächste. Dabei hatte ich das Gefühl, dass ich eigentlich hätte glücklich sein müssen, denn keiner der Reeds war da – sie waren alle mit ihrer Mama in der Kutsche ausgefahren. Auch Abbot nähte in einem anderen Zimmer, und Bessie richtete von Zeit zu Zeit in ungewohnt freundlichem Ton ein Wort an mich, während sie im Zimmer hin und her lief und dabei Spielsachen wegräumte und Schubladen in Ordnung brachte. Dieser Zustand hätte mir, die ich an nichts anderes gewöhnt war als unablässigen Tadel und undankbare Schinderei, wie ein Paradies des Friedens vorkommen müssen, doch meine gepeinigten Nerven befanden sich in einer solchen Verfassung, dass weder Ruhe sie zu besänftigen noch Angenehmes sie zu erfreuen vermochte.
Bessie war in der Küche unten gewesen und brachte mir ein Stück Torte auf einem buntbemalten Porzellanteller mit herauf, auf dem ein Paradiesvogel in einem Kranz von Winden und Rosenknospen abgebildet war und den ich stets mit Hingabe bewundert hatte. Wie oft hatte ich darum gebettelt, den Teller in die Hand nehmen zu dürfen, um ihn genauer betrachten zu können, doch war ich bis dahin einer solchen Gunst nie für würdig befunden worden. Diesen kostbaren Gegenstand stellte Bessie mir nun auf die Knie und forderte mich herzlich auf, das Stückchen köstlichen Gebäcks darauf zu essen. Vergebliche Gunst! Sie kam, wie die meisten lange verweigerten und oft ersehnten Gefälligkeiten, zu spät. Ich konnte den Kuchen nicht essen, und das Federkleid des Vogels, die Farben der Blumen schienen seltsam verblasst. Ich stellte Teller und Kuchen zur Seite. Bessie fragte, ob ich ein Buch haben wolle. Das Wort Buch weckte vorübergehend meine Lebensgeister, und ich bat sie, mir Gullivers Reisen aus der Bibliothek zu holen. Dieses Buch hatte ich immer wieder mit Vergnügen gelesen. Ich hielt es für eine Schilderung wahrer Begebenheiten und entdeckte darin Dinge, die mich mehr fesselten als das, was Märchen mir zu geben vermochten. Denn was die Elfen anbetraf, so hatte ich mich, nachdem ich sie unter Fingerhutblättern und -glocken, zwischen Pilzen und in efeuumrankten alten Mauernischen vergeblich gesucht hatte, schließlich mit der traurigen Wahrheit abgefunden, dass sie England verlassen und sich in ein unwegsameres Land geflüchtet hatten, wo die Wälder noch dicht und undurchdringlich waren und nur wenige Menschen lebten. Dagegen war ich überzeugt, dass Lilliput und Brobdingnag feste Bestandteile des Globus waren, und ich bezweifelte nicht, dass ich eines Tages nach einer langen Reise mit meinen eigenen Augen die kleinen Felder, Häuser und Bäume, die zwergenhaften Menschen, die winzigen Kühe, Schafe und Vögel des einen und auch die baumhohen Getreidefelder, die mächtigen Doggen, die Riesenkatzen und turmhohen Männer und Frauen des anderen Reiches sehen würde. Doch als ich das geliebte Buch nun in den Händen hielt, als ich in seinen Seiten blätterte und in seinen wunderbaren Bildern den Zauber suchte, den ich bisher immer darin entdeckt hatte, war alles unheimlich und bedrückend: Die Riesen waren ausgemergelte Kobolde, die Pygmäen bösartige, furchterregende kleine Teufel, Gulliver ein einsamer, hoffnungsloser Wanderer in schaurigen und gefährlichen Gegenden. Ich klappte das Buch zu, in dem ich nun nicht mehr zu lesen wagte, und legte es neben den unberührten Kuchen auf den Tisch.
Bessie war mittlerweile mit Staubwischen und Aufräumen fertig, und nachdem sie sich die Hände gewaschen hatte, öffnete sie eine kleine Schublade voller herrlicher Seiden- und Satinreste und machte sich daran, Georgianas Puppe eine neue Haube zu nähen. Dabei sang sie das Lied:
»Als einst wir übers Land gezogen,
Lang, lang ist’s her.«
Ich hatte es schon oft gehört, und zwar stets mit großem Entzücken, denn Bessie hatte eine angenehme Stimme – wenigstens fand ich das. Und obwohl ihre Stimme auch an diesem Tag hübsch klang, schien mir nun mit einem Mal eine unbeschreibliche Traurigkeit in der Melodie zu liegen. Zuweilen, wenn die Arbeit ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, sang sie den Refrain ganz leise und gedehnt, und dann ertönte ihr »Lang, lang ist’s her« wie der herzzerreißende Schluss einer Totenklage. Danach sang sie eine andere, diesmal wirklich traurige Ballade.
»Meine Füße sind wund und schwer meine Glieder,
Lang ist der Weg, den ich gehe geschwind.
Bald schon sinkt düster die Dämmerung nieder
Auf den Pfad, auf das arme Waisenkind.
Warum schicken sie mich fort, so einsam und weit
Ins Moor, wo nur Heide und Felsen ich find?
Die Menschen sind hart, nur die Engel vor Leid
Bewahren das arme Waisenkind.
Am Himmel funkeln die Sterne als glitzerndes Band,
Aus der Ferne weht sacht nur der nächtliche Wind:
Gott in seiner Gnade hebt schützend die Hand,
Spendet Hoffnung und Trost dem Waisenkind.
Und sollt ich auch gleiten vom morschen Steg,
Mich verlaufen im Moor, vor Irrlichtern blind,
Gott der Vater wird mich leiten auf meinem Weg,
Zu sich heimführn das arme Waisenkind.
Und wenn meine Kräfte dereinst einmal schwinden,
Geborgenheit, Familie versagt mir hier sind:
Der Himmel ist mein Zuhaus, eine Heimstatt werd ich dort finden,
Denn Gott ist ein Freund dem armen Waisenkind.«
»Aber, aber! So weinen Sie doch nicht, Miss Jane«, rief Bessie, als sie geendet hatte. Ebenso gut hätte sie zum Feuer sagen können: »Brenne nicht!« Doch wie sollte sie ahnen, welch krankhafte Niedergeschlagenheit sich meiner bemächtigt hatte! Im Laufe des Vormittags kam Mr. Lloyd wieder.
»Was, schon auf?«, sagte er, als er ins Kinderzimmer trat. »Nun, Bessie, wie geht es ihr?«
Bessie antwortete, es ginge mir schon recht gut.
»Dann sollte sie eigentlich fröhlicher aussehen. Kommen Sie einmal her zu mir, Miss Jane. Sie heißen doch Jane, nicht wahr?«
»Ja, Sir. Jane Eyre.«
»Sie haben geweint, Miss Jane Eyre. Können Sie mir sagen, weshalb? Haben Sie Schmerzen?«
»Nein, Sir.«
»Ach, bestimmt weint sie, weil sie nicht mit der Gnädigen in der Kutsche ausfahren konnte«, warf Bessie ein.
»Das glaube ich kaum! Für solche Kinderlaunen ist sie doch schon zu alt.«
Der Meinung war ich auch, und da meine Selbstachtung durch die falsche Anschuldigung verletzt worden war, erwiderte ich rasch: »Mein ganzes Leben lang habe ich noch nie wegen so etwas geweint. Ich hasse es geradezu, im Wagen auszufahren. Ich weine, weil mir so elend zumute ist.«
»Pfui, Miss!«, schalt Bessie.
Der gute Apotheker schien ein wenig erstaunt. Ich stand vor ihm, und er musterte mich aufmerksam. Seine Augen waren klein und grau und glänzten nicht sehr, doch würde ich sie heute wohl als klug bezeichnen. Er hatte harte Gesichtszüge, wirkte aber trotzdem gutmütig. Nachdem er mich ausgiebig betrachtet hatte, fragte er: »Was hat Sie gestern krank gemacht?«
»Sie ist hingefallen«, mischte sich Bessie erneut ein.
»Hingefallen? Das klingt ja schon wieder, als wäre sie noch ein kleines Kind! Kann sie denn noch nicht richtig laufen? In ihrem Alter? Sie muss doch acht oder neun Jahre alt sein.«
»Ich wurde zu Boden geschlagen«, erklärte ich unverblümt, da mein Stolz erneut verletzt worden war. »Aber das hat mich nicht krank gemacht«, fügte ich hinzu, während Mr. Lloyd eine Prise Schnupftabak nahm.
Als er die Dose wieder in seiner Westentasche verstaute, rief eine laute Glocke die Dienstboten zum Mittagessen. Auch Mr. Lloyd wusste, was das Läuten zu bedeuten hatte. »Das gilt Ihnen, Fräulein«, wandte er sich an Bessie. »Gehen Sie ruhig hinunter. Ich werde Miss Jane ins Gebet nehmen, bis Sie zurückkommen.«
Bessie wäre zwar lieber dageblieben, musste aber gehen, denn in Gateshead Hall wurde auf Pünktlichkeit bei den Mahlzeiten streng geachtet.
»Der Sturz hat Sie also nicht krank gemacht. Was war es denn dann?«, fuhr Mr. Lloyd fort, nachdem Bessie gegangen war.
»Ich war bis nach Einbruch der Dunkelheit in einem Zimmer eingeschlossen, in dem es spukt.«
Ich bemerkte, dass Mr. Lloyd lächelte, dabei aber gleichzeitig die Stirn runzelte. »Spukt! Dann sind Sie ja doch noch ein kleines Kind! Sie haben Angst vor Geistern?«
»Vor Mr. Reeds Geist schon. Er starb in dem Zimmer und wurde dort aufgebahrt. Weder Bessie noch sonst jemand geht bei Dunkelheit hinein, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt; und es war grausam, mich dort ganz allein und ohne Kerze einzusperren – so grausam, dass ich es wohl niemals vergessen werde.«
»Unsinn! Und deshalb ist Ihnen elend zumute? Fürchten Sie sich denn jetzt am helllichten Tag auch?«
»Nein, aber es wird bald wieder Nacht werden; außerdem bin ich aus ganz anderen Gründen unglücklich – sehr unglücklich sogar.«
»Was sind denn das für Gründe? Können Sie mir ein paar nennen?«
Wie gern hätte ich diese Frage ausführlich und aufrichtig beantwortet! Wie schwer fiel es mir indes schon, überhaupt eine Antwort zu geben! Kinder sind wohl tiefer Gefühle fähig, vermögen sie aber nicht zu erklären; und selbst wenn es ihnen in Gedanken gelingt, sich wenigstens teilweise darüber klar zu werden, wissen sie doch nicht, wie sie das Ergebnis ihrer Überlegungen in Worte fassen sollen. Aus Angst, die erste und einzige Gelegenheit zu versäumen, mir meinen Kummer von der Seele zu reden und mir damit ein wenig Erleichterung zu verschaffen, brachte ich nach einer Weile angestrengten Nachdenkens allerdings doch noch eine zwar etwas dürftige, aber immerhin wahrheitsgemäße Antwort zustande.
»Erstens habe ich weder Vater noch Mutter und auch keine Geschwister.«
»Sie haben eine gütige Tante, einen netten Vetter und liebenswürdige Kusinen.«
Wieder zögerte ich. Dann platzte ich unbeholfen heraus:
»Aber John Reed hat mich zu Boden geschlagen, und meine Tante hat mich im Roten Zimmer eingesperrt.«
Mr. Lloyd holte ein zweites Mal seine Schnupftabakdose hervor.
»Finden Sie nicht, dass Gateshead Hall ein wunderschönes Haus ist?«, fragte er. »Sind Sie denn nicht zutiefst dankbar, dass Sie an einem so schönen Ort leben dürfen?«
»Es ist ja nicht mein Haus, Sir; und Abbot sagt, ich hätte weniger Recht, hier zu sein, als ein Dienstbote.«
»Pah! Sie werden doch nicht so töricht sein, von einem so herrlichen Ort fortzuwollen?«
»Wenn ich irgendwo anders hin könnte, würde ich Gateshead Hall gern verlassen; aber ich werde von hier wohl erst wegkommen, wenn ich erwachsen bin – vorher nicht.«
»Vielleicht doch – wer weiß? Haben Sie irgendwelche Verwandte außer Mrs. Reed?«
»Ich glaube nicht, Sir.«
»Keine Verwandten väterlicherseits?«
»Ich weiß es nicht; ich habe Tante Reed einmal danach gefragt, und sie sagte, möglicherweise hätte ich noch ein paar arme, heruntergekommene Verwandte namens Eyre, aber sie wisse nichts von ihnen.«
»Falls es solche Verwandte wirklich gäbe – würden Sie dann zu ihnen gehen wollen?«
Ich überlegte. Armut erscheint schon Erwachsenen als etwas Schreckliches, und Kindern noch viel mehr. Sie haben kaum eine Vorstellung von der ehrbaren Armut anständiger, arbeitsamer Menschen und verbinden den Begriff meist nur mit zerlumpter Kleidung, kärglichem Essen, kalten Kaminen, rohen Manieren und entwürdigenden Lastern. Armut war für mich gleichbedeutend mit Erniedrigung.
»Nein, zu armen Leuten möchte ich nicht gehören«, lautete meine Antwort.
»Auch nicht, wenn sie gut zu Ihnen wären?«
Ich schüttelte den Kopf; ich konnte mir nicht vorstellen, wie arme Leute es fertigbringen sollten, gut zu sein. Und dann der Gedanke, einmal so zu sprechen wie sie, ihre Umgangsformen anzunehmen, ungebildet zu sein und aufzuwachsen wie eine der Frauen, die ich manchmal im Dorf vor den Türen ihrer Hütten ihre Kinder stillen oder Wäsche waschen sah – nein, ich war nicht heroisch genug, mir meine Freiheit auf Kosten meiner gesellschaftlichen Stellung zu erkaufen.
»Aber sind Ihre Verwandten denn wirklich so arm? Sind es Arbeiter?«
»Ich kann es Ihnen nicht sagen. Tante Reed meint, wenn ich überhaupt welche hätte, so könnte es nur Bettelvolk sein, und betteln gehen möchte ich nicht.«
»Würden Sie gern zur Schule gehen?«
Wieder überlegte ich. Ich wusste kaum, was eine Schule war. Bessie sprach zuweilen davon als einem Ort, wo junge Mädchen aus vornehmem Hause mit einem Brett auf dem Rücken kerzengerade auf harten Bänken sitzen und sich schrecklich geziert und steif benehmen mussten. John Reed hasste seine Schule und schimpfte über seinen Lehrer, doch John Reeds Ansichten waren für mich kein Maßstab, und wenn Bessies Schilderungen von schulischer Zucht und Ordnung (die von den jungen Damen einer Familie stammten, bei der sie in Dienst gewesen war, ehe sie nach Gateshead kam) einerseits auch recht abschreckend waren, so hatten andererseits ihre Berichte über gewisse Fertigkeiten, die die jungen Damen dort erwarben, für mich etwas Verlockendes. Voller Stolz erzählte sie von herrlichen Landschafts- und Blumenbildern, die diese gemalt hatten; von Liedern, die sie singen, und Musikstücken, die sie spielen konnten, von Geldbörsen, die sie in feiner Filetarbeit häkelten, von französischen Büchern, die sie übersetzen konnten, bis in mir beim Zuhören schließlich das Verlangen wuchs, es ihnen gleichzutun. Für mich würde ein Schulbesuch zudem eine grundlegende Veränderung bedeuten: eine lange Reise, eine vollständige Trennung von Gateshead und den ersten Schritt in ein neues Leben.
»Ich würde sehr gern zur Schule gehen«, war die laut geäußerte Schlussfolgerung aus meinen Überlegungen.
»So, so. Nun, wer weiß, was passieren wird?«, sagte Mr. Lloyd und erhob sich. »Dem Kind würde eine Luftveränderung und eine andere Umgebung guttun«, fügte er, mehr zu sich selbst, hinzu. »Nervlich in keiner guten Verfassung.«
In diesem Augenblick kam Bessie zurück, und gleichzeitig hörte man den Wagen den Kiesweg herauffahren.
»Ist das Ihre Herrin?«, wandte sich Mr. Lloyd an Bessie. »Ich würde gern mit ihr sprechen, bevor ich gehe.«
Bessie bat ihn, im Frühstückszimmer zu warten, und führte ihn dorthin. Die späteren Ereignisse veranlassen mich zu der Vermutung, dass der Apotheker in der folgenden Unterredung meiner Tante nahegelegt haben muss, mich auf eine Schule zu schicken. Seine Empfehlung wurde ohne Zweifel nur zu bereitwillig angenommen, wie ich einer Bemerkung Abbots entnehmen konnte, die sie eines Abends machte, als sie mit Bessie im Kinderzimmer saß und nähte. Ich lag im Bett, und Bessie und Abbot, die wohl annahmen, ich schliefe schon, unterhielten sich über mich. Mrs. Reed sei gewiss überaus froh, erklärte Abbot, ein so lästiges, bösartiges Kind loszuwerden, das immer den Eindruck mache, als beobachte es alle und jeden und führe stets irgendetwas im Schilde. Ich glaube, Abbot hielt mich für eine Art kindlichen Guy Fawkes.
Bei dieser Gelegenheit erfuhr ich auch aus dem, was Miss Abbot Bessie erzählte, dass mein Vater ein armer Geistlicher gewesen war; dass meine Mutter ihn gegen den Willen ihrer Angehörigen geheiratet hatte, die die Verbindung für nicht standesgemäß hielten; dass mein Großvater Reed über ihren Ungehorsam äußerst erzürnt war und er sie bis auf den letzten Shilling enterbte; dass mein Vater ein Jahr nach der Hochzeit an Typhus erkrankte, als er Krankenbesuche bei den Armen seiner in einer großen Industriestadt gelegenen Pfarre machte, während die Seuche dort wütete, und dass meine Mutter sich bei ihm ansteckte und beide innerhalb eines Monats starben.
Als Bessie diese Geschichte hörte, seufzte sie und sagte: »Die arme Miss Jane kann einem aber auch leidtun, Abbot.«
»Ja«, erwiderte Abbot, »wenn sie ein liebes, hübsches Kind wäre, könnte man Mitleid mit ihr haben, so einsam und verlassen, wie sie ist, aber eine solch kleine Kröte kann man beim besten Willen nicht gern haben.«
»Nicht sehr, das stimmt schon«, pflichtete Bessie ihr bei, »jedenfalls würde eine Schönheit wie Miss Georgiana unter den gleichen Umständen viel rührender wirken.«
»O ja, in Miss Georgiana bin ich ganz vernarrt!«, rief Abbot begeistert. »Ein richtiger kleiner Schatz! Mit ihren langen Locken und blauen Augen und ihrem rosigen Teint sieht sie fast aus wie gemalt! – Ich hätte Lust auf eine überbackene Käseschnitte zum Nachtessen, Bessie.«
»Ich auch – mit einer gerösteten Zwiebel. Kommen Sie, wir wollen hinuntergehen.« Und damit gingen sie.
Kapitel 4
Aus meinem Gespräch mit Mr. Lloyd und der eben geschilderten Unterhaltung zwischen Bessie und Abbot schöpfte ich genügend Hoffnung, um wieder gesund werden zu wollen: eine Veränderung schien bevorzustehen – ich sehnte sie herbei und harrte schweigend aus. Sie ließ indes auf sich warten; Tage und Wochen verstrichen. Ich war inzwischen wieder völlig hergestellt, doch das Thema, das mich so beschäftigte, wurde mit keiner Silbe mehr erwähnt. Mrs. Reed musterte mich zwar zuweilen mit ernstem Blick, richtete aber nur selten ein Wort an mich. Seit meiner Krankheit zog sie eine noch schärfere Trennungslinie als früher zwischen mir und ihren eigenen Kindern: Sie hatte mir eine kleine Kammer zugewiesen, in der ich allein schlafen musste, und mich dazu verurteilt, meine Mahlzeiten für mich einzunehmen. Außerdem musste ich die ganze Zeit im Kinderzimmer bleiben, während mein Vetter und meine Kusinen ständig im Wohnzimmer sein durften. Zwar sprach sie nie davon, mich auf eine Schule zu schicken, doch fühlte ich instinktiv, dass sie mich nicht mehr lange unter ihrem Dach dulden würde, denn wenn ihr Blick auf mich fiel, so war darin deutlicher denn je eine unüberwindliche und tiefverwurzelte Abneigung zu lesen.
Eliza und Georgiana hatten offensichtlich Anweisung erhalten, so wenig wie möglich mit mir zu sprechen, und hielten sich daran. John schnitt jedes Mal Fratzen, wenn er mich sah, und einmal versuchte er sogar, mich zu schlagen. Da ich mich jedoch, angetrieben von demselben Gefühl unbändiger Wut und verzweifelten Aufbegehrens, das schon einmal den Teufel in mir geweckt hatte, augenblicklich zur Wehr setzte, hielt er es für besser, mich in Frieden zu lassen: Verwünschungen ausstoßend und beteuernd, ich hätte ihm die Nase eingeschlagen, rannte er davon. Tatsächlich hatte ich diesem markanten Körperteil mit aller Kraft, deren meine Knöchel fähig waren, einen Schlag versetzt; und als ich merkte, dass entweder dieser oder mein Blick ihn einschüchterten, hatte ich größte Lust, meinen Vorteil zielstrebig auszunutzen, aber da war er schon bei seiner Mama. Ich hörte, wie er weinerlich von »dieser niederträchtigen Jane Eyre« zu erzählen begann, die wie eine Wildkatze auf ihn losgegangen sei. Recht schroff wurde ihm Einhalt geboten:
»Erzähl mir nichts von ihr, John. Ich habe dir gesagt, du sollst nicht in ihre Nähe kommen. Sie ist es gar nicht wert, dass man sie beachtet. Ich wünsche nicht, dass du oder deine Schwestern euch mit ihr abgebt.«
In diesem Augenblick lehnte ich mich oben über das Treppengeländer und rief, ohne auch nur im Geringsten über meine Worte nachzudenken, hinunter:
»Sie sind es nicht wert, dass ich mich mit ihnen abgebe.«
Mrs. Reed war eine recht korpulente Frau, aber als sie diese unerhörte, dreiste Äußerung vernahm, kam sie behände die Treppe heraufgelaufen, fegte mich wie ein Wirbelwind ins Kinderzimmer, drückte mich auf die Kante meines Bettes nieder und befahl mir in unmissverständlichem Ton, es nicht zu wagen, mich für den Rest des Tages vom Fleck zu rühren oder auch nur eine Silbe von mir zu geben.
»Was würde Onkel Reed dazu sagen, wenn er noch am Leben wäre?«, fragte ich fast gegen meinen Willen. Ich sage fast gegen meinen Willen, denn es schien, als äußerte mein Mund Worte, ohne dass ich es wollte: aus mir sprach etwas, worüber ich keine Macht hatte.
»Was?«, stieß Mrs. Reed leise hervor. Ihre sonst so kalten, gelassen blickenden grauen Augen nahmen einen beunruhigten, ja ängstlichen Ausdruck an. Sie ließ meinen Arm los und starrte mich an, als wüsste sie wirklich nicht, ob ich ein Kind war oder ein Teufel. Mir stand nichts Gutes bevor.
»Onkel Reed ist im Himmel und kann alles sehen, was Sie tun und denken, und Papa und Mama sehen es auch. Sie wissen, dass Sie mich den ganzen Tag lang einsperren und dass Sie wünschen, ich wäre tot.«
Mrs. Reed gewann ihre Fassung rasch wieder. Sie schüttelte mich tüchtig, versetzte mir rechts und links eine Ohrfeige und ging dann ohne ein weiteres Wort hinaus. An ihrer Stelle kam Bessie herein, die mir in einer einstündigen Strafpredigt unwiderlegbar nachwies, dass ich das ungezogenste und verworfenste Kind war, das je unter einem Dach aufgezogen worden war. Ich glaubte ihr beinahe, denn ich fühlte tatsächlich nur noch böse Regungen in meiner Brust.
November, Dezember und der halbe Januar gingen vorüber. Weihnachten und Neujahr waren in Gateshead in der üblichen Festtagsstimmung begangen worden. Geschenke waren ausgetauscht, Essen und Abendgesellschaften gegeben worden. Von all den Vergnügungen war ich natürlich ausgeschlossen. Mein Anteil an der festlichen Fröhlichkeit beschränkte sich darauf zuzusehen, wie Eliza und Georgiana jeden Tag herausgeputzt wurden und wie sie in ihren dünnen Musselinkleidern und roten Schärpen und mit kunstvoll gelocktem Haar die Treppe hinunterschritten. Und danach lauschte ich den Klängen des Klaviers oder der Harfe, die aus dem Salon zu mir heraufdrangen. Ich hörte das geschäftige Hin und Her der Diener, das Klirren und Klappern von Gläsern und Porzellan, wenn Erfrischungen gereicht wurden, und zuweilen fing ich ein paar Gesprächsfetzen auf, wenn unten die Türen zum Salon geöffnet und wieder geschlossen wurden. War ich dieser Beschäftigung müde, zog ich mich vom Treppenabsatz in das verlassene, stille Kinderzimmer zurück, wo ich, wenn auch ein wenig traurig, keineswegs unglücklich war. Um die Wahrheit zu sagen, ich verspürte nicht den geringsten Wunsch, in Gesellschaft zu sein, denn dort wurde ich kaum beachtet. Und wäre Bessie nur etwas freundlicher und geselliger gewesen, hätte es mir viel mehr Freude bereitet, die Abende ruhig und beschaulich mit ihr zu verbringen, als mich unter dem furchteinflößenden Blick Mrs. Reeds in einem Raum voller feiner Herrschaften aufhalten zu müssen. Aber Bessie pflegte sich, sobald sie die jungen Damen angekleidet hatte, in belebtere Regionen wie die Küche oder die Kammer der Haushälterin zu begeben, und meist nahm sie die Kerze mit. Dann saß ich mit meiner Puppe auf den Knien da, bis das Kaminfeuer heruntergebrannt war, und ließ von Zeit zu Zeit meinen Blick durch das düstere Zimmer wandern, um mich zu vergewissern, dass kein bedrohlicheres Wesen als ich selbst dort herumgeisterte; und wenn dann die letzten Kohlen zu dunkelroter Glut zerfielen, zerrte ich, so flink ich konnte, an Knoten und Bändern, schlüpfte hastig aus meinen Kleidern und suchte in meinem Bett Schutz vor Kälte und Dunkelheit. Meine Puppe nahm ich stets mit in dieses Bett. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, etwas liebzuhaben, und in Ermangelung eines Objektes, das meiner Zuneigung würdiger gewesen wäre, fand ich schließlich Freude daran, diesem in einem verblichenen Kleidchen steckenden Götzen, der wie eine schäbige kleine Vogelscheuche aussah, meine Liebe und Zärtlichkeit zu schenken. Heute erstaunt mich die groteske Aufrichtigkeit, mit der ich damals in dieses unscheinbare Spielzeug vernarrt war, ja mir einbildete, es sei lebendig und menschlicher Gefühle fähig. Ich konnte nicht einschlafen, ehe die Puppe nicht in die Falten meines Nachthemdes gebettet war; und erst, wenn sie sicher und geborgen bei mir lag, fühlte ich mich einigermaßen glücklich, weil ich glaubte, sie sei es auch.
Endlos erschienen mir die Stunden, während ich auf das Weggehen der Gäste wartete und lauschte, ob ich nicht Bessies Schritte auf der Treppe hören konnte. Manchmal kam sie nämlich zwischendurch herauf, um ihren Fingerhut oder die Schere zu holen oder um mir eine Kleinigkeit – ein Rosinenbrötchen etwa oder ein Stück Käsekuchen – zum Nachtessen zu bringen. Dann setzte sie sich zu mir auf die Bettkante, solange ich aß, und wenn ich fertig war, deckte sie mich fürsorglich zu; zweimal gab sie mir sogar einen Kuss und sagte: »Gute Nacht, Miss Jane.« Wenn sie so lieb zu mir war, dünkte mich Bessie das beste, hübscheste, liebenswürdigste Geschöpf auf der Welt, und ich wünschte mir inständig, sie möge immer so freundlich und nett sein und mich nie mehr herumstoßen oder grundlos schelten oder tadeln, wie sie es oft zu tun pflegte. Bessie Lee muss meiner Meinung nach ein Mädchen mit guten natürlichen Anlagen gewesen sein, denn sie war geschickt in allem, was sie tat, und hatte ein beachtliches Talent zum Erzählen – das zumindest schloss ich aus dem Eindruck, den ihre Kindergeschichten auf mich machten. Wenn mich meine Erinnerung an ihr Gesicht und ihr Äußeres nicht trügt, war sie auch hübsch: eine schlanke junge Frau mit schwarzem Haar, dunklen Augen, sehr ansprechenden Zügen und gesunder, reiner Haut. Allerdings war sie launisch und aufbrausend und hatte keinen besonders ausgeprägten Sinn für Grundsätze und Gerechtigkeit. Trotzdem zog ich sie so, wie sie war, jedem anderen in Gateshead Hall vor.