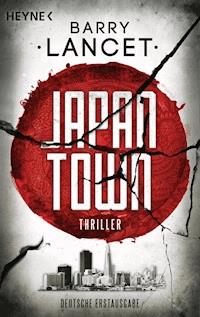
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mein Name ist Jim Brodie. Ich bin in Tokio aufgewachsen, lebe in San Francisco und verbringe meine Zeit vor allem damit, antike Vasen zu reparieren. Ab und zu helfe ich der Polizei. Heute Nacht haben sie mich nach Japantown gerufen. Eine japanische Familie wurde auf brutale Weise hingerichtet. Doch das ist nicht alles. Am Ort des Verbrechens fand ich ein japanisches Schriftzeichen – dasselbe Zeichen, das vor drei Jahren bei meiner ermordeten Frau entdeckt wurde. Dies wird der Fall meines Lebens, der Fall, den ich lösen muss, koste es, was es wolle ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ZUM BUCH
Jim Brodie, der in Tokio aufgewachsen ist, lebt mit seiner kleinen Tochter in San Francisco und verbringt seine Zeit vor allem damit, antike Vasen zu reparieren. Er ist aber auch in den asiatischen Kampfkünsten bewandert und fungiert als inoffizieller Berater der Mordkommission. Eines Nachts wird Brodie nach Japantown gerufen, wo ein wahres Massaker stattgefunden hat. Eine japanische Familie ist niedergeschossen worden. Doch das ist nicht alles. Am Ort des Verbrechens findet sich ein japanisches Schriftzeichen, ein sogenanntes Kanji – das gleiche Zeichen, das Brodie Jahre zuvor bei seiner ermordeten Frau gefunden hat. Die Umstände ihres Todes konnten damals nicht aufgeklärt werden. Doch jetzt hat Brodie eine neue Spur, die nach Tokio führt, wo bei mehreren Gewaltverbrechen dasselbe rätselhafte Zeichen aufgetaucht ist. Brodie muss den Fall lösen – koste es, was es wolle …
ZUM AUTOR
Barry Lancets große Liebe zu Japan nahm vor über 30 Jahren ihren Anfang. Nach einer ersten Asienreise beschloss Lancet, seine Heimat Kalifornien zu verlassen und für längere Zeit in Tokio zu leben. Er blieb über 20 Jahre in Japan, arbeitete bei einem großen Verlag und entwickelte zahlreiche Bücher vor allem über die japanische Kunst und Kultur. Als Lancet eines Tages aufgrund eines Missverständnisses stundenlang von der Tokio Metropolitan Police verhört wurde, beschloss er, einen Thriller zu schreiben: Japantown war geboren.
Besuchen Sie Barry Lancet im Internet unter
www.barrylancet.com
BARRY LANCET
JAPANTOWN
Thriller
Aus dem Amerikanischen
von Joannis Stefanidis
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe JAPANTOWN erschien 2013
bei Simon & Schuster, New York
Meinen Eltern, Bob und Lenny,
für ihre unermüdliche Unterstützung und
denjenigen meiner japanischen Freunde,
die sich immer »eingekeilt« fühlten.
Vollständige deutsche Erstausgabe 07/2014
Copyright © 2013 by Barry Lancet
Copyright © 2014 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Ulrike Nikel
Umschlaggestaltung: Büro Überland, unter Verwendung von
Motiven von © shutterstock/Alexander Demyanenko und © corbis/Yi Lu
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-13420-4
www.heyne.de
Ein weiser Mensch hört,
was keinen Laut verursacht,
und sieht, was keine Form besitzt.
Zen-Sprichwort
TAG 1
VOM DIEB KEINE SPUR
KAPITEL 1
San Francisco
Zwei Rottöne stachen mir in der Einkaufsmeile von Japantown ins Auge, als ich dort eintraf. Einer gehörte zum scharlachroten Kleid eines kleinen Mädchens, der andere zu einer allzu menschlichen Flüssigkeit. Später bei der Pressekonferenz sollte noch ein dritter hinzukommen, nämlich die Schamesröte auf den Gesichtern der Stadtoberen.
Aber ehe die Nachricht vom Gemetzel in Japantown die Runde machte, landete das Problem bei mir.
Ein paar Minuten nach Erhalt des dringenden Ersuchens, zum Tatort zu kommen, raste ich in meinem kastanienbraunen Cutlass-Cabrio, einem Klassiker, die Fillmore hinunter. Bevor der mitternächtliche Anruf eintraf, hatte ich eine japanische Teeschale aus dem achtzehnten Jahrhundert repariert – eine Fertigkeit, die ich in der Töpferstadt Shigaraki, eine Stunde außerhalb von Kyoto, erlernt hatte. Obwohl ich mit offenem Verdeck fuhr, hing mir immer noch der scharfe Geruch des Lacks in der Nase, mit dem ich das fingernagelgroße Plättchen an den Schalenrand geklebt hatte. Sobald es getrocknet war, konnte ich das fehlende Muster auftragen – einen Schnörkel aus verflüssigtem Goldstaub. Gut, eine Reparatur bleibt immer eine Reparatur, aber richtig ausgeführt, kann sie einem Gegenstand die Würde zurückgeben.
Ich bog so scharf in die Post Street ab, dass Reifenspuren zurückblieben, und schnitt dabei zwei Gangmitglieder, die in einem flammend roten Mazda Miata den Hügel hinaufjagten. Der Fahrtwind blies mir ins Gesicht und durch die Haare und wehte die letzten Spuren von Schläfrigkeit fort. Die Gangmitglieder fuhren ebenfalls mit offenem Verdeck – zweifellos ein Vorteil, wenn man in der Gegend herumballern will.
Jetzt glitten sie hinter mir heran. Ich hörte sie mit dröhnenden Stimmen Flüche ausstoßen, die trotz der kreischenden Reifen zu verstehen waren, und im Rückspiegel sah ich sie wütend ihre Fäuste in die Luft stoßen, während der schnittige Sportwagen immer mehr an meine Stoßstange herankroch. Als Nächstes erschienen im Spiegel die unheilvollen Umrisse einer Pistole, gefolgt vom Oberkörper eines Mannes, doch dann bemerkte der Fahrer die Polizeiblockade, stieg voll auf die Bremse und riss den Mazda herum. Der abrupte Richtungswechsel schleuderte den Pistolenmann zur Seite und um ein Haar aus dem Wagen. Mit wild rudernden Armen bekam er gerade noch den Rahmen der Windschutzscheibe zu fassen und ließ sich in den gepolsterten Schalensitz des Miata zurückfallen, der mit frustriertem Motorengeheul davonjagte.
Ich hätte am liebsten das Gleiche getan. Doch ich folgte gewissermaßen einer persönlichen Einladung, und so blieb mir keine andere Wahl, als mir den nächtlichen Tatort anzusehen.
Als das Telefon geklingelt und ich meine Arbeit an der Teeschale beendet hatte, streifte ich mir äußerst vorsichtig die Gummihandschuhe ab, damit keine giftigen Lackreste an meine Haut kamen. Da es tagsüber im Laden zu viel zu tun gab, pflegte ich solche Reparaturen erst abends zu erledigen, nachdem ich meine Tochter zu Bett gebracht hatte.
Lieutenant Frank Renna vom San Francisco Police Department vergeudete keine Zeit mit Höflichkeiten. »Du musst mir einen Gefallen tun. Diesmal einen großen.«
Ich warf einen Blick auf die hellgrünen Ziffern der Uhr. 0 Uhr 24. »Wahrlich ein grandioser Zeitpunkt.«
Am anderen Ende der Leitung brummte Renna eine Entschuldigung. »Du erhältst das übliche Beraterhonorar. Dürfte wie immer zu wenig sein.«
»Ich werd’s überleben.«
»Gute Einstellung. Ich möchte, dass du herkommst und dir etwas anschaust. Hast du eine Baseballkappe?«
»Klar.«
»Drück sie dir tief ins Gesicht, und zieh außerdem Sportschuhe und Jeans an. Dann komm so schnell wie möglich her.«
»Wohin?«
»Japantown. In die Fußgängerzone.«
Ich schwieg, denn ich wusste, dass in J-Town außer Denny’s Coffeeshop und einigen Bars längst alles geschlossen hatte.
Renna fragte: »Wie schnell kannst du hier sein?«
»Viertelstunde, wenn ich ein paar Verkehrsregeln ignoriere.«
»Mach zehn Minuten draus.«
Neun Minuten später raste ich auf die Straßenblockade zu, einem Haufen kreuz und quer geparkter Streifenwagen genau dort, wo die Fußgängerzone in der Buchanan an der Einmündung Post Street anfängt. Dahinter erkannte ich den Kombi des Gerichtsmediziners und drei Krankenwagen – die Türen standen offen, und die Innenräume erinnerten mich an dunkle Höhlen. Etwa hundert Meter davon entfernt fuhr ich vor dem Japan Center an den Straßenrand und stellte den Motor ab, stieg aus und ging auf das Durcheinander zu. Düster und unrasiert, löste Frank Renna sich aus einer Gruppe von Cops und kam mir auf halbem Weg entgegen. Die rotierenden roten und blauen Lichter der Einsatzfahrzeuge beleuchteten seine Silhouette.
»Alles aufgefahren heute Nacht, was?«
Sein Blick war finster. »Fast.«
Ich war das wandelnde Lexikon, das man beim SFPD zurate zog, wann immer es um etwas Japanisches ging. Und das, obwohl mein Name Jim Brodie lautet, ich eins fünfundachtzig messe, fünfundachtzig Kilo wiege und blaue Augen habe. Und Weißer bin.
Der Zusammenhang? Ganz einfach: Die ersten siebzehn Jahre meines Lebens habe ich in Tokio verbracht, wo ich auch zur Welt kam. Als Sohn eines bulligen, irisch-amerikanischen Vaters, der eine Ermittlungsagentur leitete, und einer etwas zierlicheren amerikanischen Mutter, die Kunst liebte. Da das Geld knapp war, besuchte ich normale japanische Schulen und keine teuren amerikanisch-internationalen Einrichtungen. Auf diese Weise saugte ich die Sprache und die Kultur auf wie ein Schwamm.
Nebenbei lernte ich Karate und Judo bei zwei Großmeistern in der japanischen Hauptstadt und gewann dank meiner Mutter erste Einblicke in die Welt der japanischen Kunst.
Auf die ferne Pazifikseite war mein Vater ursprünglich durch die US-Army verschlagen worden, die nach dem Krieg das Land einige Jahre besetzte. Als junger Militärpolizist sollte er mit seiner Einheit in West-Tokio für Ordnung sorgen. Nach der Rückkehr in die USA arbeitete er eine ganze Weile für das Los Angeles Police Department. Weil er dort allerdings ein paarmal aneckte, kehrte er irgendwann nach Tokio zurück, diesmal mit meiner Mutter, und gründete dort die erste private Sicherheits- und Ermittlungsagentur nach amerikanischem Vorbild.
Dort wurde ich dann geboren. Eine Woche nach meinem zwölften Geburtstag begann er damit, mich in die Arbeit bei Brodie Security einzuführen. Ich begleitete ihn und andere Detektive zu Verhören, Observierungen und auf Ermittlungsreisen, durfte zuhören und beobachten. Im Büro vertiefte ich mich in alte Akten, sofern ich nicht gerade den Männern lauschte, wenn sie über ihre Fälle sprachen: Erpressung, Ehebruch, Entführungen und dergleichen mehr. Ihre Gespräche waren lebensnah und tausendmal spannender als eine Disconacht in Roppongi oder ein Besuch in einem spottbilligen Izakaya, einer Kneipe im Tokioter Bahnhofsviertel Harajuku, obwohl ich auch das vier Jahre später mit einem gefälschten Ausweis nicht verschmähte.
Drei Wochen nach meinem siebzehnten Geburtstag nahm Jakes Partner Shig Narazaki – »Onkel Shig«, wie ich ihn nannte – mich mal wieder zum »Anschauungsunterricht« mit. Zu einer simplen Beschattung in einem Erpressungsfall, in den der Vizepräsident einer Elektronikfirma sowie eine örtliche Bande von Möchtegern-Yakuza verwickelt waren. Es ging lediglich darum, Informationen zu sammeln. Keine Aktion, kein direkter Kontakt. Ich hatte schon Dutzende Male bei so etwas mitgemacht.
Wir saßen seit einer Stunde im Auto, versteckt in einer engen Gasse, und beobachteten ein Yakitori-Restaurant, das schon lange geschlossen hatte.
»Ich weiß nicht«, sagte Shig, »vielleicht ist es der falsche Laden.«
Er stieg aus, um nachzusehen, drehte eine Runde um das Gebäude und war gerade auf dem Rückweg, als aus einem Seitenausgang ein Schläger heraussprang und mit einem japanischen Schlagstock auf Shig einzudreschen begann, während der Rest der Bande aus einer anderen Tür stürmte und das Weite suchte.
Shig brach zusammen, und ich stürzte mit lautem Gebrüll aus dem Wagen. Woraufhin der Schläger auf mich zukam, mich anfunkelte und mit dem Stock ausholte wie mit einem Baseballschläger – was mir verriet, dass der Kerl nicht in die traditionelle Kunst des Bojutsu eingeweiht war. Dann griff er an. Bei der Waffe handelte es sich zum Glück um ein kurzes Exemplar, und so trat ich ihm, sobald er den vorderen Fuß aufsetzte, gegen die Kniescheibe. Er schrie auf und ging zu Boden – genug Zeit für Shig, um sich aufzurappeln, an dem Kerl vorbeizueilen und mich mit einer Geschichte nach Hause zurückzubringen, die meinen Vater stolz machte.
Leider zerstörte der Vorfall den Rest dessen, was von der kriselnden Ehe meiner Eltern noch übrig war. Während mein Vater Japan aus ganzem Herzen liebte, wurde meine Mutter mit dem Land nie richtig warm. Sie fühlte sich dort immer wie eine Außenseiterin, eine blassgesichtige Weiße, die Kleidergröße vierundvierzig in einem Land trug, wo zumeist Püppchen in Größe sechsunddreißig herumtrippelten. »Mich in Lebensgefahr zu bringen«, das war der Tropfen gewesen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Sie kehrte mit mir nach Los Angeles zurück, mein Vater blieb in Tokio. Und damit hatte es sich.
All das lag fünfzehn Jahre zurück. Seither war viel geschehen: Meine Mutter starb, ich zog nach San Francisco, ließ mich zum Kunsthändler ausbilden. Nach Meinung von Jake eine Arbeit für Weicheier, aber es war eine Welt, die ich ebenso faszinierend fand wie früher meine Mutter, obwohl es auch hier von Haien wimmelte. Einer ganz eigenen Brut allerdings.
Vor neun Monaten dann, nachdem wir jahrelang nichts voneinander gehört hatten, starb mein Vater plötzlich, und als ich zur Beerdigung nach Japan flog, fand ich mich im Schussfeld echter Yakuza wieder – nicht solcher Möchtegerngangster von der Sorte, mit denen Shig und ich einst aneinandergeraten waren. Es gelang mir gerade so, mich gegen die Kerle durchzusetzen, während ich einer lange verschollenen Teeschale nachspürte, die einst dem legendären Teemeister Sen no Rikyu gehört hatte. Die Ereignisse machten Schlagzeilen, und ich wurde eine Art Lokalheld.
Was ein weiterer Grund dafür war, dass man mich nach Japantown bestellt hatte. Das sowie der Umstand, dass ich über Informationskanäle verfügte, an die das SFPD nicht herankam: Jake hatte mir nämlich trotz unserer Entfremdung die Hälfte seiner Firma überschrieben.
Nachdem mein Vater gestorben war, wurde ich also in genau die Art von Leben hineingezogen, das einst meine Eltern auseinandergebracht hatte. Und so jonglierte ich im Alter von zweiunddreißig Jahren plötzlich mit einem Antiquitätengeschäft und einer Sicherheitsagentur herum. Feingeist und Haudrauf in einem.
Kurz gesagt, ich war der Elefant im Porzellanladen – nur dass mir der Laden gehörte.
Und in dieser Nacht stellte ich mir die beunruhigende Frage, welche Folgen das noch haben könnte.
KAPITEL 2
Mich vor den neugierigen Blicken seiner Kollegen abschirmend, hängte Renna mir einen Polizeiausweis an die Brusttasche, und zwar so, dass das Foto von der Hemdklappe verdeckt wurde. Mit seiner hünenhaften Statur hätte der Lieutenant einer ganzen Kompanie die Sicht versperren können – sogar mich mit meiner nicht gerade geringen Größe und meinen breiten Schultern verschluckte der Schatten dieses Zweimeterbrockens, dessen Brustkorb wuchtiger war als der der meisten NFL-Abwehrspieler. Wenn Renna die Waffe zog und »Keine Bewegung« rief, wackelte ein vernünftiger Mensch nicht mal mit dem kleinen Zeh.
»Fertig«, sagte er und betrachtete zufrieden sein Werk. »Sieht sowieso keiner genau hin.«
»Wie beruhigend.«
Renna musterte meine Jeans und das leichte Flanellhemd, dann blickte er auf die Beschriftung an meiner Baseballkappe. »Wofür steht HT?«
»Hanshin Tigers.«
»Was ist das?«
»Ein japanischer Baseballklub aus Osaka.«
»Ich sagte, du sollst ein Kappe tragen, und du setzt so was Exotisches auf? Warum kannst du nichts wie ein normaler Mensch tun?«
»Ist Teil meines Charmes.«
»Hoffentlich finden andere das auch.« Mit einem Rucken seines Kopfes deutete Renna auf den Ausweis an meinem Hemd. »Du bist verdeckter Ermittler und offiziell gar nicht hier. Also rede nicht so viel.« Rennas ruhige graue Augen sahen müde aus. Es würde übel werden.
»Verstanden.«
Der Lieutenant trat einen Schritt zurück und unterzog mich einer weiteren nachdenklichen Inspektion.
»Gibt es ein Problem?«, fragte ich.
»Diese Sache ist … anders als das Übliche. Es geht nicht um, äh, Diebesgut.«
Aus seinen Worten hörte ich Zweifel, ob ich dem hier gewachsen sein würde. Eine Frage, die ich mir ebenfalls stellte, denn bislang waren meine Dienste nur bei der Wiederbeschaffung von Kunstgegenständen gefragt gewesen.
Ich hatte Renna vor einigen Jahren kennengelernt, als er und seine Frau bei Bristol’s Antiques in der Outer Richmond Ecke Geary Street hereinspaziert waren. Die beiden waren wegen der englischen Walnusskommode im Schaufenster gekommen. Als Miriam Renna auf das Stück deutete, war ihr Mann unnatürlich still geworden und hatte verstohlen in meine Richtung geschielt. Der Glanz in Miriams Augen verriet, dass sie von der Kommode hin und weg war. Vermutlich hatte sie von ihr geträumt. Von nichts anderem mehr geredet. Gebettelt und Frank so lange beschwatzt, bis er eingeknickt war und sich ihrem Drängen nicht mehr widersetzte. Wenn ein schönes Stück einen packt, dann löst es diesen Effekt aus. Und die Kommode war ein schönes Stück.
Ich hätte den Verkauf mit einigen geschickten Bemerkungen über die Qualität der Einlegearbeit und der eleganten Kreuzbindung perfekt machen können. Ich wusste es, und Renna wusste es auch. Aber sein Gesichtsausdruck und der bescheidene Schmuck seiner Frau verrieten mir, dass es ein schmerzvoller Kauf sein würde, und so führte ich die beiden zu einem gleichermaßen eleganten Pembroke Table aus dem neunzehnten Jahrhundert, der hundert Jahre jünger war und nur ein Viertel so viel kostete wie die Kommode. Mit der Zeit würde auch der Tisch immens wertvoll werden, erklärte ich der Frau.
An jenem Tag wurde der Grundstein gelegt für ein Vertrauensverhältnis zwischen den Rennas und mir, das sich über die Jahre vertiefte wie die Patina auf ihrem Pembroke. Damals schloss ich beim alten Jonathan Bristol, der auf europäische Antiquitäten spezialisiert war, gerade meine Ausbildung zum Kunsthändler ab. Inzwischen besitze ich in der Lombard Street meinen eigenen Laden mit Schwerpunkt auf japanischen Objekten, ergänzt durch eine bunte Mischung aus chinesischen, koreanischen und europäischen Stücken. Nach unserer ersten Begegnung begann Renna gelegentlich bei mir vorbeizuschauen, um meine Meinung einzuholen, wenn bei einem seiner Fälle eine wie immer geartete Verbindung zu Asien auftauchte. Meistens sprachen wir abends darüber bei einem Anchor Steam oder einem Single Malt. Heute aber hatte er mich zum ersten Mal an einen Tatort bestellt.
Renna sagte: »Es wird ziemlich scheußlich. Ich kann dir sonst morgen ein paar Fotos vorbeibringen, den Rest musst du nicht sehen. Keiner weiß, dass du hier bist – du kannst also immer noch verschwinden.«
»Ich bin hergekommen. Also schaue ich es mir auch an.«
»Bist du sicher? Hier geht es nicht um Einlegearbeiten in antiken Möbeln.«
»Ganz sicher.«
»Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt.«
»In Ordnung«, erwiderte ich und blinzelte ins aufdringliche Licht der rotierenden Signalleuchten.
»Nichts ist in Ordnung«, raunte Renna und meinte vermutlich, was sich jenseits der Straßensperre verbarg.
Hoch über unseren Köpfen trieb ein stürmischer Wind eine Nebelbank vor sich her und hüllte die höchsten Punkte der Stadt in wallende Schwaden ein, während wir hier unten immer wieder von Windböen gepeitscht wurden.
»Ziemlicher Auflauf zu dieser späten Stunde«, sagte ich und wunderte mich über die vielen Cops in Uniform und in Zivil, die am Anfang der Fußgängerzone herumstanden.
»Gibt es dafür einen bestimmten Grund?«
»Jeder will einen Blick darauf werfen.«
O Mann, das versprach wirklich übel zu werden, dachte ich, während Renna mich an den Ort der Finsternis führte.
Auf einem zweihundert Meter entfernten Dach lag ein Mann, der den Namen Dermott Summers benutzte, flach auf dem Bauch und beobachtete, wie Lieutenant Frank Renna mit einem Neuankömmling auf den Tatort zuging.
Stirnrunzelnd stellte er sein Nachtsichtfernglas schärfer. Jeans, Flanellhemd, Baseballkappe, halb verdeckter Ausweis. In so einem Aufzug lief kein Amtsträger herum.
Ein Undercoveragent? Vielleicht. Aber warum war der Lieutenant dann zu ihm gegangen und hatte ihn begrüßt?
Summers zoomte den Neuankömmling heran. Da war etwas an dessen Gang … Nein, es war kein Polizist. Summers legte das Fernglas zur Seite und nahm seine Kamera, stellte das Teleobjektiv ein und schoss mehrere Fotos von dem Mann.
Diesmal bemerkte er die HT-Initialen,und ihm stellten sich die Nackenhaare auf. Eine japanische Baseballkappe? Schlechte Neuigkeit. Und doch genau die Art von Neuigkeit, die zu entdecken er beauftragt war. Eine Angelegenheit, um die er sich kümmern musste. Das war ein Prinzip der Soga: Observationen auch nach der Vollstreckung sorgten dafür, dass niemand ihnen auf die Schliche kam.
Summers richtete die Kamera auf das Fahrzeug des Neuankömmlings, fotografierte das Nummernschild und machte mehrere Aufnahmen des Cutlass-Cabrios, dann gab er das Kennzeichen weiter. Binnen dreißig Minuten würde er den Namen des Halters und alle wichtigen Informationen erfahren.
Bei dem Gedanken juckte es Summers in den Fingern. Es war eine perfekte Operation gewesen, und er hatte sich geärgert, nicht mitmachen zu dürfen. Nun aber schien es eine Zugabe zu geben. Sah aus, als bekäme auch er noch etwas zu tun.
KAPITEL 3
Der Ort der Finsternis lag zwischen einer Reihe von Sitzbänken.
Der einen Häuserblock umfassende Abschnitt der Buchanan zwischen Post Street und Sutter Street war vor langer Zeit in eine Fußgängerzone umgewandelt worden. Warmer roter Backstein ersetzte den kalten schwarzen Asphalt, und ein Sushi-Imbiss, ein Shiatsu-Salon und mehrere Dutzend weitere Läden säumten den Straßenverlauf. Bänke und Skulpturen in der Mitte der Einkaufsmeile luden dazu ein, sich eine Weile vom Shoppen zu erholen. Nun umrahmten sie eine Szene, die ich nie mehr vergessen würde.
Während wir darauf zugingen, rückten tragbare, leistungsstarke Jupiterlampen die Opfer ins Blickfeld: drei Erwachsene und zwei Kinder.
Kinder?
Meine Bauchmuskeln verkrampften sich, und in meinem Magen bildete sich ein Klumpen. In einem Kreis aus gelbem Absperrband bot sich ein Bild, das der schlimmste Albtraum aller Eltern war. Ich konnte die Körper eines Jungen und eines Mädchens erkennen – die Kleine war ungefähr so alt wie meine Jenny. Daneben lagen zwei Männer und eine Frau. Eine Familie, und zwar eine japanische. Touristen. Das hier war nicht einfach der Schauplatz eines Verbrechens. Es war eine Hinrichtung. Ein Frevel, eine Versündigung gegen Gott.
»Zum Teufel, Frank.«
»Ich weiß. Hältst du das aus?«
Warum müssen Kinder unter den Opfern sein?
Renna sagte: »Du kannst immer noch verschwinden. Letzte Chance.«
Ich winkte ab. Jemand hatte eine Familie ausgelöscht, hatte etwas Heiliges, etwas Unantastbares mit einer leistungsstarken Waffe in ein Bündel aus zerfetztem Fleisch, zerfaserter Kleidung und verklumptem Blut verwandelt.
Die Säure in meinem Magen begann zu brennen. »Das muss das Werk eines Psychopathen sein. Ein zurechnungsfähiger Mensch tut so etwas nicht.«
»In letzter Zeit mal eine Gang in Aktion erlebt?«
»Guter Einwand.«
Als ich durch die Scheidung meiner Eltern nach Los Angeles katapultiert wurde, wohnte ich fünf Jahre an der Grenze zu South Central, wo Gangs das Sagen hatten, danach hing ich in San Francisco noch zwei Jahre im schmuddeligen Mission District herum, ehe ich mir eine vernünftige Bleibe in Sunset und nach meiner Hochzeit die gegenwärtige Miniwohnung in East Pacific Heights leisten konnte. Ich hatte mehr als genug Leichen gesehen, aber das hier war heftiger als fast alles, was man normalerweise in den von Gangs dominierten Vierteln geboten bekam. Zwischen den toten Körpern hatten sich glitschige purpurrote Blutlachen gebildet, von denen zähflüssige Rinnsale über den Backstein flossen.
Ich atmete tief ein und aus, um meine Nerven zu beruhigen.
Dann sah ich das im Tod zur Grimasse erstarrte Gesicht der Mutter. Ihre gequälten Züge. Ihre Verzweiflung in den letzten Sekunden ihres Lebens angesichts des grauenvollen Todes ihrer Kinder.
Der Anblick verschlug mir den Atem, traf mich bis ins Mark. Vielleicht war ich der Sache dochnicht gewachsen. Meine Glieder wurden schwer. Ich ballte die Fäuste. Biss die Zähne zusammen. Versuchte meiner Wut Herr zu werden.
Gerade noch war die Familie durch Japantown spaziert, und im nächsten Moment überraschten Dunkelheit und Tod sie in einem fremden Land.
Vom Dieb keine Spur,
doch zurück ließ er
die friedvolle Stille
der Okazaki-Berge.
Vor vielen Jahren, lange bevor wir heirateten, hatte Mieko mir diese Worte ins Ohr gehaucht, um meinen Schmerz über den Tod meiner Mutter zu lindern – meine erste Begegnung mit dem Gedicht. Dann fiel es mir unwillkürlich wieder ein, als Mieko ums Leben kam und Jenny und ich fortan ohne sie zurechtkommen mussten. Nun drängte sich dieser Vers abermals in mein Bewusstsein, und ich wusste auch, warum. Aus diesen vier Zeilen sprach eine größere Wahrheit, eine tröstliche, heilende Kraft. Eine Weisheit, die Generationen zurückreichte.
»Alles im Lot bei dir?«
Ich schüttelte meine persönlichen Dämonen ab. »Denke schon.«
Renna bewegte den Mund, als würde er darin ein paar imaginäre Murmeln herumrollen, während er meine Antwort überdachte. Ich sah ihn an. Ein dichter schwarzer Haarschopf über Polizistenaugen, die nichts verrieten. Markante, harte Gesichtszüge mit tiefen, aber weich konturierten Falten. Hätte man sein Gesicht mit einem Fanghandschuh verglichen, würde man von perfekt eingetragenem Leder sprechen.
Renna trat an das gelbe Band und sagte: »Wie läuft’s, Todd?«
Hinter der Absperrung kratzte ein forensischer Techniker eine Blutprobe auf. Seine Haare waren raspelkurz, die Ohren groß und rosafarben. »Einiges gut, das meiste schlecht. Als es passierte, war die Straße menschenleer, und deshalb ist nichts kontaminiert. So weit die gute Nachricht. Andererseits meint Henderson, das, was wir haben, würde uns kaum weiterhelfen. Er macht gerade eine Schnelluntersuchung. Ist mit Splittern, Textilfasern und Fußspuren ins Labor gefahren. Aber er war ziemlich skeptisch. Die Textilfasern sind alt. Er glaubt nicht, dass sie von dem Schützen stammen.«
»Und die Fußabdrücke?«
Todd schaute zu mir herüber und richtete einen fragenden Blick auf Renna, der uns daraufhin vorstellte: »Todd Wheeler, Jim Brodie. Brodie berät uns bei dem Fall – behalte es erst mal für dich.«
Wir nickten uns zu.
Todd deutete mit dem Kinn auf eine Gasse. »Hat lange nicht geregnet, deshalb fanden wir dort Fußspuren neben dem Restaurant. Weiche Sohlen ohne Absatz. Vermutlich Slipper oder mokassinartige Schuhe. Gehörten wahrscheinlich dem Killer.«
Renna und ich blickten in den unbeleuchteten Durchgang zwischen einem japanischen Restaurant und einem Kimonogeschäft, an dessen Ende ein öffentlicher Parkplatz lag. Weil Balkone in das Gässchen hineinragten, war es dort stockfinster. Ich blickte auf die Geschäfte links und rechts. Auf der gegenüberliegenden Seite befand sich ein ähnlicher Durchgang, der aber weniger Deckung bot.
Meine Bauchmuskeln vibrierten, und ich richtete mein Augenmerk wieder auf die Leichen. Sie lagen dicht beieinander, ein Wirrwarr aus kreuz und quer ausgestreckten Armen und Beinen, das anmutete wie ein groteskes Mikado-Spiel. Im unbarmherzigen weißen Licht der Scheinwerfer warfen die Augenbrauen dunkle Schatten auf eingesunkene Augenhöhlen, betonten rundliche Wangenknochen. Die Toten waren elegant und teuer gekleidet. Genau der Look, den ich dreimal im Jahr sah, wenn ich über den Pazifik flog.
Diese Japaner stammten aus Tokio.
Im alten Japan hätte man diese Szene vielleicht auf einem Holzschnitt festgehalten, als das Genre sich von der »schwebenden Welt« und ihren gefälligen Sujets abwandte. Ich hatte Kunden, die für makabre Ukiyo-e-Drucke mit Geistern, Kobolden und heftigen Gewaltdarstellungen gutes Geld hinlegten. Die Abbildungen waren zwar nicht so drastisch wie der Anblick, der sich mir hier bot, doch einige kamen dem recht nahe. Vor dem Aufkommen der Fotografie dienten Ukiyo-e und dessen Varianten nämlich auch dem Zweck, von den Tagesereignissen zu berichten, hatten also eher die Funktion einer vormodernen Nachrichtenübermittlung als die eines Kunstwerks. Außerdem benutzte man sie – ganz so, wie man heute Zeitungspapier verwendet – als Packmaterial für zerbrechliche Gegenstände, und auf diese Weise gelangten sie westwärts bis nach Europa.
Renna sprach in einem leisen Knurrton. »Es ging ganz schnell. Automatik aus kurzer Distanz. Vielleicht vier, fünf Schüsse die Sekunde. Die Hülsen verstreut wie Erdnussschalen. Dem Mistkerl war es egal, dass sie liegen blieben und gefunden werden.«
»Enorm arrogant«, sagte ich. »Wenn man die Schießorgie hinzunimmt, was ergibt das dann? Die Tat eines Psychopathen oder einer Gang?«
»Könnte beides sein. Komm, sieh dir das mal an.«
Renna schob die Hände in die Hosentaschen und schlenderte um die Absperrung herum auf die gegenüberliegende Seite. Ich trottete ihm hinterher, bis wir dicht neben der Mutter standen und einen anderen Blickwinkel auf die Kinder hatten. Der Mund des Jungen stand offen, die Lippen waren eisblau. Die langen schwarzen Haare des Mädchens waren fächerartig auf dem Boden ausgebreitet. Sie trug ein glitzerndes scharlachrotes Kleid unter einem pinkfarbenen Mantel, der offen stand. Das Kleid schien neu zu sein und sah aus, als sei es für einen festlichen Anlass gekauft worden. So etwas würde meine Tochter ebenfalls gerne tragen.
Ich hob die Hand, um meine Augen gegen das grelle Scheinwerferlicht zu schützen. Die knubbeligen Finger des Mädchens umschlossen einen flauschigen, blutverklebten Klumpen. Ich glaubte ihn zu erkennen. »Ist das Pu der Bär?«
»Ja.«
Plötzlich wurde mir bewusst, wie kühl die Nachtluft war, die bei jedem Atemzug in meine Lunge strömte. Und dass in dieser Nacht nur ein dünner gelber Plastikstreifen die Lebenden von den Toten trennte. Und wie sehr das kleine Mädchen dort auf dem Boden, das eines seiner Lieblingsspielsachen an sich drückte, meiner Jenny ähnelte.
Renna reckte das Kinn in Richtung der Mutter. »Kommt dir das bekannt vor?«
Ich ließ meinen Blick aus der neuen Position über die Szenerie wandern. Etwa zwei Meter von mir entfernt schwamm nahe der Mutter ein Stück Papier in einer Blutlache. Darauf befand sich ein Kanji-Schriftzeichen von der Form einer riesigen Spinne, die sich in freier Spreizung auf der weißen Zetteloberfläche ausbreitete.
Kanji sind die Grundbausteine des japanischen Schriftsystems. Es sind komplizierte, aus vielen Pinselstrichen zusammengesetzte Ideogramme, vor Hunderten von Jahren aus dem Chinesischen entlehnt. Blut war in das faserige Papier eingesickert und zu bräunlichem Purpur, der Farbe alter Leber, getrocknet, sodass man den unteren Teil des Schriftzeichens nur undeutlich erkannte.
»Und, kommt es dir bekannt vor?«, wollte Renna wissen.
Ich trat ein Stück zur Seite, um besser sehen zu können, und erstarrte.
Angestrahlt vom unbarmherzigen weißen Licht der Scheinwerfer, lag da das gleiche Kanji, das ich am Morgen nach dem Tod meiner Frau entdeckt hatte.
KAPITEL 4
Am deutlichsten erinnere ich mich an die Knochen.
Der Brandinspektor und seine Leute hatten im Vorgarten meiner Schwiegereltern eine schwarze Plastikplane ausgebreitet, auf der sie die mit Asche bedeckten Funde, die sie aus den Trümmern zogen, auslegten. Formlose Klumpen aus geschmolzenem Metall. Versengte Zementbrocken. Und in einer entfernten Ecke, abgeschirmt durch eine aufgestellte Leinwand, ein immer höher werdender Haufen verkohlter Knochen.
Die nächsten zwei Monate verbrachte ich ausschließlich damit, die Spur des auf den Gehsteig gesprühten Kanji zu verfolgen. Es hatte mir ein Ziel gewiesen, einen Weg, mit meiner Trauer umzugehen. Falls Miekos Tod eine Botschaft darstellte, dann wollte ich sie verstehen.
Ich forderte einen Haufen von Gefallen ein, die diverse Leute mir schuldeten, und suchte Experten überall in den USA und in Japan auf. Keiner von ihnen konnte das Kanji lesen, niemand hatte es je zuvor gesehen. Das verdammte Ding existierte überhaupt nicht. Nicht in den vielbändigen Kanji-Nachschlagewerken. Nicht in den linguistischen Datenbanken. Nicht in Jahrhunderte zurückreichenden Aufzeichnungen.
Da ich es aber mit eigenen Augen gesehen hatte, ließ ich nicht locker. Ich hielt mich an das gleiche Prozedere, mit dem ich einem schwer auffindbaren Kunstwerk nachzuspüren pflege, und stieß schließlich auf eine Spur. In einer Ecke der mit Schimmelpilz übersäten muffigen Universitätsbibliothek von Kagoshima sprach mich ein alter, verschrumpelter Mann an. Er hatte von meinen Nachforschungen gehört und bat mich, ihm das Kanji zu zeigen, bestand allerdings auf strikter Anonymität. Sonst würde er nicht mit mir sprechen, sagte er. Ich willigte ein, und er erzählte mir, dass er drei Jahre zuvor ebendieses Kanji neben einer Leiche in einem Vorstadtpark von Hiroshima gesehen habe. Und fünfzehn Jahre früher sei es an einem anderen Mordschauplatz in Fukuoka gefunden worden. Da mein einziger Zeuge jedoch entsetzliche Angst zu haben schien, verschwand er, ehe ich aus ihm weitere Einzelheiten herausholen konnte.
Renna wusste von meiner Jagd nach dem Kanji – er und Miriam hatten während der aberwitzigen Japan-Trips auf Jenny aufgepasst und sie getröstet, während sich ihr Vater mehr mit den Toten als mit den Lebenden beschäftigte.
»Kann ich es mir genauer anschauen?«, sagte ich jetzt zu ihm.
Der Lieutenant schüttelte den Kopf. »Noch nicht. Ich darf dich nicht hinter die Absperrung lassen. Aber wenn du von hier aus draufblickst – glaubst du, es handelt sich um das gleiche Zeichen?«
»Zu neunzig Prozent.«
»Warum keine hundert?«
»Ich muss es ohne Blut sehen.«
Bevor Renna etwas entgegnen konnte, rief jemand, der bei den Streifenwagen stand, ihn lautstark zu sich herüber. Vor sich hinmurmelnd, stapfte er davon und steckte mit einem Detective in Zivil die Köpfe zusammen. Die beiden wechselten ein paar Worte, woraufhin Renna eine Beamtin zu sich beorderte, die zimtfarbene Haare und eine sportliche Figur hatte und kein Make-up trug. Sie löste sich aus der Menge.
»Sir?«
»Corelli«, sagte Renna, »so was schon mal gemacht?«
»Zweimal, Sir.«
»Okay. Hören Sie zu. Ich möchte, dass Zweierteams überall klingeln, wo noch Licht brennt. Und sobald es annehmbar ist, sagen wir um sechs, auch beim Rest. Sie sollen sich die Buchanan hocharbeiten und auf beiden Seiten der Fußgängerzone die Apartmentkomplexe nach Augenzeugen durchkämmen. Außerdem überall auf dem Hügel, von wo aus man den Tatort sieht. Zwei Teams sollen das Miyako Inn auseinandernehmen – dort waren die Opfer abgestiegen. Finden Sie raus, ob irgendjemand etwas gesehen oder gehört hat und ob eines oder mehrere Familienmitglieder Kontakt mit dem Personal hatten. Sprechen Sie mit allen, Angestellten wie Gästen. Wenn es sein muss, zerren Sie die Leute aus dem Bett. Alles verstanden?«
»Jawohl, Sir.«
Ich bezweifelte, dass das Herumgerenne brauchbare Hinweise zutage förderte. Sollte der Killer sich auch nur als halb so schwer fassbar wie das Kanji erweisen, würden Rennas Bemühungen ins Leere laufen.
»Gut, weiter. Bringen Sie mir die Hotelrechnung, das Gepäck und einen Computerausdruck mit eventuellen Telefongesprächen der Opfer. Ordnen Sie eine vollständige Untersuchung der Zimmer auf Fingerabdrücke und Stofffasern an. Wenden Sie sich ans japanische Konsulat wegen einer Liste von Freunden, die die Opfer vielleicht in der Stadt, im Staat oder irgendwo im Land hatten. In dieser Reihenfolge.«
»Okay.«
»Schon einen Augenzeugen gefunden, der zufällig vorbeilief?«
»Nein, Sir.«
»Irgendwer im Coffeeshop?«
»Nein, aber dort hat die Familie zum letzten Mal etwas zu sich genommen. Die Erwachsenen Tee und Kuchen, die Kinder einen Eisbecher. Den dritten Abend in Folge. Sie waren auf dem Rückweg zum Hotel, als es sie erwischte.« Sie deutete auf das blaue Miyako-Inn-Schild am anderen Ende der Fußgängerzone, das hinter den beiden hoch aufragenden Säulen des roten Torii am Nordrand der Einkaufsmeile einladend leuchtete.
Diese Tore, die zumeist aus zwei leicht nach innen geneigten Säulen und zwei Querbalken bestehen – dem oberen, der auf beiden Säulen aufliegt, und dem unteren, der die Säulen miteinander verbindet –, sind das architektonische Symbol des Shinto, der vorherrschenden Religion in Japan, und markieren normalerweise den Eingang zu einem Schrein, also die Stelle, wo der geweihte Boden beginnt. Dieses Torii hingegen kennzeichnet den Anfang der Shoppingzone von Japantown, was im Grunde einen Frevel darstellte.
Renna spitzte die Lippen. »Aber keine Zeugen.«
»Nein.«
»Wer hat die Schüsse gehört?«
»Erst mal die meisten Leute im Denny’s. Wegen der Nähe zu den Gangvierteln dachten sie, die Burschen dort würden herumballern oder mit Feuerwerkskörpern spielen.«
Mit anderen Worten, niemand war bereit gewesen, sich vor die Tür zu begeben und nachzuschauen, was den Lärm verursachte.
»Okay, lassen Sie die Gegend abriegeln. Niemand darf raus, bevor unsere Jungs nicht die persönlichen Daten kennen, und niemand darf rein, es sei denn, er hat eine Erlaubnis vom lieben Gott. Verstanden?«
»Jawohl, Sir.«
»Und, Corelli?«
»Sir?«
»Haben Sie im Hauptquartier den Rest meiner Leute angefordert?«
»Steht als Nächstes auf meiner Liste, aber …«
Rennas Augen verengten sich zu Schlitzen. »Aber was?«
»Das sind jede Menge Beamte. Erwarten Sie Druck von oben, Sir?«
»Ich gehe davon aus, dass es Hunde und Katzen regnet. Warum fragen Sie?«
»Schon gut.«
Mit frischem Elan stürzte Corelli davon, und Renna stapfte zu mir zurück. »Der Computer hat die Namen der Familienmitglieder aus den Reisepässen bestätigt. Hiroshi und Eiko Nakamura, die Kinder Miki und Ken. Sagt dir das was?«
»Nein. In Japan gibt es wahrscheinlich Millionen von Nakamuras.«
»So wie bei uns Smiths und Jones?«
»Ja. Und sie haben eine Tokioter Adresse, stimmt’s?«
»Wissen wir noch nicht.«
»Sie stammen aus Tokio.«
»Bist du sicher?«
»Ja. Die Haarschnitte, die Kleidung – es sind Hauptstädter.«
»Gut zu wissen. Und was ist mit Kozo Yoshida, dem zweiten Mann?«
Ich zuckte mit den Schultern.
Rennas Blick streifte durch die Einkaufsmeile. »War klar. So, und jetzt frisch meine Erinnerung auf. Erzähl mir alles über das Kanji und warum du das verdammte Ding noch immer nicht lesen kannst. Aber mach es simpel.«
Zwei Meilen vor der kalifornischen Küste saß ein Mann von Anfang dreißig am Heck eines zehn Meter langen Sports-Fisherman-Bootes mit zwei Volvo-Motoren, das von Captain Joseph Frey gesteuert wurde. Das Boot pflügte durch die wogende pazifische Dünung mit Kurs auf die Humboldt Bay, zweihundertfünfzig Meilen nördlich von San Francisco. Der Passagier und seine drei Begleiter gaben sich als wohlhabende asiatische Geschäftsleute aus, die vor der nordkalifornischen Küste fischen wollten. Das Angelzeug war eingehakt und frisch geölt. Lebendköder schwammen am Boden eines Stahltanks, schossen im Mondlicht umher.
Es war bereits ihre dritte Fahrt innerhalb von zwei Wochen, und Captain Frey hoffte, die Männer würden Stammkunden werden. Am vorherigen Wochenende waren sie südlich von San Francisco herumgeschippert und hatten an drei ergiebigen Fanggründen zwischen der Stadt und Santa Cruz gefischt, wo die Männer von Bord gingen: wegen eines IT-Kongresses, den sie am nächsten Tag angeblich besuchen wollten. Am Wochenende davor waren sie drei Meilen aufs offene Meer hinausgefahren, um sich an ernsthafter Hochseefischerei zu versuchen. Im Verlauf des heutigen Trips wollten die generösen Kunden an einigen beliebten Stellen auf dem Weg nach Norden die Angeln auswerfen, dann in Humboldt von Bord gehen und einen Abendflug nach Portland nehmen, wo eine Firmenkonferenz stattfand.
Der Captain wusste nicht, dass es ihre letzte gemeinsame Fahrt war. Genau genommen war es für mindestens fünf Jahre überhaupt das letzte Mal, dass seine Passagiere sich in die Bay Area begeben würden.
So wollten es die Soga-Regeln.
Im vorderen Teil der Motorjacht verwickelte einer der Männer den Captain in ein Gespräch über die besten Fanggründe für Lengdorsche. Während er stetig Kurs nach Norden hielt, beschrieb Frey die Stellen entlang der Küste, an denen er haltmachen würde, und deutete voller Begeisterung auf die unsichtbare Unterwasserwelt jenseits des Bugs. Unbemerkt öffnete derweil der Mann am Heck den Reißverschluss der schwarzen Sporttasche zu seinen Füßen, zog die in Japantown verwendete Uzi-Maschinenpistole heraus und warf sie über Bord ins schäumende Wasser, von wo sie ihre Reise zum düsteren Meeresgrund in hundertfünfzig Metern Tiefe antrat.
KAPITEL 5
Mein Albtraum begann von vorne.
Ich schaute zu der Ansammlung uniformierter und ziviler Cops, die sich vor der Straßensperre drängten. Die meisten der Streifenpolizisten trugen zum Schutz vor der kühlen Meeresbrise schwarze Lederjacken über den blauen Sommerhemden, die Detectives Trenchcoats oder strapazierfähige Parkas. Einige redeten, einige hörten zu, und mehr als nur einer blickte verstohlen zu uns herüber.
Nein, falsch. Nicht zu uns.
Zu den Leichen.
Unsicherheit war das vorherrschende Gefühl, das in der Luft lag. Es kündete von der hilflosen Verzweiflung, die man in dieser Art und Intensität bei Polizisten höchst selten spürt. Genau jenen zerstörerischen Mix, den ich seit dem Tod meiner Frau vor vier Jahren immer wieder durchlebte. Dabei war sie bloß nach L.A. geflogen, um ihren Eltern bei einigen Einwanderungsformularen zu helfen.
Der Anruf weckte mich morgens um 6 Uhr 49; die Polizei hatte meine Nummer von einem Nachbarn bekommen. Ich nahm den nächsten Pendlerflug nach LAX und fuhr mit meinem Mietwagen bereits vor, während der Inspektor noch mitten in der Arbeit steckte.
Als ich mich vorstellte, sah er mich mitfühlend an. »Ist immer dasselbe. Bei diesen älteren Häusern ist die Elektrik oft eine Katastrophe. Wegen der vielen Beben und Nachbeben springt irgendwann ein Isolierrohr aus dem Verteilerkasten und reißt die Kabel heraus. Falls sie zu einer unbenutzten Steckdose führen, bleibt es unbemerkt. Und wegen der heißen Sommer in L.A. werden die Löcher in der Wand über die Jahre immer bröckeliger, bis die Kabel irgendwann locker herabhängen und von irgendwoher ein Funke überspringt. Und dann ist Feierabend. Falls keines der Opfer geraucht hat, dürfte dies die Brandursache gewesen sein.«
»Keiner von ihnen war Raucher.«
»Da haben wir’s.«
Während ich wie betäubt darauf wartete, dass die Untersuchung vor Ort abgeschlossen wurde, bemerkte ich das Kanji. Miekos Eltern wohnten fünf Straßen entfernt von meiner alten Bleibe, weshalb ich das Viertel gut kannte. Menschen aus aller Welt lebten dort, und entsprechend viele Gangs gab es, die ihre Reviere mit den üblichen hässlichen Graffiti kennzeichneten. Zu meiner großen Überraschung entdeckte ich in der Gebietsmarkierung einer salvadorianischen Gang auf dem Gehweg beim Grundstück meiner Schwiegereltern ein japanisches Schriftzeichen in den Farben Schwarz, Rot und Grün. Für den Uneingeweihten war es nicht vom Drumherum zu unterscheiden, passte sich in Form und Farbe den anderen Hieroglyphen an und schien nur Teil eines unleserlichen Geschmieres zu sein. Falls man jedoch Japanisch lesen konnte, sprang es einen mit der Aggressivität einer 3-D-Grafik an. Und die Farbe sah zudem frischer aus.
Da in der Gegend auch asiatische Gangs herumzogen, war das Vorhandensein des Kanji an sich nicht ungewöhnlich. Aber weil es sich vor dem Haus befand, in dem soeben meine Frau gestorben war, und weil alte Freunde im Viertel glaubhaft versicherten, dieses Schriftzeichen bisher nicht gesehen zu haben, weckte es meinen Argwohn.
Sobald feststand, dass das Kanji nirgendwo sonst in der Gegend aufgetaucht und in keinem Nachschlagewerk zu finden war, reiste ich nach Japan, wo mir der alte Mann in der Bibliothek sein Geheimnis offenbarte. Die Tatsache, dass jemand anders das Kanji tatsächlich gesehen hatte – und zwar schockierenderweise an Schauplätzen eines Mordes –, war bereits ein gewaltiger Fortschritt.
Zumindest für mich.
Allen anderen war es egal.
Als ich in Hiroshima zur Polizei ging, behandelten die Beamten mich mit verständnisvoller Herablassung. Niemand konnte sich an ein solches Verbrechen erinnern oder hatte von einem unbekannten Kanji gehört. Widerwillig gestatteten sie mir, eine schriftliche Meldung zu machen, bevor sie mich mit endlosen Verbeugungen zum Ausgang führten und mir versprachen, ich würde von ihnen hören, falls sich etwas Neues ergeben sollte. Nichts ergab sich. Und den Beamten in Los Angeles war selbst der Schreibkram zu viel – sie schickten mich einfach nach Hause. Zwei Wochen später deklarierte der zuständige Inspektor den Brand als Unfall, und die Polizei schloss die Akte.
»In einfachen Worten«, erinnerte Renna mich.
Ich fuhr mir mit den Fingern durchs Haar. »Damals habe ich mit jedem gesprochen, Frank. Ich flog überallhin, sogar nach Taiwan, Singapur und Shanghai für den Fall, dass es sich um ein chinesisches Schriftzeichen handelte, doch ich fand nichts heraus. Niemand hatte es je zuvor gesehen. Wäre ich nicht dem alten Mann in Kagoshima begegnet, hätte ich den Verstand verloren.«
Während er mir zuhörte, rollte Renna seine imaginären Murmeln im Mund herum. »Aber du bist ihm begegnet. Und sollten sich die Schriftzeichen als identisch erweisen, haben wir einen ganz neuen Ansatz.«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass es verschiedene sind.«
»In Ordnung. Kennst du das M&M in der Fifth Street?«
»Klar.«
»Frühes Dinner gegen vier? Ich bring dir das Kanji, sobald die Jungs vom Labor damit fertig sind.«
»Hört sich gut an.«
»Glaubst du, es wird sauber?«
Ich nickte. »Falls normale Kalligrafietinte verwendet wurde, hat sie das Blutbad unbeschadet überstanden. Einmal getrocknet, können die meisten Flüssigkeiten der Tinte nichts mehr anhaben. Weshalb ja viele alte Schriftrollen bis heute so gut erhalten sind.«
Rennas Augen blitzten auf wegen der vermutlich ersten positiven Nachricht des Abends. »Gut zu hören«, sagte er.
»Gut und schlecht. Sollten wir einen Treffer landen, geraten wir womöglich mitten in eine Schlangengrube.«
Er nickte unglücklich. »Du sprichst von der Tatsache, dass es in mindestens zwei Ländern mehrere Opfer gab, richtig?«
»Ja.«
»Klingt wenig verlockend, ich weiß. Aber ich nehme es, wie es kommt. Hat der alte Bursche etwas über die Anzahl der Leichen an den japanischen Fundorten verlauten lassen?«
»Nein. Allerdings hegte er einen Verdacht.«
»Und der wäre?«
»Dass es sich um einen methodischen Serienkiller handelt.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























