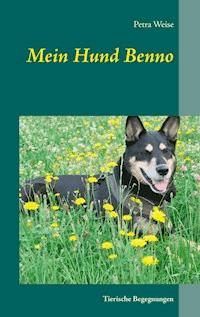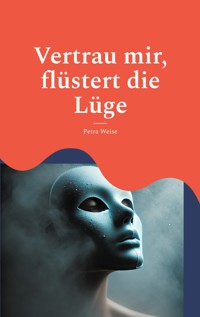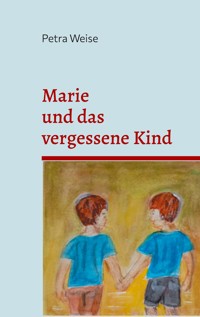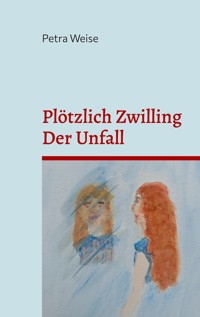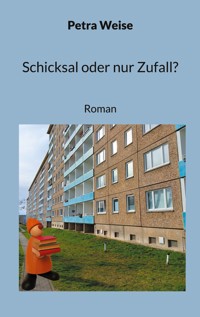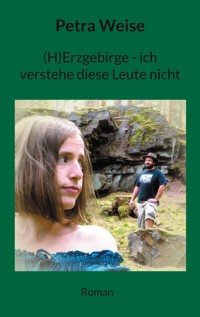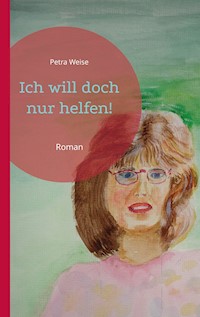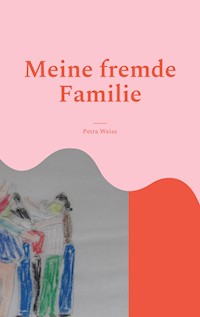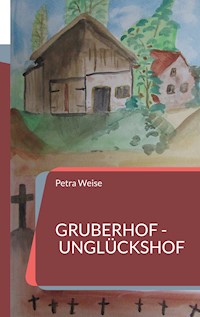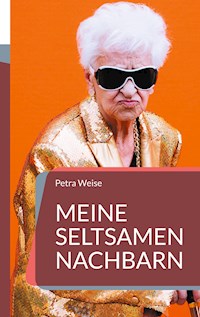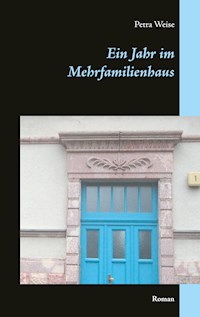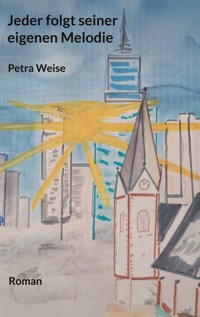
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Anfang ist auch das Ende. Als Tanjas Oma stirbt, reist sie zum ersten Mal nach über dreißig Jahren wieder in ihr Heimatdorf Reinsberg in Sachsen, wo sie alte Spielkameraden aus ihrer Kindheit trifft. Entsetzt erfährt sie deren Lebensgeschichten. Kaum wieder daheim in Frankfurt ändert sich ihr Leben, weil ihr Mann seltsam wird und ihre Familie auseinander bricht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 219
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
-
Wenn einer aus seiner Seele singt, heilt er zugleich seine innere Welt.
Yehudi Menohin
Das Leben ist wie eine schöne Melodie. Nur die Texte sind durcheinander.
Unbekannt
Inhalt
2025 - Reinsberg
Oma
Helga
Nicole
Andrea
Heiko
Roswitha
Torsten
Sven
Schilddrüsentest
Eltern
2000 - Ralf
Edda
Kinder
2025 - Ralf
Leonie
Konflikt
Krankheit
Eskalation
Sparkasse
Linus
Schluss
2025 - Reinsberg
„Hörst du die Kirchenglocken?“
„Nein.“
„Hast du wieder kein Hörgerät in deinen Ohren?“
„Nein.“
„Dir ist wirklich nicht zu helfen.“
Ralf winkt mit der Hand ab. Das tut er oft, wenn er meint, jeder Rat an mich wäre verschwendet.
„Aber es ist doch nicht wichtig, Kirchenglocken zu hören“, verteidige ich mich.
„Was bitte ist dir überhaupt wichtig?“
„Du bist mir wichtig!“, sage ich und lächle ihn an.
Ralf verzieht das Gesicht.
„Das glaube ich nicht, denn mich verstehst du auch nicht.“
„Weil du nuschelst.“
„Ich nuschle nicht. Mach deine Hörgeräte rein! Dazu sind sie schließlich da.“
„Ja“, sage ich und denke: „Und du nuschelst weiter statt laut und deutlich zu sprechen.“
Seit ich schwerhörig bin, versteht Ralf mich nicht mehr. Ich muss fast jeden Satz wiederholen, obwohl ich laut und deutlich spreche. Er selbst wiederholt seine gemurmelten Worte nicht, ich soll die Hörgeräte einsetzen. Das finde ich seltsam, weil es verkehrte Welt ist.
Ich merkte als Kind nicht, dass ich schwer höre, weil ich es nicht anders kannte. Mein Umfeld hielt mich für gedankenlos und schusslig, wenn ich nichts verstand. Vor etwa fünf Jahren wurden die Texte in Fernsehfilmen immer häufiger mit Musik unterlegt, die oft lauter war als die leisen Stimmen der Schauspieler, die oft undeutlich sprachen. Ich merkte, dass ich sie besser verstand, wenn ich den Mund beim Sprechen sah, was natürlich nur bei deutschen Filmen und nicht bei fremden Sprachen funktionierte. Denn das, was ich sah, passte nicht zu dem, was ich hörte.
Also ging ich zum nächstbesten HNO-Arzt. Dort musste ich trotz Termin stundenlang warten, während Kunden, die eine Botox- oder Vitaminbehandlung vereinbart hatten, sofort ins Sprechzimmer gerufen wurden. Verärgert beschwerte ich mich, doch es hieß, die Ärztin bestimme selbst, wen sie wann behandelt. Da wartete ich nicht länger, ging nach Hause und vereinbarte bei einer anderen HNO-Praxis einen Termin. Dort schockte mich der brechend volle Warteraum, in dem es keinen freien Stuhl mehr gab. Trotzdem wurde ich exakt zur vereinbarten Zeit aufgerufen. Allerdings so leise, dass ich meinen Namen nicht hörte. Schließlich bin ich schwerhörig. Eine Frau im weißen Kittel nickte mir zu und zeigte auf eine Tür. Dahinter verbarg sich eine schalldichte Kabine, wo ich mir Kopfhörer aufsetzen sollte. Damit hörte ich in unterschiedlichen Lautstärken Zahlen und Worte, manchmal mit Geräuschen unterlegt. Danach untersuchte mich die Ärztin. Zuerst glaubte ich, sie sei taubstumm, weil sie nicht sprach, sondern nur mit ihrer Hand zeigte, in welche Richtung ich meinen Kopf drehen sollte. Sie erklärte nicht, was sie machte und warum. Zum Glück war keine der Untersuchungen schmerzhaft, nur unangenehm. Jedenfalls besitze ich seitdem Hörgeräte. Allerdings nutze ich sie nur zum Fernsehen, weil ich die vielen Geräusche nicht ertrage, die mir ohne Hörhilfen erspart bleiben: Autos sind viel zu laut, auch das Vogelgezwitscher. Besonders nerven mich die Kaugeräusche beim Essen, dieses Schmatzen und Schmorgeln, was mir den Appetit und die Lust an Gesellschaft am Tisch verderben.
„Beim Wandern brauche ich keine Hörgeräte. Ich trage sie nur beim Fernsehen.“
„Eben. Dabei sollst du sie nur zum Schlafen herausnehmen.“
„Die Technik soll mir helfen, wenn ich sie nötig habe. Am Tag ist sie mir lästig, da will ich sie nicht.“
„Weil du stur bist.“
Nein, stur bin ich nicht, denn die Hörgeräte sind für mich da und nicht ich für die Hörgeräte. Ich habe sie in allen Situationen ausprobiert und gemerkt, wobei ich mich wohl fühle und wobei nicht.
Ralf winkt noch einmal mit der Hand ab und bleibt stehen, um eine Blüte an einem Strauch zu fotografieren. Er macht immer und überall Fotos. Nicht wie ich mit dem Handy, sondern mit einer großen Kamera, die er stets mit sich herumschleppt. Die Aufnahmen bearbeitet er am Computer und speichert sie in einer Datei. Ich bekomme sie höchst selten zu sehen, andere Leute überhaupt nicht. Manchmal fasst er Bilder zu Themen zusammen wie zum Beispiel Vögel im Wald oder Motorräder oder alte Türen und lässt sich Bücher mit diesen Aufnahmen drucken. Die teuren Bildbände liegen dann in seinem Bücherregal oder er verschenkt sie an Freunde und unsere Kinder. Leonie interessiert sich nicht für Bildbände. Sie will nach dem Abitur Politik studieren und Linus träumt davon, mit einer Musikgruppe auf Konzerten zu spielen. Zum Glück ist inzwischen seine Hip-Hop-Phase vorbei, denn der eintönige Sprechgesang, Rhythmus-Schläge, seltsamen Bewegungen und schlotternde Hosen gingen mir ziemlich auf die Nerven. Im Keller hat er einen Übungsraum, wo er seine E-Gitarre an den Verstärker anschließen und so laut röhren darf wie er mag. Mich wundert, dass Linus inzwischen Heavy Metal mag, denn er ist ein stiller und in sich gekehrter Junge, der jedem Streit aus dem Weg geht und laute Worte verabscheut, aber keine laute Musik. Ich muss zugeben, dass einige der Titel, die er spielt, eine recht hübsche Melodie haben. Sein Vorbild sind vier Brüder aus Australien, die sich Mixed Up Everything nennen und Titel von bekannten Hardrock- und Metalgruppen nachspielen.
Soll ich weitergehen oder auf Ralf warten? Er kennt die Leute nicht, die uns ständig grüßen. Hier im Dorf grüßt jeder jeden, auch den, den er gar nicht kennt. Für den Gruß dankt man. Das ist neu für Ralf, denn in der Großstadt gibt es so etwas nicht. Anfangs konnte ich mich nur schwer daran gewöhnen, in der Großstadt an den Leuten, denen man begegnet, grußlos vorbeizugehen und sie nicht einmal anzuschauen. So ist das in Frankfurt, wo wir seit mehr als dreißig Jahren wohnen und arbeiten.
Doch jetzt sind wir in Reinsberg, meinem Heimatdorf. Es ist nicht das berühmte Rheinsberg nördlich von Berlin, obwohl es auch hier in unserem kleinen Dorf ein Schloss gibt. Es ist nur nicht so gewaltig, so schön und schon gar nicht so berühmt wie das Rheinsberg, über das Kurt Tucholsky das Bilderbuch für Verliebte schrieb und es sogar einen Film gibt. Unser Schloss ist eher eine Burg, die auf einem Steilhang über dem Flüsschen Bobritzsch steht. Man kann sie nicht besichtigen. Auch das nahe Schloss Bieberstein nicht, in dem allerdings manchmal Kammerkonzerte stattfinden. Als Kind trieb ich mich gern auf dem Gelände herum. Es gab viele alte Bäume und Baumalleen rund um das Schloss, für uns Kinder das reinste Abenteuer. Nur durften wir uns nicht erwischen lassen, wenn wir auf der Mauer herumturnten.
Ich erinnere mich an das Vogelschießen, das seit zweihundert Jahren immer im Juni stattfindet und zu dem es angeblich immer regnet. Das stimmt aber nicht, denn ich weiß, dass ich meist kurze helle Sommerkleidchen, weiße Kniestrümpfe und Sandalen trug. Immer spielte eine Musikkapelle. An den hölzernen Vogel, den die Männer mit Armbrüsten abschossen, kann ich mich allerdings nicht erinnern. Aber ich weiß noch, dass einmal der Dorfschmied zum besten Schützen gekürt wurde, obwohl er gar nicht geschossen hatte. Er war viel zu betrunken dazu. Es verlangte der Brauch, dass der Sieger alle Männer zu einem großen Festessen einladen musste und ich weiß noch, dass alle ein lustiges Lied grölten von einem Schmied, der eine Sau schlachtet und dem Refrain Gehn wir mal rüber zum Schmied seiner Frau. Doch seine Frau war darüber so entsetzt, dass sie weinend nach Hause lief. Sie kannte die Männer und wusste, wie viel sie essen und trinken konnten. Damals gab es in der DDR nicht so viel zu kaufen wie heute, aber vermutlich besaß der Schmied ein Schwein, auf das es die Bewohner abgesehen hatten.
1990 zogen meine Eltern nach Frankfurt. Ich war damals dreizehn Jahre alt. Im nächsten Jahr werde ich bereits fünfzig. Mit Fünfzig ist man alt. Trotzdem werde ich diesen Tag feiern, weil ich sehr gern feiere und keine Gelegenheit auslasse. Für Ralf ist ein Geburtstag kein Grund für ein Fest.
Oma
Nach all den Jahren begleite ich meine Eltern nach Reinsberg, weil Oma gestorben und morgen ihre Beerdigung ist. Sie erreichte mit sechsundachtzig Jahren ein sehr hohes Alter. Ich weiß nicht, warum ich sie nie besuchte. Früher waren wir ein Herz und eine Seele, aber das ist lange her – mehr als fünfunddreißig Jahre. Wir lebten in einem winzigen Haus: Oma, meine Eltern, meine große Schwester Helga, unser Bruder Nik und ich. Nik schlief auf dem Wäscheboden hinter einer Trennwand aus Sperrholz. Helga und ich teilten uns die Bodenkammer unter der Dachschräge, wo es im Winter entsetzlich kalt durch alle Ritzen pfiff. Oma schlief in einer winzigen Kammer ohne Fenster. Eine Stube gab es nicht, nur noch das Schlafzimmer der Eltern. Aber es gab eine schöne große Küche mit einem Herd, der das gesamte Häuschen wärmte. Später stellte Vater einen Propangasherd auf, der Oma das Kochen erleichterte. Wir hatten Wasseranschluss in der Küche und eine Treppe tiefer ein Spülklosett. Die meisten Leute im Dorf mussten sich mit einem Plumsklo auf dem Hof begnügen.
Die Eltern fuhren am Morgen nach Freiberg zur Arbeit und kamen erst nach 19 Uhr mit dem letzten Bus zurück. Am Wochenende hatten sie frei, doch wir Kinder und die Oma mussten Samstags in die Schule, denn Oma war Lehrerin. Sonntags wanderte Oma mit uns Kindern die Grabentour. Oft aßen wir Mittag in einem Gasthof, von denen es im Ort und in der Umgebung mehrere gab. Ich habe mich nie gefragt, warum uns die Eltern so selten begleiteten. Wenn wir Sonntags nicht in einem Gasthof zu Mittag aßen, kochte Oma für uns. Meist gab es Buletten mit Kartoffeln und Möhren aus ihrem Garten, Bratwurst mit Kartoffelbrei und Sauerkraut, Makkaroni mit Jagdwurst oder Pellkartoffeln mit Quark und Leberwurst. Immer am ersten Weihnachtsfeiertag schmorte Oma Rouladen, dazu Rotkraut und Klöße. Gemüse gab es im Dorfladen nicht zu kaufen, nur Rot- und Weißkohl.
Nik musste nie daheim helfen, weil er ein Junge war. Helga hatte die Steinfußböden im Haus und die Außentreppe zu schrubben und zu wischen. Für mich blieb der tägliche Abwasch. Wir hatten keine Spülmaschine, das heiße Wasser erhitzte ich erst in einem Kessel auf dem Herd. Ich weiß noch, dass ich als Kind mit dem Geschirr im Abwaschwasser spielte. Die große Schüssel war ein Boot, das im Spülwasser versank und sämtliche Passagiere verlor: Messer-Männer, Gabel-Frauen und Löffelkinder. Tassen waren meine Rettungsboote und der Spüllappen rubbelte die Ertrunkenen ab und brachte sie an Land: das Abtropfgitter. So brauchte ich sehr lange für diese Arbeit, aber sie war nicht mehr ganz so eintönig.
Wenn Oma mich dabei erwischte, schimpfte sie: „Trödel nicht!“ Sie nannte mich Trödelliese, auch die Eltern nannten mich so, obwohl sie gar nicht wussten, wie viel Arbeit der Alltag in diesem kleinen alten Haus machte. Sie kamen erst nach Haus, wenn die Arbeit getan war, und setzten sich an den gedeckten Abendbrottisch. Beim Essen wurde nicht geredet. Wir sprachen überhaupt nur das Nötigste. Es war nicht nötig, über die Nachbarn und Schulfreunde zu reden. Ich fand das nicht schlimm, weil ich es nicht anders kannte.
Opa sahen wir nur selten, denn er war Seemann und fuhr auf den Weltmeeren umher, wovon er uns wilde Geschichten erzählte, die ich zwar nicht alle glaubte, mich aber einschüchterten. Ich fürchtete mich vor ihm, denn seine laute Stimme ließ die Wände wackeln. Das stimmt wirklich, denn nur die Außenmauern unseres Hauses waren aus Ziegeln, die Tür zur Schlafstube der Eltern aus Lehm und oben auf dem Boden gab es dünne Holzwände, weshalb wir ihn schnarchen hörten, wenn er bei Oma in der Kammer schlief.
Anfangs hatten die Sowjets alle Frachter als Reparation mitgenommen und ließen auf den wenigen verbliebenen Fischkuttern stets bewaffnete Rotarmisten mitfahren. Neue Schiffe zu bauen erlaubte die Besatzungsmacht vorerst nicht. Doch bereits Mitte der 70er Jahre gehörte die DDR zu den wichtigsten Seefahrernationen der Welt mit einer Flotte von über zweihundert Schiffen, die die Häfen in über hundert Länder anliefen. Kein anderes europäisches Land hatte ein so weitverzweigtes Netz von Routen. Opa war glücklich, so gut zu verdienen und aus dem Land herauszukommen, das von einer stark bewachten Mauer umgeben war, die niemanden durchließ. Eines Tages blieb er einfach weg. Es hieß, er habe sich abgesetzt, doch es wurde nie wieder über ihn gesprochen. Ich habe ihn nicht vermisst, denn ich kannte ihn kaum. Ob Oma ihn vermisste, weiß ich nicht. Vermutlich macht man sich als Kind darüber keine Gedanken.
Erst viele Jahre später erfuhr ich, dass Opa gar nicht unser richtiger Opa war. Er hätte gern meine Mutter adoptiert, doch das wollte Oma nicht.
Sie lernte einen anderen Mann kennen, dem wir nie begegneten, weil er in Freiberg wohnte und arbeitete. Oma wollte keinen Mann mehr im Haus, weil sie das selbständige Leben allein mit ihrer Tochter gewöhnt war. Er durfte sie später auch nie zu ihren Besuchen bei uns in Frankfurt begleiten. Vor fünf Jahren legte sie ihrem Brief eine Todesanzeige aus der Zeitung bei. Ich empfand keine Trauer, denn ich kannte den Mann nicht und glaubte nicht, dass Oma ihn vermisst, da sie nicht einmal mit ihm zusammen wohnen wollte. Sie erzählte uns, dass sie Sonntags manchmal Ausflüge mit ihm unternahm und ich stellte mir vor, wie sie mit ihm die Grabentour lief.
Für mich war sie schon immer alt, obwohl sie kaum fünfzig gewesen sein kann, als wir wegzogen. Aber sie war ja eine Oma und Omas sind alt. Sie trug immer einen dunklen Rock und eine beige Bluse zur Arbeit in der Schule und daheim eine bunte Kittelschürze. So sehe ich sie auch heute noch vor mir. Mutter wollte Oma später bei ihren Besuchen in Frankfurt immer etwas Hübsches zum Anziehen kaufen, doch sie blieb nach wie vor bei ihrem dunklen Rock und der beigen Bluse.
Als ich Ralf von meinem Seefahrer-Opa erzählte, lachte er mich aus und erklärte mir, dass die DDR keine seetüchtigen Schiffe hatte und schon gar keine weltweit bekannte Flotte. Ihm fiel eine Dokumentation ein, wo Seemannsfrauen berichteten, dass sie ihre Männer besuchten, wenn diese in einem Hafen irgendwo in der Welt ankerten. Das war Oma natürlich nicht möglich, denn sie konnte nie nach Frankreich oder Südamerika oder Asien reisen, um ihren Mann zu treffen. Sie lebte in der DDR und hätte maximal in die beiden Nachbarländer Polen und CSR reisen dürfen.
*****
Mir fällt ein, dass Oma beim Kochen und Waschen ein Lied summte. Es war immer die gleiche Melodie, doch sie erinnerte sich nur an wenige Worte wie Susi, Kindle, Suse, wirst du grot, so schloa ick di. (gesamter Text auf Seite 231)
„Aber was heißt das?“
„Das weiß ich nicht genau. Vermutlich bedeutet es, dass man das Kind umsorgt, so lange es klein ist, es aber später streng erziehen und schlagen wird. Mir ist nur diese eine Zeile geblieben. Meine Mutter sang es uns Kindern, damit wir einschlafen.“
Solch einen seltsamen Text hat man Kindern zum Einschlafen vorgesungen?
„Was ist das für eine Sprache?“
„Pommersches Platt. Ich habe es vergessen, aber manchmal spüre ich die Melodie der Sprache in mir.“
Oma sprach nie von dieser Heimat und ich fragte erst viele Jahre später.
Sie wuchs ist in Pommern auf, in Stolp. 1944 war sie fünf Jahre alt, als die Vertreibung begann. Der Vater war im Krieg gefallen, die Mutter trug die kleine Schwester Marta, Hugo schleppte den Sack mit dem Bettzeug und Wiltraud den Korb mit Brot, sauren Gurken, Äpfeln und Trockenfischen. So gingen sie der Katastrophe entgegen. Am Straßenrand standen die polnischen Neubürger, jagten die Deutschen mit Schimpf und Schande davon und nahmen ihnen das Wenige weg, was sie bei sich trugen. Oma sollte auf Ursula aufpassen, die nicht mehr laufen wollte und sich einfach an den Straßenrand setzte. Plötzlich verschwanden die Mutter und Geschwister zwischen all den vielen Menschen, die an ihnen vorbeizogen. Eine Frau legte ihr Baby neben Ursula und ging einfach weiter. Das Kind war steif wie eine Riesenpuppe. Es war tot. Eine andere Frau zog den Schwestern Jacken und Schuhe aus und nahm sie einfach mit. Oma war viel zu schockiert, um sich zu wehren. Es war November und die Mädchen froren entsetzlich. Als es Nacht wurde, krochen sie in eine Scheune und versteckten sich im Stroh. Sie waren schrecklich erschöpft und schliefen sofort ein, obwohl sie der Hunger quälte. Oma wurde am Morgen von Gewehrschüssen und Angstschreien wach. Bevor sie nachsehen konnte, was draußen passiert, spürte sie einen heftigen Schlag gegen ihr Bein, von dem sie ohnmächtig wurde. Als sie wieder zu sich kam, war es stockdunkel und sie fand sich ganz allein in der Scheune. Alle, die dort mit ihr übernachtet hatten, waren verschwunden. Auch Ursula. Omas Bein hämmerte und ihr fielen die Schüsse und Schreie wieder ein. Am Oberschenkel klaffte ein Loch, verdeckt von verkrusteten schwarzen Blutresten. Sie band einen Fetzen Stoff um die Wunde, kroch vorsichtig aus ihrem Versteck und schloss sich einer Gruppe zerlumpter Leute an, die auf der Straße vorbei zogen. Es gab nur diese eine Richtung, in die sich die vielen Menschen schleppten mit ihren Handwagen, Kindern und Rucksäcken. Oma trottete einfach mit, obwohl sie mit dem verletzten Bein kaum laufen konnte und nicht wusste, wo Ursula war und wo die Mutter und die anderen Geschwister. Sie hatte keine Vorstellung davon, wie lange sie mit all den fremden Leuten unterwegs war und erinnert sich nicht daran, wo sie während dieser Zeit schlief. Sie weiß nur noch, dass es schrecklich kalt war und sie ständig ein beißender Hunger quälte.
Schließlich kam der Tross in Reinsberg an, wo die Schusswunde versorgt wurde. In ihr steckte ein Projektil, das man entfernte. Endlich bekam Oma Suppe, Brot und heißen Tee und schwor, diesen Helfern bis an ihr Lebensende dankbar zu sein. Im Ort gab es fast mehr Vertriebene als Einwohner. Alle brauchten ein Dach über dem Kopf, ein Bett und etwas zu essen. Mitgefühl gab es nicht, da jeder durch Krieg und Vertreibung traumatisiert war. Oma wurde einem Bauern zugeteilt, der sie für wenig Essen viel arbeiten ließ. Später kam sie in ein Waisenheim, wo sie nicht mehr hungern musste und mit anderen Kindern spielen durfte. Sie wollte ihre Familie finden, doch das war nicht möglich, weil sie sich nur an die Vornamen ihrer Geschwister und nicht an Nachnamen und Geburtsdaten erinnerte. Und da keiner nach ihr suchte, ging sie schließlich davon aus, dass alle auf dem Treck umkamen. Die Bilder an die Gesichter ihrer Familie verblassten, nur wie sie Ursula, ihre Mutter und die anderen verlor, sind in ihr Gedächtnis eingebrannt.
Weil sie so gut mit kleinen Kindern umgehen konnte, lernte sie später, als sie vierzehn Jahre alt war, Kindergartenhelferin. Den Beruf hatte sie sich nicht ausgesucht, sie wurde nicht einmal gefragt. Sie wurde auch nicht gefragt, ob sie die Zudringlichkeiten des Lehrmeisters erträgt. Als sie sich ihrer Erzieherin anvertraute, musste sie Schweigen geloben. Ansonsten drohte ihr die Einweisung in einen Jugendwerkhof. Schweigen klingt nach Ruhe und Frieden. In Wirklichkeit ist es die Vorstufe zur Lüge oder sogar schlimmer als eine ausgesprochene Lüge.
Oma war sechzehn Jahre alt und schwanger, als ihr nach der Ausbildung in Freiberg eine Anstellung in einem Kindergarten und eine Bodenkammer zugewiesen wurde. Zwei Häuser weiter befand sich die Kinderkrippe, wo das Baby von 6 bis 17 Uhr untergebracht war, so dass Oma voll arbeiten konnte. Gleichzeitig besuchte sie einen Lehrgang zur Unterstufenlehrerin, denn in der Nachkriegszeit fehlten Lehrer. Viele Lehrer waren gefallen oder nicht mehr arbeitsfähig. Außerdem wurden alle, die Mitglied der NSDAP waren, aus dem Schuldienst entlassen.
Die Arbeit als Lehrer machte ihr viel Freude, zumal sie nun mehr Zeit für ihr Kind hatte. Alleinerziehend in der DDR war kein Problem, wenn man sich linientreu verhielt. Damals wussten wir nicht, dass man Andersdenkenden die Kinder einfach wegnahm und von zuverlässigeren Paaren adoptieren ließ.
Als Mutter vier Jahre alt war, wurde Oma die Stelle als Grundschullehrerin für Reinsberg und das benachbarte Bieberstein zugewiesen. Außerdem erhielt sie den Schlüssel zu dem kleinen Häuschen, in dem später wir alle lebten. Heute kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie drei Erwachsene und drei Kinder in solch einem winzigen Haus leben können. Es hatte zwar eine große Küche, aber nur ein einziges Zimmer, zwei Bodenkammern und ein Klo. Wir Kinder fanden das nicht schlimm, zumal wir es gar nicht anders kannten. Außerdem waren wir fast nur draußen und kamen wie die Eltern nur zum Schlafen ins Haus. Schulaufgaben machten wir am Küchentisch. Ab der fünften Klasse gab es keinen Unterricht mehr im Dort. Wir fuhren mit dem Bus nach Halsbrücke oder Nossen zur Schule, wobei wir uns frei und mächtig erwachsen fühlten.
Ich erfuhr erst viele Jahre später ein wenig aus Omas Vergangenheit, weil sie nie etwas erzählte, schon gar nicht von Pommern. Das war in der DDR nicht erwünscht. Das Wort Vertreibung gehörte zum Klassenfeind in die BRD und galt in der DDR als revanchistisch. Man nannte die Menschen, die man mit Gewalt aus ihrer Heimat vertrieben hatte, Umsiedler. Vertriebene, die in den umliegenden Dörfern lebten, suchten Kontakt zu Oma, doch die lehnte es ab, weil es nicht gern gesehen wurde und sich sich für eine Lehrerin nicht ziemte. Nur ein einziges Mal hörte ich Oma von Stolp schwärmen, das sie Kleinparis nannte, von den gepflegten Parks, den prächtigen Gebäuden, von der Fahrt mit der Bahn zum Strand nach Stolpmünde, vom Flüsschen Stolpe, das langsam und glitzernd zwischen Weiden dahinfloss, deren Zweige bis hinunter zum Wasser reichten, wo man sich wunderbar verstecken konnte. Ich glaubte damals, Stolp sei eine Stadt in der DDR. Heute tut es mir leid, dass ich nie fragte und ihre Geschichte erst viel später erfuhr, als ich längst erwachsen war und Oma uns in Frankfurt besuchte.
Ich verließ als Kind ebenfalls meine Heimat Reinsberg, doch freiwillig zusammen mit meinen Eltern und Nik. Außerdem war ich viel älter als Oma damals und nie ganz allein auf mich gestellt. Wie fühlen sich Menschen, die man brutal aus ihrer Heimat vertreibt? Ich mag es mir nicht vorstellen. Omas Leidensgeschichte habe ich bis heute nicht wirklich verdaut und viele Jahre von verlassenen Kindern, Sterbenden, Verletzten und Hungernden geträumt.
*****
Meine Schwester Helga organisierte die Beerdigung in der Kirche. War Oma gläubig? Ich weiß es nicht, weil wir nie darüber sprachen. Glauben kann ich es nicht, denn Lehrer in der DDR waren keine religiösen Personen, sondern das wichtige Sprachrohr des Staates.
Die kleine weiß getünchte Kirche mit ihrem hohen roten Dach wirkt freundlich auf mich. Auch innen erstrahlt alles in Weiß und ein wenig Hellblau mit Gold ohne jeden Prunk, was auf mich angenehm ehrlich wirkt. Ein gewaltiger tiefer Ton lässt mich erschrocken zusammenfahren. Ich schaue mich um und entdecke oben auf der Empore eine wunderschöne schneeweiße Orgel, deren Klänge den gesamten Saal einnehmen. Das Musikstück kenne ich nicht, aber es geht mir zu Herzen. Danach hält der Pfarrer eine befremdende Rede über Tod und Auferstehung und die Liebe Gottes und dass die Oma während ihrer letzten Lebensjahre zu ihrem Glauben zurück fand. Ihr Mann sei ihr vorausgegangen. Wohin vorausgegangen? Auf den Friedhof? Vier Frauen singen eine angenehme Melodie mit einem seltsamen Text, der von Führung handelt, ohne die man nicht leben kann, denn allein kann man keinen Schritt gehen. (So nimm denn meine Hände von Friedrich Silcher) Hat Oma so empfunden? Oder Helga? Der Pfarrer findet freundliche Worte über Omas Leben und lobt ausführlich Helgas Fürsorge. Dagegen habe sich die übrige Familie sofort nach der Wende in den Westen abgesetzt, was der Oma viel Kummer bereitete. Was redet er da? Sie hat nie dergleichen durchblicken lassen, sondern uns jedes Jahr mit Freude in Frankfurt besucht und noch lange von unseren Ausflügen in ihren Briefen geschwärmt. Sie war sogar zwei Mal bei Nik in New York.
Nik wäre sicher gern zur Beerdigung gekommen, doch seit Omas Tod sind nur sieben Tage vergangen und wir erhielten erst vorgestern die Nachricht von der heutigen Beerdigung. Wir riefen Nik sofort an, doch er hätte einen Privatjet nehmen müssen, um rechtzeitig hier zu sein. Ein normaler Flug von New York nach Frankfurt dauert acht Stunden und dann noch einmal sechs Stunden per Zug oder Mietauto bis Freiberg. Das war innerhalb von zwei Tagen nicht machbar.
Mehr als hundert Leute aus dem Dorf legen große Blumensträuße an der Urne ab. Ganz offensichtlich war Oma im Ort sehr beliebt. Nach der Beisetzung erbittet der Pfarrer den Beistand Gottes für die Verstorbene und ihre Angehörigen und segnet das Grab. Für mich ist das alles neu und spannend, denn noch nie zuvor war ich während eines Gottesdienstes in einer Kirche und auch noch nie auf einer Beerdigung.
Die meisten Leute geben Mutter und Helga die Hand, doch einige nicken Mutter nur kurz zu und umarmen Helga. Vielleicht, weil Helga im Ort lebt und sich um Oma kümmerte. An Mutter oder mich erinnern sich vermutlich nur wenige.
Eine Frau drückt fest meine Hand und sagt: „Deine Oma war großartig. Sie wird dem Ort fehlen.“
Mir auch, denke ich, obwohl ich sie nur wenige Tage im Jahr sah. Ich schaue die Frau an und weiß, dass ich sie kenne.
„Nicole“, sagt sie. „Ich bin die Nicole. Wir haben als Kind zusammen gespielt.“
„Nicole!“, rufe ich aus und beiße mir auf die Lippen, weil der frohe Ruf so unpassend zwischen all den schweigenden Leuten erschallt.
Wir waren Nachbarskinder und gingen in die gleiche Klasse. Im Leben hätte ich sie nicht erkannt, wenn sie sich nicht vorgestellt hätte. Wir waren dreizehn Jahre alt, als ich fortging.
Mir fällt ein Mann auf, dem einige Leute ihr Beileid aussprechen, obwohl er nicht mit uns verwandt ist.
„Das ist Heiko“, erklärt Nicole. „Sein Vater hat sich totgesoffen und wurde gestern in Freiberg beerdigt.“
„Oje“, stöhne ich, weiß aber trotzdem nichts über diesen Heiko.
Angestrengt überlege ich, ob ich ihn als Kind kannte.
„Wir laden zum Trauerkaffee in den Landgasthof Dittmannsdorf ein“, verkündet Mutter, denn in Reinsberg gibt es keinen Gasthof mehr, nur einen Imbiss am Bad, der keine Trauerfeiern ausrichtet.
„Du brauchst dich hier nicht aufzuspielen!“, zischt Helga. „Hättest fernbleiben sollen.“ Sie wendet sich an die Trauergäste. „Im Gemeindehaus haben fleißige Helfer den Leichenschmaus vorbereitet, wozu ich alle Freunde, Nachbarn und Kirchenmitglieder einlade.“
„Die Familie hat sie nicht erwähnt“, bemerke ich.
„Das kann nur ein Versehen sein“, beruhigt mich Vater.
Helga dreht uns den Rücken zu. Ich gehe zu ihr und sage, dass ich im Gasthof für dreißig Leute Suppe, belegte Brötchen, Kaffee und Kuchen bestellte.
„Du kannst bestellen, wann und wofür du willst. Was geht mich das an?“
„Aber Helga, es ist Omas Trauerfeier!“, ruft Mutter aus.