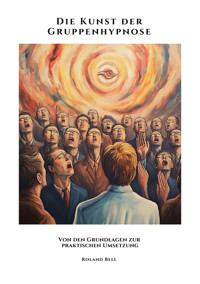Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Palästina: Fegefeuer für Fortgeschrittene. *** Israel kennen Sie? Juden scheinen ihn alle ein wenig seltsam? Nicht mehr, nachdem Sie Rafael kennengelernt haben! Während andere sich um sein Wohlbefinden sorgen, büxt der Schwerkranke heimlich aus seiner Jerusalemer Klinik aus und macht sich auf den Fußweg ins benachbarte Ramallah, um zwei zerschundene Seelen zu vereinen, die Gott füreinander bestimmt hat: Einen politischen Gefangenen und eine verurteilte Mörderin … *** Roland Bell, Naturwissenschaftler, Romantiker, dem Weltschmerz verpflichtet, führt seine Leser ins Zentrum des Schmerzes: Jerusalem, dem Schmelztiegel dreier Religionen. * Seit über fünfzig Jahren steht das benachbarte Westjordanland völkerrechtswidrig unter israelischer Besatzung. Das bisschen Selbstbestimmung, das den Palästinensern gewährt wird, missbrauchen machtvolle Familien, Funktionäre und Fanatiker für ihre Zwecke. Kein Ort, um Gerechtigkeit zu erfahren; geschweige denn wahre Liebe … *** »Der Krieg bringt mehr Leutchen zum Beten als eine Armee von Rabbinern. Gerade im Leid finden wir zu uns selbst. Tragisch für uns Menschen, aufregend für uns Schriftsteller.« *** Im palästinensischen Staatsgefängnis an-Nabhani in Ramallah stößt du auf Gewaltverbrecher, Terroristen und politische Gefangene. »Klapse« nennen seine Insassen ihren Knast liebvoll, denn außerdem beherbergt er psychisch kranke Straftäter – und Straftäterinnen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 810
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wenn ich dir in diesem Leben nicht begegne,
So lass mich den Verlust spüren.
If I never meet you in this life,
Let me feel the lack.
Terrence Malick in »The Thin Red Line«
Jehovas
Albtraum
Das Buch Tobit
von Roland Bell
Inhalt
Das Lied der tausend Nächte
Nasim
Malik
Abdel Nachim
Achmed
Tariq
Karima
Judith
Hiobs Botschaft
Rafael
Edina
Ezekiel
Ashmodai
Samira
Towbi
Ghabal
Das Buch Thabit
Vermächtnis
Das Lied der tausend Nächte
Zum Abendessen kamen die Panzer.
In einem Straßengraben beehrte ich zusammen mit meiner abgewetzten Barbie einen Mogwai aus Plüsch in seinem Herrschaftshaus. Die Vorhut der jüdischen Armee verständigte sich durch Kommandos auf Arabisch; ihre Worte drangen nicht in meine Welt. Mit meinen Spielgefährten tänzelte ich über den Ballsaal des Palastes von Königin Scheherazade. Den olivgrünen Schatten des israelischen Gefreiten übersah ich – und auf wundersame Weise blieb meine kauernde Gestalt auch ihm verborgen. Bis das Rasseln von Ketten und das Dröhnen der Motoren meinen Palast verschlang und die Welt zurückfiel in das Ocker des Sandsteins.
Als meine Nase aus dem Graben hervorlugte, sah ich mich umgeben von Panzern. Angst fühlte ich keine. Wie will sich ein fünfjähriges Mädchen bedroht fühlen von solcherlei Ungetümen? So wenig, wie die Eintagsfliege einen Menschen zu fürchten vermag. Nein, ausgeliefert fühlte ich mich einer Welt aus Stahl, Öl und Qualm. Ein Rekrut schnellte von seinem Merkava Mark II und stapfte auf mich zu. Hebräische Flüche brüllte er in die Dämmerung und lächelte auf mich herab. Sein M16-Sturmgewehr ruhte mit gesenktem Lauf in der Rechten, entsichert, wie mein geübter Blick feststellte. Seine Linke griff nach mir. Tief in den Staub duckte ich mich, meine synthetischen Spielgefährten fest umklammert. Der Rauch seiner Zigarette senkte sich über mich. Ich kniff die Augen zusammen und schrie meine Verlorenheit hinaus. Mein Kreischen erhöhte sich um eine Oktave, als zwei behaarte Pranken mich nach oben zogen. Der vertraute Geruch von Oliven und Kardamom drang mir in die Nase und erleichtert sank ich in die Arme meines Vaters, der mir über den Nacken streichelte und mich mit einem Singsang beruhigte. Auf der Suche nach mir hatte er sich den Panzern mit erhobenen Händen und freiem Oberkörper entgegengeworfen und mit seinem gebrochenen Hebräisch »Friede, Brüder! Meine Tochter Nasim spielt hier im Sand!« geschrien.
Zitternd drückte ich mein Gesicht in seine Brust, die so wohlig nach Sorge und Erleichterung roch. Panzer, Motorräder und Bulldozer hörte ich an uns vorbeifahren. Zornig schrie uns die Nachhut hinterher, wir mögen verschwinden; die Lebensgefahr jedoch war gebannt.
Gerade wollte ich mich bei Vater für meinen Leichtsinn entschuldigen, da spürte ich durch die Haut seinen Herzschlag beschleunigen und er spurtete los: »Sie ziehen in unser Viertel!« Hinter einer Ecke hatte sie gelauert, die Furcht, um uns jetzt erneut anzufallen. Vater rannte und ich betete, er möge mich nicht absetzen. Durch die Gassen Ramallahs holten wir die Juden, die sich die Hauptstraße entlangquälen mussten, rasch ein. Die Nachbarn kamen uns entgegengerannt, manche mit weinerlichen, manche mit blitzenden Augen. Frierend drängten sie sich aneinander, einige Frauen hatte ich noch nie außerhalb des Hauses ohne Kopftuch gesehen. Wie ein Schild hielt mein Vater mich den brüllenden und drohenden Soldaten entgegen. Seine Lebensversicherung war ich, deshalb zeigte ich den Besatzern mein Gesicht. Doch bald half das nichts mehr.
»Stopp!« Auf der ganzen Welt versteht man dieses Wort. Drohend schwenkte der Jude seine MAK. Vater trat beschwichtigend einen Schritt vor – nur einen. Hase und Stier rangen in ihm, als der Bulldozer unser Haus verschlang. Nichts hatten die Sandsteinwände dem Stahlkoloss entgegenzusetzen. Die Häuser unserer Nachbarn stürzten als Nächstes. Hilflos zerbarst die Wut eines palästinensischen Viertels an den Panzern der Besatzer.
»Ihr reißt unser Zuhause nieder!« Verzweiflung bemächtigte sich Vaters Stimme. Einen weiteren Schritt trat er vor und wieder hielt das MG ihn zurück, bequemte sich aber einer Antwort: »Für die Gebäude liegt keine Baugenehmigung vor, abgerissen müssen sie werden.«
»Kaum einem Palästinenser habt ihr in den letzten zwanzig Jahren eine Baugenehmigung erteilt!«, brüllte mein Vater. »Nur die lausigen jüdischen Siedler dürfen bauen.«
»Das Land von Judäa und Samaria ist genauso unser Land wie das eure«, hielt der Jude entgegen. Doch fehlte seinen Worten die Kraft. Kaum zwanzig war er, braun gebrannt, vermutlich aus Tel Aviv, leistete er in einem fremden Land, dem von Israel besetzten Westjordanland, seinen Wehrdienst ab. Und tausendmal lieber wäre er über die Wellen des Mittelmeers gesurft, als mit Helm und Sturmgewehr die Bulldozer vor Frauen und Kindern zu beschützen.
»Das von eurem Gott versprochenes Land beherbergt mehr israelische Soldaten als jüdische Siedler!« Die Stimme meines Vaters sank hinab wie sein Blick. Wie denn mit einem Bulldozer diskutieren? Zu spät, zu Schutt und Staub war unser Haus zermalmt. Die Herzlosigkeit triumphierte.
»Nasim!« Meine Mutter löste sich aus der erstarrten Menschenmenge und rannte auf uns zu, gefolgt von meinen beiden Brüdern. Wie alle Anwohner hatte man sie aus den Häusern getrieben, kein Blut wollten die Soldaten heute sehen. Aufatmend umarmten wir uns.
Später stieß mein Onkel mit seiner Frau zu uns; Hiobsbotschaften verbreiteten sich im Viertel schneller als Panzer. Wir weinten gemeinsam, wir fluchten gemeinsam und machten uns auf den Weg zu seinem Haus. Genauso unrechtmäßig hatte er es errichtet wie viele andere im Viertel. Beengt war es. Aber der Ölofen spendete Wärme, wir aßen Gemüseeintopf, Joghurt mit Nüssen und Datteln, während die Soldaten ihre Nachtschicht beendeten. Beide Seiten beteten denselben Gott an, mit unterschiedlichem Namen. Obdachlos würden wir morgen die Trümmer nach Resten unseres Lebens durchwühlen.
Doch heute Abend lagen wir alle fünf eng umschlungen im Wohnzimmer meines Onkels. Meine Brüder schnarchten, ihr Atem roch nach Knoblauch und Kardamom, ich lag wach zwischen meinen Eltern, zu aufgeregt, um einzuschlafen. Mutter trug das mandelfarbene mit feinem Garn bestickte Tuch um die Schultern, das sie so liebte. Mehr hatte sie nicht retten können. Ihr staubiges Haar, in das ich mich hineinkuschelte, duftete nach einem Hauch von Vanille. Mein Vater schaffte es, uns beide im Arm zu halten. Besitzergreifend ruhte seine Hand am Busen meiner Mutter, wohlig im Halbschlaf grunzend. Ich schmiegte mich an ihn und war – glücklich. Ewig würde mich dieser Arm beschützen – gegen Winde, Sandstürme und jüdische Panzer. Selbst gegen Schaitan persönlich. Die Heimat in unseren Herzen, erklärte Vater später, könne niemand niederreißen. Wie wahr. Wenn ich mich einsam fühle, sehne ich mich zurück nach Ramallah in die Arme meines Vaters.
Mag es ein Tag der Heimsuchung für meine Brüder gewesen sein – der Jüngste wurde wieder Bettnässer und blieb es bis zum zwölften Lebensjahr – so fühlte ich mich behütet und geliebt wie niemals wieder. Der Tag, an dem uns die Panzer heimsuchten, wurde zum glücklichsten Tag meines Lebens.
»Von der Herzlosigkeit, die triumphierte, sprichst du wie von einem Feind. Zielst du auf die Juden damit?«
»Nein, Professor, auf ihre Panzer. Kalt und tot waren sie. Das seelenlose Gegenstück zur Wärme meines Vaters. Vater ist weg und niemand beschützt mich vor der Kälte, mir bleibt nur die Erinnerung.«
»Lediglich mit einer Erinnerung der Kälte des Daseins entgegenzutreten. Schwierig. Begegnet dir das Herzlose noch immer?«
»Wie jedem von uns, Professor. Doch nie wieder bohrte sich die Kälte so tief in mein Herz wie an dem Tag, an dem der Admiral starb.«
»Der Admiral? Klingt nach einer ungewöhnlichen Geschichte, Nasim.«
»Zugehört, bei Gott!«, bellt die Stimme des Admirals durch die Katakomben. Ich nehme die Hand von der Maus und schaue vom Bildschirm auf. Mitten im Satz unterbrechen die Kämpfer neben mir ihren Disput über den deutschen Trainer von Real Madrid.
»Zeit, meine Nachfolge zu ordnen.« Das Schweigen wird ohrenbetäubend, Unglaube gesellt sich hinzu.
»Bring Abu Ismael zu mir!« Eifrig stolpert ein vierzehnjähriger Junge nach draußen. Der Admiral verteilt bereits die nächsten Befehle: »Hört zu! Unwichtig, ob ich ihm meine Autorität persönlich übergebe: Abu Ismael bestimme ich zu meinem Nachfolger, mit Gott als Zeugen. Alle notablen Familien vertrauen ihm, kampferprobt ist er, diplomatisches Geschick besitzt er, genau wie euren Respekt. Wie ich bis heute, so wird Abu Ismael ab morgen die Truppen des Lagers führen. Vorsehen soll er sich vor den offenen und versteckten Feinden hier. Denn morgen speise ich an Gottes Tafel im Kreise der Gläubigen. Ich wurde vergiftet!«
Vorbei mit der Stille, wild brüllen alle durcheinander, einige greifen zu ihren Gewehren, als wollten sie das Gift niederschießen. Gelähmt kauere ich vor der Tastatur. Mit gequälten Augen läuft der Sohn des Admirals auf seinen Vater zu, ein Wink gebietet ihm Einhalt: »Mir bleibt keine Zeit. Ich wünsche keine Rache! Weder euch Kämpfern noch dir, meinem Sohn, erlaube ich, um meiner Willen zu töten. Steht zusammen, kämpft für Palästina!« Seine Stimme kühlt ab. »Schwöre es, mein Sohn!« Sein unbarmherziger Blick ringt dem Ältesten ein stummes Versprechen ab. Ergeben neigt der Sohn das Haupt vor seinem Vater und Anführer.
Der Admiral zückt sein Telefon und wählt, schreitet zu meinem Pult, legt den Hörer darauf ab und greift nach einem Stück Papier. »Meine Worte erreichen euch und den Sprecher des palästinensischen Rates im Lager. Morgen erwarten wir in al-Bireh eine Waffenlieferung. Abu Ismael wird sie an meiner statt annehmen, dazu legitimiert ihn dieses Schreiben. Nur erfahrene Kämpfer soll er mitnehmen; die jungen Männer spielen an den MGs wie die Kinder an ihren Telefonen.« Sein Spott verhallt unbeachtet. »Überliefert dem Richter die mahnenden Worte eines Sterbenden: Die Hygiene im Lager soll er ebenso kleinlich überwachen wie die Zeiten des Gebets.«
Kein Wort des Hasses, keine Geste der Verzweiflung entfuhr dem Admiral. Dem Admiral, der nie ein Schiff betreten, geschweige denn eine Flotte befehligt hatte. Als Jugendlicher hatte er sich für den englischen Seehelden Admiral Horatio Nelson begeistert und sich dessen Rang einverleibt, der sich immerhin von einem arabischen Wort ableitet. Die Begeisterung für den europäischen Imperialismus war verflogen, der Spitzname geblieben. Wie wir alle kämpfte er im Flüchtlingslager al-Amari, nördlich von Jerusalem, um die Belange der Palästinenser. Mit der Waffe, mit der Schaufel, mit dem Wort. Im Zuge der Katastrophe, der Gründung Israels 1948, waren seine Eltern, wie siebenhunderttausend weitere Palästinenser, aus dem neuen Staat geflüchtet oder vertrieben worden. In diesem Flüchtlingslager wurde er geboren, hier kämpfte er sein Leben lang – und hier starb er. Starb als inoffizieller Leiter des Lagers, abgesegnet von der Palästinensischen Autonomiebehörde und – viel wichtiger – von den hochrangigen Familien in al-Amari. In den letzten fünfzig Jahren war das Lager längst zur Stadt geworden. Zu einer abgesonderten Stadt. Dass die Vereinten Nationen es nominell leiteten – und leibhaftig finanzierten – für den Admiral eine Randnotiz.
Jetzt regelte er seinen Nachlass: Die UNO-Verwaltung musste benachrichtigt werden. Neue skandinavische Lehrer und Ausbilder würden morgen ankommen, die herumgeführt und eingewiesen werden mussten. Ein Schwarzhändler aus Jordanien brachte wöchentlich Lebensmittel und Medikamente, die zu bezahlen und möglichst gerecht zu verteilen waren. Keine Einzelheit entging ihm. Zuletzt opferte er seinem Sohn einige Sekunden. Endlich. »Kümmere dich um deine Mutter und deine Geschwister. Möge Gott über euch wachen und euch Frieden und Wohlstand schenken.« Fast stürzte er, klammerte sich an der Kante meines Schreibtischs fest. Statt Worte fanden wir nur Raunen.
Verkniffen lächelnd beugte sich der Admiral zu mir herab, sein Telefon schaltete er ab. »Einige Briefbogen unterschreibe ich noch. Handle in meinem Sinne, Nasim, wenn du sie ausfüllst. Ich weiß, ich kann dir vertrauen.«
Sein Blick bohrte sich durch meine Augäpfel. Eiszapfen, die in meine Seele drangen. Für Giftanschläge war der jüdische Geheimdienst berüchtigt. Doch ohne Hilfe aus dem Lager? Warum befahl der Admiral seinen Männern so vertrauensvoll, wo er einen von ihnen für seinen Mörder halten musste? Wie schob er den Gedanken ans Sterben mit so leichter Hand beiseite? Ich wusste: An Gott hatte er nie geglaubt, rechnete weder mit Strafe noch Belohnung im Jenseits. Für seine Ziele hatte er gelebt, nicht für ein ungewisses Paradies.
Abu Ismael, sein Nachfolger, hatte es nicht rechtzeitig geschafft. Flüchtig umarmte der Todgeweihte seinen Sohn, dann schickte er uns alle hinaus, setzte sich aufrecht in seinen Lederstuhl, legte die Hände in den Schoß und wartete gelassen auf das Ende. Bereits fünf Jahre nach seinem Tod rankten sich Legenden um sein Sterben – genau wie um seine letzten Worte: »Nicht der letzte Palästinenser werde ich sein, der in Unfreiheit sterben muss. Doch irgendwann reißt die Kette.«
An die Worte erinnere ich mich nicht, nur an seine grauen Augen, die mich noch heute frösteln lassen. Hatte er je ein Herz besessen, lange vor ihm musste es zu Staub zerfallen sein.
Vom Tod hab ich heut Nacht geträumt
Er fährt mir in die Glieder
Ein Höllenschlund eröffnet sich in mir
Was mir das Leben eingeräumt
Entreißt der Tod mir wieder
Ins Schattenreich mit ungezähmter Gier
Zweite Strophe
»Doktor, die Steuerunterlagen müssen Sie noch ausfüllen.«
Eliana zuckte zusammen, löste ihren Blick seufzend von den Dächern der Stadt und beschnupperte unwirsch das Tohuwabohu auf ihrem Schreibtisch. »Was muss das jüdische Volk noch alles ertragen?«, lamentierte sie.
Keine Antwort aus dem Vorzimmer. Also bellte sie durch die angelehnte Tür: »Doktor sollst du mich nur vor nebbichen Patienten nennen. Was daran ist zu viel verlangt von einer meschuggenen Empfangsdame?«
»Rate, wer zum Essen kommt!«, knurrte es zurück.
Eliana schleppte sich zur Tür.
»Rafael! Hereinspaziert, mein Junge.«
Der Angesprochene winkte und schlurfte in ihr Büro. Sie nahm ihn in die Arme, nicht ohne prüfend über Rücken und Hände zu streicheln. Rhythmisch zuckten die Finger seiner Rechten und verdächtig flach atmete er. Trotzdem sog er das Aroma ihres gammligen Büros mit geschlossenen Augen ein, wie ein Archäologe in einer Grabkammer. Für einen Schlag setzte das Herz der Ärztin aus und matt versank sie in seinen krampfenden Armen. Die Symptome hatten sich verschärft.
»Mutig von dir«, grinste Rafael, »einen 120-Kilo-Ringer Empfangsdame zu nennen. Eines Tages wird er dich erwürgen und dem israelischen Volk eine Rente sparen.«
»Der Brummbär? Ein Kriegsheld bin ich. Der Geheimdienst müsste ihn exekutieren.«
Rafael löste sich von ihr. »Privat nennt er dich Eli und vor den Patienten Frau Doktor?«
»Das muss er!« Eliana umrundete ihren überbordenden Schreibtisch und ließ sich in den Chefsessel gleiten, der ihren krummen Rücken wohltuend stützte. Dabei ließ sie ihren Schützling nicht aus den Augen. »Ein anständiger Jude wird nur gesund, wenn ihn eine Respektsperson behandelt, zu horrenden Kosten. Eine löbliche Ausnahme bist du.« Sie biss sich auf die Unterlippe. Das war zweideutig gewesen. Nur ein Wunder würde Rafael gesunden lassen.
Er schien ihr Zögern nicht zu bemerken. »Und die Araber? Lassen sie sich von einer Jüdin heilen?«
»Nur, wenn es Gott gefällt. Und das werden sie zu verhindern wissen.« Mit Absicht hatte Eli ihm nicht in den Stuhl geholfen. Kein leichtes Humpeln, kein Zittern der Hüfte entging ihrem Adlerauge, als der Junge sich ein Glas Wasser einschüttete und sich ihr gegenüber niederließ. So ein Schlamassel.
Stumm belauerten sie sich. Sie gleich einem Luchs, er wie ein kranker König auf seinem Thron. »Das letzte Jahr war eine Offenbarung. Das Leben hat mich geküsst.«
»Fünfundzwanzig, ein großartiges Alter, mein Sohn. Noch ein bisschen Jugend, schon ein bisschen Verstand. Und nicht bloß das Leben hat dich geküsst, hoffe ich.«
Schelmisch lächelte er. »Nur meine Mutter. Fragen über Sex lassen sie anlaufen wie eine Tomate.«
»Die alte Dattel.« Eli schnaubte. Vor einem Jahr hatte sie Rafael aufgeklärt, der hatte es nicht recht glauben wollen.
Seine Augen stahlen sich fort. »Mit einem Mädchen habe ich getanzt, bin ihren Bewegungen gefolgt, habe mich von ihrem Duft davontragen lassen. Ich fürchtete schon, meine Medikamente würden versagen. Ihre Anmut ließ mich mein Schicksal vergessen, den Krieg, den Terror und die Intifada. Dann tanzte sie davon, ich erfuhr nicht mal ihren Namen. Hip-Hop nennt sich die Musik, sehr laut, sehr hart. Nicht einen Beat lang störte sie das.«
»Genieße deine Techtelmechtel, mein Sohn. Der Duft einer tanzenden Frau ist mehr wert als überteuerter Tinnef.« In zwölf Monaten hatte der junge Rafael ein halbes Leben nachzuholen gehabt. Hineingeworfen hatte er sich und glänzend geschlagen, ganz ohne Schulbildung, ohne Erfahrung. Nicht recht erwachsen, doch beileibe kein Kind mehr. Mit Chuzpe hatte er sich den Fängen der Ärzte entzogen, die nach dem medizinischen Kuriosum lechzten. Der Instinkt des Ungebildeten hatte ihm versichert: Sie dürfen dich nicht einkerkern in ihrer Klinik; du bist erwachsen, frei! Also floh er – geradewegs in die Fänge seiner Mutter.
Etwas stimmte nicht! Ihr Gespräch war erloschen.
Regelmäßig zuckten Rafaels Augäpfel hin und her, aber es loderte kein Feuer in ihnen. Eli folgte dem Takt, ihre Uhr konnte sie danach stellen. In einen Gedanken hatte sich der Junge verstrickt; vielleicht in den Rhythmus des Liedes, an das er sich erinnerte, oder in die Schritte des Mädchens. »Stell dir eine Kalksteinwand vor«, hatte er es beschrieben. »Vollkommen weiß, unendlich hoch. Tastend wanderst du sie entlang, die rechte Hand gleitet über den Putz. Und nach einigen Metern knickt sie nach rechts ab – und du folgst ihr. Nach einigen Metern wieder und wieder und wieder. Und du folgst ihr und folgst ihr und folgst ihr. Dein Weg endet nicht. Niemals!«
»Dann beende den Schmu. Bieg nach links ab!«, hatte sie geantwortet. Doch das war unmöglich. Wie Lemminge wanderten die Gedanken des Kranken in endlosem Gleichlauf durch seine Gehirnwindungen. Stunden und Tage konnten vergehen. Es tat nicht weh, war keine Folter, Rafael versank lediglich in ewige Wiederkehr. Doch wusste Eli eine Möglichkeit, ihn aus seiner Hölle zu befreien: angewandte Wissenschaft! Die Ärztin beugte sich vor, verpasste ihm eine klatschende Ohrfeige und verbarg ihre Schandtat unter einer würdevollen Miene.
Das Leben kehrte zurück in Rafaels Augen, doch das Zucken seiner Pupillen blieb. Er schüttelte sich. »Du musst mich nicht schlagen, eine feste Berührung genügt.«
»Gönn einer alten Frau ihre Freuden. War das dein erstes … Dahinschwinden seit …?«
Er zuckte die Schultern. Das Versinken entzog sich seiner Kontrolle, wie auch seiner Erinnerung. Nur seine Mitmenschen bekamen es mit, wenn er abglitt. Für ihn war es wie Einschlafen, ein Übergang ohne Übergang. »Ich fürchte mich. Wie damals als Kind.«
Sie nahm seine Hand und drückte sie sanft. Mit elf Jahren hatte Rafael die Hölle durchlebt, eine sanfte, verschlingende Hölle. Immer wieder entschlummerte er für Stunden und niemand fand ein Mittel dagegen. Einem seltenen Verlauf der Schlafkrankheit ähnelte es, einer Virusinfektion von 1920. Hunderte Fälle waren damals dokumentiert worden. Doch längst war die Krankheit besiegt. Rafael trug das Virus nicht in seinem Blut, auch seine Mutter nicht. Bei seinem Vater war man auf Vermutungen angewiesen. Irgendwann, nach Monaten, war der Junge ganz hinübergeglitten, nichts vermochte mehr, ihn aufzuwecken. Füttern konnte man ihn und rasieren in diesem Zustand, ihn in einen Rollstuhl verfrachten, aber an nichts nahm seine Seele Anteil. Kennengelernt hatte Eliana ihn erst Jahre später, dahinvegetierend.
»Einmal hab ich dich zurückgeholt, wieder wird es gelingen!«
»Und wird es wieder dreizehn Jahre dauern? Ich fürchte mich nicht vor dem Verlöschen, aber trauere der verlorenen Lebenszeit nach. Du bist nicht überrascht, nicht wahr?«
Unterschiedliche Medikamente hatte Eli in den letzten Jahren an dem Jungen erprobt, welche die Dopaminproduktion des Körpers anregten. Alle hatten seinen Stoffwechsel in Schwung gebracht, seine Hirnströme angestachelt, nur aufgeweckt hatte ihn keins. Bis vor einem Jahr Neurotrans freigegeben wurde. Keine drei Tage hatte sie es ihrem Schützling verabreicht, da war er aufgewacht, ein elfjähriger Junge im Körper eines Vierundzwanzigjährigen.
»Also Tacheles: Das Muskelzucken, die Tics und das Flackern deiner Augen: Nebenwirkungen von Neurotrans. Dein Dopaminspiegel sank in den letzten Wochen beharrlich. Also habe ich die Dosis erhöht. Natürlich hast du das mitbekommen.«
»Besonders das Augenzucken. Sehr lästig.«
»Nenn es Okulogyre Krise, dann kannst du vor den Mädels damit angeben. Die Tics werden bleiben, solange wir die Dosis erhöhen.«
»Und wenn wir Neurotrans absetzen?«
»Wirst du immer öfter versinken. Erst kurz, dann länger, dann auf Dauer. Mit den Nebenwirkungen musst du leben.« Nur wie lange? Wann würde das Medikament sich endgültig abnutzen? Wenige Wochen gab Eli ihrem Schützling.
»Das letzte Jahr habe ich geliebt. Werde ich wieder lieben können?«
»Jährlich kommen neue Mittel auf den Markt, Rafael. Irgendein ausgekochter Jude wird ein neues entwickeln und einen Haufen Kies damit einheimsen. Das erwartet die Welt von uns. Ein Volk von Akademikern sind wir. Tausend kommen auf einen Maurer.«
Rafael stand auf und trat ans Fenster. Zwanzig nicht endende Sekunden brauchte er dafür. Eli brach es das Herz. Sein Blick glitt über die Hügel En Karems, eine ehemals arabische Gemeinde im Westen Jerusalems, und blieb am Verwaltungstrakt des Hadassah Medical Centers haften. »Heute Abend packe ich meine Sachen. Morgen ziehe ich zurück in die Klinik.«
»Bist du verrückt, Junge? Morgen noch nicht, morgen beginnt das muslimische Opferfest. Jerusalem wird erzittern, besonders der Osten. Das Spektakel darfst du dir nicht entgehen lassen! Vier Tage am Stück feiern die Muslime, diejenigen mit israelischem Pass, die Palästinenser, die Illegalen. Wir werden Harissa essen, das beste im Umkreis von zehntausend Meilen. Erst wird gebetet, dann gegessen und schließlich getanzt. Wir werden tanzen!«
Rafael lächelte schwach. »Sprichst du Arabisch?«
»Ein paar Brocken Arabisch, ein paar Brocken Englisch. Hebräisch und Deutsch wie meine Muttersprache. Hebräisch, weil es die Sprache des Herrn ist, und Deutsch, falls ich in die Hölle komme.« Sie seufzte. »Einst reiste ich getarnt als Muslima mit al-Khedir durch den Libanon bis Beirut. Habe ich dir die Geschichte erzählt? Deinen Vater traf ich dort.«
Skeptisch schaute er zu ihr hinunter: »Du hast Vater gekannt? Wie war er?«
»Ein Held!« Eli schnaubte. »Alle Opfer in den zahllosen Kriegen seit der Staatsgründung sind Helden, selbst die Gauner und Ganoven. Dein Vater war kein Gauner, er war kein Heiliger, wünschte euch und sich lediglich ein unbeschwertes Leben. Dann ging er kapores, wie all die anderen Helden. Und mich ungläubige Schickse lässt Gott in seiner unbehaglichen Güte alt und runzlig werden.« Mühsam erhob sie sich und befleckte dabei mehrmals den Namen des Herrn. Behutsam legte Eliana dem hoch aufgeschossenen Rafael die Hand auf die Schulter. Gereift war er im letzten Jahr, zum Sonderling geworden. Seinen Augen fehlte das Fundament, versinken konnte man darin; kein Wunder, dass die Mädchen ihn scheuten. Eine Frau wäre vielleicht bereit, sich diesem Abgrund zu überlassen.
»Deinen Rat werde ich vermissen, Eli. Deine jiddischen Flüche und deinen Starrsinn. Erzähl mir die Geschichte von meinem Vater bei meinem nächsten Erwachen. Heute brauche ich keinen Trost mehr. Heute versinke ich nicht. Heute bin ich glücklich.«
Vom Tod hat er heut Nacht geträumt
Ihm wollt er fröhlich winken
Doch hat der Tod an Frohsinn nie geglaubt
Hat ihm die Sinne eingezäunt
Durch stetiges Versinken
Ihm noch den letzten Atemzug geraubt
Dritte Strophe
In meinem Vorgarten steht die größte Pyramide des Planeten.
Judith gluckste bei dem Gedanken. Zu Zeiten waren die Pyramiden Wallfahrtsorte außerhalb von Gizeh gewesen, mittlerweile hatte das Taxi, welches sie zur Pyramids Road gebracht hatte, die Stadt nicht verlassen müssen. Gizeh hatte sich seine Pyramiden einverleibt. Und die Horde von Touristenjägern und Souvenirhehlern musste nicht mehr zur Arbeit pendeln. Einige Kletten wurden bereits aufmerksam, als Judith sich dem Eingang des Freilichtmuseums näherte. Die Händler schauten verunsichert, so früh schon auf Kundschaft zu stoßen. Judith lächelte schuldbewusst, sich nicht den gewerkschaftlich festgeschriebenen Zeiten zu unterwerfen, um angerempelt, genötigt und beschachert zu werden. Sie zog sich den Mantel enger um die Schultern.
Ein Pyramidenpolizist in schmucker touristenfreundlicher Uniform schlenderte gelangweilt auf sie zu: »Kein Einlass vor sieben«, blökte er in schmutzigem Ägyptisch, bereit, den Satz in drei weiteren Sprachen herunterzuleiern. Vermutlich hielt er sie für eine Brasilianerin.
Sie zückte einen derben arabischen Kraftausdruck und antwortete: »Kennen sie Jacob Mendel? Wir sind verabredet.« Den Namen, Englisch ausgesprochen, hatte sie gebrüllt, um weithin gehört zu werden.
»Sie gehört zu mir!«, hallte es im besten Texanisch aus dem Kartenhäuschen. Ein sonnengebräunter Modellathlet trat aus dem Schatten und eilte herbei.
»Mr. Mendel?« Sie zupfte ihre Bluse zurecht. Blonde Juden hatten es ihr angetan.
Beschwörend hob er die Hände. »Nicht diesen Namen! In Arabien trage ich den Namen meiner Frau: Juliani. Juden sind hier ungern gesehen, trotz aller Friedensverträge.« Er schüttelte ihr die Hand. Sein braun gebranntes Lächeln vermochte Eisberge zu schmelzen. »Bleiben wir beim Englisch? Die Messgeräte habe ich vorbereitet. Lassen Sie uns beginnen und später reden. Sie haben es gehört: Um sieben rollen die Touristen an – und ihre Dollars und Euros stehen den Ägyptern näher als Archäologen und Physiker.«
»Was sucht denn ein Physiker in der Cheops-Pyramide?«
»Echoskopie, Seismographie, Radaranlagen, Mikrowellenerzeuger und Ultraschallmessungen. Wer soll sich darum kümmern, Historiker?« Er lachte brüllend. »Für die Messungen, um die Sie mich gebeten haben, bräuchten die Aktenschnüffler eine Woche. Wir schaffen das in ein paar Minuten. Rechnerunterstützt. Alles für den Dienst am amerikanischen Volk.«
»Also doch für eine jüdische Firma.«
Jacob grinste, hielt kurz inne und flüsterte ihr ins Ohr: »Sie gelten unter meinen Kollegen als angesehene politische Journalistin, sonst würde ich ihnen nicht helfen. Diese Pyramide zieht Spinner an wie frisches Blut Moskitos. Ihre Idee klingt nicht besser als deren – Theorien.« Das letzte Wort spuckte er aus.
Judith ließ ihr charmantes Lächeln aufblitzen. Seine Zweifel teilte sie. »Geben Sie sich nicht mehr Hoffnungen hin als ich. Meine Quelle ist unseriös: das Internet. Die Spur ist so dünn, dass mein Redakteur sie nicht weiterverfolgen wollte. Meinen Jahresurlaub vergeude ich hier.«
Er hakte sich unter: »Schön Mylady, sie wecken keine falschen Hoffnungen. So wäre es mir eine Freude, den Morgen mit ihnen zu gestalten.«
»Keiner Magie spüre ich nach und keinen Außerirdischen. Ich ermittle nach Menschen, die solchem Unsinn verfallen. Fanatiker. Oder Spinner, wie Sie sagen. Die Große Pyramide dürfte ihr Ziel sein.«
Sie wandte sich nach links, grinsend korrigierte er sie. Richtig, die Große Pyramide war nicht die große. Cheops hatte die größte Pyramide bauen lassen, fast hundertfünfzig Meter hoch. Das Ungetüm links davon, zu Ehren seines Sohnes und Nachfolgers, war nur zwei Meter kleiner, stand aber auf einem Plateau und überragte damit seinen älteren Bruder um einige Meter. Der Enkel schließlich hatte es lediglich auf knapp die Hälfte gebracht.
An Tempeln und Gräbern vorbei geleitete Jacob sie durch die Jahrtausende. Zur Linken thronte der Vater des Schreckens, wie die Sphinx im Arabischen genannt wurde. Ein aus einem einzelnen Stück Kalkstein geschlagener Löwe. Ein Löwe fast so lang wie ein Fußballfeld – und mit einem Menschenkopf. Das Schoßhündchen der Pyramiden.
»Darf ich vorstellen: die Große Pyramide des Cheops. Das letzte verbliebene der Sieben Weltwunder. Mit ihren Steinen könnten Sie eine hüfthohe Mauer um Deutschland errichten, ohne nur einen Block spalten zu müssen.« Jacob pries sein Steckenpferd an wie eine Skulptur auf einer Vernissage. Bis ins Mittelalter hinein war die Pyramide viertausend Jahre lang das höchste Gebäude der Welt gewesen, hatte Zeit und Erosion getrotzt, auch wenn sie seitdem ein paar Ellen eingebüßt hatte. Eine helle Kalksteinhaut hatte ihr ursprünglich Glanz und Geometrie verliehen, doch war Kalk ein begehrter Baustoff. Moscheen, Krankenhäuser und Gefängnisse im nahen Kairo hatten sich ihrer bedient. Auch der Islam und mancher seiner Herrscher hatten den Pyramiden zugesetzt, huldigten sie doch einem gotteslästerlichen Kult. War es denn unmöglich, in der Pracht dieser Grabkammern Gottes Allmacht und die Genialität seiner Schöpfung auszumachen? Unwirsch schüttelte Judith den Kopf, mochten sich die Fanatiker die Schädel einschlagen, die Pyramiden würden bestehen.
Sie näherte sich der Ostseite des nach den Himmelsrichtungen orientierten Bauwerks, die aufgehende Sonne verlieh der Pyramide Glanz; unordentlich sah sie wegen der herumliegenden Steine aus, nicht schmutzig.
»Die Seiten sind bis auf vier Winkelminuten genau auf den geographischen Nordpol ausgerichtet«, erklärte der Physiker. »Wenn ich recht verstanden habe, wollen Sie die Intensität elektromagnetischer Signale messen, die durch die Pyramide dringen?«
Sie nickte. »Als wollte ich aus ihr telefonieren. Der Kalk schluckt die Signale?«
»Allerdings. Kalk, Granit, Basalt. Da werden wir kräftig strahlen und sehr fein messen müssen. Schalten Sie ihr Telefon aus, das stört die Messung. Ich hole mein Zeug.«
Judith schritt die zweihundertdreißig Meter der Ostmauer ab. Sie erklomm einige Stufen, jede über einen Meter hoch; niemand störte das. Auf den Knien rutschte sie über die Steine und wischte den Dreck aus den Fugen.
»Auf manchen Steinen finden Sie Reste alter Markierungen aus der Bauzeit«, brüllte Jacob hinauf. Einen Handkarren zog er hinter sich her mit einem Sammelsurium an Technik darin, alles notdürftig mit einer Plastikplane abgedeckt.
Judith triumphierte. Ein »י«, genau wie im Internetforum beschrieben. »Hier habe ich eine jüngere Markierung. Lackstift!«
Jacob stöhnte. »Da oben wollen Sie messen?« Er zählte. »Auf der siebten Stufe? Wie mystisch!«
Sie schaute traurig hinunter: »Nein, von hier aus soll das Signal gesendet werden, wir messen an der Westwand. Warte, ich helfe dir.«
Zwanzig Minuten später hatten sie die siebte Stufe der Westwand erklommen, wo Judith auf eine weitere Markierung gestoßen war. Auf der anderen Seite hatte Jacob ein »mörder EM-Signal« losgeschickt, mitten ins Zentrum der Pyramide, »das dort aber nie ankommen wird!«
»Was ist das für eine Markierung? Kommt mir bekannt vor.« In seinem kakifarbenen Dress sah er ordentlicher aus als Judith, deren braune Bluse über und über mit Wüstensand verdreckt war. Im Schatten der Großen Pyramide schlotterte sie ein wenig. »Ich vermute, es ist ein Jod.«
Jacob schaute verständnislos. »Das chemische Zeichen für Iod?«
»Nein, der zehnte Buchstabe unseres hebräischen Alphabets.«
Ertappt. »Da habe ich wohl im Tanachunterricht Comics gelesen. Ist das Jod von rechts nach links geschrieben?« Jacob räusperte die schwache Pointe weg. »Dann sind es wenigstens keine islamischen Terroristen.« Er baute seine Messapparatur auf, verband sie mit dem Rechner und fluchte dabei inbrünstig über den Wüstenstaub.
Judiths Gewissen regte sich. Jacob war ein netter Kerl und tüchtiger Physiker. – Und sie verschwendete seine Zeit mit Hirngespinsten. Spuren von Verrückten an der Cheops-Pyramide zu finden, war leicht; sie zu entlarven lästige Nebenbeschäftigung für hiesige Wissenschaftler. Man wurde nicht krank in einer Pyramide, außer durch Viren, man wurde nicht gesund darin, außer durch die Bewegung; und auch Obst verdarb nicht langsamer in ihrem Inneren – außer aufgrund des Klimas.
Der Physiker schnaubte, fluchte erneut und bearbeitete seine mit einer Folie geschützte Tastatur. »Verrückt! Ich empfange das Signal von der anderen Seite. Praktisch unmöglich in diesem Frequenzbereich.«
»Ein Störsignal?«, Judith überprüfte ihr Telefon. Ausgeschaltet.
»Nein, eine unverkennbare Modulation habe ich aufgespielt. Eindeutig unser Signal. Erstaunlich!«
»Es dringt ungehindert durch den Stein?«
»Ungehindert? Ein Jumbo-Jet startet an der Ostseite und hier landet ein Papierflieger. Aber ich empfange ihn. Und darüber hinaus ungewöhnliche Variationen entlang der z-Achse. Ich benötige eine Dreieckspeilung.«
Genervt blickte Judith gen Himmel. Wissenschaftler! Hartnäckig verbarrikadieren sie sich hinter ihren Fachbegriffen. Sie half ihm, die Messapparatur um dreißig Meter zu verschieben, und bohrte nicht nach.
»Hier empfange ich gar nichts. Wie hast du die Markierung, dieses Jod, gefunden?«
»Ich habe die Pyramidenseite aufgeteilt, im Verhältnis des Goldenen Schnitts.«
Hörbar schnappte Jacob nach Luft. »Goldener Schnitt? Geometrischer Firlefanz. Dem fehlt jede physikalische Grundlage! Suchen wir den Schnitt und dein dämliches jüdisches Jod auf der Nordseite. Und wehe, ich empfange dort ein verdammtes Milliwatt.« Unbeaufsichtigt ließ er den Karren an der Westseite stehen und trug sein Equipment mit Judiths Hilfe schimpfend und stolpernd über die siebte Quaderreihe Richtung Pyramiden-Eingang.
Der Goldene Schnitt trennt eine Strecke in zwei Teile. Das Verhältnis von kleinem Teil zu großem entspricht dabei dem Verhältnis des großen Teils zur ganzen Strecke. Jede Strecke kann so geteilt werden, auch die Seite einer Pyramide. Der Schnitt liegt nicht weit weg von zwei Dritteln. Gemeinsam suchten sie den fraglichen Bereich der Nordseite ab und diesmal fand Jacob das Jod.
»Ich fasse es nicht«, lamentierte er. »Auch hier ein Restsignal.«
»Du sprachst von einer Richtungsvarianz?«, bohrte sie vorsichtig.
»Das hier ist der Detektor, eigentlich eine Antenne. Wenn ich ihn links und rechts drehe, wird das Signal, das wir von der Ostwand senden, stärker und schwächer, je nachdem, wie genau ich ziele. Ich kann die Antenne aber auch vertikal schwenken, also hoch und runter. Normalerweise wäre das Restsignal am stärksten, würde ich genau waagerecht auf unseren Sender zielen. Aber Pustekuchen! Neige ich sie nach unten, wird das Signal schärfer, als schlüpfe es unter der Pyramide hindurch. Mitten durch den Fels.«
Das war für Judith nicht so aufregend wie für den Wissenschaftler. Trotzdem bemerkenswert, die anrüchige Internetquelle hatte recht behalten. »Wohin zeigt denn das Signal, das sich unter der Pyramide durchschlängelt?«
Jacob startete die Zeichenapp auf seinem Rechner, bettete einen Grundriss der Pyramide ein und begann, Vektoren einzufügen und Schnittpunkte zu berechnen. Schließlich warf er ein Kabel in die Wüste, zerrte eine Zeichnung aus seinem Notizblock und malte mit grimmiger Begeisterung darauf herum. »Kennst du den absteigenden Gang zur Grotte im Inneren?«
Judith nickte. Für den Ausflug hatte sie sich kluggelesen.
Er deutete nach rechts, ein Schlüsselbund schaukelte an seinem kleinen Finger. »Dort drüben liegt der amtliche Nebeneingang. Hier der Schlüssel für die Gittertür nach unten, die Aufseher kennen meinen Namen und lassen dich durch. Krabble in Richtung Grotte, ich muss hier noch ein wenig rechnen. Eilen wir uns, in einer halben Stunde laufen hundertfünfzig glückliche Touristen auf, die im Inneren der Pyramide spielen dürfen.«
Behände kletterte Judith auf den Einlass zu, auf der Suche … wonach eigentlich? Der historische Zugang lag zehn Meter weiter oben, gut zu erkennen an vier prächtigen, fünfzehn Tonnen schweren Giebelsteinen, war aber unpassierbar. Kurz nach der Bestattung des Pharaos war er mit mehreren gewaltigen Verschluss-Steinen versperrt worden. Kein Grabräuber würde dieses Hindernis überwinden können, also gruben die Plünderer einen eigenen Tunnel. Durch diesen spazierte Judith nun in das Innere der Großen Pyramide.
Zwar war der Tunnel nach einem Kalifen benannt, doch vermutlich hatten ihn Grabräuber ausgehoben – vor tausend Jahren. Dreißig Meter hatten sie ihn waagerecht ins Innere getrieben, bis auf die Höhe des versperrten, absteigenden Tunnels. Der Stollen, schmal, aber freundlich beleuchtet, knickte links ab und traf auf den absteigenden Gang.
Bis auf wenige Kammern war die Pyramide massiv, die Decke trug ein erstaunliches Gewicht und Judith spürte es auf ihren Schultern. Reichlich Steine für wenig Innenraum hatten die Konstrukteure verbaut. Gebückt schob sie sich durch den staubigen Gang, auf dessen Boden ein Brett mit Dielen befestigt war, eine Hühnerleiter. Nach dreißig Metern erblickte sie in der Decke eine Öffnung: ein nach oben führender Stollen. Doch die große Galerie und die Grabstätte oben würde Judith heute nicht zu Gesicht bekommen, ihr Weg führte hinab.
Weitere siebzig Meter kroch die Reporterin hinunter. Die Kalksteine an Wänden und Decke gingen in gewachsenen, behauenen Fels über. Durch die von Jacob erwähnte verschlossene Gittertür erreichte sie die Felsenkammer. Direkt in das Gestein war sie getrieben worden – niemand wusste warum. Fünfhundert Kubikmeter Hohlraum, eindeutig unvollendet. Unentschlossen kraxelte Judith in der Kammer herum, kühl war es, trotzdem klebte ihr die Kleidung an der Haut und sie atmete schneller als notwendig.
»Menschen fürchten die Zeit, doch Zeit fürchtet die Pyramiden. Mein Kollege vermutet, als Reserve sei diese Kammer angelegt worden, um den Pharao zu beherbergen, wäre er vor Fertigstellung der eigentlichen Grabkammer gestorben.«
Jacob war hinter ihr hergeklettert. Unbefangen bewegte er sich, aber vorsichtig, als hätte er sich schon öfter den Kopf am Fels gestoßen. Sie war erleichtert, nicht mehr allein zu sein.
»Das Wetter, die Zeit, Politiker und Grabräuber – alle haben der Pyramide zugesetzt. Die Leiche, welche ihrer Obhut übergeben wurde, ist seit Jahrhunderten verschollen und wird es bleiben. Vor hundert Jahren entwickelten sich neue Schädlinge: Abgase, Touristen und Souvenirjäger. Alle wollen hierher: in die Große Pyramide, für zwölf Dollar Eintritt. Die zweitgrößte kostet gerade mal drei und bietet nicht mehr und nicht weniger.«
Judith blickte auf die Uhr. Noch wenige Minuten und sie mussten sich der Touristen erwehren. »Hast du den Bereich, der die Funksignale weiterleitet, genauer eingrenzen können?«
Er nickte, wies sie an, ihm zu folgen, und trat zurück auf den Gang. Nach etwa fünfzehn Metern blieb er stehen. »Hier schneidet der wundersame Funkweg diesen Gang. Vielleicht fünf Meter weiter oben oder unten, aber ungefähr hier.«
Unschlüssig tasteten sie die Umgebung ab. Jacob hob sogar die Hühnerleiter an und spähte darunter.
»Diese Stelle fühlt sich seltsam an!« Judith schnupperte. »Und sie riecht anders.« Sie ertastete im rauen Fels eine Art Belag in Rissen und Fugen.
Der Physiker trat neben sie und setzte ein tüchtiges Stirnrunzeln auf. »Die Oberfläche ist gereinigt worden. Manchmal wollen sich Urlauber hier verewigen. Zum Glück habe ich einen UV-Detektor zur Hand, auch Schwarzlicht genannt.« Er grinste. »Wann hast du zuletzt in einer Tel Aviver Diskothek getanzt?«
Kürzlich, dachte Judith. Gemeinsam drehten sie die umliegenden Neonröhren aus der Fassung, es wurde dunkel und bei dem Gedanken an die Steinmassen über sich begann Judiths Herz zu trommeln. Mit wichtiger Miene schaltete Jacob seine Taschenlampe aus und das Schwarzlicht an, wie die Ermittler im Fernsehen.
»Schlecht zu erkennen. Kannst du es lesen? Das Obere kommt mir bekannt vor.«
הוהי
המקנ
»Das bekannteste hebräische Wort: הוהי. Wir nennen es Adonai – HERR. Die Buchstaben sind: JHWH, und stehen für Jahwe oder fälschlich Jehova. Die fehlenden Vokale in der Schrift, sehr unpraktisch.«
Der Wissenschaftler stocherte mit seinem Kugelschreiber in den Felsspalten herum: »Vermutlich hat jemand die Worte mit Farbe, Öl oder Teer an die Wand gepinselt. Ich frage mal in der Verwaltung nach, ob ein Vorfall dokumentiert ist. Das Wort darunter?«
»Rache.«
»Da hast du deine Spinner. Glückwunsch, deiner Story ist soeben Fleisch auf den Knochen gewachsen. Fanatische Juden?«
»Beherbergt Jerusalem wie die Wüste den Sand. Böte sich die Gelegenheit, morgen würden sie dieses prächtige Bauwerk in die Luft sprengen. Die Sache mit der Signalverstärkung habe ich von einer UFO-Seite im Netz.«
Jacob, der gerade begonnen hatte, die Neonröhren wieder anzudrehen, verdrehte die Augen und hustete nervös.
Judith musste lächeln: »Ein Forum voller Spinner, aber ein Kommentar war wortgewandt, bedrohlich. Eine Gruppierung, die sich Ayyubs Krieger nennt.«
»Ayyubs Krieger? Wie Dumbledores Armee? Nur nicht so nahe an der Wirklichkeit.«
»Ayyub, der arabische Name eines Propheten. In unserem Tanach heißt er Hiob. Sie benennen sich nach der arabischen Form, obwohl der Beitrag überquoll vor Hass auf die Palästinenser und den Islam. Auch behaupteten sie, Juden hätten die Pyramiden in Sklavenarbeit erbaut.«
Eine alte Mär, die nicht ausstarb. Arbeiter hatten die Pyramide über Jahrzehnte erbaut. Sie waren schlecht behandelt worden und auch gestorben beim Bau, aber freie und vermutlich sogar geschätzte Facharbeiter waren es gewesen, vergleichbar Kumpel unter Tage.
»Vor viereinhalbtausend Jahren, zu Cheops Zeiten, lebte kein einziger Jude auf der Welt, weil Abraham, der Stammvater der Juden und Araber, noch nicht geboren worden war. Keine Juden, keine Christen, keine Muslime.«
Judith seufzte: »Was für friedliche Zeiten mögen das gewesen sein. Unsere fanatischen Spinner dürsten jedenfalls nach Rache. Aber an wem – und wofür? Und wie gelangte unser Schmierfink eigentlich durch die Gittertür hier runter?«
Jacob grinste: »Bakschisch. Manche Touristengruppen dürfen in die Felsenkammer. Für eine kleine Zuwendung lässt dich die Pyramidenpolizei hinunter.« Er prüfte die Uhrzeit auf seinem Telefon. »Gehen wir zurück, Judith. Das Beste steht dir noch bevor.«
Sie stiegen hinauf, verschlossen das Gitter und schlängelten sich durch den Gang des Kalifen. Jacob schritt voran und als die Journalistin ins Freie trat, drehte er sich um und ließ Judiths Blick auf sich wirken, als die Sonne sie umfing. »Der Blick eines Menschen, der nach Stunden in der Pyramide zurück ins Licht tritt, ist wie der Kuss eines Neugeborenen.«
Allerdings. Mächtig waren die Pyramiden, uralt und erhaben. Doch sie standen für das Sterben, für die Dunkelheit. Judith atmete auf: »Genug vom Tod für einen Morgen. Und nicht mal eine Mumie haben wir gesehen.«
»Du stehst auf einem Friedhof, Mädchen. Mumien liegen hier überall herum. Die edlen werden geklaut oder ausgestellt, mit den gewöhnlichen heizt man Dampf-Lokomotiven, man verarbeitet sie zu Zeitungspapier oder zu wundersamen Tinkturen für Leichtgläubige.«
»Einen spannenden Beruf hast du dir gesucht, Jacob Mendel Juliani: Elektromagnetische Strahlen verfolgen, jahrtausendealte Geheimnisse ergründen, Verschwörungen aufdecken …«
»Und manchmal lasse ich Roboter durch schmale Lüftungsschächte von Pyramiden fahren, zur Freude der Archäologen.«
Sie stolperte, mit leichter Hand hielt er sie fest, wahrlich gut trainiert der Mann.
»Du brauchst einen Kaffee. Beim ersten Mal verschlägt Cheops Klause jedem den Atem.«
Kaffee! Ein himmlischer Gedanke. Und sie mussten herausfinden, wann die Schmiererei im Gang entstanden war. Dünn waren die Hinweise, aber es bestand die Gefahr eines Anschlags. Ihr Redakteur würde Augen machen.
Der Tod wurd uns heut Nacht gewahr
Wir folgten seinen Spuren
Doch Gräber führen nicht in sein Versteck
Selbst Weisen ist er unkündbar
Und schlauen Kreaturen
Kein Monument erschließt uns seinen Zweck
Vierte Strophe
Esra Kaufmann ließ den Lautsprecher des Verhörraums knacken. Ein bewährter Trick. Der Verdächtige zuckte hoch und starrte verquollen in die Kamera. Esra ließ ihn schmoren. Nach einer Minute verlor sich der Alte wieder in Apathie.
Der Beamte erhob sich und zog die Krawatte zurecht. Sein Schützling war gargekocht. Gemächlich schritt er über den Flur zum Verhörzimmer. Mehrere Sekunden behielt er die Klinke niedergedrückt, bevor er die Tür energisch aufschob. »Friede sei mit dir.«
»Er sei mit dir«, antwortete der Palästinenser mechanisch; dann stockte er und senkte den Blick.
Der Anflug eines belasteten Gewissens, Esra ließ sich seine Befriedigung nicht anmerken. Geschäftig setzte er sich dem kümmerlichen Alten gegenüber und sortierte die Akte auf dem Aluminiumtisch.
»Thabit, israelischer Staatsbürger, ein Sohn. Wohnhaft in Silwan, im Osten Jerusalems. Seit …?«
»1973«, half der Angesprochene hektisch. »Aus Jordanien stammen wir.«
Der Beamte schwieg ihn an. Zu viele Worte wären imstande, die Dunstglocke der Furcht aus dem Verhörraum zu vertreiben.
»Im religiösen Mittelpunkt der Welt wollten wir leben«, schluckte Thabit. »Und eröffneten ein Geschäft.«
Der Mittelpunkt der Welt. Pah. Noch ein Islamist. Ohne sie und die orthodoxen Juden lägen weniger Tote auf den Straßen. Esra nickte freundlich. »Im Wohlstand leben Sie, handeln mit Juden und ihresgleichen, in Israel und dem Westjordanland.«
Der Alte wagte nichts zu erwidern.
»Worüber plaudern Sie denn mit Ihren jüdischen Freunden?«
»Geschäftsfreunden«, verbesserte Thabit schnell. »Ich führe Rechner und Smartphones aus aller Welt ein, wie vorgeschrieben über jüdische Zwischenhändler. Und verkaufe palästinensische Güter, Nahrung und Textilien an euch.«
Euch. »Und Fahrräder«, ergänzte Esra wichtig. Eine Akte hatte er aufgeschlagen und blätterte darin herum. »Das Dossier behandelt ausführlich Ihre innige Beziehung zu israelischen Geschäftsleuten.« Wie ein Skalpell schnitt das letzte Wort in Thabits Haut.
»Ich handle mit Juden, geselle mich aber nicht zu ihnen«, stotterte er. »Oft schwanken sie in ihrem Glauben.«
Diese muslimische Ratte! Mit einem Urteil über den Glauben anderer war er rasch zur Stelle. »Zigarette?«
Dankbar nahm der Palästinenser den Glimmstängel und das dargebotene Feuer.
Esra sog den Rauch ein. »Ich vermisse es, habe kürzlich aufgehört. Eine Sonderabteilung für Wirtschaftskriminalität verfolgt Ihre Geschäfte seit Jahren.« Er blätterte in der fetten Akte herum. Zwischen lauter leere Seiten hatte er die Tageszeitung von heute geklemmt. Von außen platzte die Akte wie die Schuld des Delinquenten aus allen Nähten. »Unlautere Geschäfte?«
Schnapp! Jeder Kaufmann fürchtete die Steuer, jeder hatte etwas zu verbergen. Eigennutz war ihr Geschäft. Der Polizist ließ sein Opfer köcheln, strickte weiter an seiner Legende. Thabit war nicht sein erster Kunde. Anfänger sprachen meist zu viel. Seine eigene Angst musste den Alten überzeugen. Dann würde er die Geschichte verinnerlichen, in seinen Alltag einbauen. Jedes Schreiben, jedes Gerücht, jede zufällige Geste aus seiner Erinnerung würde sich für Thabit in einen Beweis verwandeln: Seit Jahrzehnten überwachen sie mich. Sie wissen alles!
»Ihre Fuhre vom letzten Montag …«
»Die Fahrräder für Nablus. Israelische Fertigung aus Tel Aviv.«
»Natürlich.« Pause. »Sie waren unversteuert. Nicht zugelassen für den Transport in die besetzten Gebiete.« Esra vermied den ungeliebten Begriff: Palästinensisches Autonomiegebiet.
Hörbar atmete der Alte auf. »Damit ist alles in Ordnung. Die Papiere sind von Ihrem Ministerium gegengezeichnet.«
Ihrem Ministerium. Esra blätterte weiter in der leeren Akte. »Dem Bericht müsste eine Kopie der Überführungsdokumente beiliegen.« Er hob die Brauen. »Tatsächlich, hier ist sie.« Der Polizist zog die letzte Rechnung seines Zahnarztes hervor. »Sie haben recht. Offenbar ist uns ein Fehler unterlaufen. Das ist mir äußerst unangenehm. Danke für Ihre Mitarbeit. Sie können gehen.«
Misstrauisch erhob sich Thabit. Ein halbes Leben Gängelung durch die Behörden hatten ihre Spuren hinterlassen.
»Sobald du mir erklärt hast, wie du 1973 innerhalb eines Jahres die israelische Staatsangehörigkeit ergaunern konntest!«
Ein Schuss ins Blaue, aber ein Blattschuss, der den Alten zurück in seinen Verhörstuhl trieb. Er bemühte sich nicht mal, seine Schuld zu verbergen. »Die Einbürgerungsurkunde liegt Ihnen sicherlich vor. Keine Fälschung«, erwiderte er kraftlos.
»Der Beamte war dir sicherlich gewogen.«
Thabits Schuld stand ihm ins Gesicht geschrieben. Was für ein Waschlappen. Bestochen hatte er wie Tausend andere. Keine Untersuchung der Welt hätte das nach all den Jahrzehnten aufgedeckt. Trotzdem gebärdete er sich wie eine Ratte in der Falle. »Nicht zu vergessen, die Hilfe deiner einflussreichen Familie. Wie gedenkst du, deine Schuld an Israel zu tilgen?«
Thabit sank in sich zusammen. »Das habe ich längst. Meine Familie gab in der Not aus reinem Herzen. Sie half mir und meiner Frau, in Jerusalem Fuß zu fassen – über dunkle Kanäle, zugegeben. Doch redlich waren ihre Forderungen, als wir uns eingelebt hatten. Mit welchem Recht hätte ich sie abschlagen sollen, die Gefallen? Gefallen über Gefallen.«
Thabit entstammte einer einflussreichen Sippe. Viel wert in Palästina. Mit ein wenig Korruption hatte seine Familie ihm in den Siebzigern geholfen, schneller in Jerusalem ansässig zu werden. Nicht der Rede wert, für Esra jedoch eine Gelegenheit, Druck auszuüben. »Willst du in Jerusalem bleiben? Ich könnte das garantieren. Was bist du deinen Landsleuten noch schuldig – und wie viel mehr Israel, deiner hinzugewonnenen Heimat?«
»Jerusalem!«, spuckte der Alte aus. »Ein Traum wurde zum Albtraum. Jeder hier trägt Gott in seinen Worten, doch keiner befolgt seine Gesetze. Einen Batzen Geld beten sie lieber an. Wie konnte diese Stadt zum Moloch werden?«
Ein Judenhasser, wie alle Araber. Und alle plapperten die Legende des geldgierigen Juden nach. Die Worte erschütterten den Polizisten nicht. Dieser Mann bastelte keine Bomben und ermordete keine Juden. Seine verqueren Ansichten schadeten niemandem. Seinen Wert jedoch für das israelische Volk konnte er noch beweisen. Der Hebel dazu lag in der Schublade vor ihm. Esra öffnete und griff nach einer weiteren Akte, der wahren Akte, prall gefüllt mit einer Geschichte; einer Geschichte voller Zündstoff.
»Nicht mit jedem, der seinen Weg kreuzt, muss ein Kaufmann handeln. Doch will er seine Familie ernähren, darf er nicht wählerisch sein. Mit Palästinensern handelst du, redlichen und niederträchtigen. Und mit Juden handelst du, redlichen und niederträchtigen. Wie war es, mit dem Teufel ins Bett zu gehen, mit Menschen, die deinesgleichen vernichten wollen?«
Thabit sackte in sich zusammen. »Ein schrecklicher Fehler. Doch er ist verbüßt.«
Allerdings! Das stand in der Akte und deutlicher las Esra es in der Miene des Alten. Mit radikalen Juden hatte Thabit gehandelt. Die jüdischen Siedlungen wurden zum Nährboden für Fanatiker. Sie beabsichtigten, alles zu zerstören, was muslimisch war im Heiligen Land, mit allen Mitteln. Der Geheimdienst hatte alle Hände voll zu tun, ihren Wahnsinn zu stoppen. Einen Krieg sollte ihr Terror heraufbeschwören, den die Regierung zu verhindern trachtete. Und der alte Thabit war ihnen auf den Leim gegangen. Das hatte ihm einige Nächte im Gefängnis eingebrockt. Sein Sohn war von der Universität geflogen, die Handelslizenz hatte Israel ihm entzogen. »Vor achtzehn Monaten warst du ruiniert, wie konntest du dich so schnell berappeln?«
»Meine Familie, mein Neffe glaubt an mich.« Stolz triefte aus den Worten des Alten.
Thabits Clan, sein größter Trumpf. In Palästina, im ganzen verdammten Nahen Osten, ging nichts ohne die weitverzweigte Familie. Nach dem Tod des Scheichs, des mächtigen Clanoberhaupts, in einem Jerusalemer Gefängnis, trat dessen Sohn seine Nachfolge an. Und der liebte Thabit, seinen entfernten Lieblingsonkel, über alles.
»Mein Neffe würdigte, wie die Juden mich und meine Familie drangsalierten. Das besänftigte meine Gegner, die mir Verrat vorgeworfen hatten. Mein Geschäft baute ich wieder auf. Ich handle mit Gläubigen, ich handle mit Ungläubigen, mein Brot teile ich mit Ungläubigen, aber nicht ihre Ziele! Rein bleibt mein Gewissen.«
Lüge! Ein Schatten lauerte hinter seinen frommen Worten. Esra spürte ein Geheimnis auf Thabit lasten, einen Schmutzfleck auf dessen Seele, nebelhaft. Der Israeli schnaufte. Gläubige jeder Fasson wissen allzu leicht zwischen Heiligen und Unheiligen zu unterscheiden, schnell fühlen sie sich den Unheiligen überlegen. Bis sie sich fragen: Warum hat Gott sie erschaffen? Als Prüfung? Ist es unsere heilige Pflicht, sie von der Welt zu tilgen? Radikale Muslime krochen aus allen Ecken der Welt hervor, töteten, zerstörten, massakrierten. Diesen Glaubensbruder hier würde Esra für seine Zwecke einspannen.
»Willst du in Jerusalem bleiben?«, wiederholte der Polizist.
Das war Erpressung. Abwehrend hob Thabit die Hände. »Quälen können Sie mich, verstoßen, ruinieren. Aber wozu? Mein Einfluss ist gering, jeder weiß um meine Geschäfte in Ost und West, niemand weiht mich in seine Geheimnisse ein, Geheimnisse kümmern mich nicht. Wieso drohen Sie mir, einem unbescholtenen Mann? Wie will ich in diesen Zeiten meine Ehrlichkeit beweisen? Und warum muss ich das überhaupt? Wir alle sind gleich vor Gott. Was, wenn ich Sie zwänge, Ihre Familie zu hintergehen?«
Esra krempelte seinen Hemdsärmel nach oben und öffnete das speckige Lederarmband seiner Uhr. Fast zärtlich schob er den Chronographen in seine Hemdtasche. Unter seinem Schweigen sank Thabit in seinem Stuhl zusammen. Innerlich lachte der Beamte. Ein gläubiger Mann, unfähig zur Sünde, stark und unabhängig. Töten konnte man ihn. Töten, aber niemals brechen. Wann lernten diese frommen Spinner, zwischen Gewissheit und Wahrheit zu unterscheiden? Zwischen Glauben und Wissen.
»Abu Towbi, ein ehrbarer Mann sind Sie, fürchten Gott und achten seine Gesetze, in der Gewissheit, im Jenseits dafür belohnt zu werden. Am Unglauben der Welt vermögen wir nicht zu rütteln, aber ein Beispiel können wir geben und den Verfehlungen der Schwachen widerstehen, nicht wahr?«
Thabit nickte überrascht.
Esra schnellte vor, entriss dem Alten die Zigarette und rammte die Glut auf dessen Handrücken. Die Schreie und Tränen überging er. Mit einem Satz über den Tisch stieß er auf das Männlein hinab, bohrte sein Knie in dessen Schoß und spuckte ihm ins Gesicht. Er roch die Angst des Alten, der wimmernd zusammensackte. Lohn im Jenseits. Pah!
»Du bist ein Fundamentalist. Aus Fanatikern besteht deine Familie und deine Nachkommen werden zu Terroristen herangezüchtet! Doch das werde ich zu verhindern wissen, mit oder ohne deine Hilfe, Abu Towbi.« Er benutzte die vertrauliche arabische Anrede, in welcher der Vater mit »Abu« und dem Namen seines erstgeborenen Sohnes angesprochen wird. Die Drohung darin war unverkennbar. »Niemand wird mehr Sprengstoffgürtel bauen aus Waren, die du vertreibst.«
»Wie soll ich das verhindern?«, jammerte der Alte. »Aus allem können sie Sprengsätze zusammenbasteln. Aus Nägeln, aus Benzin, aus Reinigern. Was kann mein Towbi dafür? Ich lebe noch, weil ich hinter meiner Familie stehe, auch wenn ich mich an keinem Terror beteilige.«
»Dein Sohn Towbi studiert wieder. Psychologie. Wieso nicht Maschinenbau? Was für eine Schande, ein Verlust für Palästina. Möchtest du ihn retten, retten vor mir? Dann besuche deinen Neffen, biete ihm deine Hilfe an, deine Hilfe im Kampf gegen den jüdischen Erzfeind.«
Thabit zitterte. Die funkelnden Augen des Polizisten nahmen seinen Blick gefangen. »Ich kann nicht.«
Stille.
»Du kannst nicht? Du musst! Hunderte haben es getan, Tausende. Palästina ist ein Volk von Spitzeln. Rette deinen Sohn! Beschere deiner Familie Wohlstand und Sicherheit. Für uns zählen nur Gewalttäter. Wir retten Menschen auf beiden Seiten, ehrbare Palästinenser bleiben unbehelligt.«
Der Alte rutschte zu Boden. Rotz lief sein Gesicht hinab. »Ich kann nicht«, wimmerte er. »Was immer Sie mir antun. Ich kann nicht.«
Wie konnte dieser Abschaum es wagen, nicht zu brechen? »Du gestehst es: Deinen Pass hast du unrechtmäßig erworben!«
Der Alte nickte.
»Und mit jüdischen Fanatikern hast du gehandelt?«
Stummes Nicken.
»Und deine Familie beherbergt Terroristen und unterstützt den Kampf gegen Israel!« Die Antwort wartete er nicht ab. Thabit war so weit. »Ich bin deine letzte Hoffnung. Willst du mich verlieren?«
»In Gottes Hände lege ich mein Schicksal.«
»Vor mir wird dich dein lächerlicher Glaube nicht bewahren!«
»Darum lasst den Gläubigen sein, der will, und den Ungläubigen sein, der will.«
Der Alte zitierte Sure achtzehn. Esra richtete sich auf und stemmte den Fuß in die Kehle seines Opfers. Dann öffnete er eine Schublade des Verhörtischs und angelte nach einem Baumwollsack. Den stülpte er Thabit übers Gesicht, ohne Gegenwehr.
Ein Krug mit Wasser stand bereit. Esra tröpfelte es gleichmäßig auf das Tuch, das sich sofort vollsaugte. »Siehe, wir haben für den Frevler ein Feuer bereit. So wird ihnen geholfen werden mit Wasser gleich geschmolzenem Blei, das die Gesichter verbrennt. Den Koran kenne ich, dein heiliges Buch. Atme flach und bedenke: Nur ein Gefühl des Ertrinkens erzeuge ich. Alles Schein, man nennt es weiße Folter. Dein Sohn, der Psychologe, kann es dir besser erklären. Aber Vorsicht, dass nicht zu viel Wasser in die Lungen rinnt.«
Thabit hustete und spuckte.
»Tee gefällig? Was du hörst, ist der Wasserkocher. Die Amerikaner haben das Foltern eingestellt, zumindest behaupten sie es. Wir haben immer gefoltert, wie du weißt. Keine sicherer, aber ein gebräuchlicher Weg, an Geheimnisse zu gelangen. Ich darf dich schlagen, dir in die Eier treten und dich nackt über den Innenhof prügeln. Scham ist eine arabische Volksneurose. Israel ist umzingelt von Feinden, allein, dass wir noch leben, erteilt jeder unserer Taten Absolution. Schrei ruhig, niemand wird dich erhören.« Mit diesen Worten goss Esra Kaufmann kochendes Wasser über die Kapuze. Der Schall trug die Schreie seines Opfers durch die Flure.
»Niemals wirst du deinen Sohn wiedersehen.« Esra drückte den heruntergefallenen Zigarettenstummel auf dem Tuch aus. Obwohl er nie geraucht hatte, bezeichnete er Zigaretten gerne als lästige Angewohnheit. Die Glut fraß sich in Thabits Haut. Trotzdem erlahmten seine Schreie.
»Ein Wort«, flüsterte ihm Esra ins Ohr, »und ich beende es.«
Thabit schwieg.
»Hörst du das, Abu Towbi?«, flüsterte er weiter. »Nein? Meine Armbanduhr. Aber ihrem Ticken kannst du nicht lauschen, denn sie steht still. An dem Tag, an dem sie aussetzte, blieb auch mein Leben stehen. Was für ein Segen. Vor Bestechung, Erpressung und Folter schützt sie mich. Denn was wollen sie mir nehmen, was wollen sie mir bieten, wo mir alles gleich ist? Du hast mir widerstanden, ich achte das. Wir sind uns ähnlich in unserer Kraft, aber für meine Stärke brauche ich keinen Gott. Weder den der Juden noch deinen. Zur Belohnung lasse ich dir dein Geheimnis. Hüte es weiter für deinen Gott.«
Der Alte röchelte. »Meine Bürde lässt du mir und erwartest Dank dafür? Du hast mich vernichtet, so geht das Geheimnis mit mir zugrunde. Gott belohnt und Gott straft, wie es ihm beliebt. Wir Gläubigen sind Spott und Hohn der anderen. Willkommen heiße ich den Tod, mehr als dahinzuvegetieren. Nimm die Last von mir! Wende dich nicht ab von meinem Leid. Lass mich wieder zu Erde werden!«
Esra war nicht sicher, wem die Worte galten. Religiöser Spinner! Er nahm ihm die Kapuze ab. Thabits Gesicht leuchtete in ungesundem Rosa, die Augen zugeschwollen. Hilflos tastete der Alte umher; ein Häufchen gottgläubiges Elend.
Dieser Thabit. Seinen Pass hatte der Alte ergaunert. Wenig kümmerte es ihn, was mit den Waren geschah, mit denen er handelte. Und an jüdische Fanatiker war er geraten, leichtsinnig. Nichts, was man ihm ernsthaft anlasten konnte, dem kleinen Mann. Nichts, was den Geheimdienst kümmerte. Aber ein letztes Geheimnis hatte Esra ihm nicht entreißen können, ein Geheimnis, das Thabit mit aller Kraft schützte. Lohnte es nachzubohren? Vermutlich nicht. Als palästinensischer Spitzel war Thabit ungeeignet, zu alt. Junge Menschen waren leichter zu manipulieren, gierten nach Besitz, Sex und Anerkennung. Oder danach, sich gegen Erwachsene aufzulehnen. Thabits Sohn wäre ein Kandidat.
Auf dem Weg in sein Büro rieb Kaufmann sich die geschwollene Handfläche, beim Foltern hatte er sich verbrannt. Ein Kollege bemerkte es.
»Hast du wieder jemandem deine Uhr gezeigt?«, lachte der. »Hättest besser die andere Hand genommen.«
Esra zog seinen Ärmel über den Handschuh an seiner Rechten. Auf seine Prothese wurde er nicht gerne angesprochen, aber wie immer nahm sein dreister Kollege keine Rücksicht. »Hast du den Alten mit der Hakenhand gewürgt? Ich hab dir gesagt: Bei dem ist nichts zu holen. Seine Familie verheimlicht ihm die heiklen Geschäfte.«
Esra brummte unwirsch. »Er trägt etwas mit sich herum, aber ich konnte ihn nicht knacken und lasse ihn laufen. Bedrohung ist er keine.« Wie so viele andere, die in israelischen Gefängnissen schmorten.
»Aber seine Landsleute bedrohen uns, auf der Suche nach Rache.« Der Kollege zeigte wenig Anteilnahme. »Du folterst den Falschen. Neunundneunzig Mal lagst du richtig, und darum ängstigst du ein Mal im Jahr einen armen Hund zu Tode; ohne Ertrag. Kommt er auf die Beine?«
»Verbrühungen. Auch an der Hornhaut, sollte er die Augen nicht rechtzeitig geschlossen haben. Es wird heilen.«
»Meistens tut es das.«
Der Tod wurd euch heut Nacht gewahr
Lässt euch vor Angst erbeben
Sein Rätsel eure Ohnmacht offenbart
Die Kraft, die euch dereinst gebar
Verjagt euch aus dem Leben
Ins Licht, das König Tod für euch bewahrt
Hochzeitsnacht
»Ich dachte, nur diese zarten Bänder halten dich zusammen, und plötzlich stoße ich auf einen Reißverschluss.« Er ließ die azurbestickten Seidenbänder durch seine Finger gleiten.
Lachend drehte sie sich zur Seite, damit er ihr Kleid am Rücken lockern konnte. Näher kam sie ihm dabei als je zuvor. »Die Bänder dienen nur Dekoration, wie die Taschen an deinem Sakko. Unser Auge sehnt sich nach Täuschung.«
»Und die Hände verzweifeln daran«, lamentierte er. Doch sein Schritt, der sich an ihre Hüfte drückte, verriet Samira, wie sehr er die Rangelei genoss.
Ächzend ließ Mohammat sich auf sie fallen und vergrub Reißverschluss und Hände unter ihren Leibern. Prustend kam sein Gesicht auf ihrem Nacken zur Ruhe. Ihr Bukett aus Schweiß und Lavendel raubte ihm die Sinne. Samira lachte Tränen und drehte sich, um einen Teil seines Gewichts der Matratze aufzubürden.
Ihr Glück überstrahlte jedes Make-up, ihr zerzaustes Haar machte sie noch begehrenswerter. Eine erwachsene Frau frisch erblüht.
Mohammat machte sich, allmählich hektischer, an ihrem Verschluss zu schaffen. »Du musst mithelfen, sonst krieg ich dich nie rausgepellt. Wir hätten vorher üben sollen.«
Sie zog die Hände aus seinem Kaschmirhemd und legte die Arme an, damit er das Kleid über ihre Schultern nach unten ziehen konnte. Der Kragen stupste gegen ihr neugierig gesenktes Kinn. »Die Braut vor der Hochzeit beschauen? Deine Mutter wäre gestorben.«
»Deswegen? Immerhin den Stehkragen haben wir ihr zugestanden. Was hätte es geschadet, wenn ich deinen Alabasterkörper vorgestern zur Probe aus dem Kleid geschält hätte?« Er zog ihren Oberkörper aus der Fülle von Tuch, Spitze und Bändern. Mit dem BH tat er sich leichter.
»Der Kragen rettete Mutter das Leben. Den ersten Herzinfarkt erlitt sie, als ihr klar wurde, wie viel Bein das Hochzeitskleid frei lässt.«
»Diese Beine durfte ich der Welt nicht vorenthalten. Nicht heute! Den Preis musste sie zahlen, um eine Tochter zu gewinnen.«
Seine Hände strichen ihre Beine entlang, begierig erkundete seine Zunge die neuentdeckten Brustwarzen. Ihre Hand strich über seinen Nacken. Stöhnend drückte sie den Rücken durch. Welch anmutiges Geschöpf rekelte sich da in seinen Armen. Es folgte ihr erster erotischer Kuss als Mann und Frau. In diesem Augenblick war Mohammat ihre ganze Welt. Er genoss seine Macht. Fern der Straßenlärm des nächtlichen Ramallahs. Fern die verlorenen Jahre im Gefängnis, die eine Brautschau so lange hinausgezögert hatten. Fern die Bindungsängste.
»Du hast eine Fahne«, flüsterte sie nach dem Kuss vertraut. »Zu viel Taybeh?«
»Solltest du dir gleich wünschen, der Augenblick möge ewig fortdauern, wird das Bier zu deinem Verbündeten. Ohne diese Bremse wäre ich längst über dich hergefallen.«
Samira kicherte. »So spricht ein Mann von wahrer Liebe, wie Gott sie einst über seine Getreuen ausschüttete.«
Mohammat ließ seine Finger über ihren Nabel zum Venushügel hinabgleiten. Entschlossen war er, die letzten Gefilde zu erobern. »Keine Spuren von sich hat dein Gott in seiner Schöpfung hinterlassen. Das Göttliche ist nur eine Erfindung des Menschen, vielleicht die verhängnisvollste. Die überwältigendste ist Liebe!«
Mohammats Hand wanderte unter ihren String, sein Mittelfinger drang tiefer. Sie küsste ihren Ehemann, ließ die Zugbrücke hinunter und gewährte ihm Einlass. Spöttisch hob er eine Braue.
»Ich habe es gebeichtet: Keine Jungfrau heiratest du.«
»Und du kein Landei, das seine fünfzehnjährige Cousine um die Ehe bittet, um endlich Sex haben zu können. Weniger Blut, weniger Schmerz. Gut so! Nichts daran reizt mich. Selbst, wenn der Prophet uns das Gegenteil lehrt. Worauf verstehst du dich denn so?«, fragte er forsch.
Jetzt senkte Samira doch verschüchtert die Augen, ganz im Widerspruch zu der Erregung, die Mohammat in ihr weckte.
Er grunzte: »Entspann dich, meine Blume. Es würde mich wundern, hätte dir ein Mann je einen ordentlichen Höhepunkt verschafft. Zwar kann ich dir heute Nacht keinen garantieren, aber eine wundervolle Zeit miteinander. Für mehr müssen wir lernen, aufeinander einzugehen.« Gelassen streckte Mohammat sich seitlich auf dem Laken aus, seine Finger forschten weiter. Dabei versuchte er angestrengt, seiner Erektion Herr zu werden. Kichernd knöpfte sie seine Hose auf und verschaffte allem darin den nötigen Freiraum.
Genießerisch sog er die Luft ein: »Nur mit einem Ohr gehorcht er meinem Willen, genau wie du.«
Samira schmollte, ermunterte ihn aber fortzufahren. Eine Weile fiel kein Wort.
»So sind wir also verheiratet, mein Stern.«
»Endlich«, vollendete Mohammat.
»Was träumt ihr Männer vom Sex und redet von der Ehe.«
Er küsste ihren Nacken. »Wir reden von Wärme, Nähe, Vertrauen. Und ja, Orgasmen.«
»Das ist alles, was die Menschen Liebe nennen?«, fragte Samira, den Blick zur Decke gerichtet.
»Es ist, was alle sich wünschen, und mehr, als mancher je erfährt.«